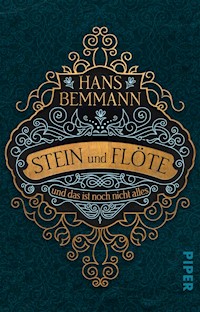
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der gefeierte Klassiker in komplett überarbeiteter Neuausgabe: Lauscher ist ein Mensch, der stets in die Irre geht und dennoch immer ans Ziel gelangt. Als er einen geheimnisvollen Stein und eine Flöte erbt und dazu ein wundersames Holzstück geschenkt bekommt, setzt er alles daran, mit diesen magischen Gaben die Welt seinen Wünschen gemäß zu unterwerfen – und scheitert. Doch das Schicksal beschert ihm so manches phantastische Abenteuer, um ihn letztendlich auf seinen ganz persönlichen Weg zu führen … »Ein zauberhaftes Buch.« General-Anzeiger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
www.Piper-Fantasy.de
© Piper Verlag GmbH, München 2003
Erstausgabe:
Edition Weitbrecht in K. Thienemanns Verlag, Stuttgart 1983
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Guter Punkt, Sarah Borchart unter Verwendung von Motiven von Getty Images
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Erstes Buch,
…
Die Geschichte von Arni mit dem Stein
Die Geschichte von Urla
Geschichte von Gisa und den Wölfen
Das Märchen vom fröhlichen König
Geschichte von Rübe und dem Zaubermüller
Geschichte von Schön Agla und dem Grünen
Geschichte von Arni und den Leuten am See
Die Geschichte vom alten Barlo und seinem Sohn Fredebar
Geschichte vom jungen Barlo
Zweites Buch,
…
Traum von der Kröte
Traum von Lauschers Besuch bei Arnis Leuten
Traum vom (fast) vollkommenen Flöten
Traum von der Frau an der Quelle
Der Traum vom Falken
Der süße Traum
Der schwarze Traum
Der zweite schwarze Traum
Der dritte schwarze Traum
Drittes Buch,
Erster Teil
…
Zweiter Teil
…
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
I
II
III
Karte
Erstes Buch,
in dem erzählt wird,
wie Lauscher einen merkwürdigen Stein geschenkt bekommt
und auf der Suche nach dessen Geheimnis
in den Machtbereich der schönen, blauäugigen Gisa gerät.
Hier läßt er sich zu einer Untat verleiten,
die er selbst durch eine mühevolle, drei Jahre währende Reise
als Diener eines landfahrenden Flöters
nicht ungeschehen machen kann.
Dafür kommen ihm unterwegs viele Geschichten zu Ohren,
an denen er sich in der Kunst
des Zuhörens
üben kann.
…
In Fraglund wurde vorzeiten ein Knabe geboren, von dessen merkwürdigem Schicksal hier erzählt werden soll. Sein Vater war ein gewaltiger Mann, den man den Großen Brüller nannte. Er war hochgewachsen, fülligen Leibes und trug seine dichtbehaarte Brust gern offen. Obwohl er ein ungestümes Gemüt besaß, bald aufbrausend in polterndem Zorn, bald geschüttelt von dröhnendem Gelächter, galt er doch als gerecht, und deshalb hatten ihn die Leute von Fraglund von weither als Richter über die Bewohner ihres Gebietes berufen.
Als der Große Brüller nach Fraglund gekommen war, um sein Amt anzutreten, hatte er eine stille Frau mitgebracht, die so wenig in Erscheinung trat, daß manche Leute sie zunächst gar nicht für sein Eheweib gehalten hatten. Es hieß, sie sei die Tochter des Sanften Flöters, von dessen Künsten man auch schon in Fraglund gehört hatte, obgleich er weit entfernt hinter den tiefen Wäldern von Barleboog lebte. Man sagte von ihm, sein Flöten sei so süß, daß sogar die Vögel verstummten um zuzuhören, und es besänftigte die Menschen dermaßen, daß schon mancher Streit allein durch diese Töne geschlichtet worden sei.
Nachdem der Große Brüller ein Jahr lang in Fraglund Recht gesprochen hatte, gebar ihm seine Frau eben diesen Sohn, von dem hier die Rede sein soll. Sie hatte die ganze Nacht in den Wehen gelegen, und erst gegen Morgen wurde ihr Mann zu ihrer Kammer gerufen, wo ihm die Hebamme das Kind, nackt wie es war, entgegenhielt.
»Man kann wohl sehen, daß dies dein Sohn ist«, sagte sie; denn das Kind war am ganzen Körper mit einem pelzigen Flaum überzogen.
»So«, sagte der Große Brüller mit seiner dröhnenden Stimme und nahm den Sohn auf seine Arme. »Sieht man das? Und warum brüllt er nicht?«
»Merkwürdig«, sagte die Hebamme, »mir hat die ganze Zeit über etwas gefehlt. Jetzt weiß ich’s, da du es sagst: Er brüllt nicht. Sieh ihn doch an. Er schaut aus, als ob er lauscht.«
»Ein Kind muß brüllen«, sagte der Vater befremdet.
»Laß ihn doch«, sagte die Hebamme. »Wer brüllt, hört nicht gut. Laß ihn nur lauschen.«
»So soll er Lauscher heißen«, sagte der Große Brüller und gab den Sohn der Hebamme zurück. Er schien etwas enttäuscht über diesen Sohn, der haarig war wie sein Vater, aber nicht brüllen wollte, wie es dessen Art war.
»Ein stilles Kind hast du geboren«, sagte der Große Brüller zu seiner Frau, nachdem er ihr für diesen Sohn gedankt hatte.
»Er gerät wohl nach meinem Vater«, sagte sie.
Da der Große Brüller jedoch ein gerechter Mann war, redete er in den folgenden Jahren stets freundlich zu diesem Sohn und dämpfte dabei mit der Zeit sogar seine gewaltige Stimme; denn es stellte sich heraus, daß Lauscher nur leise gesprochene Worte verstand, während Gebrüll ihn verwirrte. Das zeigte sich in besonderer Weise, wenn er Zeuge von Streitigkeiten wurde, was im Hause seines Vaters, der ja das Richteramt versah, nicht eben selten vorkam. Je lauter die Streitenden ihre Stimmen erhoben, desto ratloser blickte Lauscher sie an, um schließlich entsetzt davonzulaufen, wenn sie anfingen, einander zu überschreien. Er hielt damals seinen Vater wohl für einen mächtigen Zauberer, weil es ihm gelang, das Keifen der Streitenden mit seiner Donnerstimme zu überbrüllen und damit zugleich verstummen zu lassen.
So wuchs Lauscher im Hause seines Vaters heran, ohne daß etwas Erwähnenswertes geschah. Als er jedoch 17 Jahre alt war, kamen vom Osten die Beutereiter über das Land und fingen an zu heeren und zu brennen. Der Große Brüller sammelte die waffenfähigen Leute von Fraglund, um sich den Eindringlingen entgegenzustellen. An diesem Tage führte er Lauscher in seine Waffenkammer und forderte ihn auf, sich ein Schwert auszuwählen.
»Ich will kein Schwert«, sagte Lauscher mit seiner leisen Stimme.
»Willst du zu Hause bleiben bei den zahnlosen Greisen und den Weibern?« fragte der Große Brüller und konnte seine Abscheu vor solcher Feigheit nicht verbergen.
»Nein«, sagte Lauscher. »Ich werde mit euch ziehen. Aber es ist nicht meine Art, Wunden zu schlagen. Erlaube mir, daß ich die Verwundeten versorge.«
Der Große Brüller fand zwar, dies sei ein erbärmliches Vorhaben für einen jungen Mann, aber da Lauscher auf keine Art zu bewegen war, eine Waffe in die Hand zu nehmen, ließ er ihn schließlich gewähren.
So zog Lauscher mit den Männern von Fraglund gegen die Beutereiter. Nach drei Tagesmärschen meldeten Späher einen Vortrupp des Feindes. Der Große Brüller beschloß, der Reiterhorde in einer Waldschlucht aufzulauern, die sie passieren mußte, wenn sie nach Fraglund vorstoßen wollte. Er legte Bogenschützen in einen Hinterhalt, und als die Reiter mitten zwischen ihnen waren, schossen die Fraglunder ein paar von ihnen aus den Sätteln. Doch auch die Beutereiter verstanden sich aufs Bogenschießen, und so fehlten einige der Fraglunder Männer, als die Reiter in wilder Flucht davongeprescht waren und der Große Brüller das Zeichen zum Sammeln gab.
»Jetzt fängt deine Arbeit an«, sagte er zu Lauscher. »Suche das Gebüsch nach Verwundeten ab!« Lauscher schlug sich ins Dickicht, fand im Unterholz drei tote Männer aus Fraglund und stieß dann auf einen verwundeten Beutereiter, der, einen Pfeil in der Brust, am Fuße einer Eiche lag. Es war ein alter Mann. Sein graues, strähniges Haar war zu zwei Zöpfen geflochten, die ihm über die Schultern hingen, und auf Kinn und Oberlippe sprießte ein dünner, fädiger Bart. Als Lauscher versuchte, den Pfeil aus der Wunde zu ziehen, schlug der Alte die Augen auf und schüttelte den Kopf.
Lauscher sah selbst, daß hier nicht mehr zu helfen war. Er nahm seine Wasserflasche vom Gürtel und setzte sie dem Mann an die Lippen. Nachdem er getrunken hatte, schaute ihm der Alte ins Gesicht und sagte: »Du bist doch einer von den Leuten des Großen Brüllers.«
»Ich bin sein Sohn«, sagte Lauscher.
»Warum kümmerst du dich um einen sterbenden Beutereiter, den deine eigenen Leute vom Pferd geschossen haben?« fragte der Mann.
»Ich bin mitgezogen, um für Verwundete zu sorgen«, sagte Lauscher. »Es ist mir gleichgültig, zu welcher Partei sie gehören.«
»Einen merkwürdigen Sohn hat der Große Brüller«, sagte der Alte.
»Ich bin wohl eher von der Art meines Großvaters«, sagte Lauscher.
»Und wer ist das?«
»Du wirst ihn nicht kennen. Man nennt ihn den Sanften Flöter.«
»Vor vielen Jahren habe ich den Klang seiner Flöte gehört«, sagte der Mann. »Ich bin alt und habe viel erfahren. Aber das nützt mir jetzt nichts mehr. Vielleicht hätte ich in seiner Nähe bleiben sollen. Sag ihm das von mir, wenn du ihn siehst.«
»Ich kenne ihn selber nicht«, sagte Lauscher. »Aber ich will es ihm ausrichten, wenn ich ihn einmal treffe. Wie soll ich dich nennen?«
»Grüße ihn von Arni mit dem Stein«, sagte der Alte. Er fing an, in einem Lederbeutel zu kramen, der ihm am Gürtel hing, und zog einen runden, glatten Stein hervor. Eine Zeitlang hielt er ihn in der Hand, und während er ihn anschaute, glätteten sich die scharfen Falten um seinen Mund, als sei er plötzlich frei von Schmerzen, seine Züge entspannten sich mehr und mehr, und Lauscher sah mit Verwunderung, daß dieser Sterbende heiter, ja fast fröhlich zu sein schien. Seine Augen waren die eines jungen Mannes, als er wieder zu Lauscher aufblickte und ihm den Stein hinhielt.
»Nimm das«, sagte er, »zum Dank, daß du mich nicht allein im Gebüsch hast verrecken lassen.«
Lauscher nahm den Stein und betrachtete ihn. Er war glattgeschliffen wie ein Bachkiesel, halb durchscheinend und schimmerte in dunklen Farben zwischen Grün, Blau und Violett. Als er ihn gegen das Licht hielt, sah er, daß die Farben in dem Stein einen Strahlenring bildeten wie die Iris in einem Auge.
Der Alte lag jetzt im Sterben. Er schlug noch einmal die Augen auf und murmelte etwas. Lauscher beugte sich herab und hörte den Sterbenden raunen:
»Suche den Schimmer,
suche den Glanz,
du findest es nimmer,
findst du’s nicht ganz.«
»Was soll ich suchen? Was soll ich finden?« fragte Lauscher.
»Du wirst schon sehen«, murmelte der Alte. »Heb ihn gut auf, den Augenstein. Aber vergiß nie: Das ist noch nicht alles.«
Und dann starb er.
Die nachfolgenden Ereignisse sind für diese Geschichte ohne Belang und auch sonst nicht des Erzählens wert. Immer wieder geschieht das gleiche, wenn Männer einander totschlagen. Es genügt zu sagen, daß es dem Großen Brüller gelang, die Beutereiter von Fraglund fernzuhalten und daß er schließlich mit seinen Männern – von denen jetzt allerdings einige fehlten – nach Fraglund zurückkehrte, wo bald alle wieder ihren Geschäften nachgingen, soweit sie durch abgehauene Glieder nicht daran gehindert wurden.
Lauscher hatte seit jenem Tag, an dem ihm der sterbende Beutereiter den Augenstein geschenkt hatte, wie in einem wüsten Traum gelebt, und es wollte ihm auch nach seiner Rückkehr nicht recht gelingen, daraus aufzuwachen. Er schlenderte ziellos durch die Gassen oder saß vor dem Haus auf dem Hackklotz und starrte vor sich hin. Von Zeit zu Zeit holte er den Stein aus seiner Tasche und betrachtete ihn. Es schien ihm, als ginge eine Art Trost von diesem kühlen, glatten Stein aus. Und dann fiel ihm auch wieder ein, was der Alte zu ihm gesagt hatte, ehe er gestorben war.
Eines Tages ging Lauscher zu seinem Vater und sagte: »Gib mir ein Pferd und ein paar Vorräte. Ich will in das Land hinter den Wäldern von Barleboog reiten, um meinen Großvater zu suchen.«
»Eigentlich gedachte ich, dich zu meinem Nachfolger heranzubilden«, sagte der Große Brüller und dämpfte dabei seine Stimme, wie es ihm schon zur Gewohnheit geworden war, wenn er mit seinem Sohn sprach.
»Ich weiß nicht, ob ich zum Richter tauge«, sagte Lauscher. »Brüller bin ich keiner, Streit kann ich nicht ertragen, und ehe ich meine Stimme zu erheben vermag, werde ich noch viel zuhören müssen.«
»Ich sehe schon«, sagte der Große Brüller, »du bist wirklich von der Art des Sanften Flöters. Suche ihn also auf. Ich will dir ein Pferd geben und alles, was du für die Reise brauchst.«
Am nächsten Morgen schon sattelte Lauscher sein Pferd und packte ein paar Vorräte in seinen Mantelsack. Für den Augenstein hatte er sich einen Lederbeutel genäht, den er an einer Schnur um den Hals trug. Als er sich von seinen Eltern verabschiedete, sagte seine Mutter zu ihm: »Reite immer nach Westen durch die Wälder von Barleboog und laß dich nur nicht aufhalten. Aus diesem Dickicht ist schon mancher nicht mehr zurückgekehrt. Und lausche auf den Klang der Flöte. Wenn du ein Lied hörst, bei dem dir die Tränen kommen, ist der Sanfte Flöter nicht mehr weit. Sage ihm Grüße von seiner Tochter.« Dann küßte sie ihren Sohn, und Lauscher ritt davon, geradewegs nach Westen auf die Wälder von Barleboog zu.
Am ersten Tag kam er bis zum Waldrand. Er band sein Pferd an einen Baum, machte sich ein Feuer und aß etwas von seinen Vorräten. Dann nahm er den Augenstein aus dem Beutel und ließ seine Farben im Licht der untergehenden Sonne spielen. Über ihm im Baum saß eine Amsel und flötete ihr Abendlied. Das klang so süß, daß Lauscher sich fragte, ob der Sanfte Flöter schon in der Nähe sei. Doch das konnte wohl nicht sein; denn einmal lagen noch die unermeßlichen Wälder von Barleboog zwischen ihm und dem Großvater, und außerdem blieben seine Augen trocken. Er blickte hinauf in das Geäst und sah die Amsel dicht über seinem Kopf auf einem Zweig sitzen. Sie war jetzt verstummt und beäugte den Stein, den Lauscher noch immer in der Hand hielt.
»Das Glitzerding gefällt dir wohl?« sagte er. Als ob sie ihn verstanden hätte, flatterte die Amsel von ihrem Zweig auf Lauschers Schulter. Er zerbröckelte mit der anderen Hand ein Stück Brot und hielt der Amsel die Krümel hin. Sie hüpfte auf seine Hand und pickte das Futter auf.
»Mir scheint, ich habe schon eine Freundin gefunden«, sagte Lauscher. Sie blickte ihn mit ihren glänzenden schwarzen Augen an und flötete einen Dreiklang wie zur Bestätigung. Dann flog sie wieder hinauf auf ihren Zweig und kuschelte sich zum Schlafen zusammen. Da nahm auch Lauscher seine Decke vom Pferd und streckte sich neben dem verlöschenden Feuer aus.
Am nächsten Morgen ritt er in den Wald hinein. Er hatte einen schmalen Pfad gefunden, der nach Westen zu führen schien und dem er sieben Tage lang folgte. Anfangs ließ es sich gut reiten. Es ging durch uralte Buchenwälder. Wie riesige Säulen ragten die silbergrauen glatten Stämme empor und trugen oben ein dichtes Blätterdach, das nur grünes Dämmerlicht hindurchließ. Hier war der von braunem alten Laub bedeckte Boden frei von Unterholz.
Später traten die Stämme dichter zusammen, Äste ragten quer über den Pfad, und Lauscher mußte achtgeben, daß er nicht unversehens vom Pferd geschlagen wurde. Der Pfad wurde immer schmaler und schlängelte sich schließlich als kaum noch wahrnehmbare Spur durch dichtes Gestrüpp. Schließlich mußte Lauscher absteigen und sein Pferd am Zügel führen. Immer wieder zerrten Brombeerranken an seinen Kleidern, er mußte über gestürzte Baumstämme klettern und Sumpflöchern ausweichen, in denen mannshohe Binsen und Schachtelhalme wucherten.
Am Abend des siebenten Tages stolperte er abgerissen und verschwitzt auf eine Lichtung, die sich unversehens hinter einer Mauer von Gestrüpp geöffnet hatte. Er beschloß, hier die Nacht zu verbringen. Nachdem er sein Pferd versorgt hatte, machte er Feuer und aß die letzten Vorräte. Dann holte er wieder den Augenstein aus dem Beutel und schaute ihn an. Aber ob nun die Sonne schon zu tief stand oder der Schatten des Waldes sich düster über ihn legte: seine Farben blieben unter der glatten Oberfläche verborgen. Er sah nicht anders aus als irgendein runder Kiesel, den man aus einem Bach aufgelesen hat.
»Ein hübsches Spielzeug hast du da«, sagte eine Stimme hinter ihm.
Lauscher fuhr herum und erblickte eine Frau, die an einem Baum lehnte. Diese Frau schien ihm über die Maßen schön. Sie schaute ihn aus ihren dunkelblauen Augen an, und diese Augen übten eine solche Gewalt auf ihn aus, daß es ihm Mühe machte, den Blick abzuwenden.
»Deine Augen sind schöner«, sagte er, und als er wieder auf seinen Stein blickte, erschien er ihm tatsächlich matt und glanzlos neben den Augen dieser Frau.
»Hat dich der Stein hierhergeführt?« fragte die Frau.
Lauscher blickte sie erstaunt an. Konnte das sein? Weswegen war er überhaupt hierhergekommen? Er wußte es nicht mehr. Wie hatte der alte Beutereiter geraunt: Folge dem Schimmer, folge dem Glanz – war es das, was er suchen und finden sollte?
»Ich weiß nicht«, sagte er. »Vielleicht hat mich dieser Stein hergeführt.«
»Bist du ein Steinsucher?« fragte die Frau. »Dann bist du zum rechten Ort gekommen. Ich werde dir so schöne Steine zeigen, wie du in deinem Leben noch nie gesehen hast. Wie heißt du?«
»Man nennt mich Lauscher, den Sohn des Großen Brüllers.«
»Des Richters von Fraglund? Da hast du einen gewaltigen Mann zum Vater.«
»Das ist er wohl«, sagte Lauscher. »Und wer bist du?«
»Ich bin Gisa, die Herrin von Barleboog«, sagte die Frau. »Wenn dein Pferd nicht zu müde ist, dich noch ein paar Schritte zu tragen, brauchst du heute nicht auf dürrem Laub und Moos zu schlafen.«
Lauscher löschte das Feuer, packte sein Pferd auf und führte es am Halfter, während er neben Gisa über die Lichtung ging. Sie bogen um eine vorspringende Waldzunge, und da sah Lauscher das Schloß der Herrin von Barleboog vor sich liegen. Die Lichtung öffnete sich hier zu einem breiten Talkessel, in dessen Mitte das Schloß auf einem Hügel emporragte, gekrönt von Zinnen und Türmen, ein düsteres Gemäuer aus schwarzen Basaltblöcken, dessen gewaltiger Umriß die Landschaft beherrschte. Hier am Waldrand hatte Gisa ihr Pferd an einen Baum gebunden. Sie machte es los und schwang sich in den Sattel, ohne sich von Lauscher helfen zu lassen. Da saß auch er auf und ritt neben ihr durch den Talgrund und den steilen Weg hinauf zum Schloß. Als sie zum Tor kamen, wurde an rasselnden Ketten die Zugbrücke herabgelassen. Sie ritten hinüber, dann ging es durch eine düstere Einfahrt, die im Innenhof mündete. Eilfertig liefen Bedienstete herbei, nahmen Lauscher Pferd und Gepäck ab, und Gisa befahl ihnen, für den Gast ein Bad und frische Kleider herzurichten.
Bald darauf saß Lauscher Gisa gegenüber an einem Tisch in der Halle, und die Diener trugen ein Mahl auf, frisch gefangene Fische, Wildbret und dazu einen schweren, goldenen Wein.
»Dir fehlt es an nichts«, sagte Lauscher, als er sich gesättigt zurücklehnte.
»Nein«, sagte Gisa. »Ich bin die Herrin, und mir gehört alles ringsum, so weit das Auge reicht.«
»Dir allein?« fragte Lauscher.
»Mir allein. Aber das könnte sich ändern.« Bei diesen Worten blickte sie ihn wieder mit ihren zwingenden Augen an, die Lauscher alles vergessen ließen, was vorher gewesen war.
»Was willst du damit sagen?« fragte er.
»Daß ich die Herrschaft mit dir teilen könnte, wenn du dich als tüchtig erweist. Willst du das?«
Lauscher blickte ihr in die Augen und wußte jetzt, daß dies das Ziel sein mußte, zu dem er unterwegs gewesen war.
»Ich will es versuchen«, sagte er. »Es scheint mir der Mühe wert zu sein.«
»Dann befiehl du jetzt den Dienern, das Geschirr abzutragen.«
Lauscher zögerte. »Werden sie mir gehorchen?« fragte er.
»So darfst du nicht fragen, wenn du befehlen willst«, sagte Gisa ungeduldig. »Sag es ihnen!«
Lauscher blickte hinüber zu den Dienern, die wartend an der Saalwand standen. »Kommt und räumt das Geschirr ab!« sagte er mit seiner leisen Stimme. Die Diener blickten unschlüssig auf ihre Herrin. Gisa lachte. »Du mußt schon ein bißchen lauter reden«, sagte sie. Dann wendete sie sich den Dienern zu und sagte schroff: »Hört ihr nicht, was euch befohlen wird? Tut, was er gesagt hat! Von heute an gelten seine Befehle gleich wie die meinen.«
Jetzt eilten die Diener herbei und räumten hastig den Tisch ab. Gisa stand auf und sagte: »Komm mit mir. Du mußt noch viel lernen. Ich werde dir zeigen, welche Lust es ist, Herr auf Barleboog zu sein.« Sie führte ihn in ein Schlafgemach, wo sie ohne Zögern die Kleider ablegte. Als Lauscher sie nackt vor sich stehen sah, meinte er, noch nie in seinem Leben etwas so Verlockendes gesehen zu haben. Wie verzaubert schaute er sie an, bis Gisas Lachen ihn aus der Erstarrung riß. »Bin ich die erste Frau, die du so siehst?« fragte sie, »oder schämst du dich, nackt vor mir zu stehen?«
Lauscher wußte, daß beides zutraf. Aber das wollte er nicht eingestehen. Mit fliegenden Händen löste er die Knöpfe und Haken seiner Kleider, bis er nichts mehr am Leibe hatte als den Lederbeutel mit dem Augenstein.
»Lege auch das noch ab«, sagte Gisa. »Zwischen uns darf nichts sein außer unserer Haut.«
So streifte Lauscher auch noch die Schnur über den Kopf und warf den Beutel zu seinen Kleidern auf den Boden.
»Haarig bist du wie ein richtiger Mann«, sagte Gisa lachend. »Nun komm zu mir, damit ich einen aus dir mache.«
Und so umarmte Lauscher in der ersten Nacht, die er auf dem Schloß verbrachte, die Herrin von Barleboog und schlief bei ihr bis zum Morgen.
Als Lauscher sich am Morgen des nächsten Tages ankleidete, konnte er den Beutel mit dem Augenstein nicht finden.
»Suchst du etwas?« fragte Gisa.
»Ja«, sagte Lauscher. »Weißt du, wo der Beutel geblieben ist, den ich um den Hals getragen habe?«
»Die Diener werden den alten Plunder weggeräumt haben«, sagte Gisa gleichgültig. »Komm mit mir, ich zeige dir schönere Steine.«
Lauscher war traurig über den Verlust des Steines, aber er vergaß seine Traurigkeit rasch, als er Gisa in die Augen blickte. War das der Glanz, der Schimmer, nachdem er gesucht hatte? Oder waren die Farben des Augensteins doch anders gewesen?
»Träume nicht und komm endlich!« sagte Gisa ungeduldig. Da schüttelte er seine Gedanken ab und lief ihr nach hinunter in den Hof zu den Pferden.
Sie ritten zum Fluß, der am oberen Ende des Tals aus einer Gebirgsschlucht hervorbrach. Die Strecke bis zur Talmitte schoß er zwischen steilen Ufern in reißender Strömung dahin wie ein Gebirgsbach und ergoß sich unterhalb des Schlosses in einen fast kreisrunden Tobel, in dem sich das schäumende Wasser in Wirbeln drehte. Hier hielt Gisa ihr Pferd an. Eine Gruppe von nackten, braungebrannten Männern war damit beschäftigt, in die reißende Strömung hinabzutauchen, um irgend etwas vom Grund heraufzuholen.
»Was tun sie?« fragte Lauscher.
»Du wirst schon sehen«, sagte Gisa, stieg ab und trat zu einem Mann, der die Taucher offenbar zu beaufsichtigen hatte. Er trug einen struppigen Wolfspelz und blickte die Herrin aus gelblichen Augen mit einer Ergebenheit an, die Lauscher an einen Hund erinnerte.
»Wie ist die Ausbeute?« fragte ihn Gisa. Wortlos hob er einen Leinenbeutel vom Boden und schüttete den Inhalt auf ein Tuch. Da rollten blutrote Rubine, tiefblaue Saphire, goldgelbe Topase; blankgewaschen vom Wasser und noch feucht, glitzerten sie in der Morgensonne.
»Nimm, was dir gefällt!« sagte Gisa zu Lauscher. »Und vergiß das wertlose Ding, das du verloren hast.«
In diesem Augenblick gellte ein Schrei von der Uferböschung. Die nackten Männer liefen hinunter und sprangen ins Wasser. Gleich darauf zogen sie einen leblosen Körper an Land. Gisa trat hinzu und fragte: »Was ist mit ihm?«
»Er ist zu lange unten geblieben, Herrin«, sagte der Aufseher.
»Dann ist er selbst schuld an seinem Tod, der Tölpel«, sagte Gisa. »An die Arbeit! Steht nicht länger herum!«
Die Männer ließen den Toten im Gras liegen und fingen wieder an zu tauchen. Lauscher betrachtete das bleiche Gesicht des Ertrunkenen. Es war ein junger Mann mit krausem, schwarzem Haar. Seine gebräunte Haut hatte eine fahlgelbe Farbe angenommen.
»Er hat sein Leben für deine Steine geopfert«, sagte Lauscher. »Warum beschimpfst du ihn?«
»Sein Leben gehörte mir, und er hat es leichtfertig aufs Spiel gesetzt«, sagte Gisa schroff.
»Du bist hart«, sagte Lauscher.
»Wenn du herrschen willst, mußt auch du hart werden«, erwiderte Gisa. »Willst du nicht Herr auf Barleboog und mein Bettgenosse sein? Sei hart bei Tage und sanft in der Nacht. Das eine ist ohne das andere nicht zu bekommen. Willst du nicht alles haben?«
Lauscher blickte ihr in die Augen. War das schon alles, was er hier gefunden hatte? Er versuchte sich an die letzten Worte des alten Beutereiters zu erinnern, aber sie fielen ihm nicht ein.
»Du hast dir noch keinen Stein ausgesucht«, sagte Gisa.
Lauscher wählte einen dunkelblauen Saphir. »Er hat die Farbe deiner Augen«, sagte er zu ihr und spürte, wie der Stein hart und kalt in seiner Hand lag.
Der Aufseher im Wolfspelz blieb nicht der einzige dieser Art, dem Lauscher in den folgenden Wochen begegnete. Überall im Tal waren diese Männer anzutreffen und sorgten dafür, daß Gisas Anordnungen befolgt wurden. Sie trieben die Bauern zur Arbeit an, überwachten die Handwerker in den Dörfern, und der älteste von ihnen, ein grauhaariger Riese, dessen steinerne Miene nie eine Gemütsbewegung verriet, war Gisas Schloßverwalter und hatte die Dienerschaft unter sich.
Diese Männer sahen einander merkwürdig ähnlich: Alle hatten das gleiche borstige, graubraune Haar, die gleichen gelblichen Augen, und ihre Jacken aus Wolfspelz legten sie nie ab, wie warm das Wetter auch sein mochte. Sonderbar erschien es Lauscher auch, daß diese Knechte Gisas als einzigen Schmuck ein Lederband mit einem blauen Saphir um den Hals trugen. Mit der Zeit fiel ihm auf, daß er keinen von ihnen je lachen sah. Ihre Gesichter wirkten zumeist mürrisch, und manchmal zuckte eine jähe Wildheit über ihre Mienen. Ihrer Herrin schienen sie auf eine geradezu hündische Weise ergeben zu sein. Schweigend und ohne Rückfrage folgten sie ihren Befehlen und wagten kaum, ihr in die Augen zu blicken.
Lauscher hatte nie gesehen, daß einer der Gelbäugigen bei einer Arbeit selbst mit Hand anlegte. Sie schienen ständig in einem angespannten Trab unterwegs zu sein, schlichen auf leisen Sohlen durch die Gänge, traten unhörbar ins Zimmer, so daß Lauscher sich von den lauernden Blicken ihrer gelben Augen ständig beobachtet fühlte. Nur am Abend verschwanden sie, als hätte sie der Erdboden verschluckt. Lauscher war jedenfalls noch keinem dieser Wolfspelze nach Sonnenuntergang begegnet, weder draußen im Freien noch innerhalb der Schloßmauern.
Anfangs überkam ihn stets ein unbehagliches Gefühl, wenn einer dieser Männer in der Nähe war. Als er jedoch Tag für Tag sah, wie unbefangen Gisa mit ihren Knechten umging, sagte er sich schließlich, daß man wohl ohne Leute dieser Art nicht auskommen konnte, wenn man ein so weites Gebiet wie das Tal von Barleboog beherrschen wollte. Und für Ordnung sorgten Gisas Knechte, das mußte man ihnen lassen. Sie verstanden, sich Respekt zu verschaffen; das sah man schon daran, wie die Diener im Schloß oder die Bauern auf dem Feld sich ängstlich duckten, wenn einer der Gelbäugigen vorüberkam.
Lauscher ritt oft mit Gisa durch das Tal. Sie jagten zusammen in den Wäldern, und Lauscher übte sich im Bogenschießen, um Gisa in nichts nachzustehen; denn sie verstand eine Maus auf hundert Schritt mit dem Pfeil an den Boden zu nageln. Als sie eines Tages von der Jagd heimritten, merkte Lauscher, daß sein Pferd lahmte. Er stieg ab und untersuchte die Hufe, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Auch Gisa hatte ihr Pferd gezügelt und wartete ungeduldig neben ihm. »Steig auf und gib dem Gaul die Sporen!« sagte sie. »Dann wird ihm das Hinken schon vergehen.« Lauscher schüttelte den Kopf. »Ich will das Pferd nicht zuschanden reiten«, sagte er. Gisa lachte nur und sagte: »Was ist schon ein Pferd! Ich habe genug Rösser im Stall stehen.«
Doch für Lauscher war dies nicht irgendein Pferd. Diese Fuchsstute hatte er geritten, seit er auf Gisas Schloß gekommen war, und er mochte das Tier gern. Also nahm er es beim Zügel und begann es langsam weiterzuführen. Da gab Gisa zornig ihrem Pferd die Peitsche und jagte allein über Wiesen und Äcker auf das Schloß zu.
Lauscher beeilte sich nicht auf diesem Heimweg. Er war sich bewußt, daß Gisa wieder einmal Härte von ihm erwartet hatte, aber er brachte es nicht übers Herz, diesem wehrlosen Tier unnötig Schmerzen zuzufügen. Bis er ins Schloß kam, würde Gisas Zorn schon verraucht sein, hoffte er. Was den Umgang mit der Dienerschaft betraf, konnte Gisa mit ihm schon zufrieden sein. Es gelang ihm zwar noch immer nicht, seine Stimme zu der von ihr gewünschten Lautstärke zu erheben, aber er hatte sich schon recht gut daran gewöhnt, Befehle zu erteilen und keinen Zweifel daran zuzulassen, daß er seinen Willen auch durchzusetzen gedachte. Dazu brauchte man ja nicht gleich zu brüllen. Er begann es sogar schon ein wenig zu genießen, daß jeder auf sein Wort hin widerspruchslos tat, was er angeordnet hatte.
Unter solchen Gedanken stieg er den Schloßhügel hinauf, führte sein Pferd durch die Toreinfahrt und brachte es in den Stall. Der Pferdeknecht, ein baumlanger, kräftiger Bursche, war noch dabei, Gisas schweißnasses Pferd abzureiben. Lauscher winkte ihn heran und gab ihm den Auftrag, die Hufe seines Pferdes nachzusehen. Der Mann nickte schweigend und nahm ihm das Pferd ab. Dann ging Lauscher hinüber ins Schloß.
Gisa verzog spöttisch den Mund, als sie ihn sah. »Hast du deine Stute wohlbehalten nach Hause gebracht?« fragte sie. »Nimm dich in acht, daß ich nicht eifersüchtig werde!«
»Auf ein Pferd?« sagte Lauscher lachend und schaute ihr in die saphirblauen Augen. »Du traust deiner Schönheit wenig zu, Gisa.« Damit hatte er den letzten Rest ihres Zorns verscheucht, und Gisa befahl den Dienern, Wein zu bringen und das Abendessen aufzutragen. Lauscher war erleichtert, daß ihre Mißstimmung so rasch verflogen war. Er ließ sich von den Dienern allerlei Leckerbissen vorlegen, aß mit Appetit und fand den Wein besonders süffig.
Als die Diener abgetragen hatten, fiel ihm dann doch wieder seine Stute ein. »Ich schaue noch einmal nach meinem Pferd«, sagte er zu Gisa.
»Soll ich dir dein Bett im Stall aufstellen lassen?« fragte sie, und Lauscher wußte nicht recht, ob dies ein Scherz oder eine Drohung sein sollte. Er entschloß sich, es als einen Scherz zu nehmen, und sagte: »Nur wenn du selbst bei den Pferden schlafen willst.«
Das hörte Gisa gern. »Ich ziehe mein Schlafzimmer vor«, sagte sie. »Hoffentlich stinkst du nicht nach Pferdemist, wenn du zurückkommst.« Und dann entließ sie ihn mit einer herrischen Geste.
Es war schon dunkel, als Lauscher über den Hof zu den Ställen ging. Er blieb einen Augenblick stehen und schaute hinauf zu dem Berghang im Osten, über dem der Mond aufstieg, eine riesige silberne Scheibe, vor der sich die Wipfel der Fichten abzeichneten, die Zähne eines schwarzen Rachens, der das Tal umschloß. Lauscher fröstelte, als er von den Wäldern her Wölfe heulen hörte, und es war nicht nur die kühle Nachtluft, die ihn zusammenschauern ließ. Jäh überfiel ihn die Angst, gefangen zu sein in diesem weit klaffenden Rachen, dessen Kiefer sich langsam über den Nachthimmel emporschieben könnten, um schließlich in gierigem Zubiß zusammenzuschnappen. Doch dann löste sich der Mond vom Horizont, stieg frei empor und ließ den Waldsaum unter sich zurück. Lauscher schüttelte die Beängstigung ab und ging weiter auf die offene Stalltür zu, aus der das warme Licht einer Laterne auf das Hofpflaster fiel.
Der Pferdeknecht war damit beschäftigt, den rechten Vorderhuf von Lauschers Stute zu untersuchen. »Hast du etwas gefunden?« fragte Lauscher.
»Ja«, sagte der Pferdeknecht, ohne aufzublicken. »Sie hat sich einen langen Dorn eingetreten. Ich habe ihn herausgezogen, aber die Stelle ist entzündet.«
Lauscher war inzwischen gewöhnt, daß die Diener ihm ehrerbietiger begegneten als dieser Mann, dem das Tier wichtiger zu sein schien als die Schloßherrschaft. Oder zählte er in den Augen dieses Pferdeknechtes überhaupt nicht zu den Leuten, die hier zu befehlen hatten? Das Benehmen dieses Bediensteten, der nur wenige Jahre älter zu sein schien als er selbst, machte ihn unsicher. Doch dann sagte er sich, daß es schließlich die Aufgabe eines Pferdeknechts war, sich um Pferde zu kümmern. »Kannst du etwas gegen die Entzündung unternehmen?« fragte er.
»Das könnte ich«, sagte der Pferdeknecht, »aber ich habe nicht die richtigen Kräuter, die man auflegen müßte.«
»Weißt du, wo man sie finden kann?« fragte Lauscher.
»Ja«, sagte der Pferdeknecht.
»Dann hole sie dir morgen früh«, sagte Lauscher ungeduldig.
Jetzt setzte der Pferdeknecht den Huf vorsichtig auf den Boden und richtete sich aus seiner gebückten Stellung auf. Er blickte Lauscher ohne jeden Ausdruck von Ergebenheit ins Gesicht und sagte: »Das wird nicht gehen.«
»Warum nicht?« fragte Lauscher.
»Weil ich das Schloß nicht verlassen darf«, sagte der Pferdeknecht.
»Das wußte ich nicht«, sagte Lauscher und merkte zugleich, daß er damit vor diesem Mann zugab, über die Verhältnisse im Schloß nicht Bescheid zu wissen. »Ich werde mit dem Verwalter sprechen, damit er es dir erlaubt«, sagte er, und als er die Zweifel im Gesicht des anderen bemerkte, fügte er hinzu: »Ja, das werde ich, und zwar jetzt gleich.«
Jetzt lächelte der Pferdeknecht, und es kam Lauscher so vor, als sei dies das nachsichtige Lächeln eines Erwachsenen über die Motive eines Kindes, das noch keine Vorstellung hat von der Welt, in der es lebt. Dann verschwand dieses Lächeln wie weggewischt aus dem Gesicht des Pferdeknechtes, und er sagte: »Du wirst ihn nicht finden.«
»Das laß meine Sorge sein«, sagte Lauscher brüsk, drehte sich um und verließ den Stall.
Er ging geradewegs ins Schloß zurück und fragte den erstbesten Diener, der ihm über den Weg lief, nach dem Verwalter. Der Diener blickte ihn erschrocken an und sagte: »Den wirst du jetzt nicht finden.« Das hatte Lauscher eben schon einmal gehört, und es schien ihm jetzt an der Zeit zu sein, diese Frage zu klären. »Zeige mir sein Zimmer!« befahl er. Doch der Diener rührte sich nicht von der Stelle, fing an zu zittern und stammelte: »Ich kenne es nicht.«
Lauscher hatte das Gefühl, gegen eine Mauer zu rennen. »Dann sage mir, wer es mir zeigen kann!« stieß er zornig hervor. Der Diener schüttelte nur stumm den Kopf. Da ließ Lauscher ihn stehen und stürmte in den Saal, um Gisa zu fragen. Doch sie war schon gegangen.
Er fand sie im Schlafzimmer. Gisa stand nackt am Fenster im kalten Licht des Mondes und blickte hinaus in die Nacht, eine makellose Marmorstatue, deren Schönheit Lauscher die Sprache verschlug. Eine Zeitlang starrte er auf die reglose Gestalt und wagte nicht, sich zu bewegen, als könne er dadurch dieses Traumbild verjagen. Doch es war kein Traumbild; denn Gisa sagte unvermittelt und ohne sich ihm zuzuwenden: »Hast du dich endlich von deiner Stute trennen können?«
»Sie ist verletzt«, sagte Lauscher und berichtete ihr, was er von dem Pferdeknecht erfahren hatte. »Wo kann ich den Verwalter finden?« fragte er schließlich.
Da fuhr Gisa herum und sagte scharf: »Jetzt nicht.« Lauscher erschrak und blickte sie ratlos an. Da kam sie auf ihn zu und sagte: »Laß das jetzt! Das hat bis morgen Zeit. Willst du die ganze Nacht mit den Gedanken an dein Pferd verschwenden?« Lauscher schüttelte den Kopf, und während er ihr in die Augen schaute, vergaß er alles, was er sie hatte fragen wollen. »Komm«, sagte Gisa, »laß mich dein weiches Fell kraulen.«
Am nächsten Morgen sprach Lauscher mit dem Verwalter. »Du solltest diesen Leuten nicht trauen«, sagte der Alte mürrisch. »Dieser Pferdeknecht sucht nur eine Gelegenheit, um davonzulaufen.« Doch Lauscher ging es jetzt um seine Stute, und er dachte daran, wie sorgsam dieser Mann mit ihr umgegangen war. »Er kennt die richtigen Kräuter, also muß man sie ihn suchen lassen«, sagte er.
»Wenn du meinst«, knurrte der Verwalter. »Aber ich werde ihm einen meiner Männer mitgeben, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt.«
Damit mochte der Verwalter recht haben, dachte Lauscher. Ein sonderlich fügsamer Diener schien dieser Pferdeknecht nicht zu sein. Lauscher sah sich wieder vor diesem Mann stehen und verspürte nachträglich Zorn darüber, wie dieser Stallbursche ihn seine Überlegenheit hatte spüren lassen. Gisas Knechte würden schon wissen, wie sie mit solchen Leuten umzugehen hatten. Kurze Zeit später sah er, wie der Pferdeknecht mit einem der gelbäugigen Männer das Schloß verließ. Als Lauscher am Abend nach seiner Stute schaute, ging es ihr schon besser, und nach wenigen Tagen konnte er sie wieder reiten.
Lauscher vergaß nicht, wie heftig Gisa auf seine Frage nach dem Verwalter reagiert hatte, und kam nicht mehr auf dieses Thema zurück. Er nahm es künftig als gegeben hin, daß Gisas Knechte am Abend nicht mehr zu finden waren, und gab es auf, darüber nachzudenken. Nach wie vor fühlte er sich in der Gesellschaft dieser gelbäugigen Männer unwohl; sie blieben ihm unheimlich, aber er bediente sich ihrer, wenn ihm dies erforderlich schien; denn er merkte bald, daß man in Barleboog alles erreichen konnte, wenn man sie auf seiner Seite hatte. Da Gisa ihren Knechten vertraute, sah er keinen vernünftigen Grund, dies nicht zu tun; er mußte das wohl auch, wenn er zu jenen gehören wollte, die hier zu befehlen hatten. Die Kunst, Befehle zu erteilen, meinte er von Tag zu Tag besser zu beherrschen, und es erfüllte ihn mit Befriedigung, wenn die Diener seinem leisesten Wink gehorchten. Er bemerkte auch, daß Gisa dies mit Wohlgefallen beobachtete, und gewöhnte sich daran, genau wie sie alles im Tal von Barleboog als seinen Besitz zu betrachten.
»Heute ist Gerichtstag«, sagte sie eines Morgens. »Und da du einen so berühmten Richter zum Vater hast, sollst in Zukunft du auf Barleboog Recht sprechen.«
Diesen Vorschlag empfand Lauscher als eine große Ehre. »Mein Vater hatte im Sinn, mich zu seinem Nachfolger zu erziehen«, sagte er, »aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Nun habe ich es wohl aus eigener Kraft so weit gebracht.«
»Dann zeig mir, wie du unser Recht zu wahren verstehst«, sagte Gisa. »Ich will mich beiseite halten, damit jeder sehen kann, daß von heute an du hier der Gerichtsherr bist.«
Unten in der Mitte der weiten Halle war der Richterstuhl aufgestellt worden. Daneben stand ein Tisch, auf dem zum Zeichen des Gerichts ein entblößtes Schwert lag. Gisa blieb zurück an ihrem gewohnten Platz neben dem Kamin, während Lauscher sich auf den Richterstuhl setzte und den Dienern befahl, die Rechtsuchenden einzulassen.
Als erster trat ein Mann vor, der seinen Nachbarn beschuldigte, ihm des Nachts drei Hühner vom Hof gestohlen zu haben. Er brachte zwei Zeugen bei, die den Vorfall beobachtet und gesehen hatten, wie der Dieb die Hühner am nächsten Tag gebraten und mit seiner Familie verzehrt hatte.
»Ist der Dieb hier?« fragte Lauscher.
»Ja, Herr«, sagte der Kläger, »dort steht er«, und zeigte auf einen Mann, der von zwei anderen festgehalten wurde.
»Er soll vortreten«, sagte Lauscher. »Laßt ihn los!«
Der Mann rieb sich die Handgelenke und trat ein paar Schritte vor.
»Gestehst du die Tat ein?« fragte Lauscher.
Der Mann nickte.
»Ich will dich etwas fragen«, sagte Lauscher. »Gibt es etwas auf meinem Land, das mir nicht gehört?«
»Nein, Herr«, sagte der Mann.
»Wem hast du also die Hühner gestohlen?« fragte Lauscher weiter. »Jenem dort, dem sie nicht gehörten?«
Der Dieb blickte ihn verwirrt an. »Wenn sie ihm nicht gehörten, kann ich sie ihm auch nicht gestohlen haben«, stammelte er.
»Richtig«, sagte Lauscher. »Da sie mir gehörten, hast du sie mir gestohlen. Und zur Strafe wirst du mir für jedes Huhn eine Woche ohne Lohn dienen. Ich werde dich meine Hühnerställe ausmisten lassen. Zu dieser Tätigkeit scheinst du geeignet zu sein.« Und er befahl den Dienern, ihn ins Gesindehaus zu bringen.
»Und wer ersetzt mir die gestohlenen Hühner?« fragte der Kläger.
Lauscher blickte ihn eine Zeitlang nachdenklich an. Dann fragte er:
»Bist du bestohlen worden?«
Der Mann bedachte sich für einen Augenblick. Dann sagte er: »Nein, Herr«, und trat in den Kreis der anderen zurück.
Als nächster wurde ein Mann auf einer Bahre vor den Richterstuhl getragen. Die Männer, die ihn begleiteten – der Kleidung nach handelte es sich um Holzfäller –, schleppten einen anderen gefesselt mit sich und stellten ihn vor den Richter.
»Was hat er getan?« fragte Lauscher.
»Er hat meinem Vetter, der hier auf der Bahre liegt, im Streit die Axt ins Bein geschlagen«, sagte einer der Männer.
»Dafür wirst du mir zahlen müssen«, sagte Lauscher zu dem Gefesselten.
»Dir?« fragte dieser. »Was habe ich dir getan?«
»Das weißt du nicht?« sagte Lauscher. »Du hast mein Eigentum beschädigt.«
Er wandte sich zu dem Sprecher der Gruppe und fragte: »Wie lange wird dein Vetter nicht für mich arbeiten können?«
»Die Wunde sieht böse aus«, sagte jener. »Der Hieb ging bis in den Knochen. Wenn er Glück hat, wird er in drei Monaten wieder gehen können.«
»Wie lange arbeitet ihr am Tage?« fragte Lauscher.
»Zehn Stunden«, sagte der Mann.
»Dann soll der Schuldige täglich fünfzehn Stunden arbeiten, und zwar so lange, bis er mir diesen Verlust wieder eingebracht hat«, sagte Lauscher. »Geht!«
Während er noch sprach, wurde die Tür des Saales aufgerissen. Lauscher blickte hinüber und sah zunächst nur den Pferdeknecht, der seine Stute geheilt hatte, auf der Schwelle stehen. Wieder fiel es Lauscher auf, wie wenig das Benehmen dieses Mannes der demütigen Haltung der Diener glich. Ohne anzuklopfen trat er ein, als sei er hier zu Hause. Lauscher wollte ihn gerade zurechtweisen, als er erkannte, daß der Pferdeknecht nicht freiwillig gekommen war. Hinter ihm erschien der Schloßverwalter, packte den langen Burschen am Arm und zerrte ihn vor den Richterstuhl. »Hier ist noch ein Fall zu verhandeln«, sagte er.
Der Pferdeknecht riß seinen Arm aus dem Griff des gelbäugigen Riesen und blickte über Lauscher hinweg aus dem Fenster, als ginge ihn das alles gar nichts an. Lauscher mußte von seinem Sitz aus zu ihm aufblicken, und das ärgerte ihn. »Wessen beschuldigst du ihn?« fragte er den Verwalter.
»Er hat dich bestohlen«, sagte der Alte und zog einen Lederbeutel aus der Tasche, den Lauscher sogleich als jenen erkannte, in dem er seinen Augenstein bei sich getragen hatte.
»Ist in dem Beutel ein Stein?« fragte er.
»Ja«, sagte der Verwalter.
»Nimm ihn heraus und lege beides auf den Tisch«, sagte Lauscher.
Der Verwalter öffnete den Beutel, ließ den Stein auf den Tisch rollen und legte den Beutel daneben. Der Stein schimmerte matt, doch seine Farben blieben unter der glatten Oberfläche verborgen.
»Warum hast du ihn genommen?« fragte Lauscher den Beschuldigten. Der Pferdeknecht blickte gleichmütig auf Lauscher herab, als habe er nichts zu befürchten.
»Ich habe den Beutel nicht gestohlen«, sagte er. »Die Herrin hat ihn mir gegeben.«
Lauscher blickte hinüber zu Gisa und sah, daß ihre Augen dunkel vor Zorn waren. »Geschwätz eines Stallburschen!« sagte sie, stand auf und kam herüber. Neben dem Tisch blieb sie stehen und betrachtete den Stein. »Zu viel Geschrei um das wertlose Ding«, sagte sie geringschätzig.
»Wertlos oder nicht«, sagte Lauscher, »er gehörte mir. Hat er ihn nun gestohlen oder von dir bekommen?«
»Warum sollte ich dir diesen Kiesel nehmen, wo ich dir tausendfach wertvollere Steine schenken kann?« sagte Gisa. »Dem frechen Lügner soll es genauso ergehen wie diesem billigen Plunder!« Bei diesen Worten raffte sie den Stein vom Tisch und warf ihn in weitem Schwung hinaus durch das offene Fenster. Für einen Augenblick blitzte er draußen in der Sonne auf, dann war er verschwunden.
»Warum nennst du mich einen Lügner, Gisa, wo du weißt, wie es in Wahrheit gewesen ist?« fragte der Pferdeknecht zornig.
»Ich nenne dich, wie es mir gefällt«, sagte Gisa, »denn du gehörst mir.«
»Ja«, sagte der Pferdeknecht, »ich gehöre dir wie alles hier, so weit das Auge reicht. Auch der Mann hier auf dem Richterstuhl gehört dir und tut nichts anderes als deinen Willen. Du hast ihm das einzige genommen, das er besaß, und ihn dann mit Geschenken überhäuft, damit alles, was er hat, von dir kommt. Du hast ihn gekauft, damit er dir zu Willen ist und dein Spiel mitspielt.« Er wandte sich von ihr ab und blickte Lauscher an. »Merkst du nicht, Lauscher, daß du hier nicht mehr zu sagen hast als irgendeiner von uns? Oder gefällt es dir, ein Sklave zu sein?«
Da sprang Lauscher auf, daß der Richterstuhl hinter ihm umstürzte, und schrie blind vor Zorn: »Schneidet ihm die Zunge heraus und jagt ihn in die Wälder!«
Der Verwalter ließ den Verurteilten von seinen Knechten aus der Halle schleppen. Gisa aber trat auf Lauscher zu und sagte: »So wird auf Barleboog Recht gesprochen.« Dann nahm sie ihn in die Arme und küßte ihn auf den Mund.
Lauscher klammerte sich an sie, bis er wieder klar sehen konnte. Dann löste er sich aus ihrer Umarmung und blickte ihr nachdenklich in die Augen.
»War es Recht, was ich gesprochen habe?« fragte er.
»Wer Recht spricht, darf nicht an sich zweifeln«, sagte Gisa, »sonst ist er verloren. Komm, wir wollen zur Jagd ausreiten, damit dein Zorn verfliegt.«
Ehe sie den Saal verließen, nahm Lauscher den leeren Beutel vom Tisch und steckte ihn ein. Im Hof ließen sie die Pferde satteln, nahmen ihre Jagdbogen und Pfeile und galoppierten, gefolgt von der Hundemeute, hinaus über die Zugbrücke und hinunter ins Tal.
Am Waldrand stöberten die Hunde einen Hirsch auf und hetzten ihn kläffend durch das Unterholz. Lauscher setzte ihnen nach, Zweige peitschten sein Gesicht, Dornenranken rissen an seinen Kleidern, aber er spornte sein Pferd an und trieb es tief in den Wald, wo das Gebell der Hunde zu hören war. Auf einer kleinen Lichtung hatten die Hunde den Hirsch gestellt. Er stand mit gesenktem Geweih vor dem Stamm einer uralten Eiche und forkelte eben einen der Hunde zu Tode. Lauscher legte einen Pfeil auf die Sehne, spannte den Bogen und schoß. Federnd fuhr der Pfeil dem Hirsch ins Blatt. Das Tier warf röchelnd den Kopf zurück und brach zusammen. Während Lauscher die Hunde von dem erlegten Wild fortpeitschte und an die Leine nahm, trabte Gisa auf die Lichtung. Sie stieg ab und begutachtete sachkundig den Schuß.
»Du hast gut getroffen«, sagte sie. »Hier ist ein angenehmer Platz. Wir wollen rasten und frühstücken.«
Lauscher breitete im Schatten der Eiche seine Satteldecke aus, und Gisa holte Brot, Fleisch und Wein aus ihrer Packtasche. Während sie aßen, begann hoch oben im Baum eine Amsel zu flöten. Lauscher hörte ihr zu und meinte, seit langem kein so süßes Lied gehört zu haben. Die Melodie erinnerte ihn an irgend etwas, aber er konnte nicht herausfinden, woran. Neugierig spähte er hinauf in den Wipfel, um den Vogel zu entdecken.
»Dort oben sitzt er«, sagte Gisa und zeigte ihm die Stelle. »Du bist zwar mittlerweile ein recht guter Schütze geworden, aber ich wette, daß du ihn nicht mit einem Pfeil herunterholst.«
»Warum sollte ich ihn totschießen?« fragte Lauscher. »Er singt so schön.«
»Eine Amsel wie tausend andere«, sagte Gisa. »Hast du Angst, danebenzuschießen und die Wette zu verlieren?«
»Laß sie doch weiterflöten«, sagte Lauscher.
»Ich werde dir zeigen, wie man Amseln schießt«, sagte Gisa, stand auf und griff zu ihrem Bogen.
Da nahm Lauscher den Saphir aus der Tasche, den er seither immer bei sich getragen hatte, hielt ihn Gisa hin und sagte: »Um des Steines willen, den du mir geschenkt hast, bitte ich dich: Laß die Amsel leben.«
Gisa lachte. »Was soll ich mit dem Stein? Ich besitze Tausende davon. Bist du zu schwach, eine Amsel sterben zu sehen?« Sie nahm einen Pfeil und legte ihn auf die Sehne. Da sprang Lauscher auf und schlug ihr den Bogen aus der Hand. Blaß vor Zorn drehte sich Gisa zu ihm um. »Du Narr!« schrie sie. »Ist dir ein Vogel mehr wert als mein Vergnügen? Ist dir vielleicht dein schäbiger Augenstein mehr wert als mein Saphir? Du Träumer, aus dir wird nie ein Mann!«
Sie sprang auf ihr Pferd, hetzte es quer über die Lichtung und setzte mit einem Sprung ins Gebüsch, das rauschend hinter ihr zusammenschlug. Lauscher blickte noch einmal auf den Saphir, der eisig blau in seiner Hand schimmerte. Dann warf er ihn ins Dickicht, wo Gisa verschwunden war. »Da hast du deinen Stein, du Hexe!« rief er ihr nach.
Der Stein flog in weitem Bogen über die Lichtung wie eine bläulich blitzende Sternschnuppe und tauchte im Schatten der Bäume unter. Lauscher glaubte einen erstickten Aufschrei zu vernehmen, dann hörte er nur noch das Krachen brechender Zweige und das dumpfe Gepolter von Hufen auf dem Waldboden, das sich rasch entfernte. Lauscher machte die Hunde los und jagte sie Gisa nach. Dann setzte er sich wieder unter die Eiche und lehnte sich an den Stamm. Auf einmal fühlte er sich wie von einer Last befreit, wußte aber nicht zu sagen, von welcher. Über ihm fing wieder die Amsel an zu flöten. Diesmal klang ihr Gesang viel näher. Lauscher blickte nach oben und sah sie dicht über sich in den untersten Zweigen der Eichen sitzen. Dieses Bild erschien ihm vertraut. Wo hatte er das schon einmal gesehen? Es wollte ihm nicht einfallen.
Jetzt verstummte die Amsel und äugte zu ihm herunter. Dann flatterte sie zu einer Höhlung im Stamm, klammerte sich mit ihren Krallen in der rissigen Rinde fest und pickte eifrig in das modrige Astloch. Rindenstücke und Holzsplitter rieselten auf Lauschers Haar herab.
»Hast du Hunger?« fragte er, und dabei fiel ihm ein, wo er die Amsel schon einmal gesehen hatte. »Meine Freundin vom ersten Tag«, sagte er und hielt ihr ein paar Brotkrümel auf der flachen Hand hin. Im gleichen Augenblick rollte etwas Schimmerndes aus der Höhlung und fiel ihm in den Schoß. Er griff danach und hielt seinen Augenstein in der Hand.
»Hast du ihn für mich aufgehoben?« sagte er zu der Amsel. »Du bist wahrhaftig eine Freundin, auf die man sich verlassen kann.«
Er hielt den Stein in die Sonne. Das Licht fing sich in dem Strahlenring und ließ ihn in allen Farben schimmern, schöner als er ihn je im Gedächtnis gehabt hatte, tausendmal schöner als alle Rubine, Saphire und Topase von Barleboog.
Die Amsel war inzwischen auf den Boden gehüpft und pickte die Krumen auf, die Lauscher aus der Hand gefallen waren, als er nach dem Stein gegriffen hatte. Und während er den Stein betrachtete, erinnerte sich Lauscher wieder, warum er überhaupt in den Wald geritten war. Wie hatte er den Sanften Flöter vergessen können, zu dem er unterwegs war? Er hatte nicht mehr an ihn gedacht, seit er den Augenstein verloren hatte. Oder seit er den Saphir in der Tasche getragen hatte. Laß dich nicht aufhalten, hatte seine Mutter zum Abschied gesagt. Aber er hatte sich aufhalten lassen, hatte den großen Herren auf Barleboog gespielt und sich auf den Richterstuhl setzen lassen. Über alles andere hätte man lachen können, aber als er jetzt daran dachte, wie er am Morgen des gleichen Tages Recht gesprochen hatte, war ihm durchaus nicht mehr so leicht zumute wie eben noch. Ich muß verhext gewesen sein, dachte er. Sie hat mich verhext vom ersten Augenblick an. Mit Grausen erinnerte er sich an den Pferdeknecht, dem er die Zunge hatte herausschneiden lassen, weil er die Wahrheit gesagt hatte. Irgendwo hier würde er jetzt durch den Wald irren.
Plötzlich ergriff ihn panische Angst, daß er ihm begegnen könnte. Er sprang so hastig auf, daß die Amsel erschreckt hochflatterte. Einen Augenblick blieb sie über ihm auf einem Zweig sitzen und flötete ihren Dreiklang. Dann flog sie hinaus ins Freie, umkreiste einmal die Lichtung und strich dann über die Baumwipfel davon, immer nach Westen.
Lauscher zog den Lederbeutel aus der Tasche, verwahrte den Stein darin und hängte ihn um den Hals. Dann raffte er hastig die restlichen Essensvorräte zusammen, verstaute sie in seiner Packtasche, sattelte sein Pferd und stieg auf. Noch einmal blickte er zu der Stelle, an der Gisa verschwunden war. Dann wendete er sein Pferd und ritt so schnell er konnte in den Wald, immer nach Westen, weg von Barleboog.
Lauscher kam an diesem Tag nur langsam voran. Ohne Weg und Steg ritt er immer weiter nach Westen, den Berg auf durch den Wald, trieb sein Pferd durch dichtes, von zähen Geißblattranken durchwobenes Unterholz und mußte oft absteigen, um einen Durchschlupf zu suchen. Während er mühsam mit zurückschnellenden Zweigen und widerstrebenden Ranken kämpfte, meinte er seitwärts im Dickicht Zweige knacken zu hören, als dränge sich ein großes Tier hindurch. Doch sobald er sein Pferd anhielt, war nichts mehr zu hören.
Je höher er kam, desto düsterer wurde der Wald. Statt der Buchen und Eichen, durch deren Laub das Licht grünlich hindurchgeschimmert hatte, waren es turmhohe Fichten und Tannen, zwischen deren Stämmen er jetzt bergauf ritt. In diesem Schattendunkel gab es kaum Unterholz, so daß Lauscher im Sattel bleiben konnte. Obwohl der weiche Nadelboden den Hufschlag des Pferdes dämpfte, war hier kaum ein Geräusch zu hören, kein Vogelschrei, kein unvermutetes Rascheln. Dann lockerte sich der Baumbestand auf, und Lauscher sah vor sich den Kamm eines Bergrückens, auf dem nur noch einzelne, von Wind und Wetter bizarr verformte Fichten standen. Er trieb seine Stute an; denn ihm schien, daß der Bannkreis von Barleboog hinter dem Höhenrücken enden müsse.
Oben zwischen den Wetterfichten blickte er sich noch einmal um, hinunter über den in langen Wellen abfallenden Waldhang in das grüne Tal, in dessen Mitte das Schloß seinen Schatten über die Wiesen warf. Dann wendete er sein Pferd und ritt auf der anderen Seite in den Wald hinab.
Gegen Abend kam er zu einem träge zwischen verknäulten Baumwurzeln dahinrinnenden Bach und beschloß, hier für die Nacht zu bleiben. Er sattelte sein Pferd ab, ließ es aus dem Bach trinken und setzte sich auf einen bemoosten Stein. Als er jetzt still saß und von den Resten des Jagdfrühstücks aß, drangen die Geräusche des Waldes nach und nach in sein Bewußtsein, verhaltene Vogelrufe, unvermitteltes Rascheln im welken Laub am Boden, das Knacken dürrer Äste unter dem Tritt eines Tieres, das ferne Raunzen einer Wildkatze – überall regte sich heimliches Leben, und Lauscher fühlte sich von tausend Augen beobachtet.
Damit seine wenigen Vorräte nicht von irgendeinem Nachttier gefressen würden, schnürte er sie in ein Bündel, das er mit dem Halfterriemen an einen Ast hängte. Dann rollte er sich in seine Decke und schloß die Augen. Doch mit steigernder Dunkelheit nahmen die Geräusche zu und schienen immer näher zu kommen. Glucksend rann der Bach über den steinigen Grund, über ihm im Geäst schrie ein Käuzchen. Dann hörte er dicht neben seinem Kopf ein Platschen im Wasser. Erschreckt riß er die Augen auf und erblickte dicht vor seinem Gesicht eine dicke Kröte, die ihn ohne zu blinzeln mit ihren goldbraunen Augen ansah.
»Was hast du doch für schöne Augen«, sagte Lauscher.
Die Kröte rückte noch ein Stück näher, und ihre warzige Haut überlief ein violetter Schimmer. Das war wohl ihre Art zu erröten.
»Es gibt wenig Menschen, die das merken«, sagte sie geschmeichelt. »Die Herrin von Barleboog hat dich offenbar noch nicht ganz verdorben.«
»Schlimm genug, was ich dort bei ihr getan habe«, sagte Lauscher bekümmert.
»Schlimm genug, schlimm genug«, bestätigte die Kröte. »Es war dein Glück, daß du ihr den blauen Stein nachgeworfen hast, sonst wärst du nie von ihr losgekommen.«
Sie zog ihr Maul noch breiter, als es ohnehin schon war, und blubberte mit den Lippen (so pflegen Kröten zu kichern). »Mitten auf ihre Stirn ist er geknallt, und jetzt hat sie eine Beule, groß wie ein Hühnerei und blau wie ihr Klunkerstein.«
»Woher weißt du das?« fragte Lauscher.
»Im Wald spricht sich so etwas rasch herum«, sagte die Kröte, »besonders eine so erfreuliche Nachricht, daß ihr einer entkommen ist. Das geschieht selten genug. Es wird den Leuten Mut machen.«
»Welchen Leuten?« fragte Lauscher.
»All den Leuten, von denen sie meint, sie gehörten ihr. Du hast ihre hochmütige Stirn gezeichnet, und das hat ihre Macht ein bißchen angeknackst. Das wird sie dir nie verzeihen.«
Lauscher bekam Angst. »Kann sie mir hier noch schaden?« fragte er.
»Sie nicht«, sagte die Kröte. »Du bist schon jenseits der Grenze ihrer Macht. Aber ihre Knechte könnte sie schon auf deine Spur setzen. Du solltest morgen in aller Frühe weiterreiten. Wohin willst du überhaupt?«
»Ich suche den Sanften Flöter«, sagte Lauscher. »Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde?«
Die Kröte blickte ihn nachdenklich mit ihren schönen Augen an. »Weit im Westen«, sagte sie schließlich. »Aber es wird vor allem darauf ankommen, ob er sich finden lassen will. Warum suchst du ihn?«
»Ich bin sein Enkel«, sagte Lauscher. »Und außerdem soll ich ihm Grüße von Arni mit dem Stein bringen.«
»Mit großen Leuten hast du zu tun«, sagte die Kröte. »Man sagt, Arni sei tot. Stimmt das?«
»Ja«, sagte Lauscher. »Ich war bei ihm, als er starb. Und vorher gab er mir seinen Stein.« Er kramte den Augenstein aus dem Beutel und zeigte ihn der Kröte.
Obwohl es Nacht war, leuchtete der Stein in Lauschers Hand und zeigte sein Farbenspiel, das sich in den Augen der Kröte spiegelte. Lange schaute sie voller Bewunderung auf den strahlenden Augenstein. »Und das wolltest du gegen das kalte blaue Ding der Herrin von Barleboog eintauschen, du Dummkopf?« sagte sie schließlich.
»Ich dachte, ich wäre schon am Ziel«, sagte Lauscher kleinlaut.
»Was bist du doch für ein ungeduldiger Bursche!« sagte die Kröte. »Weißt du nicht, daß dies noch lange nicht alles ist?«
»Ich hatte es vergessen«, sagte Lauscher.
»Vergiß es nie wieder!« sagte die Kröte. »Und morgen reite weiter, immer den Bach abwärts. Am siebenten Tag wirst du an das Ende des Waldes kommen, und dort kannst du den Sanften Flöter finden – das heißt, wenn er dich überhaupt sehen will. Aber sieh dich vor: Es schleicht etwas durch den Wald. Ob es gut für dich ist oder böse, wirst du selber herausfinden müssen. Ich sage dir das auch nur zum Dank dafür, daß du mir den Stein gezeigt hast. Solange du den bei dir trägst, wirst du nicht ohne Trost sein. Gute Reise.«
Lauscher steckte den Stein in den Beutel zurück und sah noch, wie die Kröte schwerfällig ins Gebüsch kroch. Dann fielen ihm die Augen zu, und er wachte erst wieder auf, als ihn ein Sonnenstrahl auf der Nase kitzelte. Er schlug die Augen auf, und das erste, was er sah, war der leere Halfterriemen, der über ihm von einem Ast herunterbaumelte. Seine Vorräte waren verschwunden. Er sprang auf und sah sich die Riemen an. Das konnte kein Tier gewesen sein. Da war nichts zerbissen oder angenagt, sondern jemand hatte säuberlich die Schnalle geöffnet. Ein Mensch hatte ihn bestohlen.
Lauscher fiel die Warnung der Kröte ein. Es war also ein Mensch, der durch den Wald schlich und ihm sein Frühstück gestohlen hatte. Er lauschte, aber ringsum war nichts zu hören als die Stimmen der Vögel und das Plätschern des Baches. Dennoch wurde es ihm unheimlich. Er sattelte hastig sein Pferd, saß auf und ritt so rasch er konnte bachabwärts.
So rasch er konnte – das war nicht viel schneller als im Schritt. Den Bach entlang wucherte dichtes Unterholz, es gab sumpfige Stellen, denen er ausweichen mußte, und schließlich begann sich der Bachlauf zwischen steilen Ufern abzusenken. Lauscher mußte wieder absteigen, denn an dem schlüpfrigen Hang glitt sein Pferd immer wieder aus.
So war er drei Tage lang unterwegs, pflückte im Gehen ein paar Beeren und briet sich zum Abendessen Pilze, die er unter den Büschen fand. Jetzt tat es ihm leid, daß er seinen Jagdbogen bei dem getöteten Hirsch liegengelassen hatte; denn von Zeit zu Zeit scheuchte das stolpernde Pferd einen Hasen oder auch ein Reh auf. Sein Pferd hatte es besser; denn Gras gab es am Bach entlang in Hülle und Fülle.
Am dritten Abend war er so müde und zerschlagen, daß er sich neben den Bach ins Moos fallen ließ und sofort einschlief, ohne etwas zu essen oder sich um sein Pferd zu kümmern, das er den ganzen Tag lang am Halfter hinter sich hergezerrt hatte. Er erwachte von einem heiseren Schrei, der ihn hochfahren ließ. Im fahlen Licht der Dämmerung reckten ringsum uralte Bäume ihre knorrigen Äste in den Morgennebel. Während er mühsam aufstand, ließ ihn ein zweiter Schrei zusammenzucken. Und dann hörte er weit oben am Hang das Poltern von Hufen. Da merkte er erst, daß sein Pferd nicht mehr da war. Der unheimliche Schreier mußte es ihm gestohlen haben, und er war es wohl auch gewesen, der ihm seine Vorräte genommen hatte.
Lauscher fühlte sich zu schwach, um den Dieb zu verfolgen. Er starrte hinauf zu den gespenstigen Baumriesen und spürte, wie die Angst in ihm hochkroch. Nun besaß er nichts mehr als seine auf der langen Wanderung von Dornen zerfetzten Kleider und den Augenstein, den er auf der Brust trug. Er zog den Beutel hervor und ließ den Stein in die hohle Hand fallen. Warm schimmerten die Farben unter der glatten Oberfläche. Lauscher blickte in das Auge aus Stein und spürte, wie die Angst verging. Es war ihm, als ob ihm das Auge zuredete, weiterzugehen und den Mut nicht zu verlieren. Er legte den Stein zurück in den Beutel, trank einen Schluck Wasser aus dem Bach und machte sich wieder auf den Weg.





























