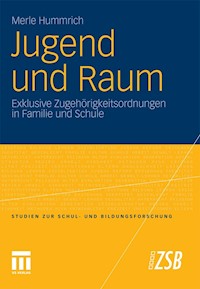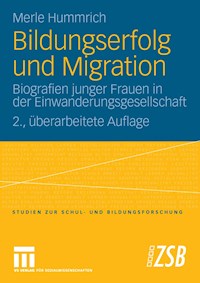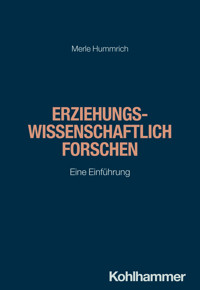
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Der Band stellt den Zusammenhang von geschichtlicher Entwicklung der Disziplin, Theorien und Methoden ins Zentrum. Fragen wie "Was ist das Erziehungswissenschaftliche an Fragen zu Erziehung und Bildung?" werden ergründet und mit Bezug auf ausgewählte Theorien systematisch vertieft. Wie Fragestellung, Gegenstand und Zielsetzung in Verbindung zum methodischen Vorgehen stehen, inwiefern Erziehungswissenschaft und Gesellschaftstheorie sich verbinden und welche forschungsethischen Fragen in erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisprozessen gestellt werden müssen, wird systematisch und anhand von Fallbeispielen und ausgewählten Studien verdeutlicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
I Einführung
1 Erziehungswissenschaftlich forschen – eine Feldbestimmung
1.1 Eine erste Feldbestimmung erziehungswissenschaftlicher Forschung
1.2 Zur Gliederung des Bandes
II Grundlegungen
2 Erziehungswissenschaftliches Fragen
2.1 Skizze der Eigenschaften erziehungswissenschaftlicher Fragen
Massenmediale Fragestellungen
Fragestellungen der Ratgeberliteratur
Fragestellungen in der Wissenschaft
2.2 Die Entwicklung von Fragestellungen
Zur Bestimmung der Forschungsfrage über die Phänomene
Die Bestimmung der Forschungsfrage über Forschungsdesiderate
Wie fragen?
2.3 Das Verhältnis von Fragestellung, Gegenstand und Zielsetzung
Historisch-/Systematisches Arbeiten
Hypothesenüberprüfendes Arbeiten
Hypothesengenerierendes Arbeiten
2.4 Die Grenzen erziehungswissenschaftlichen Fragens: Praxistauglichkeit und Ethik
Zur Praxistauglichkeit
Ethische Grenzen des Fragens
3 Historische Schlaglichter: Die Idee »guter Praxis« und die Ungleichheiten in Bildungs- und Forschungszugängen
3.1 Pädagogische Forschung in ihren Anfängen
Frühe wissenschaftliche Perspektiven auf Pädagogik: Kant und Trapp
Ausdifferenzierungen zur wissenschaftlichen Disziplin: Herbart
Zur weiteren Entwicklung pädagogischer Forschungsperspektiven im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung zu den Anfängen erziehungswissenschaftlicher Forschung
3.2 Pionierinnen der wissenschaftlichen Pädagogik
Helene Lange: politische Partizipation und Professionalisierung
Alice Salomon und Jane Addams: Professionalisierung Sozialer Arbeit
Mathilde Vaerting: Sozialkonstruktivismus, Begabung und Leistung
Einordnung in den disziplinären Zusammenhang
3.3 Pädagogische Strömungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Geisteswissenschaftliche Pädagogik
Reformpädagogische Ansätze
Empirische Bezüge auf Pädagogik aus Psychologie und Sozialpsychologie
Einordnung in den disziplinären Zusammenhang
Exkurs: Erziehungswissenschaft im Nationalsozialismus
3.4 Die empirische Wendung und die Forderung, Pädagogik durch Erziehungswissenschaft zu ersetzen
3.5 Ausblick: Von den individuell verbürgten Ansätzen zu Theorie-»Schulen«
III Theorie und Empirie
4 Theoretisierungsangebote der Analysen von Erziehungsverhältnissen
4.1 Kritische Erziehungswissenschaft
Dialektik der Aufklärung in erziehungswissenschaftlicher Erkenntnis
Zur erziehungswissenschaftlichen Bedeutung der Kritischen Theorie
Eine Beispielstudie und ein Fallbeispiel aus der Erziehungswissenschaft
4.2 Strukturfunktionale Erziehungswissenschaft
Erziehungswissenschaftliche Bedeutung des Strukturfunktionalismus
Ein Fallbeispiel aus der Erziehungswissenschaft
4.3 Systemtheoretische Perspektiven in der Erziehungswissenschaft
Die erziehungswissenschaftliche Bedeutung der Systemtheorie
Eine Beispielstudie aus der Erziehungswissenschaft
4.4 Interaktionistische Erziehungswissenschaft
Die erziehungswissenschaftliche Rezeption des Symbolischen Interaktionismus
Ein Fallbeispiel aus der Erziehungswissenschaft
4.5 Strukturtheoretische Perspektiven in der Erziehungswissenschaft
Die erziehungswissenschaftliche Bedeutung strukturtheoretischer Theorien
Fallbeispiele im Licht strukturtheoretischer Betrachtungen
4.6 Poststrukturalistische Perspektiven
Die erziehungswissenschaftliche Bedeutung poststrukturalistischer Theorien
Fallbeispiel
4.7 Zusammenfassung: Theorieangebote und ihre Perspektivierung
5 Methodologien und Methoden erziehungswissenschaftlicher Forschung
5.1 Historisch-systematische Forschung
Gegenstandskonstitutionen und Fragestellungen
Ausgewählte methodologische Prinzipien
Resümee zu den methodologischen Prinzipien historisch-systematischen Vorgehens
5.2 Quantitative Forschung
Gegenstand und Fragestellungen
Operationalisierung: Datengenerierung und Datenauswertung
Resümee zu quantitativen Forschungsmethoden
5.3 Qualitative Forschung
Gegenstandsbestimmung und Fragestellungen
Operationalisierung: Datengenerierung und Dateninterpretation
Resümee zu qualitativen Forschungsmethoden
5.4 Nach der Analyse: Theoretisierung und Modellierung
Historisch-systematische Arbeiten abschließen
Hypothesenüberprüfende (quantitative) Arbeiten abschließen
Hypothesengenerierende (qualitative) Arbeiten abschließen
Vereinbarkeiten und Unvereinbarkeiten von Forschungslogiken
IV Abschluss
6 Forschung wozu? Eine Revision
6.1 Revision des Forschungs-Praxisverhältnisses
Die Zweckorientierung in der (Aus-)Bildung
Die Idee der Professionalisierung
Relationale Theoriebildung
6.2 Wissenschaftskritik, Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen
Kritisch theoretische Wissenschaftskritik in der Erziehungswissenschaft
(Erziehungs-)Wissenschaft und symbolische Gewalt
Postkoloniale Wissenschaftskritik und Erziehungswissenschaft
Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen in der Erziehungswissenschaft
6.3 Forschung wohin? Ein Ausblick
Transnationalisierung und Methodologischer Nationalismus
Postdigitalisierung
7 Schluss: Tabus über der erziehungswissenschaftlichen Forschung
Literatur
Grundrisse der Erziehungswissenschaft
Herausgegeben von Jörg Dinkelaker, Merle Hummrich, Wolfgang Meseth, Sascha Neumann und Christiane Thompson
Die Autorin
Dr. Merle Hummrich ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Schule und Jugend an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Merle Hummrich
Erziehungswissenschaftlich forschen
Eine Einführung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-037631-1
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-037632-8epub:ISBN 978 – 3 – 17–037633 – 5
I Einführung
1 Erziehungswissenschaftlich forschen – eine Feldbestimmung
Die Studie »Strukturelle Diskriminierung von Kindern mit unsicherem Aufenthaltsstatus« (Eisenhuth 2015) geht der Frage nach der Lebenssituation von begleiteten Minderjährigen in Deutschland nach.
In »Szene und soziale Ungleichheit« (Hoffmann 2016) fragt die Verfasserin nach Ungleichheiten in der Jugendkultur, die sich in der Techno-/Elektro-Szene gebildet haben.
Die PISA-Studie arbeitet den Leistungsstand von 15-Jährigen anhand standardisierter Messverfahren heraus und vergleicht dabei international, welchen Einfluss die Lebensverhältnisse auf die Leistungsfähigkeit haben.
In dem Band »Erwachsenenbildung in Grundbegriffen« (Dinkelaker/Hippel 2015) wird der Stand des Wissens über das Lernen Erwachsener aus theoretischer, historischer und empirischer Perspektive systematisiert.
In dem Band »Bildung anders denken« (Koller 2012) geht der Autor dem Vorhaben nach, den Bildungsbegriff zeitgemäß zu bestimmen und greift dazu auf Konzepte aus Pädagogik, Philosophie, Soziologie und Psychologie zurück.
Die kurzen Beispiele, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, zeigen: Fragestellungen in der Erziehungswissenschaft betreffen eine große Breite an Themen und an methodischen Bearbeitungsmöglichkeiten. Sie betrachten dabei insbesondere Prozesse des Aufwachsens, des Lernens und der Bildung sowie der Aushandlung um Teilhabe, setzen dabei allerdings ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Neben der fachlichen Einordnung als erziehungswissenschaftlich haben sich all diese Publikationen mit Fragen und Gegenständen befasst, die sie in Buch- und Zeitschriftenform einer Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie dokumentieren dabei Forschungsergebnisse, die sie in theoretischer, historischer und/oder empirischer Weise gewonnen haben. Damit stellen sie sich selbst einem Anspruch, der in diesem Band verhandelt werden soll: dem Anspruch wissenschaftlichen Kriterien zu genügen und einen Beitrag zu neuer erziehungswissenschaftlicher Erkenntnis zu leisten. Die relevante Frage für diesen Band ist dabei: Was macht, bei aller Unterschiedlichkeit, erziehungswissenschaftliches Forschen aus?
Dass Erziehungswissenschaft als Sozialwissenschaft begriffen wird, soll auch in diesem Band als Annahme vorweggeschickt werden. Es handelt sich dabei um eine Wissenschaft, die sich damit befasst, dass Erziehungswissenschaft über ihren Gegenstand bestimmt werden kann und dieser Gegenstand als Prozesse der Erziehung, Bildung und Sozialisation beschreibbar ist. Damit handelt es sich erstens um soziale Prozesse und zweitens um Prozesse, die auch in soziale Zusammenhänge eingebunden sind. Das heißt: Prozesse der Bildung, Sozialisation oder Erziehung kann man sich zunächst als soziale Prozesse vorstellen. Sie finden zwischen unterschiedlichen Personen statt und sind damit intersubjektiv (zwischen zwei Subjekten) und interaktiv (auf Interaktion basierend: zum Beispiel durch Sprache und Symbole vermittelt) ausgestaltet; Erziehung, Sozialisation und Bildung sind aber auch sozial eingebettet – sie entstehen in Zusammenhängen, in denen es Normen gibt, auf die sich Personen in ihren Interaktionen beziehen (z. B. wie ›man‹ in einem bestimmten Kontext spricht, welche Kleidung ›man‹ trägt usw.).
Nun wurden hier zwei relevante Bezugsdisziplinen der Erziehungswissenschaft genannt: Psychologie und Soziologie. Noch heute gelten sie – neben der Philosophie – als Nachbardisziplinen der Erziehungswissenschaft und sind erkenntnistheoretisch relevant. Gleichzeitig machen die um Erziehung, Bildung und Sozialisation zentrierten Gegenstandsbereiche die Erziehungswissenschaft als eigene Disziplin aus. Beiden Bezügen, dem Bezug auf die Nachbardisziplinen und dem Bezug auf die originären Gegenstandsbereiche, soll in diesem Band Rechnung getragen werden, indem sie in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden. Vor diesem Hintergrund kann aber erziehungswissenschaftliche Forschung gerade nicht als Forschung zu einem disziplinären Kern beschrieben werden, sondern vielmehr als Feld, in dem ganz unterschiedliche Themen, Gegenstandsbezüge und Theorien aufgenommen und zueinander relationiert werden.
1.1 Eine erste Feldbestimmung erziehungswissenschaftlicher Forschung
Weil es nicht »den« Kern »der« erziehungswissenschaftlichen Forschung gibt und die Themen divers, aber dennoch verbunden sind, sollen hier zwei Varianten der Bestimmung von Erziehungswissenschaft angeboten werden: a) das Feld der Erziehungswissenschaft in seinen unterschiedlichen disziplinären Bezügen und Teildisziplinen; b) das Feld der Erziehungswissenschaft in seinen Gegenstandsbezügen.
Das erste Feld, das die erziehungswissenschaftliche Forschung beschreibt, ist durch das Verhältnis von Theorie und Praxis bestimmt. Eine Spezifik der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Erziehung besteht darin, dass Erziehungswissenschaft sich zuallererst herausbildete, um die Praxis der Erziehung zu verbessern. Diese Forderung wird auch heute noch häufig in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit gestellt. Die Frage im Seminar »Und was bedeutet das jetzt für die Praxis?« scheint zuweilen die Textauswahl und die Bewertung der Texte durch Studierende nach dem Kriterium der Brauchbarkeit zu lenken (Krüger 2019). Ähnlich wie in dem Fall, in dem Schüler:innen im Stochastikunterricht nach der Nutzbarkeit des Wissens fragen (»Wozu brauchen wir das später im Leben?«), bemisst sich die Auseinandersetzung mit der Wichtigkeit des Wissens auch in erziehungswissenschaftlichen Studiengängen offenbar an seiner Nützlichkeit und Verwertbarkeit (Hummrich 2020).
Begreifen wir Erziehungswissenschaft als Sozialwissenschaft, so lässt sich hinsichtlich des Verhältnisses von Theorie und Praxis an einen Gedankengang anschließen, den Max Weber schon 1922 ausführt: Sozialwissenschaft, schreibt Weber, »war ›Technik‹ etwa in dem Sinne, in welchem es auch die klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften sind« (ebd. 1922/1988: 148). Dies markiert einen Unterschied zu Studienfächern wie Philosophie, Geschichte oder Theologie, die vor allem auf Wissens- und Erkenntnisgenerierung gerichtet sind, und bei denen der direkte Praxisbezug (die Technik) nicht im Vordergrund steht. Und gleichzeitig zeigt sich an erziehungswissenschaftlichen Theorien, dass auch hier das Wissen nicht unmittelbar auf »die« Praxis übertragbar ist – wobei hier auch gefragt werden muss, inwiefern überhaupt von »einer« Praxis gesprochen werden kann, betrachtet man die Allzuständigkeit erziehender und bildender Berufe (▸ Abb. 1.1).
Abb. 1.1:Erziehungswissenschaft in ihrer inter- und subdisziplinären Verwobenheit (Freie Universität Berlin, OSA Bildungs- und Erziehungswissenschaft [B.A.])
In der Grafik sehen wir »Bildungs- und Erziehungswissenschaft« zu unterschiedlichen disziplinären Bezügen relationiert. Das sind einmal die interdisziplinären Fächer, unter denen etwa die Psychologie schon genannt wurde. Nicht zufällig ist sie eines der meistgewählten oder sogar verpflichtenden Nebenfächer in einem Hauptfachstudiengang Erziehungswissenschaft. Zu wissen, welche Vorstellungen es über das Aufwachsen gibt, dass Entwicklung in unterschiedliche Phasen eingeteilt werden kann und somit Vorstellungen von angemessenem Handeln jeweilige Lebensphasen und Entwicklungsstufen voraussetzen, ist ein Wissen, das auch in späteren fachspezifischen Orientierungen von großer Wichtigkeit ist. Die interdisziplinären Fächer, die hier aufgerufen werden, haben meistens einen Bezug zur Erziehungswissenschaft (z. B. pädagogische Psychologie, Bildungsphilosophie usw.), bestehen aber (das sieht man rechts oben in der Grafik) als eigenständige Fächer auch jenseits ihrer Schnittstellen (Intersektionen) mit der Erziehungswissenschaft.
Das Feld unten links – die allgemeine Erziehungswissenschaft – markiert grundlegende Fragen in der Erziehungswissenschaft. Es geht um die Entwicklung der Disziplin, um Reflexion von Erziehungsverhältnissen (systematische Erziehungswissenschaft) oder auch um Erziehungsverhältnisse in unterschiedlichen Epochen (historische Perspektive) und Ländern (vergleichende Perspektive). Dieses Wissen um die Disziplin rahmt und durchdringt gewissermaßen die fachspezifischen Handlungs- und Forschungsfelder, die auf die Praxis hinführen (z. B. Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung usw.) oder in denen bestimmte, vertiefende Forschungsperspektiven entfaltet werden (wie frühkindliche Bildung, Jugend- und Schulforschung).
Die Vielgestaltigkeit »der« Erziehungswissenschaft vor Augen, lässt sich wiederum mit Max Weber auf ihre Bedingungen als Sozialwissenschaft reflektieren. Hier findet sich die Erkenntnis, dass es nicht die Aufgabe der Wissenschaft sein kann, »bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können« (Weber 1922/1988: 149), sondern, dass sie lediglich dazu verhelfen kann, die Wertmaßstäbe, an denen sich Handelnde orientieren, erkennen können (ebd.: 151). Erziehungswissenschaftliches Wissen kann also als Professionalisierungswissen verstanden werden; Forschung kann damit leisten, Erkenntnisse über die Praxis zu produzieren. Über Praxis Wissen zu generieren bedeutet schließlich, einen Beitrag zu Grundlagen der Erziehungswissenschaft zu leisten. Dies kann mit einem idealtypischen Wissen verglichen werden, das man an der Universität erwirbt (Wernet u. a. 2018): Man weiß dann z. B. etwas über die Struktur des Bildungs- und Sozialwesens, die Expert:innen-Klient:innen- oder das Lehrer:innen-Schüler:innen-Verhältnis, das Wissen ist aber nicht unmittelbar auf die konkrete Praxis übertragbar.
Wenn Weber hier darauf verweist, dass Wissenschaft keine Rezepte produzieren kann, sagt er damit auch, dass es nicht möglich ist, Wissen ausschließlich für die Praxis zu generieren bzw. Wissen(schaft) in den Dienst von Praxis zu stellen. Eine solche Perspektive kommt zuweilen in politischen Diskussionen um Erziehung auf, spielt aber auch in den erziehungswissenschaftlichen Studiengängen eine Rolle, wenn nach Vermittlungsmethoden gefragt wird. Hier kann es sein, dass unterstellt wird, es gebe Technologien der Wissensvermittlung, der Erziehung und der Sozialisation, die man einfach lernen und dann anwenden könne. Diese Annahme verkennt die Grenzen der Übertragbarkeit von Wissenschaft/Technologien auf pädagogische Praxis. Luhmann und Schorr erfassen das 1982 als ›Technologiedefizit‹ der Erziehung und des Erziehungssystems. Damit ist die Unmöglichkeit benannt, das mit der Aufklärung als zentral benannte Kernziel von Erziehung – Autonomie – durch Kausalität im Sinne eines technologischen Einwirkens auf die zu Erziehenden zu erreichen; zum anderen gerät die Hoffnung eines Wissens für die Praxis in Konflikt mit dem Grundsatz der Zweckfreiheit von Wissenschaft, die allerdings als Grundbedingung für die Ermöglichung von Erkenntnis verstanden wird (Weber 1988, Roth 1963). Obwohl nun Erkenntnis nicht automatisch eine Verbesserung der Praxis bedeutet, heißt das nun nicht, dass Forschen keine Bedeutung für die Praxis und umgekehrt Praxis keine Bedeutung für die Forschung hätte. Forschung kann wichtige Reflexionsprozesse über Erziehung anstoßen. Gleichzeitig braucht erziehungswissenschaftliche – wie jede sozialwissenschaftliche – Forschung Praxis als Anlass der Erkenntnisgewinnung. Beide sind also aufeinander verwiesen, gehen aber – so schreibt es schon Adorno (1969) über die Sozialwissenschaft – nicht ineinander auf.
Das zweite Feld kann über die Gegenstandsbezüge der Erziehungswissenschaft bestimmt werden. Dabei stehen die Handlungsorientierungen und Praxisformen, in denen sich Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsverhältnisse ausgestalten, eine zentrale Rolle. Hierzu sei angemerkt, dass im Folgenden dieser Dreiklang (Erziehung, Bildung und Sozialisation) gewählt wird, um die Komplexität von Erziehungsverhältnissen deutlich zu machen. Gleichzeitig stellt sich auch dieser Bestimmungsversuch als reduktiv heraus, weil versucht wurde, einen gemeinsamen Nenner für die Vielfalt der erziehungswissenschaftlichen Felder zu finden, ohne ein Feld (z. B. die Schule) überzubetonen. Die Praxen von Erziehung, Bildung und Sozialisation finden in Institutionen (z. B. Schule, Kindergarten, Jugendzentren, Erwachsenenbildungseinrichtung) und anderen Zusammenhängen statt (z. B. Familie, Freundeskreis) und können zum Gegenstand der Forschung werden. Sie können zum Beispiel danach unterschieden werden, ob sie durch Generationsdifferenz oder durch Generationsgleichheit geprägt sind: Lehrer:innen und Schüler:innen-Beziehungen sind zum Beispiel ebenso wie Beziehungen zwischen Eltern und Kindern durch Generationsdifferenz geprägt; Beziehungen zu Gleichaltrigen durch Generationsgleichheit. In der Erwachsenenbildung kann sich aber das Generationsverhältnis von Lehrenden und Lernenden auch als generationsgleiches oder umgekehrtes Generationsverhältnis (jüngere Lehrende, ältere Lernende) ausgestalten (▸ Abb. 1.2).
Abb. 1.2:Feldbestimmung erziehungswissenschaftlicher Gegenstandsbereiche (eigene Darstellung)
Die Gegenstandsbestimmung kann sich aber auch darauf beziehen, ob die Beziehungen direkt untersucht werden (z. B. in der Unterrichtsforschung oder in der Erforschung von Experten-Klienten-Beziehungen im Jugendamt) oder ob es sich um eine Institutionenanalyse handelt (z. B. Schulkulturforschung, Mechanismen institutioneller Diskriminierung usw.). In erziehungswissenschaftlicher Forschung kommt es also darauf an, sich mit Erziehungskonstellationen auf unterschiedlichen Ebenen des Sozialen (z. B. in von Interaktionen geprägten Zweierbeziehungen, in pädagogischen Handlungskontexten, in Milieus und in Gesellschaften) auseinanderzusetzen und dabei zu berücksichtigen, welche Möglichkeiten und Grenzen der Teilhabe Kontexte der Erziehung, Bildung und Sozialisation hervorbringen. Mögliche Forschungsfragen richten sich dann auf die Struktur der Interaktionsbeziehung, die Bedeutsamkeit der Instanzen, die bilden, erziehen und sozialisieren, oder die Überschneidungsbereiche zwischen unterschiedlichen Feldern (z. B. Familie und Schule) – um nur einige mögliche Zusammenhänge zu nennen.
Zusammenfassend kann das Feld erziehungswissenschaftlicher Forschung wie folgt beschrieben werden:
1.
Mit Blick auf die erste Feldbeschreibung bedeutet erziehungswissenschaftliches Forschen, sich über das Verhältnis von Theorie und Praxis klar zu werden und dabei auch die interdisziplinären Theoriebezüge zur Kenntnis zu nehmen;
2.
In der zweiten Feldbeschreibung geht es darum, die soziale Wirklichkeit, in der Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse stattfinden, ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, indem Handlungsfelder, Interaktionen und Institutionen sowie ihre jeweilige gesellschaftliche Eingebundenheit analysiert werden.
Mit dieser sehr allgemeinen Beschreibung wird es möglich, einerseits Forschungsvorhaben ganz allgemein zu verorten. (1) Welche theoretischen Bezüge werden in einem Forschungsgegenstand eröffnet? Handelt es sich um Bezugnahmen auf machttheoretische, philosophische oder strukturtheoretische, soziologische Annahmen? (2) Wie sind Subjekt und Gesellschaft zueinander konstelliert? Welche Eigenlogik hat Familie gegenüber Schule oder Jugendhilfe? Diese Fragen systematisch einzubeziehen ist in jedem Forschungsprozess hilfreich, denn das Wissen um die »Verortung« der Forschungsfrage gibt die Möglichkeit, am Anfang das Erkenntnisinteresse klar zu umreißen und am Ende den Gewinn, aber auch die Grenzen von Forschungsergebnissen zu reflektieren.
1.2 Zur Gliederung des Bandes
Vor dem Hintergrund dieser groben Feldbeschreibung soll im zweiten Teil des Bandes mit Grundlegungen zur Erziehungswissenschaftlichen Forschung begonnen werden. Dabei wird zunächst auf die Gegenwärtigkeit von Forschungsinteresse eingegangen und sich mit erziehungswissenschaftlichen Forschungsgegenständen befasst. Im Zentrum des zweiten Kapitels (▸ Kap. 2) steht die Frage, mit welchen Voraussetzungen man sich auseinandersetzen muss, wenn man sich auf erziehungswissenschaftliche Forschung einlässt. Damit wird versucht, die Vielfalt der Fragen, wie sie besonders zu Beginn eines Forschungsprozesses auftauchen und im obigen Beispiel exemplarisch aufgeführt wurden, zu systematisieren. Wie oben schon erwähnt, leitet sich die Etablierung der Erziehungswissenschaft als Disziplin aus dem philosophischen (theologischen, psychologischen und soziologischen) Nachdenken über Erziehung ab. Dieser Tradition soll im dritten Kapitel (▸ Kap. 3) nachgegangen werden, indem die Forschungsperspektiven einiger Wegbereiter:innen der disziplinären Entwicklung skizziert werden. Zentral ist die kritische Reflexion der Bedeutung, Forschung zu Erziehungsverhältnissen müssten der »guten Praxis« einen Dienst erweisen. In historischen Schlaglichtern wird auf die Bedeutung der Vorstellungen gelingender Praxis für die Entwicklung von Forschungsperspektiven eingegangen.
Im dritten Teil des Bandes geht es um theoretische und empirische Perspektiven der Gegenwart. Dabei werden in Kapitel vier (▸ Kap. 4) ausgewählte theoretische Richtungen der Erziehungswissenschaft herausgearbeitet. Hier wird auch exemplarisch gezeigt, wie sich die Nachkriegserziehungswissenschaft als Abgrenzungsdisziplin entwirft und wie schwierig es angesichts der Fragestellungen und Forschungsgegenstände ist, Erziehungswissenschaft positiv, im Sinne von einer genauen Definition, zu bestimmen. Kann also Erziehungswissenschaft nur darüber bestimmt werden, was sie nicht ist (das nennen wir ex negativo)? Wenn dies so ist, was bedeutet es für die erziehungswissenschaftliche Forschung? Im fünften Kapitel (▸ Kap. 5) geht es um Methoden erziehungswissenschaftlicher Forschung. Hier wird die Weiterentwicklung der Erziehungswissenschaft als eine Disziplin, in der die soziale Wirklichkeit von Erziehungsprozessen untersucht wird, thematisch. In diesem Zusammenhang werden unterschiedliche Zugänge zu Erkenntnissen über Erziehungsverhältnisse hervorgehoben und am Beispiel unterschiedlicher Methodologien die Erkenntnismöglichkeiten dargestellt. Das sechste Kapitel (▸ Kap. 6) ist eine Revision des thematischen Zusammenhangs dieses Bandes und diskutiert neben der Zielorientierung und der Zweckmäßigkeit zentrale Herausforderungen erziehungswissenschaftlicher Forschung. Dies betrifft zum einen die Reflexion der machtförmigen postkolonialen Gebundenheit von Forschung, zum anderen neue Forschungsbedingungen, wie sie etwa durch Postdigitalität gegeben sind.
II Grundlegungen
2 Erziehungswissenschaftliches Fragen
Es gibt zwei »Problempunkte«, die die Bestimmbarkeit erziehungswissenschaftlicher Forschung erschweren. Der erste liegt in dem Präfix »Erziehung« von »erziehungswissenschaftlich«, der zweite im Suffix »wissenschaftlich« desselben Begriffs.
Erziehungswissenschaft hat kein Monopol auf Fragen der Bildung, Erziehung und Sozialisation (zur kurzen Erklärung dieser Begriffe: ▸ Kap. 1). So gibt es etwa in der Soziologie die Bildungs- und Ungleichheitssoziologie und Sozialisation-, Biographie- und Migrationsforschung sind auch hier bedeutsame Grundbegriffe; in der Psychologie existiert eine Pädagogische Psychologie, die Psychoanalyse, Kindheits- und Adoleszenz-Psychologie usw. Umgekehrt werden in der Erziehungswissenschaft soziologische, psychologische und philosophische Theorien diskutiert. Um Prozesse des Aufwachsens zu analysieren, bedarf es soziologischer, philosophischer und psychologischer Grundlagentheorien, wenn es darum geht, erziehungswissenschaftlich interessante Fragen zu beantworten. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, zeigt sich in dieser kurzen Auflistung, wie die disziplinären Grenzen verwischen. Dies ist für »die« Erziehungswissenschaft zuweilen sogar sehr produktiv, denn sie ist darauf verwiesen, »über den Tellerrand« zu blicken.
Erziehungswissenschaftlich stellt sich die Frage, was eigentlich als Fragestellung formulierbar ist, was wissenschaftliche Fragen sind, zu denen geforscht wird. Denn zu Erziehung wird viel publiziert und zahlreiche Autor:innen nehmen in Anspruch, über eine Expertise zu verfügen. Erziehung ist auch immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen und politischer Auseinandersetzungen. Wo liegt also die besondere Perspektive der Erziehungswissenschaft? Darüber hinaus wird an die Wissenschaft der Anspruch herangetragen, die Ergebnisse der Praxis verfügbar zu machen: zu sagen, wie »es« geht. Aber kann Erziehungswissenschaft dies einlösen? Und welchen Geltungskriterien muss sich eine erziehungswissenschaftliche Forschung von Beginn an stellen? Was unterscheidet das wissenschaftliche Fragen von anderen Arten des Fragens, worin besteht die besondere Leistung des wissenschaftlichen Fragens und wo sind vielleicht auch Grenzen erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisfähigkeit?
Fragen wie diesen und dem »Problem« interdisziplinärer Überschneidung soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden. Dabei ist das Kapitel so strukturiert, dass es den Anfang einer Forschungsarbeit nachzeichnet. Dieser besteht nicht etwa in der Entwicklung einer Fragestellung, sondern in der Unterscheidung von Thematisierungsformen von Erziehung (▸ Kap. 2.1). Die Frage, wie in journalistischen Medien, Erziehungsratgebern und wissenschaftlichen Artikeln Erziehung thematisiert wird, soll dabei helfen, den wissenschaftlichen Blick auf den Gegenstand zu schärfen. Vor diesem Hintergrund kann erarbeitet werden, was eine erziehungswissenschaftliche Fragestellung ist (▸ Kap. 2.2). Damit ist ein weiteres Teilkapitel dieser Zuspitzung angelegt, das auf Fragestellung, Gegenstand und Zielsetzung Bezug nimmt (▸ Kap. 2.3). Forschungsarbeiten konkretisieren sich, indem sie zugespitzt auf eine Fragestellung und einen Gegenstand Bezug nehmen. Schließlich muss sich mit Blick auf Forschungsethik mit der eigenen Position als (angehende:r) Wissenschaftler:in auseinandergesetzt werden, da die Frage, welche Haltung man zum Zweck der Erkenntnisgewinnung einnimmt, besonders in dem sensiblen Feld des Involvierens anderer Menschen in den Forschungsprozess, auf Grenzen der Machbarkeit – nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Forschung – verweist (▸ Kap. 2.4).
2.1 Skizze der Eigenschaften erziehungswissenschaftlicher Fragen
»Die moderne Gesellschaft produziert sehr unterschiedliche Textsorten, die sehr unterschiedliche Arten von Lektüre erfordern. In gewissem Sinne verdirbt die auf eine Textsorte spezialisierte Gewohnheit den Leser für die Lektüre andersartiger Texte; und da es sich um weitgehend unbewußt ablaufende, habituell gewordene Routinen handelt, sind solche Spezialisierungen schwer zu korrigieren« (Luhmann 2000: 150).
Niklas Luhmann (1927 – 1998) markiert hier ein Lektüreproblem, das sich allerdings ebenso gut als Problem der Herangehensweise an erziehungswissenschaftliche Forschung lesen ließe. Welche Perspektive wird zu einem Forschungsgegenstand eingenommen, welche Haltung zu einer Fragestellung? Damit steht schließlich die Haltung zur Wissenschaftlichkeit von Erziehungswissenschaft selbst zur Disposition. In diesem Teilkapitel betrachten wir unterschiedliche Textsorten zu Erziehungsfragen und deren Bedeutsamkeit für die Eigenschaften, die mit erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen verknüpft werden können. Drei Fragerichtungen werden unterschieden: die massenmediale, die beratende und die wissenschaftliche.
Massenmediale Fragestellungen
In einer Online-Ausgabe der Zeitschrift »Spiegel« wurde 2019 das Thema »Aufwachsen als Sandwichkind. Kinder mit älteren und jüngeren Geschwistern« (Spiegel 10. 07. 2019) verhandelt. Der Teaser, der zum Lesen einladen soll, ist wie folgt formuliert: »Sanfte Vermittler oder ständig auf der Suche nach Aufmerksamkeit? Sandwichkinder bekommen sehr unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben. Ist da was dran?«
Darunter wurde zum Erscheinungszeitpunkt ein Bild mit drei Kindern gezeigt, die an einem Holztisch sitzen. Obst, Geschirr und Pflanzen bilden eine bunte Anordnung. Ein Kind, das als sehr junges Mädchen identifiziert werden könnte, hält mit beiden Händen eine Tasse vor ihrem Gesicht, die anderen beiden Kinder (vermutlich Jungen im Grundschulalter) sitzen mit seitlich herabhängenden Armen am Tisch. Der Junge, der mit dem Rücken zur Bildbetrachter:in sitzt, wird von den anderen Kindern angeschaut. Die Kinder, deren Gesicht durch die Kamera eingefangen wird, blicken ernst. Alle Kinder sind blond, wohlgenährt, gut angezogen und hellhäutig.
Ohne dieses Bild eingehender interpretieren zu können, wird doch deutlich: die Fragestellung wird mit bestimmten Symbolen aufgeladen, sie wird regelrecht in Szene gesetzt, indem ein deutsches Mittelschichtideal (zwei bis drei Kinder, gut angezogen und frisiert, gesund ernährt, an ausgesuchten Möbel sitzend) repräsentiert wird und ein Schnappschuss aus dem Alltag suggeriert wird (dies wird z. B. auch daran sichtbar, dass die Kinder nicht der Kamera zugewandt sind oder nicht in die Kamera lächeln). Die Frage selbst kann als Frage nach der Wahrhaftigkeit der Zuschreibungen an sogenannte Sandwichkinder identifiziert werden. Sie wird dem Text überschrieben, das heißt, Informationen werden schnell und plausibel zusammengestellt und können mit dem Alltagswissen (»Ist da was dran?«) verknüpft werden. Zugleich verspricht der Text einen Wissenszuwachs. Um diesen herbeizuführen, werden ein Wissenschaftler, ein Psychotherapeut und eine Buchautorin aufgerufen. Der Wissenschaftler (Ralph Hertwig vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin) referiert eine Studie zur Persönlichkeit der Kinder, der Therapeut (Wolfgang Kügler) erzählt von seinen Erfahrungen, die Buchautorin (Nicola Schmidt) erwähnt, dass die mittlere Geschwisterposition gesund sei und gibt Tipps zur Förderung der Mittelkinder. Alle drei Expert:innen interpretieren somit die Fragestellung jeweils für sich: der Wissenschaftler nimmt Bezug auf die Möglichkeit objektivierbarer Aussagen, der Therapeut ordnet das Thema vor dem Hintergrund einer professionellen Erfahrung ein, für die Buchautorin verbindet sich mit der Frage eine normative Aufladung: wie gelingt es, mittlere Kinder zu integrieren? Massenmediale Darstellungen – so lässt sich hier zusammenfassend sagen – müssen die Leser:innen vor dem Hintergrund alltäglicher Handlungsprobleme für sich interessieren. Darum »übersetzen« sie Erkenntnisse in Alltagssprache. In diesem Sinne ist der (im Übrigen: zumeist männliche) Wissenschaftler ein Referenzgeber, der sich mit anderer Expertise (Therapeut, Buchautorin) vermischt. Die Kriterien, nach denen die Aussagekraft dann beurteilt werden kann, sind unklar: Die wissenschaftliche Studie mag hier noch auf wissenschaftliche Referenzen verweisen; der Therapeut spricht aus Erfahrung; die Buchautorin, weil sie ein Buch geschrieben hat. Ziel ist damit keine exakte Bestimmung der Bedeutung von Geschwisterbeziehungen, sondern eine interessante Vermarktung, die unterschiedliche Perspektiven vermengt. Damit hat der Artikel allerdings keinen Gebrauchswert als wissenschaftliche Referenz. Verlassen wir nun den Bereich der massenmedialen Darstellung, wir kommen später darauf zurück, und wenden uns der Ratgeberliteratur zu:
Fragestellungen der Ratgeberliteratur
Ratgeber zur Erziehung behandeln häufig Fragen, die auch in der Erziehungswissenschaft eine Rolle spielen, z. B. Kindererziehung, Jugenderziehung, Krisen des Selbst, Anforderungen an Erwachsensein, Alterungsprozesse. Allein im Bereich der Kindererziehung gibt es einen unübersichtlichen Markt – Bücher von Familientherapeuten wie Jesper Juul, die eher für eine Pädagogik vom Kinde aus stehen (Juul 2012), rangieren ebenso auf dem Markt wie Bücher zur Disziplinierung und zur Bedürfnisorientierung. Für Lehrkräfte gibt es Methodentrainings oder Bücher, die eine bestimmte Anzahl (10, 20, 25) an Handlungsmöglichkeiten bei ›schwierigen‹ Schüler:innen versprechen, für Soziale Arbeit und Erwachsenenbildung gibt es ebenso eine Vielzahl an Methodenhilfen, Moderationsunterstützungen usw. Den Eltern, Erzieher:innen und Lehrer:innen, den Sozialarbeiter:innen und Erwachsenenbildner:innen wird versprochen, dass sich darüber die Praxis von Erziehung, Bildung und Sozialisation gut bearbeiten ließe, dass es einfache Antworten auf Schwierigkeiten des Alltags und außergewöhnliche Herausforderungen gebe, dass ihre Fragen auch Antworten finden. Ratgeber funktionieren im Allgemeinen wie Journalismus: Es wird suggeriert, dass immer mehr von etwas (ungezogene Kinder, ratlose Eltern) vorhanden ist – in der Medienwissenschaft als »Immermehrismus« bezeichnet (Brosius et al. 1991) – und dass die Angst vor dem Widerfahrnis dieses »Notstandes« durch die Lektüre bearbeitet werden kann. So auch im Fall des Ratgeberbuches von Jesper Juul (2012), das die Frage stellt: »Wem gehören unsere Kinder? Dem Staat, den Eltern oder sich selbst?«. Dabei erscheinen die Worte »Kinder« und »oder sich selbst« in roter Schrift. »Kinder« ist zu dem dick unterstrichen, so dass es von dem Folgesatz abgesetzt ist.
Jesper Juul (2012) positioniert damit zwei Fragen, mit denen unterschiedliche Suggestionen transportiert werden: erstens die, dass diese Fragen für das Aufwachsen und die Auseinandersetzung damit relevant seien; zweitens, die (durch Farbe symbolisierte) Zugehörigkeit »unserer Kinder« zu »sich selbst«. Die Unterstreichung setzt dabei das »Gehören« und die Akteure, die dafür in Frage kommen (Staat, Eltern), von einander ab. Schon auf diesen wenigen Zeilen finden wir also eine empirische Ausdrucksgestalt davon, wie Ratgeber funktionieren: Eine Person – in diesem Fall der bekannte Autor, Kinder- und Jugendtherapeut Jesper Juul (die Schrift ist anders formatiert, aber genauso groß wie die erste Frage) – stellt Fragen, die er zu beantworten verspricht. Dabei tritt er als erfahrener Experte (ähnlich wie der Psychotherapeut im vorhergehenden Beispiel) in Erscheinung.
Doch die Fragen kann er sich nicht nur zufällig stellen und nicht nur, weil er erfahren ist. Es wird auch mit dem Stilmittel der Charismatisierung gearbeitet: In der Größe und Gestalt der Schrift erscheint Juul als Person und als Autor von Fragen und Antworten. Er steht damit dafür, dass er in der Lage ist, provokante oder unbequeme Fragen zu stellen. Er irritiert, denn in der westlichen Moderne »gehört« niemand einem anderen Menschen; das Ziel von Erziehung ist Mündigkeit und Teilhabe. Es geht folglich nicht um Leibeigenschaft, sondern um Verfügbarkeit des Menschen über sich selbst und um »Zugehörigkeit« zu einer Gemeinschaft, die legitimerweise von »unseren« Kinder sprechen kann. Das bedeutet, dass die Überantwortung oder besitzhafte Beanspruchung als illegitim markiert werden.
Die Frage nach dem Kind – oder den Kindern – stellt sich hier schließlich nicht als Frage nach Kindheit an sich oder als Perspektive, die sachlich diskutiert werden kann. Vielmehr geht es um die Rechtmäßigkeit der Zugehörigkeitskonstruktionen und der damit verbundenen Haltungen von Erziehenden gegenüber dem Kind. Die Fragen selbst tragen eine Antwort in sich, die der Autor als charismatischer Führer in Erziehungsfragen zu beantworten verspricht. Dabei suggeriert der Autor, die Fragen seien drängend und die Eltern wünschten eindeutige Antworten. Diese liefert er, blendet dabei aber andere mögliche Perspektiven auf Erziehung aus.
Fragestellungen in der Wissenschaft
Selbstverständlich ist auch die erziehungswissenschaftliche Literatur unüberschaubar und es ist unmöglich, über »die« Fragestellung in »der« Wissenschaft zu schreiben. Wir finden auch hier Fragestellungen, die sehr deutlich an normative Ordnungen geknüpft sind und von der Frage geleitet sind, was gut und richtig ist. Wir finden Literatur, die ihre Frage pointieren und dramatisch zuspitzen. Ein frühes Beispiel ist hier die von Schleiermacher (1826/1959) gestellte Frage: Was will die ältere Generation mit der jüngeren, mit der die Bedeutung der jüngeren für die ältere Generation zunächst infrage gestellt wurde. Der Inhalt dieser Frage wird später noch einmal aufgegriffen (▸ Kap. 2.2); an dieser Stelle geht es zunächst um eine abstrakte Bestimmung der Textsorten. Ist hier Schleiermachers Frage als Aufhänger einer wissenschaftlichen Abhandlung über Generationsbeziehungen in Erziehungsverhältnissen zu sehen, so finden wir auch andere Überschriften, die stärker beschreibend sind.
Dazu zählt z. B. die Auseinandersetzung mit »Ordnungen der Kindheit«. Diesem Sammelband stellt Michael-Sebastian Honig die Frage nach dem »Kind der Kindheitsforschung« voran. So fokussiert er dann auf die Gegenstandskonstitution »Kind« und »Kindheit« in den »childhood studies« (2009).
Der Artikel ist in einem vom Verfasser selbst herausgegebenen Buch zu »Ordnungen der Kindheit« erschienen. Genauer: Honig versteht seinen Beitrag als Einleitungs- oder Auftaktartikel. Auch das wissenschaftliche Wissen wird medial (in einem Buch) aufbereitet, das Bild, das (vermutlich vom Verlag) gewählt wurde, ist vergleichsweise klein und in schwarz-weiß gehalten. Hierauf sind zwei als Jungen identifizierbare Menschen zu sehen, beide blond, dem einen würde man zuschreiben, im Kleinkindalter zu sein, dem anderen im Grundschulalter. Sie spielen mit einer Modelleisenbahn, wobei sie ernst dreinblicken. Das kleinere Kind blickt dabei zum größeren auf und sein Gesicht ist halb, der Körper ganz verborgen. Das größere Kind hat die Hand an dem Eisenbahnzug, sein Körper ist teilweise zu sehen, das Gesicht im Profil, es blickt zu dem Zug, so dass Hand und Kopf (Blick) eine Einheit bilden. Auch wenn hier die Aufmachung des Buches nicht im Vordergrund stehen soll, so werden Annahmen über Kindheit mittransportiert: die Kinder scheinen sich in einem Alter zu befinden, in dem sie spielen, sie verfügen über aufwändiges Spielzeug und repräsentieren in ihrer Erscheinung das Kindheitsbild der nord-westlichen Hemisphäre – zugespitzt könnte man sagen: eine Ordnung von Kindheit, die durch Fürsorge gerahmt ist und in der es ausreichend Gelegenheit gibt, typisch kindlichen Tätigkeiten (Spielen) nachzugehen.
Honigs Aufsatz »Das Kind der Kindheitsforschung. Gegenstandskonstitution in den childhood studies« nimmt seinen Ausgangspunkt bei diesen Vorstellungen – den Konstruktionen – von Kindheit, wie sie unter anderem in den childhood studies untersucht werden. Diese seien zwar aktuell und wichtig, schreibt Honig, sie hätten jedoch die Frage noch nicht beantwortet, was ihr Gegenstand sei: »Was will die Kindheitsforschung unter einem ›Kind‹ verstehen?« (ebd.: 26). Dies ist eine grundlegende Frage, die hinter das Bild auf dem Buchdeckel, das ein Selbstverständnis von Kindheit repräsentiert, zurückgeht – oder anders gesagt: die darauf hinweist, dass dieses Bild, das eine Alltagssituation von Kindheit zu vermitteln scheint, mit spezifischen Vorstellungen dieser Lebensphase verknüpft ist.
Auch wenn man die Frage von Honigs Beitrag mit den oben aufgeworfenen Fragen vergleicht, wird deutlich: hier geht es zunächst nicht darum, das Interesse einer breiten Masse zu wecken, wie in den ersten beiden Beispielen. Mit der Art zu fragen verbindet sich – so ein erster Eindruck – zunächst eine gewisse Handlungsentlastung: es wird nicht gefragt (und beantwortet), was mit Kindern gemacht werden soll oder wie sie behandelt werden sollen, sondern die Frage ist viel schlichter: Was ist ein Kind? Wie kann es aus Forschungsperspektive beschrieben werden? Die Alltagswahrnehmung wird damit irritiert. Diese war in den vorgenannten Beispielen eine Voraussetzung. Bevor man von einem Sandwichkind spricht oder nach der Zugehörigkeit von Kindern fragt, fragt man sich nicht mehr, was eigentlich ein Kind ist. Wissenschaftlich wird aber gerade dies als interessante Frage markiert. Das Alltagsverständnis wird hinterfragt: welche objektiven Kriterien sprechen dafür, einen Menschen als Kind zu bezeichnen?
Es wird hier deutlich: erziehungswissenschaftliche Fragen befassen sich auch mit grundlegenderen Themen. Es geht bei solchen grundlegenden Fragen weniger darum, wie etwas sein soll, als darum, wie Phänomene hinreichend beschrieben werden können. Um dies zu erreichen, gibt es zwei Logiken, in denen Fragen gestellt werden können: nach (1) naturwissenschaftlichen Maßgaben und nach den Prinzipien der (2) Geistes- und Sozialwissenschaften.
1.
Nach naturwissenschaftlichem Vorbild ist die Logik zentral. Stellt man die Frage ›Was ist ein Kind?‹ zum Beispiel aus biologischer Perspektive, dann müsste Kindheit als vermessbar angenommen werden, es müsste weiter überlegt werden, was alles getan werden kann, um im Bereich der Lebewesen von Kindern zu sprechen – die Frage würde also mit Blick auf standardisierte Messverfahren operationalisiert, um präzise Aussagen dazu machen zu können, was ein Kind ist. Anatomisch betrachtet könnte man weiterfragen: ist ein Mensch noch im Wachstum, wie ist er im Verhältnis zu durchschnittlichen Erwachsenen proportioniert, welche Merkmale der sexuellen Reife wurden entwickelt? Man könnte das Kind auch verhaltenspsychologisch, entwicklungspsychologisch oder neurobiologisch (usw.) untersuchen und fragen: inwiefern unterscheidet sich das Verhalten der meisten Neugeborenen von noch nicht erwachsenen Menschen im Alter von ein, drei, sechs oder zehn Jahren, welche Hirnaktivitäten sind wann wahrscheinlich usf.? Hier zielt die Frage auf die Ermöglichung von Durchschnittswerten, die sich im Sinne einer Ursache-Wirkungs-Logik verallgemeinern lassen.
2.
Sozialwissenschaftliche Erkenntnis vermag jedoch noch ein weiteres Erkenntnisinteresse zu äußern – dies ist die Auseinandersetzung mit sozialen und kulturellen Vorstellungen – z. B. davon, was ein Kind ist. Heute gehen zum Beispiel in der Regel alle Kinder zur Schule und dürfen bzw. müssen in Gesellschaften, die sich selbst als »modern« bezeichnen würden, nicht arbeiten. Dies ist sogar gesetzlich verankert, das heißt: wer Kinder für sich arbeiten lässt, macht sich strafbar. Das Kind hat einen rechtlichen Status – es geht in den Kindergarten, zur Schule und ist das Kind der Familie (Honig 1999). Das bedeutet, es ist staatlich (durch die Schulpflicht und die Jugendhilfe) vereinnahmt und an die Familie werden normative Erwartungen des Aufwachsens und der Fürsorge geknüpft. Um zu untersuchen, wie es zu den Vorstellungen von Kindheit kommt und woher die Bedeutung, die Kindheit in der Gesellschaft hat, rührt, bedarf es anderer Frage- und Aufmerksamkeitsrichtungen als der Vermessung von Menschen, die noch nicht ausgewachsen sind. Zum Beispiel kann gefragt werden: Wann hat sich denn die Vorstellung von Kindheit, wie wir sie heute kennen, herausgebildet, wie lässt sich Kindheit als soziale Konstruktion begreifen? In welche generationalen Ordnungen ist das Kind in welcher Weise eingebunden? Wie gestaltet sich das Alltagsleben von Kindern unter gegenwärtigen Bedingungen? Wie werden pädagogische Beziehungen zu Kindern ausgestaltet? In diese zweite Perspektive würde auch die Frage, die Michael Sebastian Honig (2009) stellt, fallen. Er repräsentiert somit eine sozio-kulturelle Perspektive in der Erziehungswissenschaft.
Die Trennung der Textformen ist selbstverständlich nur eine idealtypische. Das bedeutet: in erziehungswissenschaftlichen Studien und gerade auch in Publikationen, die im Studium vorkommen, treffen wir häufig auf Mischformen, die z. B. stark der Praxis verpflichtet sind. Solche Formen finden wir unter anderem in Methodenbüchern und in didaktischen Veröffentlichungen. Das heißt, dass es auch erziehungswissenschaftliche Publikationen gibt, die Nützlichkeitsfragen bedienen. In der Unterscheidung von Textsorten kann jedoch gezeigt werden, dass es wissenschaftliche Kriterien gibt, an denen sich erziehungswissenschaftliche Forschung orientiert. Hierzu zählt das Prinzip der Sachlichkeit, das in den beiden erstgenannten Beispielen (Massenmedien und Ratgeber) nicht im Vordergrund steht. Vielmehr tritt in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen die Persönlichkeit der:des Fragenden in den Hintergrund und es erfolgt eine Auseinandersetzung um den Gegenstand.
Damit soll hier nicht gesagt werden, dass es in der Praxis prinzipiell nachteilig ist, sich auch mit Blick auf den Publikationssektor der Massenmedien oder der Ratgeber zu informieren. Gerade hieran ist es doch möglich, den gesellschaftlichen Diskurs tagesaktuell zu verfolgen. In einem Buch über (erziehungs-)wissenschaftliches Arbeiten ist allerdings auf die Differenz zwischen eher erfahrungsgesättigten Berichten und wissenschaftlicher Analyse hinzuweisen. Wissenschaftliche Analyse ist dabei durch stringente Argumentation in Bezug auf einen Gegenstand geprägt. Die Ergebnisse stehen im Anspruch nachvollziehbar zu sein, das heißt: theoretisch und methodisch begründet. Behauptungen müssen so entweder durch eigene Analysen hergeleitet oder anhand von Quellen und Literaturangaben belegt werden. Kurzum: Wissenschaftliches Arbeiten ist kriterial gestützt. Im Unterschied zu journalistischen Texten oder Ratgeberliteratur geht es weder um eine effektreiche Story noch um eine charismatische Erzählung des Gelingens, sondern um intersubjektiv nachvollziehbare Argumente und die sachliche Präsentation eigenständiger – originaler – Forschungsergebnisse.
2.2 Die Entwicklung von Fragestellungen
Wozu braucht der Mensch Erziehung?Was will eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?Was will die jüngere Generation mit der älteren?Gibt es eine allgemeine Theorie über Pädagogik?Wie wird am familialen Abendbrottisch erzogen?Was ist ein:e gute:r Lehrer:in?Welche Leistungsfähigkeit zeigen Jugendliche im internationalen Vergleich?Wie wird soziale Differenzierung im Erziehungsprozess hervorgebracht?Wann sind Kinder schulreif?Brauchen Kinder die Handschrift?Wieviel Medienkonsum ist für Jugendliche schädlich?Wie gehen ethnisch diverse Gruppen miteinander um?Wie lernen Erwachsene?Was ist professionelles Handeln?Ist Mehrsprachigkeit ein Vorteil in der schulischen Bildung oder ein Nachteil?Wie wichtig ist Familie, sind Freunde, sind Lehrer:innen für das Aufwachsen?Können Menschen im Alter noch lernen?Wie kann Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft gestaltet werden?Was ist eine gute Schule?Wie lassen sich Bildungssysteme vergleichen?
Die Auswahlliste zeigt: Fragen rund um den Gegenstand der Erziehung lassen sich nicht ohne Weiteres als Forschungsfragen identifizieren. Sie können als Fragen von allgemeinem Interesse rund um Prozesse der Bildung, der Erziehung und der Sozialisation gesehen werden, die auch zu erziehungswissenschaftlichen Fragen werden können. Dabei ist es kaum möglich, sie alle auf einen Nenner zu bringen. Ebenso wenig lässt sich »der« eine Kern von erziehungswissenschaftlichen Fragen identifizieren (vgl. Koller 2014, Krüger 2019). Die Aussage: »Typisch für Erziehungswissenschaft sind Fragen zu...« kann nicht kurz und bündig erfolgen. Es lässt sich wohl annehmen, dass die Fragen, die gestellt werden, es insgesamt mit Erziehung, Bildung und/oder Sozialisation zu tun haben. Ob aber nun das Individuum in seiner psychischen Verfasstheit betrachtet wird oder die gesellschaftlichen Bedingungen und die sozialstatistisch relevanten Orientierungen hängt wesentlich davon ab, wie Fragen gestellt werden.
In einer vorläufigen Bestimmung (man nennt diese Vorläufigkeit, die durchaus methodisch sinnvoll sein kann, auch heuristisch) soll hier auf zwei unterschiedliche Varianten des Fragestellens eingegangen und von dort darauf geschlossen werden, welche Bedingungen an die Forschung mit der Art der Fragestellung geknüpft sind:
1.
soll in diesem Zusammenhang die Bestimmung der Forschungsfrage über die Phänomene, die eine soziale Praxis als eine Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationspraxis kennzeichnen, entwickelt werden;
2.
wird die Möglichkeit entfaltet, Fragen von Forschungsdesideraten her zu denken, das heißt als Feststellung, dass zu bestimmten Bereichen noch keine Ergebnisse vorliegen oder die Ergebnisse unter einer bestimmten Perspektive nicht aussagekräftig genug sind.
Beide Varianten sind nicht isoliert voneinander zu denken, sondern stehen in einem Verweisungszusammenhang, denn auch bei der Frageentwicklung über Phänomene (1) muss der Forschungsstand und müssen die -desiderate geprüft werden, auch beim Ausgang von Forschungsdesideraten ist zu überlegen, wie diese an die soziale Wirklichkeit anschließen. Dieser Verweisungszusammenhang wird in Abbildung 2.1 sichtbar (▸ Abb. 2.1).
Abb. 2.1:Verweisungszusammenhang Erziehungswissenschaftlicher Fragen (eigene Darstellung)
Wie sich die einzelnen Varianten ausdifferenzieren lassen und wie es schließlich um den Verweisungszusammenhang bestellt ist, soll im Folgenden behandelt werden. Dabei kann vorausschickend angemerkt werden, dass die Entfaltung der Varianten auch bedeutet, neben den im vorhergehenden Kapitel entfalteten Merkmalen erziehungswissenschaftlichen Fragens Eigenschaften zu entfalten, die für die Disziplin Erziehungswissenschaft kennzeichnend sind. Es geht also nicht so sehr darum, wie man mit Blick auf Prozesse der Bildung, Erziehung und Sozialisation wissenschaftlich fragt (▸ Kap. 2.1), sondern darum, sich mit der disziplinären Verortung von Fragen auseinanderzusetzen und diese idealtypisch zu bestimmen.
Zur Bestimmung der Forschungsfrage über die Phänomene
Wie eng das Stellen wissenschaftlicher Fragen mit der untersuchten Praxis verbunden ist, zeigt sich daran, dass Erziehungswissenschaft häufig ihre Forschungsfragen aus der Praxis heraus generiert. Eine sinnliche Wahrnehmung oder Beobachtung, die vielleicht irritiert, aber nicht befriedigend aus dem Alltagswissen heraus beantwortet werden kann, kann Anlass sein, sich zu fragen, welches wissenschaftliche Wissen darüber bereits vorliegt, und darauf aufbauend eine eigene Forschungsfrage zu entwickeln. Solch eine Irritation kann z. B. durch eine Beobachtung im Praktikum hervorgerufen werden, wenn man beobachtet, dass ein Großteil des Unterrichts darin besteht, die Vermittlung von Wissen durch Disziplinierung erst zu ermöglichen. Hier lassen sich Fragen danach stellen, wie Erziehung in den Unterricht eingelagert ist, wie Lehrer:innen und Schüler:innen an der Herstellung von Störungen und ihrer Bearbeitung beteiligt sind usw. In sozialpädagogischen Zusammenhängen könnte z. B. beobachtet werden, dass es in Teamgesprächen zu mehr oder weniger ausgesprochenen Konflikten kommt. Hieraus könnte die Frage entwickelt