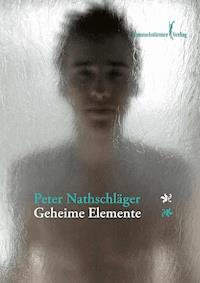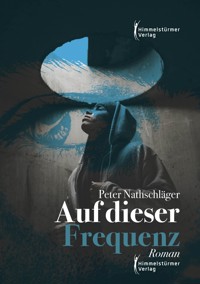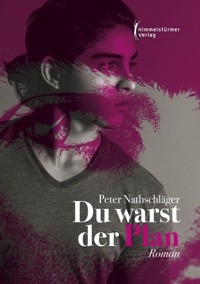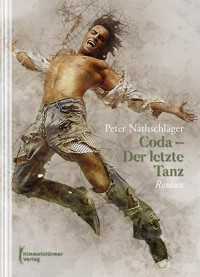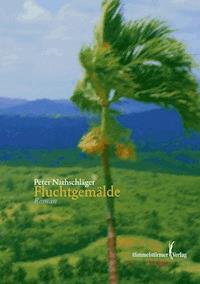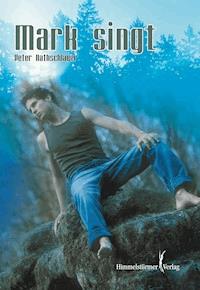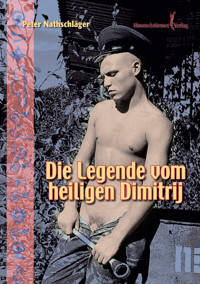Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Text für Vorschau zu: „Dunkle Flüsse“ Peter Nathschläger: „Nachdem David Schneider nach seiner Odyssee quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika nach Hause und zu seinen Eltern gefunden hat, (Dunkle Flüsse) dachte ich mir: Bleib noch eine Weile. Hier ist es schön. Hier ist ein guter Platz zum Leben. Da, die Berge, die klaren Seen, die Wälder … und die Kleinstadt Helena. Eine idyllisch gelegene Stadt an den Ausläufern der blauen Berge - eine Stadt, wie geschaffen für Geschichten. Man braucht nur ein wenig spazieren zu gehen, dachte ich mir. Ein bißchen herumgehen und die Augen offenhalten. Und tatsächlich! Da ist eine weitere Geschichte. Eine für die Stadt unrühmliche Geschichte, die im Jahr 1983 zwei verliebte Jugendliche entzweite. Ein Junge wurde von seinen Eltern verstoßen und aus der Stadt getrieben. Eigentlich schon fast ein Drama, wenn nicht doch hin und wieder die Zeit Wunden heilen würde. Denn manchmal genügt es, dass einer, der einst verstoßen wurde, nach Jahren zurückkehrt, um seine Angelegenheiten zu ordnen. Manchmal genügt es, wenn man die richtigen Leute mit Renovierungsarbeiten des Elternhauses beauftragt. Und manchmal genügt es, wenn einige Leute fest davon überzeugt sind, UFOs über Montana gesehen zu haben. Lichter über Helena. Ich war an dem See, den David Schneider seinem Freund Mark Fletcher gezeigt hatte (Mark singt). Ich sah ein paar Halbwüchsigen an einer Busstation vor einem Kiesparkplatz. Ich hatte den Waldrand des Nationalparks im Rücken, die Frühlingssonne war wunderbar, und ich wartete auf den Linienbus, um nach Helena zurück zu kommen. Da sah ich einen Mann Ende Dreißig in einem offenen Wagen vorbeifahren. Braungebrannt, mit einem Ausdruck von Trauer und Wut im Gesicht. Mit ihm sollte die Geschichte beginnen. Wißt Ihr was? Es ist gut, daß ich hier geblieben bin. Denn manchmal geschehen Wunder: Unrecht wird gesühnt, und die Liebe findet ihren Weg. Und am Ende wird alles und jedes gut. Alles wird gut.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Nathschläger
Geboren am 3.3.1965 in Wien.
Nach der Schule Tischlerlehre, Abschluss 1983.
Von 1983-1998 bei verschiedenen Wiener Bühnen als Tischler tätig.
1998 Wechsel zur IT, zurzeit tätig im IT Projektmanagement.
1999 erschien der erste Gedichtband, der erste Roman folgte im Herbst 2004.
Peter Nathschläger lebt seit 1995 gemeinsam mit seinem Freund Ryszard in einer "vom Leben gebeutelten" aber glücklichen Beziehung.
Bibliographie
„Alles besser“, Gedichte. Männerschwarm, 1999
„Mark singt“, Roman. Himmelstürmer Verlag, Herbst 2004
„Die Legende vom heiligen Dimitrij“, Roman, Himmelstürmer Verlag, Frühjahr 2005
„Dunkle Flüsse“, Roman, Himmelstürmer Verlag, Herbst 2005
Kurzgeschichten in GAY UNIVERSUM 1 und 2, Himmelstürmer Verlag
Dazwischen gab und gibt es mehrere Veröffentlichungen von Kurzgeschichten in diversen Anthologien, Literaturzeitschriften und Auswahlbänden
Himmelstürmer Verlag, Kirchenweg 12, 20099 Hamburg
E-mail: [email protected]
Photo by: Anja Müller, Berlin
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer, AGD, Hamburg
www.olafwelling.de
Originalausgabe, Februar 2006
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
ISBN Print 978-3-934825-50-8
ISBN E-pub: 978-3-86361-199-6
Peter Nathschläger
Es gibt keine UFOs
über Montana
Schlagzeilen
(Helena Independent Record: 03. September 1985)
„Prostituiert sich unsere Jugend auf Helenas Bahnhof?“
(Helena Independent Record: 26. Mai 2004)
„Großer Lichtball am Nachthimmel von Montana:
Feuerball-Boliden sind einfach die großen Brüder der normalen Sternschnuppe“
(Helena Independent Record: 11. Juni 2004,Fußnote)
„Kehrt der berühmte Autor Robert Walden nach Helena zurück?“
(Helena Independent Record: 30. Juli 2004)
"Haben wir hier in Montana ein zweites Roswell?"
(Helena Independent Record: 05. August 2004)
„Lichtpfeile in Montanas Nachthimmel“
(Montana Review: 07. August 2004)
„Werden sie landen?“
(Inside View: 10. August 2004)
1. Heimkehr, Vorbereitungen
Am Samstag, dem 22. Mai rollte der Schriftsteller Robert Walden nahezu unbemerkt und unbeobachtet im Norden von Helena in Montana unterhalb des Naturparks des Canyon Ferry Lake in seinem alten Ford Cabrio über die kurvenreiche Bundesstraße US12. Ein paar Kids, die auf dem Kiesparkplatz vor dem Canyon Ferry Lake Haupteingang bei Broadwater auf den Bus warteten, mit dem sie zurück nach Helena fahren wollten, sahen den dunkelblauen Ford und spöttelten, weil der Mann den Wagen so langsam fuhr.
Der Tag war hell, klar und groß, der Himmel hatte die Farbe von ausgewaschenen Jeans und es war warm genug, den Wagen offen zu fahren. Man brauchte zwar noch eine Jeansjacke, aber das war schon okay so.
Robert Walden fuhr so langsam, weil er versuchte, sich an den Frieden zu erinnern, den ihm die Landschaft in seiner Kindheit und Jugend vermittelt hatte. Seine Eltern waren vor drei Wochen bei einem Flugzeugabsturz in den Bergen von Vermont ums Leben gekommen. Das Kleinflugzeug eines Freundes von ihnen war – warum auch immer – außer Kontrolle geraten und in einer Schlucht zerschellt. Die Untersuchungen zum Unglückshergang liefen noch, aber Augenzeugen nach waren die drei Leute nicht ganz nüchtern, als sie in das Flugzeug stiegen.
Das Verhältnis zwischen Robert Walden und seinen Eltern war nach seiner fluchtartigen Abreise aus Helena vor neunzehn Jahrenmehr als unterkühlt gewesen; selbst sein Erfolg als Autor konnte danichts mehr retten. Okay, ja, sie hatten es versucht. Nachdem er sechs Wochen mit seinem ersten veröffentlichten Roman die Bestsellerlisten angeführt hatte, hatten sie sich bei ihm gemeldet und halbherzig versucht, den Kontakt wieder aufleben zu lassen. Mehr als ein:Komm doch mal wieder zu unswar nicht zustande gekommen. Robert war nicht darauf eingegangen – die Wunden saßen zu tief. Er mutmaßte, dass sie sich mit ihm herausputzen wollten. Dass der missratene Sohn, oder sagen wir mal der Sohn, den alle für missraten hielten, dann doch etwas zuwege gebracht hatte. Sie hatten nach jedem weiteren Buch, das in die Bestsellerlisten der verschiedenen großen Zeitungen kam, versucht, in Kontakt mit ihm zu treten. Und als er für seinen Gedichtband: „Diving to the clubs“ den National Book Award bekam, hatten die Verrenkungen, sich doch auszusöhnen, schon etwas Flehentliches. Robert hasste sie dafür, ebenso wie alle anderen, die nur den Schriftsteller um sich haben wollten, nicht den Mann. Es ist zu leicht, dachte er immer, Erfolg zu mögen. Erfolg ist die größte Nutte alle Zeiten, war Robert Waldens unumstößliche Meinung
Und dies war auch der Grund, warum ihn der Tod seiner Eltern nicht all zu sehr erschütterte. Ihnen war nicht die Liebe ihres Sohnes wichtig gewesen sondern das, was er geworden war. Sie interessierte nicht, was ihr Sohn von ihnen hielt, sondern die Kirchengemeinde, die Nachbarn, der Pfarrer, die Damen und Herren der Gesellschaft, in der sie sich so gerne und selbstbewusst bewegten. Sie hatten sich ausgerechnet, mutmaßte er, dass sie ihren befleckten Ruf durch seine Bücher und seine Erfolge wieder reinwaschenkonnten. Dabei waren sie selbst es gewesen, die ihn aus dem Haus geworfen und sogar in einer Talkshow ihr Leid geklagt hatten, sobestraft zu sein, mit so einem Sohn: „Wir wissen doch nicht, was wir falsch gemacht haben … er ist uns einfach … es ist schrecklich darüber zu sprechen. Er ist uns einfach entglitten.Verstehen sie?“
Damals, als er gerade achtzehn Jahre alt war.
Er war nach Helena gekommen, um sich um die Hinterlassenschaft zu kümmern. Er war ihr einziges Kind, und sie waren nicht wirklich wohlhabend gewesen. Das Vermögen, das es gab, war alt und steckte im Grundstück und im Haus. Aber das interessierte ihn nicht sonderlich. Er wollte mit der Erledigung der Hinterlassenschaftsangelegenheit einen Schlussstrich ziehen. Wohlhabend war er durch seine Bücher geworden - den Ertrag aus der Erbschaft würde er vermutlich in irgendwelche Sozialhilfefonds investieren, in Stiftungen für junge Autoren, irgendetwas in der Art. Es würde, davon war er fest überzeugt, keinen Erbschaftsstreit, keine Komplikationen geben. Mit wem denn auch? Er würde das große Herrschaftshaus seiner Eltern erben, dass seit Generationen weitergegeben wurde. Daneben gab es nicht viel, was sie hinterlassen konnten, außer diesen nach außen hin zuerst makellosen - und erst durch ihn angekratzten Ruf.
Er hatte vor, einen Tischler und einen Installateur mit den Renovierungsarbeiten zu beauftragen und dann einem Makler den Verkauf anzuvertrauen und nach ein paar Urlaubstagen zurück nach New York zu fahren, um sich wieder seinem angestammten Leben zu widmen. Zumindest war das der Plan. Wie viele Tage es sein würden,die er hier verbringen wollte, richtete sich in erster Linie nach der Wetterlage. Und wenn es so blieb wie jetzt, würden wohl ein oder zwei Wochen daraus werden. Er hatte seinen Laptop mit und dieHoffnung, hier in dieser Abgeschiedenheit, weit weg von der all zu erwartungsvollen New Yorker Literaturszene, sein Buch fertigstellen zu können. Momentan blockte und bockte es an allen Ecken und Enden, und er befürchtete, nur ein gewagter chirurgischer Eingriff, bei dem er an die achtzig Seiten rausschnitt - wie ein Arzt ein Krebsgeschwür herausschneidet - könnte es retten.
Die zweite Sache, die seine Freude dämpfte, hier in dieser wundervollen Landschaft zwischen Bergen, Wäldern, Seen und unter diesem gigantischen Himmel zu fahren, waren die Erinnerungen an seine Flucht vor neunzehn Jahren. Gerüchte über einen achtzehnjährigen, stillen Burschen, Gerüchte von unermesslicher Gehässigkeit und bodenloser Gemeinheit. Diese Gerüchte und seine völlige Ahnungslosigkeit, wie und warum sie zustande gekommen waren und wer sie ins Rollen gebracht hatte, hatten ihn zu einem menschenscheuen Mann gemacht, der nur schwer und ungern neue Bekanntschaft schloss.
Robert Walden war mit Sicherheit kein kaltherziger Mann. Aber seine Seele war vernarbt und seine Fähigkeit zu mögen, ja zu lieben, war verschreckt wie ein scheues Waldtier. Seine Eltern hatten ihn fallen gelassen, als er ihren Schutz und ihr Patronat am nötigsten gebraucht hätte, und die nahezu inzestuöse Betulichkeit der Kleinstadt schloss ihn aus, wie man jemanden nur ausschließen konnte, der voll und ganz in Ungnade gefallen war. Dass seine Eltern testamentarisch sogar verfügt hatten, dass ihr Sohn Robert nicht zum Begräbnis kommen sollte, förderte nicht gerade eine von Herzlichkeit geprägte Willkommensstimmung.
Sein Ausschluss aus der Gesellschaft von Helena war wasserdicht und schlüssig.
Sogar die Regionalzeitung hatte mitgespielt und die eine große Frage gestellt, die sein Leben in Helena zerstörte. Sie erwähnte nicht seinen Namen. Aber alle wussten, worum es ging. Das Foto erlaubte viele Interpretationen. Der Text dazu suggerierte allerdings die übelste Version.
Wenn sie ihn damals, Anfang September 1985, mit Spießruten aus der Stadt gejagt hätten, wäre das nicht schlimmer gewesen als der Blick seiner Eltern, als er mit seinen zwei Koffern zu Fuß zum Bahnhof ging, weil ihn niemand hinbringen wollte, die Schulkameraden, die auf dem Bahnsteig warteten und ihn mit Obszönitäten überfielen, mit Gesten und heiseren, von fröhlicher Gehässigkeit bebenden Stimmen, die sich im Stimmbruch überschlugen, wie sie vor ihm ausspuckten. Der Spott über seine Tränen. Ein schlaksiger Achtzehnjähriger, der in den Zug stieg, nicht, um irgendwohin zu fahren, sondern einfach nur, um weg zu kommen.
Aber was soll’s, dachte er jetzt bitter. Ich brauche sie alle nicht. Und sie brauchen mich nicht.
Er lenkte den Wagen an den Straßengraben und stieg aus. Er griff ins Handschuhfach, holte die Zigarettenschachtel heraus und zündete sich eine an. Er blies den Rauch aus und war wütend. Rechter Hand zogen sich die Vorläufer der South Hills sanft in tiefgrünenWellen dahin, und in der Ferne, unten im Tal, konnte er schon die zwei Kirchtürme von St. Helena sehen. Er war wütend, weil nur ein einziges Gerücht, das auf einer Lüge aufgebaut war, diesen wundervollen Anblick von Frieden und Geborgenheit zerstörte und allem die körnige Konsistenz altersbedingter Zerbrechlichkeit undlauernder Boshaftigkeit verlieh. Er war verbittert, weil er sich um die Sicherheit gebracht fühlte, die die Stadt Helena durch ihre Lage, ihr Aussehen und ihre Bürgerlichkeit suggerierte. Weil seine Jugend hier mit einem grässlichen, polyphonen Hassgesang beendet wurde.
Da stand er: Robert Walden, siebenunddreißig Jahre alt. Ein großer, stoppelhaariger Mann mit sanften Augen, hartem Mund und tiefbrauner Haut. Ein Mann in Jeans und Flanellhemd unter der Jeansjacke. Und staubigen Dockers an den Füßen. Rechts vom Straßengraben gurgelte und strudelte ein kleiner Bach mit kristallklarem Wasser.
Robert kletterte vorsichtig den Hang hinunter und wusch sich das Gesicht im eiskalten Wasser. Der gelbe Municipale rollte in Richtung Canyon Ferry Lake auf der Straße vorbei, als Robert die Böschung hochkam. Er dachte an die Jungs, die in diesen Bus steigen würden, um zu ihren Eltern heimzufahren, nach Hause zu kommen, um Abend zu essen und ihren Fang zu präsentieren. Er freute sich mit ihnen. Und es freute ihn weiterzufahren. Nach Helena zu fahren. Trotz allem. Zurück in die Stadt, in der er geboren worden war. Er wusste, dass er sich jetzt freuen konnte, zumindest ein Gefühl anzapfen konnte, das dem der Freude nahe kam. Neunzehn Jahre waren vergangen, und bis auf die letzten zwei Tage, bevor er Helenabei Nacht und Nebel verließ, war er hier glücklich gewesen: als Kind, als Junge, als Jugendlicher. Ein Rad fahrender Derwisch, ein Dichter, ein gottbegnadeter Kiffer, lässig, heiser und schon immer schwul. Akademisch gesehen wusste er von seiner Homosexualität schon, bevor ihm sein Körper sagte, dass es so war. Er wusste es, wenn er im Glacier National Park am Seeufer auf einem Holzsteg saß, kiffte undseine Gedichte schrieb. Und wenn er bei den Begriffen Schönheit, Eleganz und Anmut an die Fußball spielenden Jungs dachte. Als aus der stillen Bewunderung des Dreizehnjährigen ein ziehendes Begehren wurde, war es nur noch ein kleiner, lässiger Schritt zur Erkenntnis. Ihm tat es nicht weh, aber er hielt sich bedeckt. Das schien auch zu funktionieren. Zumindest eine Zeit lange …
Der Tag war heiß. Das Haus lag in den Schatten der alten Eichen am Ende der South Beattie Straße im Süden Helenas. Die Zufahrt bildete das Ende einer etwa vierhundert Meter langen Sackgasse, die von alten, hohen Laubbäumen gesäumt wurde, hinter denen sich gepflegte Gärten und altherrschaftliche Villen verschanzten. Das Licht des Tages flirrte durch die Blüten der Bäume, manche schon grün, die meisten aber noch im Farbenrausch. Das Viertel um die Rhode Island Straße stammte aus der Zeit des großen Goldfiebers, hier ums Eck war auch das Governors Home, uralte Häuser von denen, die zur Zeit des Goldrausches reich geworden waren. Hinter der Siedlung stiegen die grünen South Hills sanft an. Der Anblick war majestätisch, beeindruckend und wunderschön.
Als er seinen Wagen links vor dem schmiedeeisernen, rostigen Tor abstellte und ausstieg, schien es ihm, als würden hunderte Vorhänge zur Seite geschoben. Und er glaubte fast, in dem silbrigen Rauschen der Blätter das Getuschel der Nachbarn zu hören: „Ist das nicht… Er ist da? Er wagt es, hierher zu kommen? Ist das nicht? Wie kann er es wagen …“
Das Haus stand fast hundert Meter von der Einfahrt entferntam Ende einer geharkten Kieszufahrt. Es war aus rotbraunen Ziegeln, wirkte aber ungepflegt. Der Garten war verwildert, doch das störte Robert nicht sonderlich. Ihm gefiel diese wild-romantische Verkommenheit. Er nahm den Schlüsselbund aus dem Handschuhfach, den ihm der Anwalt seiner Eltern vorige Woche mit ein paar sehr unpersönlichen Zeilen per Post geschickt hatte, stieß das quietschende Tor auf und betrat zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren das Haus seiner Jugend.
Robert stand fast zehn Minuten auf dem Eichenparkett im großen Vorraum und atmete Vergangenheit ein. Links befanden sich die große Küche und das Speisezimmer, rechts das Wohnzimmer und der Salon. Die Treppe in den oberen Stock schwang sich im großen Vorraum von der linken Seite in einem weiten Bogen nach oben, wo sich zwei Schlafzimmer, ein weiterer Salon, das Bad und die Toilette befanden. Unten wie oben gab es eine große Holzveranda mit übergroßen Topfpflanzen, die jetzt allesamt als vertrocknetes Gestrüpp Verlassenheit signalisierten.
Robert wartete auf ein Gefühl. Erhoffteauf ein Gefühl.Willkommen zu sein, zum Beispiel. Oder einfach,nichtWillkommen zu sein. Er wartete auf Erinnerungen, auf etwas, das man so gerne in rührseligen Werbungen verarbeitete, auf etwas, das er in seinen Bestsellern verbriet: das Gefühl von Heimkehr, von der Gnade familiärer Liebe. Er wartete auf ein Zeichen, und das Haus wartete mit ihm.
Sie hatten sich nichts zu sagen.
Das merkwürdige Frühjahrslicht dieser Region tröpfelte inPastelltönen durch die großen Fenster, aber auch das berührte ihn nicht. Robert ging zum Telefon, hob ab und hielt den Hörer ans Ohr. Es funktionierte. Während er das tat und wie erstarrt dem lang gezogenen Tuten der Freileitung zuhörte, fiel ihm ein, dass er die Sachen seiner Eltern zusammenräumen musste. In Kisten packen und der Wohlfahrt übergeben. Das wollte er – zumindest was die Kleidung und den Schmuck betraf – noch heute erledigen. All das bedeutete ihm nichts. Er wollte nichts davon behalten. Und er hatte niemanden, dem er etwas davon schenken wollte.
Mit dem Gerücht, das ihn vor so langer Zeit aus Helena getrieben hatte, waren auch die empfindlichen Wurzeln aufkeimender Freundschaft ausgerissen worden. Er hatte hier niemanden. Und um ehrlich zu sein: Er hatte auch in New York niemanden, abgesehen von den Stricher, die er sich von Zeit zu Zeit kommen ließ. Es war ihm eine Wonne, sich von ihnen aufreizen zu lassen, und es war eine Freude, ihnen beim Strippen zuzusehen. Aber es war keiner dabei, der sein Herz berührt hätte. Es gab eine lose Freundschaft mit zwei Lektoren und einem Schriftsteller, mit dem er sich einmal in der Woche auf ein paar Bier traf. Aber das war auch schon alles an Privatleben. Alles, was in ihm an Leidenschaft vorhanden war, weinte und lachte er in die geduldige Tastatur seines Computers. All sein Leben floss aus seinen Fingern.
Robert Walden war davon überzeugt, dass seine Bücher genau deshalb Bestseller waren. Weil er stellvertretend für alle seine Leser das kaputte Leben führte, das keiner wollte. Weil sein Leben kaputt war, und weil doch noch irgendwo in ihm, ganz tief vergraben, ein Schimmer Hoffnung flimmerte. Hoffnung worauf? Das wusste ernicht. Noch nicht, aber es war da. Das wusste er, als er zum Wagen zurückging, um die Flasche Wodka zu holen, die er in einer Kühltasche im Kofferraum hatte.
Später saß er im staubigen Dämmer des Salons im oberen Stock, hatte die Verandatür offen, um Luft rein zu lassen, und starrte vor sich hin. Er wartete noch immer auf ein Zeichen des Hauses, dass er willkommen war. Oder dass er verschwinden sollte. Nichts stellte sich ein: kein Gefühl, keine Verbindlichkeit. Als die Nacht aus dem Himmel fiel, war er betrunken und kuschelte sich auf der Couch zurecht, streckte sich aus und schlief ein.
Er träumte. Er träumte verschwitzt und wirr. Robert Walden wälzte sich auf der Couch herum, träumte in Versen und Bildern, und er träumte von einem fünfzehnjährigen Fußballer, der in Zeitlupe über das Spielfeld lief, nachdem er ein Tor geschossen hatte. Seine schwarzen Haare tanzten in Zeitlupe, während er lief, seine Sporthose führte ein erotisches Eigenleben, ohne den Eindruck lächerlicherÜberzeichnung zu wecken. Er kannte den Jungen, von dem er da träumte. Er kannte die haselnussfarbenen großen Augen, dieses unamerikanisch schöne Gesicht und das spöttische Lächeln, das jedoch nie wirklich gemein war. Und da! Der Bursche stieß beide Hände in den Himmel, ballte die Fäuste und schrie lautlos. „YEHAA!“ Andere Spieler liefen zu ihm, sprangen ihn an und umarmten ihn. Aber der Torschütze sah über ihre Köpfe hinweg, suchte die Zuschauertribüne ab und fand Roberts Blick. Er hielt ihn fest, als sie ihn hochhoben und auf den Schultern davontrugen. Der junge Fußballer sah über die Schulter zurück und schrie: „ELVISHAT DAS GEBÄUDE VERLASSEN!“, dann zerfiel der Traum zu Splittern aus Kopfschmerzen und fasrigem Morgenlicht.
Robert sah auf die Uhr: 07:00 Uhr. Er war sein eigener bester Wecker. Er fühlte sich desorientiert und fehl am Platz, der Morgenwind bauschte die Gardinen und war kühl. Er starrte die leere Wodkaflasche mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination an: War ich das etwa?Oh ja, Amigo mio, das warst du. Und nur du allein: Robert Wodkakiller Walden.
Aber Robert Walden, Poet und Romancier, war geeicht. Und vorbereitet. Er schleppte sich in die Küche, trank innerhalb einer halben Stunde zwei Liter Wasser und schluckte zwei Aspirin, die er vorsorglich in der Hemdtasche bei sich hatte. Normalerweise nahm er schon während des Gelages oder vor dem zu Bett gehen ein oder zwei Schmerztabletten, diesmal hatte er es in der ungewohnten Umgebung und seltsamen Stimmung, in der er zu trinken begonnen hatte, bedauerlicherweise vergessen.
Abgesehen von diesem Traum, der zwischen erotischer Fantasie und einer nagenden Sehnsucht nach Freundschaft zu eben diesem Jungen hin und her geschwankt war, spürte er noch etwas. Er fühlte sich noch nicht zuhause. Dazu waren die Geister der Menschen, die ihn von hier vertrieben hatten, noch zu lebendig. Aber er spürte eine Option, hier zumindest vorübergehend Frieden finden zu können.
Um etwa halb zehn Uhr war er geduscht, frottiert und fühlte sich soweit in der Lage, das zu tun, weshalb er hier war. Er suchte im unteren Salon das Telefonbuch von Helena, holte das Mobiltelefon aus dem Auto und blieb kurz beim Wagen stehen, um denFrühlingsvormittag einzuatmen. Es roch nach Blüten und gediegener Stille. Weiter weg hörte er das „wusch wisch wusch wisch“ eines Rasensprengers. Die Kopfschmerzen spreizten die Schwingen und verschwanden, wie sich dunkle Farbe in einem Glas klaren Wassers auflöst. Robert grübelte: Was zuerst? Tischler, Anwalt oder Immobilienbüro? Pulver gegen Sodbrennen?
Er ging, mit dem Handy bewaffnet und noch immer unentschlossen, zurück in den Salon, drehte den Fernseher an und suchte sich einen Regionalsender. Örtliche Nachrichten von dort, wo er nicht lebte, hatten eine beruhigende Wirkung auf ihn. Er fand den Helena Nachrichtensender, drehte den Ton lauter und durchwanderte das Haus auf der Suche nach Gefühlen und Erinnerungen. Gestern hatte er keine Zeit und keine Lust dazu, heute wollte er pilgern und nach Fragmenten seiner Kindheit und Jugend suchen. Er durchstöberte die Küche nach Lebensmitteln und nahm sich vor, später in den Keller zu gehen und nach Schachteln zu suchen, um alles, was er abtransportieren lassen wollte, wegpacken zu können.
Die Emotionslosigkeit, mit der er den Zustand des Hauses analysierte, frustrierte ihn zunehmend.
Später, als er Schachteln gefunden und bereits einen Großteil der Kleidungsstücke seiner Eltern verpackt hatte und sich gerade über den Schmuck hermachte, hörte er einen Namen aus dem plärrenden Fernseher, der ihm bekannt vorkam: Helena Baldrich Schneider. Robert unterbrach die Arbeit und lief in den Salon. Er setzte sich auf die Lehne der Couch und starrte auf den Fernseher. Eine zierliche Frau wurde gerade interviewt. Neben ihr stand ein hübscher, schwarzhaariger Bursche mit fesselnden Augen. Die Frau hatterotgeweinte Augen, und Robert erkannte sofort, dass hier nicht aus Kummer geweint worden war, sondern vor Freude. Und ja! Er kannte die Frau. Er war mit ihr zur Schule gegangen. Helena! Meine Güte, Helena, dachte er. Was ist dir passiert? Hast du geheiratet? Wer ist der schwarze Engel an deiner Seite? In zwanzig Jahren kann er sich bei mir melden, dachte Robert schmunzelnd. Er erfuhr, dass der Junge neben Helena Schneider ihr Sohn David war. David war 1993 entführt worden und Anfang Mai dieses Jahres nach einer Odyssee quer durch die Vereinigten Staaten nach Hause zurückgekehrt.1Der Interviewer, ein irgendwie konturenloser, qualliger und, wie Robert fand, höchst unsympathischer Mann, versuchte, Schmutzwäsche zu waschen und Helena mit bestimmten Fragen zu drangsalieren. Etwaswar mit dem Jungen geschehen. Etwas … Schmutziges. Missbrauch? Als das Wort Prostitution fiel, wurde Robert hellhörig und spürte einen schmerzhaften Stich in seiner Seele. Aber Helena ließ sich nicht die Würmer aus der Nase ziehen, und der Reporter schien darüber ungehalten. Der Junge wandte sich während des Interviews einfach ab und ging zu einem etwa gleichaltrigen, blonden Burschen. Die beiden redeten kurz miteinander und verschwanden im Haus, das von zwei blütenübersäten Bäumen verdeckt wurde.
Robert grinste: Gut gemacht, Jungs. Helenas Antworten auf die Fragen wurden zunehmend einsilbiger, bis der Reporter das Handtuch warf und ans Studio zurückgab. Helena. Meine Güte. Hast du Cove geheiratet? Aberjahast du das.
Ihm fiel ein, dass im August immer wieder von der bevorstehenden Hochzeit von Helena und Cove die Rede gewesenwar. Ja, Helena war schwanger, damals, 1985. Helena Baldrich hatte Cove Schneider geheiratet. Helena, das wusste Robert noch, hatte in einer Immobilienkanzlei gearbeitet. Er drehte den Fernseher ab, nahm das Telefonbuch und suchte die Nummer der Familie Schneider. Zwei Minuten später hatte er sie und wählte.
Es läutete lange, bis jemand abhob. Es war eine Jungenstimme, die sich meldete: „Schneider“
„Hallo“, sagte Robert.
„Auch Hallo.“ Robert hörte das unterdrückte Grinsen in der Stimme.
„Mein Name ist Robert Walden, ich würde bitte gerne mit Helena sprechen. Ach, Junge … bist du der Dunkelhaarige, der eben im Fernsehen war? Neben Helena?“
„Ja. Wieso?“
„Nun, ich bin gerade erst angekommen, und ich weiß nicht, was dir passiert ist, wasmitdir passiert ist. Aber es ist schön, dass du wieder da bist.“
„Finden Sie? Wieso?“
„Komische Frage, Junge … Du heißt David, ja? Ich sag dir, warum: weil ich deine Mutter aus unserer Schulzeit kenne und weil ich sie mag. Und weil ich alles gut finde, das sie glücklich macht. Und sieistglücklich, nicht wahr?“
Darauf war es still in der Leitung. Er hörte den Jungen atmen. Er hörte, dass er ein Schluchzen unterdrückte. Dann antwortete er sehr heiser und sehr gepresst: „Ja, Sir. Sie ist glücklich. Wie mein Vater. Und wie mein Bruder. Ma!? Da ist ein Mister Walden für dich. EinRobertWalden!“
Robert hörte Helena im Hintergrund aufkreischen: „Robert?DerRobert Walden? Heilige Scheiße, David, gib mir das Telefon!“ Robert hörte, wie das Telefon weitergegeben wurde.
„Robert? Bist du das wirklich? Du Fahnenflüchtiger? Du Deserteur! Robert, ich freu mich so,wuuuaaahhh… Dieser Mai geht in die Geschichte ein. Das ist der Frühling der Heimkehrer, meine Güte, du solltest mich sehen, ich heule schon wieder und strample wie irre mit den Füßen … Walter, schau mich nicht so an. Hol mir lieber ein Bier … bitte!“
Robert lächelte. Das war Helena. Das war das chaotische, lebensfrohe Mädchen aus seiner High School Zeit. Robert lächelte nicht nur mit dem Mund, er lächelte von Herzen. Und das machte sich in seinem ansonsten kühlen und harten Gesicht sehr schön. Die erste Person, mit der er nach seiner Rückkehr Kontakt aufnahm, war wirklich hocherfreut. Er glaubte nicht an Zeichen und Wunder. Aber er hielt sich die Option offen, daran zu glauben, wenn ihm danach der Sinn stand.
Das Lächeln fühlte sich auf seinem Gesicht fremd an. Aber Robert vermutete, dass er sich daran gewöhnen könnte. Immerhin, als Teenager hatte er ein umwerfendes Lächeln. Bis zum September 1985. Da wurde es ihm von der ehrenwerten Gesellschaft der Stadt Helena aus dem Gesicht geätzt. Von der größten Hure aller Zeiten.
Sie unterhielten sich noch etwa fünf Minuten und vereinbarten ein Treffen. Robert schnitt das Thema des möglichen Verkaufs des Hauses nur kurz an, und Helena schien sehr interessiert, auch wenn sie meinte, er solle das Haus behalten und verdammt noch mal hier bleiben. Ein Freund unter all den Schwätzern, die sich DavidsHeimkehr zunutze machten, um sich zu profilieren,verdammt. Robert. Bleib!
Damit beendeten sie ihr Gespräch und versprachen sich, in Kontakt zu bleiben, jetzt, da er wieder hier in Helena war.
Und Robert zog wirklich kurz in Erwägung, hier zu bleiben. Sich als Autor hierher zurückzuziehen und dem Moloch New York die Arschkarte zu verpassen.
Und genau in diesem Moment hörte er ein metallisches, heißes Fauchen. Es wurde lauter und dann ohrenbetäubend. Das Licht von draußen schien heller und weißer zu werden, das Fauchen orgelte über den Himmel und zog einen Peitschenknall nach sich, der über den Himmel rollte. Als der Ton verebbte, blieb nur atemlose Stille und ein niederfrequentes Brummen, das auf den Fußsohlen kitzelte. In dieser Vibration schien die ganze Welt hochgradig nervös auf den Zehenballen zu tänzeln, bereit, irgendwohin zu laufen. Alles war durchsetzt von bitterer Erregung und namenloser Angst.
„Heiliger Jesus“, flüsterte Robert. „Was zum Teufel war das?“
Er ging steif und tapsig zur oberen Veranda und sah auf den Park hinaus und weiter bis zur Straße. Leute kamen aus den Gärten auf die Straße, langsam und ziemlich verängstigt. Dann sah er in den Himmel. Er riss die Augen auf. Eine graublaue, gedrillte Rauchspur war in den knallblauen Himmel gemalt. Es roch nach heißem Metall. Und geschmolzenem Plastik. Die Rauchspur drehte sich langsam um die eigene Achse.
Er flüsterte tonlos: „Heiliger Jesus auf einem Pony.“
Am nächsten Tag war in den Nachrichten von einer Sternschnuppe die Rede, von einem kleinen Splitter, der in derAtmosphäre verglüht war. Ein kleiner, schneller Ausreißer, sozusagen.
Am Nachmittag hatte Robert alles in Kartons verpackt, was seiner Meinung nach weg gehörte. Dazu gehörten für ihn auch der Schmuck, Accessoires und all der Firlefanz, der in Regalen und Bücherbords herumstand. Es waren zwölf Kartons voll. Als nächstes suchte er sich eine Tischlerei aus dem Branchenbuch von Helena und vereinbarte ein Treffen mit dem Tischlermeister für den nächsten Nachmittag, also dem vierundzwanzigsten Mai. Bei diesem Treffen wollte er erörtern, was an der Fassade, an den Fensterrahmen und im Haus zu tun war. Später durchwanderte er noch einmal das Haus, öffnete alle Türen und Schränke und stellte zufrieden fest, dass alle persönlichen Habseligkeiten weggeräumt waren. Abschließend stieg er auf den Dachboden hinauf. Das staubige Halbdunkel war leer bis auf eine Holzkiste, die in der Mitte des größten Dachbereiches stand. Neugierig geworden schlenderte Robert zu der Truhe. Es gab kein Vorhängeschloss oder eine ähnliche Sperrvorrichtung. Es gab nur den rostigen Riegel, den er anhob, und damit den schweren Holzdeckel öffnete. Er ließ sich auf die Knie nieder. In der Kiste waren Hefte und lose Seiten. Er kannte die Hefte und die Collegeblöcke, die mit Jahreszahlen versehen waren. Das älteste Heft war von 1983. Er spürte einen Kloß im Hals, nahm eines behutsam aus der Truhe, blies den Staub vom Umschlag und schlug es auf der ersten Seite auf:
Du bist
Handwerker, Profi:
bist gefährlich.
Dein Augen
sind stahlblaue Bohrer.
Deine Hände: Schraubstöcke,
wenn Du mich nur
fassen könntest.
Dein Schwanz würde
einen Brunnen
in mich schlagen
und mich füllen.
Deine Augen würden mich
aufbohren.
Ich wäre
Diamantenstaub.
Ich wäre das Feld,
das sich vor Dir
ausbreitet, wie sich
Felder im Regen
nun mal ausbreiten.
Ich bin
der Acker,
der von Dir
gepflügt werden will.
Es war holprig, ja. Aber es war aufrichtig. Robert Walden brach in dieser stillen, staubigen Vergangenheit des Dachbodens aus zweierlei Gründen in Tränen aus: Er erinnerte sich, für wen er diese Zeilen geschrieben hatte, als er fünfzehn Jahre alt gewesen war und erinnerte sich, wie herzzerreißend aber auch cool er geliebt hatte; nach außen hin unnahbar und überlegen, nach innen verzweifelt und händeringend. Der andere Grund war, dass er hier in dieser Kiste all die Texte fand, die er von seinem fünfzehnten Lebensjahr bis zu seiner verdammten Flucht geschrieben hatte. Seine Eltern hatten sie aufgehoben, nicht weggeschmissen, nicht verbrannt. Aufgehoben, gesammelt und in einer alten Holztruhe aufbewahrt. Robert nahm die Hefte, Zettel und Blöcke aus der Kiste, legte sie vor sich auf den Boden, klappte den Deckel zu, setzte sich darauf und schluchzte.
Er wischte sich die Augen und Wangen trocken, zog Rotz hoch und spuckte aus. Und in diesem Dämmer, durch die halbgeschlossenen Lider, sah er den Blick, der ihn so gefesselt hatte, der ihm soviel bedeutet hatte.
Schwarze, verwuschelte Haare, ein schiefes Grinsen, diese rehbraunen Augen, das Gesicht zu hübsch für einen All American Star, zu wenig kantig, zu wenig knarrig und auch nicht beliebig genug. Robert fasste sich an die Stirn und fluchte. Er hatte den Namen vergessen. Bei Gott, er hatte den Namen des damals fünfzehnjährigen Fußballstars vergessen, den er bis zum Wahnsinn vergöttert und geliebt hatte. Alles weg. Alles im Saus und Braus der New Yorker Jahre, auf Pisten aus Kokain, Speed und Alkohol davongewedelt. Da waren nur noch das Gesicht, der biegsame Körper und dieser eine Blick, dieser einzige, wahrhaftige Blick bei diesem Match, einemFreundschaftsspiel der Abschlussklasse im Juli 1985. Ein magischer Moment, als der Fußballer, inzwischen achtzehn Jahre alt, nach einem Tor, das er geschossen hatte, die Tribüne absuchte. Zuerst, wie es schien, um in den Blicken der Fans zu baden. Aber dann, als Robert es verstand, ein Funkenflug der Verzweiflung, der Zuneigung und der Frage nach Freundschaft. Zu ihm, dem langhaarigen Dichter, halbgeoutet, von blasser Schönheit, eine respektierte Randfigur. Dieses eine Mal funkte und blitzte es zwischen ihnen, und dieser Sekundenbruchteil warf mehr Fragen auf, als er beantwortete. Der Moment verging und zwei Monate später, im September 1985 ging alles den Bach runter.
2. Alberts Beitrag zur Geschichte
Es war Anfang Juni, und Albert Forrester spazierte mit der anzüglichen Entspanntheit eines siebzehnjährigen Mädchenschwarms, der er tatsächlich auch war, durch die sonnigen Gassen und Straßen Helenas. Albert hatte lange, kastanienfarbene Haare, dunkelbraune Augen und war schlaksig – für ihn schien der Begriff erfunden worden zu sein. Er hatte dreiviertel lange Jeans an, die er sehr locker trug, ein überweites, weißes Tanktop und Fila Grunge, deren Schuhbänder seitlich in die Schuhe geschoben waren. Die Filas warenabgelatscht und die weißen Frotteesocken hinuntergeschoben. Albert war tiefbraun, er lächelte unbestimmt vor sich hin und bog in das Villenviertel im Süden Helenas und ging am Governors Home vorbei. Albert hatte die Hände in die Jeans geschoben. Er zog einen Lungenhering hoch und spuckte ihn in weitem Bogen in eine Hecke.