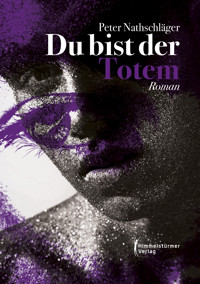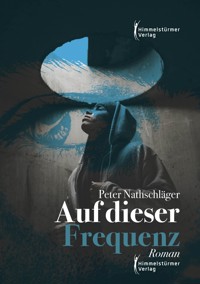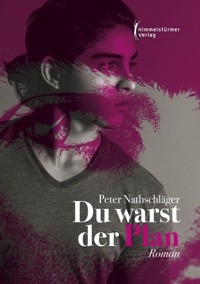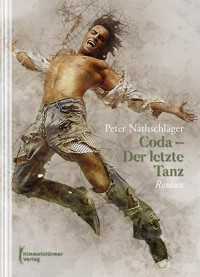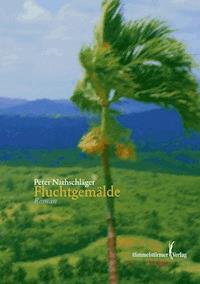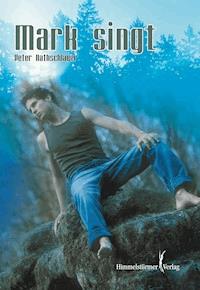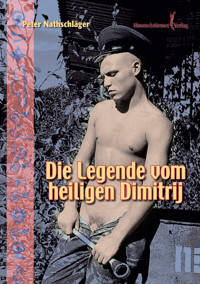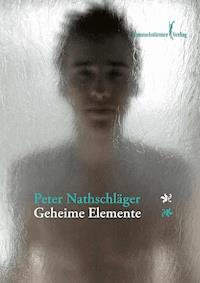
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit einem Jahr trauert der junge Martin um den Tod seines Bruders. Beinahe jeden Tag besucht er den Waldsee, in dem er ertrunken ist, und wirft Steine ins Wasser – seine Art, von ihm Abschied zu nehmen. Darüber hinaus erschwert ihm der ständige Streit mit Hotelierssohn Kai das Leben. Doch eines Tages im Sommer taucht aus dem Wasser ein elfenhafter Junge auf. Der Wassergeist nennt sich Abris; ein Elemental, dessen Aufgabe es ist, Ertrinkende ins Große Blau zu bringen. Doch Abris kann nur in seine „Halbwelt“ zurückkehren, wenn er eine Seele begleitet. So ist Abris an unsere, ihm fremde Welt gebunden, und Martin bietet ihm seine Hilfe an. Abris lernt Angst, Hunger und Schmerz kennen, ist Martin aber zutiefst für seine Hilfe dankbar. Er zeigt ihm, wie man Trauer überwindet, wie aus Feinden Freunde, und aus Freunden Liebende werden können. Denn Kais Sticheleien sollten nur verbergen, dass er eigentlich in Martin verliebt ist. Ein zutiefst bewegender Roman über den Umgang mit dem Tod, Freundschaft, Liebe und Wunder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliographie
„Alles besser“, Gedichte. Männerschwarm, 1999
„Mark singt“, Roman. Himmelstürmer Verlag, Herbst 2004
„Die Legende vom heiligen Dimitrij“, Roman, Himmelstürmer Verlag, Frühjahr 2005
„Dunkle Flüsse“, Roman, Himmelstürmer Verlag, Herbst 2005
„Es gibt keine Ufos über Montana“ Himmelstürmer Verlag, Frühjahr 2006
„Patrick’s Landing“ Himmelstürmer Verlag, Herbst 2006
Kurzgeschichten in GAY UNIVERSUM 1 und 2, Himmelstürmer Verlag
Dazwischen gab und gibt es mehrere Veröffentlichungen von Kurzgeschichten in diversen Anthologien, Literaturzeitschriften und Auswahlbänden
Himmelstürmer Verlag, Kirchenweg 12, 20099 Hamburg
E-mail: [email protected]
www.himmelstuermer.de
Foto:András Jókúti,www.saturninus.eu
Das Modell auf dem Coverfoto steht in keinen Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches und der Inhalt des Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Modells aus.
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer, AGD, Hamburg.
Originalausgabe, Herbst 2008
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage
ISBN print: 978-3-940818-02-7
Peter Nathschläger
Teil 1: Begräbnis mit Steinen
Kapitel 1
Im Zimmer war es die Stille von Nachtfaltern, draußen von Wind, der durch Gräser und Sterne fuhr, Regen mit sich führte und böig gegen das große Fenster warf. Er fand, dass die Gemeinde Königsberg im Regen lag wie eine Tote. Die Gassen und Straßen waren nicht mehr als Reliefs in der Haut einer aufgeblähten Wasserleiche. Perfekt zu seiner Stimmung und dem Bild der Wasserleiche passte die Musik, die er jetzt aus dem MP3 Ordner seines Computers auswählte und über die PC Boxen hörte. VAST:I am dying. Seit Mitte April regnete es fast jeden Tag, und wenn es nicht gerade goss, dann war es zumindest bewölkt; der Nebel ging weiter oben in dichte Wolken über, alles war feucht und klamm; der Himmel stets in Bewegung. Martin sah missmutig zum Fenster hinaus. Hin und wieder warf er einen Seitenblick zum großen Flachbildschirm, den ihm seine Eltern zu seinem siebzehnten Geburtstag gekauft hatten.
Er dachte: Die Gäste hätten Anfang April kommen sollen. Oder die zwei Wochen im Mai. Da hatten wir echt fettes Wetter hier. Knallblauer Himmel den ganzen Tag, Sternenlicht in der Nacht. Aber jetzt? So macht das keinen Sinn, no way.
Die Folge:
Buchungen blieben aus.
Was sie momentan über Wasser hielt, waren die Frühstücksgäste vom Basaltabbau auf der Rückseite des Königsbergs. Eine vertrackte Situation: Einerseits protestierten die kleinen Gemeinden am Königsberg gegen die Vergrößerung des Bergwerks, andererseits waren die Arbeiter der Grube derzeit die einzigen regelmäßigen Gäste.
Den anderen Hoteliers des Luftkurorts ging es nicht anders. Jaja, die Erderwärmung ... Martin lächelte bitter sein verschwommenes Spiegelbild an, warf einen kurzen Seitenblick auf den mit bunten Emoticons gespickten Chat der Partygroup Graz. Hüpfende Smilies, zungezeigende Smilies, wenige Sätze, viele Abkürzungen, LOL.
Dann sah er zu der Regenjacke, die am Kleiderhaken an der Tür auf ihn wartete.Komm, flüsterte sie mit dem Geräusch nassen Herbstlaubs,zieh mich an und geh. Du willst es, und mir macht es nichts aus, ein wenig nass zuwerden. Dafür bin ich ja da.
Eine andere Stimme, viel vertrauter und viel weiter entfernt als das Zischeln der Regenjacke, sagte:
Timmi? Vermisst du mich? Was ist? Du schaust so traurig. Nimm doch endlich die Steine aus deinem Herz.
Martin nahm den anthrazitfarbenen Haarreif aus der Tischlade, und strich die langen schwarzen Haare streng nach hinten. Dann zog er sich die Kapuze seines Sweatshirts über den Kopf und stand auf.
Der Chat lief ungerührt weiter. Martin wusste seit knapp einem Jahr nur zu gut, dass nichts endet, nur weil sich einer abwendet und langsam vergessen wird. Nichts endet. Alles geht weiter, egal, wie sehr es schmerzt. Er schlüpfte in die flüsternde Regenjacke und zog den Zippverschluss zu. Er wusste, dass seine Eltern jetzt ihr Mittagsschläfchen hielten. Dazu hatten sie zwischen 14:00 und 16:00 Uhr Zeit. Besonders dann, wenn die Gäste ausblieben. Und nach Meinung seines Vaters, blieben die Gäste nicht wegen des Wetters aus, sondern wegen diesem hinterhältigen, teutonischen Sauerkrautfresser namens Rüdiger Brenner. Der aus Bayern stammende Touristikfachmann mit seiner schüchternen und ewig nervösen Gattin, und seinem aufgeblasenen Edelprolet von Sohn, Kai. Das waren die Worte von Martins Vater, die ihn ebenso erheitert wie auch bestürzt hatten.
Martin dachte kurz daran, wie er damals, im September vor fast einem Jahr, gespürt hatte, wie er zum Feindbild Kais geriet, weil ihn der wegen seiner überweiten Armeehose angestänkert hatte: „Kann sich hier ein Hotelierssohn nichts besseres leisten, als diese verpissten Raversachen? Meine Fresse, siehst du beschissen aus, Alter!“
Danke, das war’s: „Wirklich nett, du bayrischer Scheißhaufen.“
Rangelei, Schubserei, ein paar Ohrfeigen, Nachsitzen. Offener Hass.
So schnell ist man gefickt, ohne Spaß daran zu haben, dachte Martin.
Er klappte die Tür des Seiteneingangs leise zu. Er wollte seine Eltern nicht wecken. Er wollte, dass sie sich ausruhen konnten, obwohl er Mittagsschläfchen für ziemlich altmodisch hielt. In Wirklichkeit war es so, dass sie nicht sehen sollten, wohin er ging. Denn dann wüssten sieauch bald,warumes ihn dorthin trieb. Und das wollte Martin nicht. Ganz und gar nicht. Raves am Wochenende in Graz oder Maribor in Slowenien waren ganz große Klasse. Aber die Stille, zu der er von Zeit zu Zeit pilgerte, war mindestens eben soviel wert. Wenn nicht vielleicht sogar mehr. Das hatte sein Bruder gesagt: „Da oben ist es manchmal so still, dass du die Gitarre in deinem Herz hören kannst.“
Martin rammte die Fäuste in die Seitentaschen der Regenjacke und ging langsam die enge und steile Kopfsteingasse hinauf zum Kirchenplatz. Er sah an der Kirche vorbei und weiter hoch zum tiefgrünen Wald, der unter dem Regen in dichten Nebelschleiern wallte und atmete.
Unter ihm, aus einem Fenster im zweiten Stock der Hotelpension seiner Eltern, blickte ihm ein Mann nach. Er stützte sich auf das Fensterbrett, drehte sich um und sagte etwas ins Zimmer. Oder zu einer Person hinter sich im Zimmer.
Hinter der Kirche wurde aus der asphaltierten Straße ein breiter Schotterweg, der zwei Weingärten teilte, zurWaldgrenze hinaufführte, und dort verschwand. Martin blieb stehen, bückte sich und schlug die weite Jeans zweimal um, damit sie nicht nass wurde. Er hatte ausgetretene Doc Martens an. Die Schuhe waren alt und bei den Nähten eingerissen. Er würde nasse Füße bekommen, nasse Socken. Und als er sich mit unerwarteter Heftigkeit erinnerte, wer ihm die geschenkt hatte, blieb er einen Moment länger knien als nötig, schloss die Augen und seufzte. Er riss sich zusammen und stieg die steile Schotterstraße rasch hinauf, um im Wald zu verschwinden.
Von der Waldgrenze aus hatte man eine ideale Aussicht auf die kleine Gemeinde: Auf die Kirchturmspitze und den Platz, wo normalerweise Touristen auf Gartenstühlen an Plastiktischen saßen, im Schatten der riesigen Sonnenschirme. Jetzt war dort nur nebelige Trostlosigkeit.
Martin folgte der Forststraße noch etwa siebenhundert Meter in den Wald, dann bog er links ab und ging einen markierten Waldwanderweg entlang, der schon lange nicht mehr gelichtet worden war. Die Äste hingen tief, und schliffen mit einem kratzigen, nassen Geräusch über seine Regenjacke, mit einem unangenehmen Ziehen über seine Schenkel.
Wenn man der geschotterten Straße folgte, kam man nach etwa fünf Kilometern zur Nachbargemeinde Tieschen. Folgte man jedoch dem Waldwanderweg, fand man zu einigen felsigen Verwerfungen und dicht bewaldeten Hügeln, die selbst die wagemutigsten Touristen verzweifeln und umkehren ließen. Rutschige Steine, tückische, mit Generationen von Tannen- und Fichtennadeln bedeckte Pfade und die Aussicht, nicht zu wissen, wohin man geht, wenn man weitergeht, all das war effektiver als ein Verbotsschild. Im stetigen Rauschen des Regens war sonst nichts zu hören. Keine Tiere, die durch das Geäst brachen, keine Vogelrufe, nichts. Normalerweise hatte Martin immer seinen iPod dabei; nicht aber, wenn er diesen Pfad einschlug. Deswegen fiel ihm die Stille überhaupt erst auf.
Nach etwa zehn Minuten Fußmarsch lichtete sich der Wald, öffnete sich wie ein Vorhang, der in seiner Bewegung einfach stehen geblieben war, und vor ihm lag ein von Nebel bedeckter Teich. Als Martin zum ersten Mal in seinem Leben den kleinen See gesehen hatte, war er fünf Jahre alt. An der Hand seines Vaters. Der Waldsee hatte die Form eines „L“. Der Pfad führte an der schmalsten Stelle nördlich des Sees vorbei, schwang sich nach einigen hundert Metern nach Westen. Der See war wunderschön anzusehen, und wurde von den wenigen Touristen, die es doch immer wieder bis hierher schafften, gerne fotografiert - der See war einfach zauberhaft. Und er hatte gedacht: Wie in einem Märchen! Und er war auch jetzt noch davon überzeugt, dass alle so dachten, die den See fanden. Wie aus einem Märchen voller Froschkönige und entlaufener Kinder, Elfen, Feen und Einhörnern.
Martin verließ den Pfad und lächelte über das kindliche Erstaunen, das ihn immer wieder erfüllte, wenn er zum Waldsee kam.
Er schlängelte sich knapp am Ufer entlang und folgte einem mit Farnen überwachsenen Pfad, der vom Waldweg aus nicht sichtbar war, bis zu einer mit hohem Gras bewachsenen Lichtung. Direkt am Ufer gab es einen Schotterstrand. Sein Vater hatte ihm einmal erzählt, dass es diesen Schotterstrand hier schon gegeben hatte, als er selbst noch klein gewesen war.
Er bahnte sich einen Weg durch das hüfthohe, gelbliche Gras bis zum Schotter. Dort setzte er sich im Schneidersitz auf einen halbwegs trockenen Stein unter den ausladenden Ästen einer uralten Buche. Er zog die Kapuze vom Kopf und schüttelte sich das Haar ins Gesicht, so dass er gerade noch die Stelle sehen konnte, wo das klare Wasser auf die glatt geschliffenen Kiesel plätscherte. Er nahm einen faustgroßen Stein, schleuderte ihn hinaus aufs Wasser und wartete, bis sich die Wellen verlaufen hatten.
Martin atmete ein paar Mal tief durch, dann flüsterte er: „Hi, Tom.“
Er wartete.
Der See schwieg, aufgeraut von Tropfen, die aus dem Himmel perlten.
„Unsere Eltern sind verzweifelt. Sie wollen sich nichts anmerken lassen, wegen der Schule und so. Aber ich spür’s. Ich glaube, sie haben Angst, dass sie die Hypothek aufs Haus nicht zahlen können, dass sie in Rückstand kommen, und alles verlieren. Paps würde es das Herz brechen. Und Mama erst. Und ich kann ihnen nicht helfen, ich kann gar nichts tun. Weißt du was? Du fehlst mir. Manchmal vergesse ich schon fast wie du ausgesehen hast. Dann vergesse ich auch, wie es war, als du da warst, weil du immer schon da warst, schon vor mir. Wie du mir die Angst vor Schatten und Geistern genommen hast, und dass du mich geliebt hast, wie größere Brüder eben ihre kleineren Brüder lieben. Und jetzt, wo es fast keine Arbeit gibt, weil keine Touristen da sind, ist es besonders schlimm. Ich könnte jetzt wirklich einen großen Bruder brauchen, das weißt du, oder?“
Martin warf wieder einen Stein weit hinaus, schniefte ärgerlich und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht.
Der See ruhte still und der Regen ließ nach. Es wurde heller. Martin hörte Schritte auf dem Schotter und schreckte hoch. Ein Mann stand seitlich hinter ihm.
„Papa!“
„Martin. Irgendwie hab ich es die ganze Zeit über gewusst.“ Er zögerte. Dann: „Darf ich mich zu dir setzen?“
Martin rutschte ein Stückchen zur Seite und sah zu, wie sich sein Vater vorsichtig auf den feuchten Stein setzte. Er sagte leise: „Mama wird einen Anfall kriegen, wenn wir beide mit feuchten Hosen zurückkommen. Und jetzt sag: Was machst du hier?“
Martin zuckte mit den Schultern und flüsterte fast unhörbar: „Nichts. Nachdenken. Und so.“
„Und du wirfst Steine ins Wasser, ja?“
Martin nickte.
„Wie um ihn zu beerdigen? Ein persönlicher Abschied nach der Beerdigung?“
Martin zuckte kraftlos mit den Schultern, weil er nicht einmal mehr hätte antworten können, wenn er gewollt hätte. Er warf einen weiteren Stein ins Wasser. Sein Vater griff nach einem flachen Stein, und ließ ihn über die Oberfläche hüpfen: „Ich war nicht mehr hier seit ...“
„Ich weiß, Paps.“
Martin lehnte sich an die Schulter seines Vaters und flüsterte mit erstickter Stimme: „Ich vermisse ihn so, Papa. Es tut immer noch so weh, es ist so ...“
Rudolf Stolz zog seinen Sohn zu sich, wiegte ihn und strich ihm durchs lange Haar, kämpfte hart um seine Fassung, blinzelte. Und sah hinaus auf den See, in dem vor knapp einem Jahr Martins Bruder ertrunken war.
Viel später, in der frühen Dämmerung, als die Luft dampfte, und nur noch von den Blättern Wasser nieder fiel, standen sie auf, stützten sich gegenseitig und versuchten, tapfer zu lächeln.
Als sie zur Pension zurückkehrten, gingen sie gleich über den Seiteneingang zur Küche, um sich Tee zu kochen. Martin schlug seinem Vater vor, Salamibrote zu machen. Als sie in die Küche kamen, saß dort ihr derzeitiger Gast am großen, massiven Holztisch, und bereitete sich ein Schmalzbrot. Er hieß Max Freimuth und kam aus Bayern, war Münchner. Und Journalist. Soviel man aus dem heraushören konnte, was er so von sich gab, wenn er in Redelaune war, und das war er zu jeder Zeit, schrieb er Reiseberichte für ein großformatiges deutsches Käseblatt, wie er selbst es zu nennen pflegte. Und nun landete er nach Reisen auf die Philippinen und China, quer durch die USA und Europa hier, um über die Sommermonate einer Touristengegend zu schreiben, die nahezu rein auf Sommerfrische ausgerichtet war. Dass man im Winter hier Langlauf machen konnte, wo im Sommer die Nordic Walker unterwegs waren, ließ er - warum auch immer – in seinem ersten Entwurf unerwähnt.
Das schlechte Wetter trug Martins Meinung nach auch nicht dazu bei, dass ihr Gast einen erfreulichen, werbewirksamen Bericht schreiben würde. Wohl eher im Gegenteil.
Als Martin sah, dass Max Freimuth am Tisch saß, wollte er sofort wieder weg. Er dachte über eine Ausrede nach, kaute an der Unterlippe. Sein Vater fragte ihn: „Und? Was ist jetzt mit den Broten? Peperoni dazu? Die kleinen scharfen?“
Martin nickte erleichtert. Sein Vater hatte irgendwie Martins Unbehagen gespürt und ihm einen Ausweg angeboten. Mutter liebte Peperoni. „Ich geh schnell hoch in die Wohnung und frag Mama, ob sie auch ein paar Brote will.“
„Geht klar, zisch ab.“
Obwohl er Max Freimuth nur kurz ansah, spürte er die Blicke des Mannes vorne auf der Hose wie eine Schnecke, die eine feuchte Spur hinterließ. Der langsame Blick war schon so schwer auszuhalten; aber wenn er sich auf ihn konzentrierte und sich wie eine feuchte Hand auf seinen Schoß legte, war das für Martin mehr als er aushalten konnte. Er versuchte, lässig zu wirken, als er aus der Küche stürmte, was auch ansatzweise gelang. Für echte Lässigkeit war er allerdings zu steif im Rücken.
Im Treppenhaus strich er sich die Haare straff nach hinten. Oben angekommen, schloss er die Tür zur Wohnung auf und hoffte, sein Vater könnte Max Freimuth mit ablehnendem Schweigen auf Distanz halten, bis der von selbst die Küche verließ, und sich in sein Zimmer im zweiten Stock zurückzog.
Seine Mutter kam gerade aus dem Bad. Sie lächelte Martin schief an und sagte trocken: „Du hast deine Jeans versaut. Ist dein Vater in der Küche unten?“
Martin nickte und antwortete: „Er macht Salamibrote. Mit Peperoni.“
„Und wieso bist du hier oben und hilfst ihm nicht? Trampelst mit deinen nassen Sachen in der Wohnung herum und ...“
„Der Freimuth ist unten.“
Seine Mutter kaute auf der Unterlippe, genau so, wie es Martin gerade unten in der Küche gemacht hatte. Dann sagte sie: „Ok. Bleib oben. Zieh die Sachen aus und gib sie in die Vierer Maschine, die Trommel ist noch frei. Herrgott, ich versteh’s nicht. Kaum Touristen hier wegen dem Sauwetter, und der Einzige, der sich bei uns einquartiert, will meinem Sohn an die Wäsche. Das ist doch verrückt!“
Martin sah sie mit gespielter Empörung an: „Du glaubst, nur der Freimuth will mir an die Wäsche? Nur der? Die Mädels kommen von der Nordsee und von der Baltik, aus Frankreich und England hierher um mich zu sehen. Glaubst du, die kommen wegen der Landschaft? Die einzige Sehenswürdigkeit hier bin ich, so schaut es aus! Ich bin ein sexyEmo. Mir wollenallean die Wäsche!“
Seine Mutter lachte hell und kicherte: „Spinner.“ Sie wuschelte ihm das Haar. Martin verzog in gespieltem Widerwillen das Gesicht.
„Zieh jetzt die nassen Sachen aus, und schlüpf in was Bequemes. Bis dahin sollte der Freimuth aus der Küche sein. Sollte er dann trotzdem noch da sein, denk daran: Er ist Gast bei uns, egal was du von ihm hältst, verstanden? Und er ist Journalist, Reporter oder so. Also sei nicht frech ...“
„Ich sag eh nichts.“
„Du kannst mit den Augen mindestens ebenso frech sein wie mit dem Mundwerk.“
„Na voll.“
Sie gab ihm einen Klaps auf den Nacken und lief dann die Treppe hinunter zur großen Gemeinschaftsküche, wo ihr Mann an der Arbeitsfläche stand und Brot schnitt.
Später saß Martin an seinem Computer, sah über den Bildschirmrand in die silbrige Dämmerung und kramte nach Worten. Vor sich hatte er auf dem Bildschirm den Arbeitsbereich seines Weblogs, eine Art Tagebuch, das er im Internet führte. Er hatte sich vor einem Jahr (bevor Tommi ertrank, war das. Bevor er für immer ging und sich nichts änderte, war das)bei live.spaces.com angemeldet und das Blog brachliegen lassen. Nach dem Tod seines Bruders hatte er zaghaft begonnen, Einträge zu machen. Texte von Songs, die ihm gefielen, Nachrichten, die ihn aufregten oder beeindruckten, und später, so vor einem halben Jahr, hatte er begonnen, persönliches hineinzuschreiben.
Er stand auf, öffnete das Fenster und griff dann in den flachen Raum zwischen Wand und Heizung, um ein Säckchen mit drei fertig gedrehten Joints herauszuziehen. Er rauchte selten zu Hause, aber heute hatte er Lust dazu. Martin zündete den Joint an, kokelte die Kappe ab und inhalierte. Er blies den Rauch zum Fenster hinaus. Auf dem Schreibtisch lag eine zweisprachige Ausgabe von Gedichten des englischen Dichters Lord Byron. Martin strich mit gedankenloser Zärtlichkeit über den Buchrücken, dann legte er den Joint im Aschenbecher am Fensterbrett ab, setzte sich und schrieb:
Ich dachte, ich könnte es, echt. Aber es hilft nix, sorry. Heute in zwei Wochen ist es ein Jahr her, dass mein Bruder im Waldsee ertrank. Wenn ich zurückdenke, an all die Trauer und so, an Paps und Mama und wie sie weinten am Grab, dann glaub ich, dass meine eigene Trauer nur ego war. Irgendwie voll asozial. Tom war nicht nur mein Bruder, er hatte auch irgendwie den Zweck, mich zu beschützen und zu beraten; er war einfach immer da, hatte immer Geduld, war nie ein Arsch zu mir. Na, ein bisschen schon - großer Bro eben – die schubsen einen immer rum.
Und ich dachte, ich würde weniger traurig sein, wenn ich beginne, ihn zu vergessen.
Ich dachte, ich könnte ihn vergessen, wenn ich – so oft wie nur möglich – zum See raufgehe und ... ich weiß nicht, wann ich zum 1. X auf die Idee kam, Steine ins Wasser zu werfen. Fuck, auf dem Schotterstrand gibt’s Steine zum Schweinefüttern. Und als heute Paps zu mir zum See kam und mich dort sah, wie ich Steine ins Wasser warf, und als er dann selbst Steine über die Oberfläche flippen ließ, da wusste er, was ich da machte. Er hat’s kapiert. Ich meine: Ich hab’s fast ein Jahr lang getan, ohne zu wissen, was ich da tu´ und warum. Er sagte es mir auf den Kopf zu. Und es stimmte: Ich will Tom beerdigen. Ich weiß ned, wie ich das ausdrücken soll: Lord Byron, hättest Du es gewusst, hä?
Wollte ich Tommi Stein für Stein beerdigen? Über all die Monate, als ich im Winter sogar ein Loch ins Eis schlug, um Steine ins Wasser zu werfen? Ja, ich schätze, das wollte ich, das will ich. Ich will Tom irgendwie mit Respekt ... sry, mir ist grad was ins Auge gekommen, ok ... Ich will ihn mit Würde vergessen. Ist das pathetisch? Fick Dich, wenn Du denkst, dass es so ist. Fick Dich. Ich will meinen Bruder im See beerdigen, mit Steinen. Bis ich keine mehr im Herz habe. Das will ich.
Martin stieß sich von der Tastatur weg und rollte auf dem Drehsessel bis zur Zimmermitte. Der sich in Falten legende Knüpfteppich stoppte seine Fahrt, er wischte sich über das Gesicht und zog am Joint. Er sah im Fenster sein Spiegelbild: Ein langhaariger Junge mit müdem Gesicht, schwarzem Kapuzensweater und grünen Boxershorts. Eine schwarze Armyhose lag zusammengerollt wie eine Schlange zwischen Nachtkästchen und Bett.
Martin stand auf, klaubte die Hose vom Boden und legte sie ordentlich zusammen auf den verschlissenen Ohrensessel rechts neben seinem Schreibtisch. Er schnippte die Kippe aus dem Fenster, und zwar so heftig, dass ein Funkenflug in der Gasse niederging. Er zog sich den Kapuzensweater aus, warf ihn über die Lehne des Lesesessels. Er sah einen bleichen und schmalen Oberkörper mit kleinen, aber gut ausgebildeten Bauchmuskeln. Er lächelte seinem Spiegelbild müde zu, ging zum Fenster und schloß es, um es dann zu kippen.
Morgen war wieder Schule. Montag, uah! Während er unter die Decke schlüpfte und sich das Kissen zurechtschüttelte, dachte er kurz daran, dass Schule auch Kai bedeutete. Hier im Ort konnte er ihm aus dem Weg gehen, was, wie er sich eingestand, seine bevorzugte Methode war, Reibereien zu vermeiden. In der Klasse konnte er das kaum. Und Kais Sticheleien wurden immer fieser, aber voll. Martin dachte, es wäre vielleicht an der Zeit, dem überheblichen Scheißkerl eins auf die Fresse zu geben. Er wusste, dass er das nicht tun würde. Er wünschte, er hätte da mehr von Tom. Denn der hätte dem Großmaul eine Abreibung verpasst, und zwar eine, bei der sich der beschissene Kai Schuschu in die Hose gemacht hätte, angepisst bis übers Kreuz! Aber er war Martin, nicht Thomas Stolz. Und Martin träumte nur davon, sich mit Fäusten Respekt verschaffen zu können. Mehr als halbwegs taugliche und rotzfreche Rückzugsgefechte brachte er nicht zustande.
Bitternis begleitete ihn in den Schlaf. Bitternis und Zähneknirschen.
Als es kurz nach Mitternacht wieder zu regnen begann, und Böen den Regen ans Fenster pladdern ließen, schreckte Martin auf. Sein Herz raste, seine Haut war mit einem Schweißfilm überzogen. Er setzte sich auf und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die verschwommene Dunkelheit seines Zimmers.
Was war das? War da etwas?
Nein, im Zimmer war nichts. Er spürte Reste eines Traums davon gleiten; noch fast greifbar und so echt. Es hatte mit Steinen zu tun. Mit dem Wasser des Waldsees und mit den Steinen, die er immer und immer wieder in den See warf. Martin schlug die Decke zur Seite und stand auf. Die Böen wurden heftiger. Er ging mit fast geschlossenen Augen im Zimmer auf und ab, blieb stehen, sah sich um. Kein typisches Jungenzimmer. Keine Poster an den Wänden, keine Wimpel, keine Pokale in diversen Regalen. Stattdessen antike Möbel, Kästen, Bücherregale; die Regale vollgestopft mit zerlesenen Taschenbüchern, die sich im Lauf der Zeit in der Pension angesammelt hatten – Bücher, die von den Gästen liegengelassen worden waren. Die Sammlung zerlesener Bücher erstreckte sich von Perry Rhodan zu John Sinclair, von Doktor Zamorra bis Michael Bulgakow, und die Gebrüder Strugatzki hatten sich auch in dem staubigen Regal eingefunden; von Walt Whitman (englisch) bis Lord Byron (zweisprachig) und ja: Theodor Storm. Den mochte er besonders.
Es war etwas im Wasser gewesen. Aber bitte was? War es, wie die Wellen auseinanderdrifteten? Oder war es das Geräusch, das ein Stein macht, wenn er die Wasseroberfläche durchbricht?
Martin ging zum Fenster, strich sich mit beiden Händen über den Bauch und überlegte, ob er pinkeln musste.
Musste er nicht. Es war das Geräusch. Der letzte Stein, den er ins Wasser geworfen, bevor er die Schritte seines Vaters auf dem Schotter gehört hatte. Es hatte ihn mehr oder weniger unbewusst irritiert, dass es sich dieses eine Mal anders angehört hatte als sonst. Wie war das Geräusch gewesen? Eher so, als ob der Stein in halbtrockenem Schlamm gelandet wäre. KeinPlatsch. Vielmehr einTitsch.Und im äußersten Spiralnebel seiner Erinnerungen, im Dunst des sich auflösenden Traumes die Erinnerung an ein weißes, schnelles Gleiten. Draußen im See.
Martin setzte sich aufs Bett, stützte das Kinn in die Hände und wartete, bis er müde genug war, um sich wieder nieder zu legen. Irgendwann, gegen ein Uhr früh, war es soweit: Schon halb im Schlaf ließ er sich zur Seite kippen, der Autopilot übernahm, und zog die Decke hoch. Er strampelte sich ins Bettzeug, schnaubte noch einmal und schlief ein.
Martin war nicht der Einzige, der in dieser Nacht mit Grimm und Unruhe ins Bett ging. Königsberg in der Steiermark erweckte auf alle, die es zum ersten Mal sahen, den Eindruck einer frisch gesalbten Braut. Es lag sauber, altmodisch und schön, sanft verpackt zwischen hügeligen Weingärten, die sich in den frühen Morgenstunden mit rosigem Nebel bedeckten, schmiegte sich an einen dichten Mischwald, der von Wanderwegen durchzogen war, auf denen man bis ins nahe Slowenien gehen konnte, wenn man sich südöstlich hielt. Im Wald lagen drei Campingplätze, die vor allem von Schulen für Wanderausflüge genutzt wurden. Und die zum Glück auf der anderen Seite des Königsbergs befindliche Wunde des Basaltabbaues - hin und wieder wehte der Wind die Geräusche der Arbeitsmaschinen und pulvrigen Staub herüber.
Und seit etwa drei Jahren gab es Routen für Nordic Walker. Diese Idee hatte Rüdiger Brenner eingebracht, kurz nachdem er den Hof der bankrotten Familie Eisinger gekauft, und mit seiner Gattin - das musste der Neid ihm lassen - auf Vordermann gebracht hatte. Nun gab es eine weitere Pension für acht Familien in Königsberg, die Konkurrenz verdichtete sich auf scheinbar immer kleinerem Terrain, und wegen dem Wetter blieben die Touristen aus.
Die Feindschaften unter den Gewerbetreibenden in Königsberg waren nicht offen. Sie waren verdeckt: kleine Gehässigkeiten bei Gemeinderatssitzungen, Klatsch, Tratsch und Unterstellungen, Halbwahrheiten und unermüdliche Sticheleien. Nur eine Handvoll Leute hielt sich gänzlich aus allen Scharmützeln raus. Einer von diesen Leuten war der achtzigjährige Ernst Kratochwil. Ein humpelndes, hustendes Unikat, dem man seit acht oder neun Jahren den baldigen Tod prophezeite. Jeden Herbst hieß es: „Diesen Winter überlebt der Alte nicht, kann gar nicht sein.“
Und er überlebte, hustete und soff; spuckte nach wie vor auf die Straße. Er trug zu jeder Jahreszeit lange Hosen und langärmelige Hemden. Sein Credo diesbezüglich war: Ich bin keine Sehenswürdigkeit, aus meinen Krampfadern kann man einen Pullover stricken, ich kann ruhig verhüllt sein. Ich habe genug Anstand, um euch nicht die letzten Gäste mit meiner ureigenen Hässlichkeit zu vertreiben. Ich bin vorbildlich, jawohl!
Man sagte ihm nach, dass er sich mit den zwei Litern Wein, die er täglich trank, für die Ewigkeit konservierte. Und nur deshalb noch nicht tot umfiel, weil er einfach viel zu faul dafür war.
In dieser Nacht humpelte er auf seinen Stock gestützt unter Martins Fenster vorbei, gerade auf dem Heimweg von seinem letzten Glas Weißwein. Er trug eine Kappe mit der Aufschrift „Styria“, und einen schwarzen langen Regenmantel. Würden ihn Kinder in dieser Nacht sehen, die ihn nicht kannten, sie würden schreiend davon laufen. Ernst Kratochwil wusste das, und möglicherweise bedauerte er sogar seine Wirkung auf Kinder. Das ist nun mal das Alter, dachte er dann immer wieder, man wird alt und faltig. Und zum Kinderschreck.
Kapitel 2
Der Montag begann erstaunlich warm und klar. Um sechs Uhr früh lag noch Frühnebel in den Talsenken, und im Wald über Königsberg lösten sich die Nebelschwaden gerade in der Morgensonne auf; so, als ob eine unsichtbare Macht transparente Seidentücher in den Wald zurückziehen würde. Martin saß fertig angekleidet in der kleinen Küche der Wohnung im ersten Stock, trank kalte Ovomaltine und aß ein frisches Brötchen mit Butter und Marmelade. Trotz des merkwürdigen Traums, der ihn gegen Mitternacht aus dem Bett getrieben hatte, fühlte er sich ruhig und ausgeglichen, und ausnahmsweise sogar einmal richtig ausgeschlafen. Seine Eltern waren seit halb fünf Uhr auf den Beinen. Martins Vater war nach Bad Radkersburg gefahren, um dort mit einem Milchlieferanten neue Konditionen zu verhandeln, seine Mutter bereitete in der großen Küche im Erdgeschoss alles für das Gästefrühstück vor. Der Bäcker kam in der Regel gegen fünf; ein duftender Schwung Brötchen und ein Lieferant, der über einen unergründlichen Vorrat an Humor und Heiterkeit verfügte.
Als Martin mit seinem Frühstück fertig war, schulterte er seinen mit Stickern übersäten schwarzen Rucksack und polterte die Treppe hinunter.
In der Hosentasche hatte er den iPod mit dem neuen Album der österreichischen Band Ephen Rian.
Er ließ den Rucksack im Flur neben der Eingangstür zu Boden fallen und ging in den Speiseraum, um seiner Mutter zu helfen, die Gedecke herzurichten. Viel war nicht zu tun. Ein Gast in der Pension und drei Bauarbeiter, die seit vier Wochen gegen halb acht zum Frühstück kamen. Martin half immer, die Gedecke herzurichten, wenn es ihm die Zeit ermöglichte. Er mochte die stille Viertelstunde am Morgen, wenn er und seine Mutter wie perfekt koordinierte Einsatzkräfte, aufeinander eingespielt, alles vorbereiteten. Sie wechselten dabei fast kein Wort, aber es war immer ein stilles Lächeln im Raum. Jetzt, da die Sonne durch das Ostfenster hereinblinzelte, schien alles noch heiterer. Wenn Martin aus dem kleinen holzgetäfelten Speisesaal zum Fenster hinaus sah, hatte er immer das Gefühl, als würde sich ihm die hügelige, bewaldete Landschaft der Südsteiermark zu Füßen legen wie eine träge Katze, um gestreichelt zu werden.
Als sie fertig waren, begleitete sie ihn zur Tür, sah zu, wie er den Rucksack schulterte und die Tür aufmachte. Sie zog ihn am Arm zu sich und flüsterte in die von Vogelstimmen punktierte Stille: „Müssen diese grausigen Nietenarmbänder sein, Martin? Und der Nietengürtel? Was soll das darstellen? Musst du auf Punk machen?“ Sie strubbelte seine Haare und küsste ihn auf die Wange.
„Emopunk, Mama. Schau mal: Schwarze Röhrenjeans, schwarzer Kapuzensweater, Nietenarmbänder, Nietengürtel, schwarzes Pony, mindestens zwei Selbstmordversuche pro Woche und mit angezogenen Knien in einem leeren Zimmer sitzen und heulen und fertig ist der Emopunk. Hab dich lieb!“ Er lächelte zärtlich, wand sich sanft aus ihrer Umarmung und lief die Gasse hinunter.
„Emopunk? Was um Himmels Willen ist das denn nun wieder?“
Sie sah noch, wie er sich die weißen In-Ear Stecker des MP3 Players in die Ohren stöpselte und um die Ecke verschwand.
Der Bus kam, wie jeden Wochentag, um fünf nach sieben am Marktplatz an, und war schon zur Hälfte voll mit Schülerinnen und Schülern, sowie ein paar Arbeitern, die in Bad Gleichenberg arbeiteten. Der Morgenbus blieb auf der Strecke nach Bad Gleichenberg nur noch zweimal stehen, deshalb schaffte er die kurvenreiche Strecke durch Wälder und über Weinberge in knapp vierzig Minuten.
Kai stieg immer eine Station früher ein, weil der Bus fast direkt vor dem Hotel seiner Eltern Station machte. Er saß ganz hinten, in einer Traube gackernder, pickeliger Jungs und riss Witze. Er schien Martin übersehen zu haben oder zu ignorieren. Martin versank, so wie jeden Morgen, in einer kleinen Gruppe von Mädchen, die jünger waren als er, und die eine absolute und eingestandene Schwäche für Emos hatten. Martin war ohne eigenes Zutun der Hahn im Korb. Und er genoss es. Außerdem unternahm er nichts gegen die von den Mädchen ausgestreuten Gerüchte, er könne bisexuell sein, weil er fand, dass ihn das noch interessanter machte. Am liebsten würde er ja auch noch Kajal auflegen, die Mädchen würden dahinschmelzen. Und der Direktor würde ihn mit großem Vergnügen an die frische Luft befördern. Vermittels Kick in the Ass, wie Martin das launisch umschrieb.
Wenn gerade keines der Mädchen versuchte, mit ihm über Musik, Haarstyling und Dresscode zu sprechen, legte er seine Wange auf die kalte, vibrierende Scheibe. Die Ohrstecker tänzelten an ihren dünnen weißen Drähten auf seiner Brust. Und obwohl er sich bemühte, sich zu entspannen, spürte er Kais Anwesenheit im Rücken wie eine dunkle Wolke vergnügter Boshaftigkeit.
Seit fast einem Jahr gab es die Möglichkeit für Schüler aus der Umgebung, die nicht im Internat untergebracht werden mussten, sich in einem großen Umkleideraum umzuziehen. Es gab neue Stahlspinde, für die die Schüler eigene Schlüssel hatten, und in denen sie auch die Unterrichtsbücher deponieren konnten.
Die Tourismusschule war grundsätzlich als Internat geplant. Externe Schüler aus der Umgebung durften daheim schlafen. Der an ein Internatsleben angepasste Unterricht, der oft bis zum Nachmittag ging, war adaptiert worden, und seit letztem Jahr war es den externen Schülern möglich, wenn die nötige Anzahl von Schülern vorhanden war, bestimmteUnterrichtseinheiten des Nachmittags bis drei Uhr Nachmittags zusammenzuziehen
Martin vermutete, dass ihn sein Unbehagen, Kai könnte wieder mit irgendeinem Unsinn daherkommen, erst recht zum Opfer machte. Indunklen Stunden sah er sich als gebücktes, ausgemergeltes Männchen, das in ständiger Furcht vor Anfeindungen im Schatten des Lebens dahin schlich. Ihn beruhigte ein wenig, dass ihm dieses Bild nicht wie eine unverrückbare Tatsache erschien, sondern mit hellem Zorn erfüllte. Und solange Zorn in ihm war, konnte er aufrecht gehen. Außerdem fand er, Wut stand ihm ganz gut. Besser als Furcht und Trauer; ein verzwergtes Herz. Oder - wie er das gerne oft tat - um Bilder aus dem Film „Herr der Ringe“ zu bemühen: Kein Gollum. Eher ein Elb. Kai, ha. Solariumgebräunter, augenbrauenrasierender Wichser, sagte er sich oft vor, stumm, aber trotzdem die Lippen bewegend.
Da, seine heisere Stimme, direkt hinter ihm: „Schade, dass es an der Schule fast nur Mädchen gibt, Emotimmi.“
Martin war zu blauäugig, um der Falle zu entgehen: „Wieso?“
Kai grinste ihn an und fixierte ihn mit seinen hellblauen Babyaugen: „Na, wegen der Mädchen wirst du wohl kaum mit der engen Jeans rumrennen.“ Kai sah sich um, ob er genug Publikum hatte. Ein paar Mädchen sahen beiläufig interessiert zu ihnen. Der Hickhack zwischen den beiden hatte schon zu viel Routine, um wirklich aufregend zu sein. Kai schmunzelte überheblich und fuhr fort: „Ne, wegen der Schüler kann’s nicht sein ...“ Kai tänzelte vor ihm nach links und rechts, streute Lächeln aus wie ein Clown Konfetti.
Martin spürte, wie sich Schweiß unter seinen Armen sammelte und hinablief. Er wusste, er spürte, dass seine Stimme zittern würde, aber noch bevor er länger darüber nachdenken konnte, sagte er erstaunlich gefasst: „Halt einfach die Fresse, du blondierte, dumme Sau.“
Kai rempelte ihn sanft und sagte leise, aber deutlich: „Du kannst deinen Fickarsch ja ins Lehrerzimmer tragen. Vielleicht hilft das bei deinem Notendurchschnitt. Verdammt, in diesen tuntigen Röhrenjeans hat man ja keinen Arsch - so sorry!“ Kai machte einen zufriedenen, eitlen Schritt zurück, um sein Zerstörungswerk zu betrachten.
Martins Gesicht war rot angelaufen, sein Atem ging schwer und er fühlte sich durch und durch verschwitzt:Das mussten doch alle sehen, oder? Das macht mich so scheißfertig, das muss doch einfach jeder sehen! Er rang nach Fassung und machte ein Gesicht, als ob er vor ihm ausspucken wollte, während er die Hose aufknöpfte, sie auszog, faltete und in den offenen Spind legte. Er nahm seine Schulhose heraus, zog sie an, zog den Zipp hoch und schloss den Knopf. Dann sagte er laut und ohne jede Unsicherheit: „Geht’s deiner Mutter nicht schon langsam auf die Nerven, dauernd dein Sperma vom Spiegel zu wischen? Oder machst du das inzwischen selbst?“
Einige Mädchen, die an der offenen Tür des Umkleideraums für Jungen standen, kicherten, und Martin verbiss sich ein siegessicheres Grinsen.
Kai sah drein, als ob er eine Ohrfeige bekommen hätte und fauchte leise: „Willst du mich einen Wichser nennen?“
Martin nickte freundlich: „Wie würdest du das sonst nennen?“ Martin roch seinen eigenen Schweiß – er mochte den Geruch sogar, aber Herr im Himmel auf zwei Beinen: Das mussten doch alle sehen, dass er wie eine Sau schwitzte und voll nervös war.
Von weiter hinten eine Jungenstimme mit dem Tremolo eines ihrer Lehrer: „Na, Spiegelwichser.“
Martin atmete erleichtert auf. Für ihn war damit die Sache erledigt. Er sah mit großer und gut getarnter Zufriedenheit, wie Kai unter seiner Solariumsbräune rot wurde, und zog sich fertig um.
Kai rempelte ihn an, als er sich an ihm vorbei schob, um zu seinem Spind zu gehen und flüsterte: „Heul doch, Emo.“
Martin sah ihn mitleidig an, während er die Nietenarmbänder abnahm, in den Spind legte und in sein frisch gebügeltes, weißes Hemd schlüpfte: „Ja, ich würde heulen, wenn ich es nötig hätte, mein Spiegelbild anzuwichsen.“
Kai holte Luft, um etwas zu entgegnen, handelte aber, in dem er schwieg, zumindest für den heutigen Schultag einen Waffenstillstand aus.
Während die Externen mit den Internen gemeinsam zu Mittag aßen, und sich von den Erstklässlern bedienen ließen, ihre Leistungen zumeist leise und abfällig kommentierten, wurde die spiegelklare Oberfläche des Waldsees bei Königsberg von einem weißen Schimmern durchbrochen. Wellen liefen auseinander, rührten an Weidenästen, die ins Wasser hingen.
Die Bewegung war zu schnell und zu groß für einen Fisch, als sie weiß schillernd für eine Sekunde die Wasseroberfläche durchbrach.
Kapitel 3
Kai saß auf dem Hocker neben seinem Bett, vorgebeugt, die Ellenbogen auf den Knien, ein Bild in den Händen. Und die wütende Stimme seines Vaters in den Erinnerungen an gute Zeiten eingebettet; lange her: „Pack jetzt endlich deinen Scheißkrempel, du fauler Hund, oder du kriegst den Arsch voll bis es raucht!“
Danke Papa.
Das Foto in seinen Händen hatte Eselsohren, war abgegriffen und bleich. Es war zwei Jahre alt und zeigte ihn zwischen seinen besten Freunden Kem und Angelo. Das strahlende Lachen der drei Jungs auf dem Foto - in einem unwiederbringlichen Sommer festgehalten. Und dort für immer verloren. Kais Kiefer mahlten, draußen rief sein Vater nach ihm, mit einer Stimme, in der Wut mitschwang, so wie immer. Seine Mutter hatte schon vor Jahren aufgegeben, Kai gegen seinen Vater beizustehen. Sie hatte es einige Male versucht, mit dem Erfolg, dass sich der Zorn des kleinen, drahtigen Mannes unglaublicherweise verdoppelt und verdreifacht hatte; eine schreckliche Erfahrung, die sie nie, nie wieder machen wollte. Auch, wenn sie den um Hilfe bittenden Blick ihres Sohnes sah; sein Blick mit Steinen aus Demütigung und Zorn angefüllt, tat weh.
Rüdiger Brenner war von Natur aus zornig, und weil seine Frau ihm einmal gedroht hatte, ihn zu verlassen, wenn er sie jemals schlagen sollte, fühlte sich Kai wie Frodo, als das Auge des Magiers ihn ins Visier genommen hatte. Hin und wieder, nein, oft wünschte sich Kai, sein Vater würde ihn nur halb so gut behandeln wie die unhöflichen, nörgelnden, abgewichsten Gäste. Neben seinem Zorn hatte Rüdiger Brenner ständig Schuldgefühle.
Kai dachte oft mit bitterer Zufriedenheit: Markenschuhe, Solarium, Markenjeans, teurer Haarschnitt, zahlt alles der Zorn meines Alten. Und das Schweigen meiner Mutter, die immer so tut, als wäre ihr etwas ins Auge gekommen, wenn Vater mich mal wieder zusammenscheißt. Oder mir eine scheuert.
Der Junge links neben Kai auf dem Foto sah aus wie Martin Stolz. Ein bisschen südländischer. Kem war Türke. Kai dachte an Martin: Hasse ich dich deshalb so? Weil ich Kem so liebte, als wir in München Tag für Tag und bei jedem Wetter herumzogen? Uns umarmten, Stirn anStirn, und wie geistesgestörtlachten? Uns nicht auslachten, auchwenn wir mal weinten? Weil ich dich vielleicht auch umarmen will? Und mit dir lachen, bis uns schwindlig wird?
Kai warf das Foto aufs Bett, sah es noch einmal an. Dann ging er mit zwei raschen Schritten zum Fenster, riss es auf und rief mit unterdrückter Wut und zitternder, heiserer Stimme: „Ich komm ja schon!“
Sein Vater war in miserabler Stimmung. Kai half ihm, die Kisten mit Mineralwasser und Wein abzuladen und in den Keller zu bringen. Nach Kais vermeintlicher Faulheit war die Familie Stolz sein Lieblingsthema: „Königsberghof, ha! Diese miese Bruchbude. Hast du dir das schon mal angesehen? In dem kleinen Gässchen? Königsberghof, da lachen ja die Hühner!“
Kai schwieg, presste die Lippen aufeinander, um nicht loszulachen. Er konnte die Wut seines Vaters verstehen, hatte doch die Familie Stolz den besten Namen für ihre kleine Pension. Aber so eine Bruchbude, wie sein Vater tat, war es auch nicht. Altmodisch und gepflegt traf es wohl eher.
„Und der punkige Schwuchtelsohn? Meine Fresse, wenn die nicht mal ihren Sohn anständig erziehen können, wie wollen die bitteschön eine Gastwirtschaft betreiben? Der ist wahrscheinlich auch in der Schule ein Vollversager, was Kai? Was?“ Jedesmal dasselbe Thema. Kais Vater hatte sich in die Familie Stolz verbissen wie ein Dobermann in eine appetitliche, blanke Wade.
Sie standen im kühlen Kellerund ruhten sich aus,die Hände in die Hüften gestemmt und keuchten.
Katzengrau schlich sich ins Tageslicht und Kai wagte es, seinem Vater zu widersprechen: „Er hat immer gute Noten. Verstehe aber nicht, wieso. Der lernt nie, geht mit seinen komischen Klamotten in die Schule und schneidet pausenlos gut ab. Notendurchschnitt 2.“ Er sah das verkniffene Gesicht seines Vaters, unheilvoll von der schwachen Glühbirne beleuchtet, und wusste, was nun kommen würde:
„Und wieso kommst du dauernd mit Dreiern nach Hause? Wird es vielleicht wieder einmal Zeit, dass ich dir meinen Standpunkt verdeutliche?“
Kai nahm die Kurve, in dem er seinen running Gag vom Vormittag verlängerte: „Vielleicht hat er unter den Lehrern einen Freund, der was auf Punks hält.“
Sein Vater grinste ihn humorlos an, nickte und flüsterte: „Wenn man das nachweisen könnte, wäre die Familie unten durch, aber so was von!“
Sie gingen zurück in den feuchtwarmen Abend, und Kai fragte sich, warum er es bedauerte, seinem Vater diese Möglichkeit (die mit Sicherheit nicht zutraf - Martin war sicher nicht schwul, aber es war gut, ihn damit aufzuziehen) unter die Nase gerieben zu haben. Er konnte diesen dünne, enge Jeans tragenden, femininen Emopunk nicht leiden. Oder näher an der Wirklichkeit: Erwollteihn nicht leiden können. Und trotzdem ... Er sah Kem nicht nur ähnlich. Er hatte auch das gleiche Lachen. Kai ließ seinen inneren Souffleur mit weinerlich, kindlicher Stimme sagen:Ich bin etwas verwirrt, aber echt, hey!
Zu dieser Zeit saß Martin auf der hinteren Veranda des Königsberghofs und las Gedichte von Theodor Storm. Zuerst las erMeeresstrand, dannDu schläfst.
Von der oberen Holzveranda hatte man einen schönen Blick auf den sanft abfallenden Mischwald und über die im Pastelllicht weichen Hügel des steirischen Thermenlandes, ja, bis über die Grenze nach Slowenien. Martin schrak hoch, als er leise Schritte hörte, und sah den Journalisten auf die Veranda kommen. Er hatte seinen Laptop unter dem Arm. Auf der Veranda gab es fünf Tische mit weich gepolsterten Korbstühlen. Ideal für Sommerabende, ideal für einen Blick auf sanfte Hügel voller Wälder und weiter links die Weingärten, wie hingeworfen im erschöpften Tageslicht.
Wind war aufgekommen und zerriss die dichte Wolkendecke, die sich am Nachmittag gebildet hatte. Die untergehende Sonne malte die Wolkenfelder rot und orange an. Max Freimuth nahm am Tisch neben Martin Platz, stellte das Laptop ab, klappte es auf und holte tief Luft. Dann sagte er mit einem verbindlichen Seitenblick zu Martin: „Guten Abend. Wie geht’s denn so?“
Martin verdrehte die Augen und antwortete leise: „Ganz gut. Alles ok. Und bei Ihnen?“
Freimuth seufzte theatralisch und sagte mit Blick auf die in der Abenddämmerung leuchtende Landschaft: „Die Stille tut gut. Nach all meinen Fernreisen in die Touristikmetropolen der Welt tut mir diese Abgeschiedenheit wirklich sehr gut.“
Martin musste sich auf die Zunge beißen, damit aus dem Gedankenkein Wort wurde:Angeber. Er hatte sich in weiser Voraussicht, wie er glaubte, die überweite, schwarze Armyhose angezogen, in der er laut Mutter weder Arsch noch Beine hatte. Darüber trug er den ausgewaschenen, ehemals schwarzen Kapuzensweater. Die abgetragenen schwarzen DC ERA Sneakers hatte er ausgezogen und ordentlich unter den Tisch gestellt, weil er gerne die Füße hochlegte. Die Hose war etwas hochgerutscht. Freimuths Blick wanderte unbekümmert vom Holzgeländer der Veranda hinüber zu Martin, verharrte dort kurz bei den schwarzen Puma Füßlingen, und wanderte dann langsam die leicht behaarten Waden hinauf, bis er sich in den Falten der weichgewaschenen Armyhose verhedderte. Ungefähr Hüfthöhe beim Nietengürtel, dachte Martin unangenehm berührt. Wenn er mir mit den Augen einen blasen könnte, würde er es vermutlich genau jetzt tun.
Seine Mutter kam auf die Veranda und fragte Max Freimuth: „Darf’s was zum trinken sein?“
Martin beobachtete, wie sich Freimuths Gesichtsausdruck veränderte, geschäftlich-höflich wurde, als er bestellte: „Ach ja, bitte ein Kürbiskernbier. Das schmeckt ja wirklich ausgezeichnet.“
„Sehr gerne!“ Sie blinzelte Martin über Max Freimuths Kopf hinweg zu und ging in die Küche, um dem Mann sein Bier zu bringen. Martin wollte eben weiterlesen, als sich Freimuth räusperte und leise sagte: „Es ist dir unangenehm, wie ich dich ansehe?“