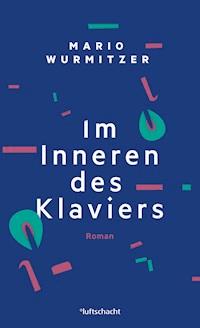Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luftschacht Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anna arbeitet für Alpha Solutions, einen multinationalen Konzern, um den sich ein Kult gebildet hat. Die Liebe zum Unternehmen gilt als heilige Pflicht, Privatleben als altmodische Idee. Viele Mitarbeiter haben das Firmengelände noch nie verlassen. Als Anna einer Gruppe rebellischer Jugendlicher erklärt, sie könnten alles erreichen, wenn sie sich nur anstrengten, glaubt sie sich zum ersten Mal selbst nicht mehr. Sie hat genug von den Lügen, die ständig erzählt und wiederholt werden sollen. Zunehmend fällt es ihr schwer, auf das zu vertrauen, was sie denken soll. Ihr Freund Thomas kann das nicht nachvollziehen. Er hat sich damit abgefunden, dass alles ist, wie es ist. Den Wunsch, etwas zu verändern, findet er befremdlich. Und er ist sich sicher, sein Leben mit Anna verbringen zu wollen. Immerhin haben die beiden im Zuge des Partnervermittlungsprogramms von Alpha Solutions erfahren, füreinander bestimmt zu sein. Als sie sich von ihm trennt, begreift er nicht, wie es so weit kommen konnte. Nüchtern und mit lakonischem Humor blickt Mario Wurmitzer in seinem zweiten Roman auf eine Welt im Jahr 2037, von der man sagt, es könnte alles noch schlimmer sein. Die Grenzen dessen, was möglich ist, haben sich ein Stück weit verschoben, aber nicht allzu weit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna arbeitet für Alpha Solutions, einen multinationalen Konzern, um den sich ein Kult gebildet hat. Die Liebe zum Unternehmen gilt als heilige Pflicht, Privatleben als altmodische Idee. Viele Mitarbeiter haben das Firmengelände noch nie verlassen. Als Anna einer Gruppe rebellischer Jugendlicher erklärt, sie könnten alles erreichen, wenn sie sich nur anstrengten, glaubt sie sich zum ersten Mal selbst nicht mehr. Sie hat genug von den Lügen, die ständig erzählt und wiederholt werden sollen. Zunehmend fällt es ihr schwer, auf das zu vertrauen, was sie denken soll. Ihr Freund Thomas kann das nicht nachvollziehen. Er hat sich damit abgefunden, dass alles ist, wie es ist. Den Wunsch, etwas zu verändern, findet er befremdlich. Und er ist sich sicher, sein Leben mit Anna verbringen zu wollen. Immerhin haben die beiden im Zuge des Partnervermittlungsprogramms von Alpha Solutions erfahren, füreinander bestimmt zu sein. Als sie sich von ihm trennt, begreift er nicht, wie es so weit kommen konnte.
Nüchtern und mit lakonischem Humor blickt Mario Wurmitzer in seinem zweiten Roman auf eine Welt im Jahr 2037, von der man sagt, es könnte alles noch schlimmer sein. Die Grenzen dessen, was möglich ist, haben sich ein Stück weit verschoben, aber nicht allzu weit.
MARIO WURMITZER schreibt Prosa- und Theatertexte. Er studierte Germanistik und Geschichte an der Universität Wien. Für seine literarischen Arbeiten erhielt er mehrere Auszeichnungen, u. a. den Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin 2015, den Osnabrücker Dramatiker:innenpreis 2017 und den Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich 2020. Seine Theaterstücke wurden u.a. im Schauspielhaus Wien, Kosmos Theater Bregenz, Theater Osnabrück, Werk X-Petersplatz und Theater Heilbronn uraufgeführt.
mariowurmitzer.at
Bei Luftschacht erschienen:
Es könnte schlimmer sein (Roman, 2023)
Im Inneren des Klaviers (Roman, 2018)
Mario Wurmitzer
Es könnte schlimmer sein
Roman
Luftschacht Verlag
© Luftschacht Verlag – Wien
luftschacht.com
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage Juli 2023
Umschlaggestaltung: Julian Tapprich – juliantapprich.com
Lektorat: Raimund Varga
Satz: Luftschacht
Gesetzt aus der Metric und der Noe
Druck und Herstellung: Finidr s.r.o.
Papier: Holmen book Cream 80 g/m2, Geltex glatt 115 g/m2
ISBN: 978-3-903422-34-6
ISBN E-Book: 978-3-903422-35-3
Gefördert von Stadt Wien Kultur und Land Niederösterreich Kultur
Inhalt
Stressabbau
Feuer
Sehnsucht
Mittleres Management
Aussteigen
Konkurrenz
Wellness
Glück
Zukunft
Erinnerungslücken
Alltag
Verlängertes Wochenende
Ruinen
Heimat
Da steh ich, ein entlaubter Stamm!
– Friedrich Schiller, Wallensteins Tod –
Stressabbau
Auf den ersten Blick war alles wie immer. Wir arbeiteten so schnell wie sonst. Wir kauften im Supermarkt dasselbe wie eh und je. Wir beschwerten uns nicht. Wir gaben den Vorständen keinen Grund, uns zu misstrauen. Niemand versuchte, das Firmengelände ohne Erlaubnis zu verlassen. Kein anonymer Beschwerdebrief wurde verfasst. Es fanden keine geheimen Versammlungen statt. Aber man machte sich Sorgen um uns. Wir erhielten ein Schreiben von den Vorständen, in dem es hieß, die Zunahme der Aggressionen sei bedenklich. Es herrsche in der Belegschaft eine Atmosphäre der Angst, des Neids und des Hasses. Wir verstanden zuerst nicht, was das heißen sollte. Wir hatten uns doch nicht verändert. Es hatte keinen Vorfall gegeben, der die Vorwürfe rechtfertigte. Wir waren entsetzt, weil man nicht zufrieden mit uns war. Wir versammelten uns im großen Veranstaltungsraum, um darüber zu reden, ob vielleicht doch etwas anders war als früher. Wir diskutierten energisch. Da stand einer der Jugendlichen, die in der Müllverbrennungsanlage arbeiteten, auf und ballte die Faust. Er meinte, es sei an der Zeit, etwas zu unternehmen, wir dürften uns nichts mehr gefallen lassen. Daraufhin kam es zu einem Tumult, wie wir ihn noch nie erlebt hatten, denn so etwas sagten wir nicht. Wir äußerten unsere Unzufriedenheit nicht offen. Das durften wir nicht. Wir riefen nicht zum Ungehorsam auf. Solange man es uns nicht befahl, unternahmen wir nichts. Wir verstanden nun, wieso wir das Schreiben erhalten hatten. Tatsächlich hatte sich etwas verändert. Wie nur hatte es dazu kommen können? Wir waren überrascht und überfordert, also entschlossen wir uns, vorerst so zu tun, als sei alles gut. Wir verfassten ein Schreiben, in welchem wir den Vorständen versicherten, jedem destruktiven, firmenschädigenden Verhalten entschieden entgegenzutreten. Aber wir waren weiterhin verunsichert. Planten die Jugendlichen aus der Müllverbrennungsanlage etwas? Hatten sich die Lagerarbeiter bei der Versammlung nicht auch seltsam verhalten? Die Kollegen aus den Laboratorien waren ungewöhnlich still gewesen. Verschwiegen sie etwas?
Seit der Versammlung wusste niemand mehr, wem er noch trauen konnte. Während der Arbeit wurde weniger geredet als früher. Wir musterten uns und versuchten zu erkennen, wer ein Geheimnis hatte. Wegen der Nachricht der Vorstände hatte es vielen die Sprache verschlagen. Ich wurde von unserem Teamleiter gefragt, ob ich mir vorstellen könne, mich zur Expertin für Gewaltprävention, Stress- und Aggressionsabbau ausbilden zu lassen. Ich sagte sofort zu. Meine Ausbildung war leider nicht allzu fundiert. Ich bekam ein achtzigseitiges Skriptum, das ich mir durchlesen sollte. Auf vielen Seiten waren Kaffeeflecken. Manche Textstellen waren durchgestrichen. Neben einigen Absätzen fanden sich große Ruf- oder Fragezeichen.
Thomas war nicht begeistert davon, dass ich diese Zusatzaufgabe übernahm. Er fürchtete, ich könnte meine Arbeit auf der Mülldeponie vernachlässigen.
„Du darfst weder die Deponie noch deine Pflichten als Mutter hintanstellen“, verlangte er.
„Aber wir haben kein Kind!“, wandte ich ein.
„Noch nicht!“, hielt er dagegen.
Ich weiß heute nicht mehr, was ich an ihm fand.
„Du denkst, du bist was Besseres, oder?“, fragte er mich oft.
„Nein“, sagte ich.
Darauf antwortete er jedes Mal mit einem zynischen Lachen.
Eineinhalb Wochen nach der Versammlung im großen Veranstaltungsraum saß ich vor einer Gruppe angeblich gewaltbereiter Jugendlicher und erzählte ihnen, sie könnten erreichen, was immer sie wollten. Während ich das sagte, wurde mir schlagartig klar, wie wenig ich vom Leben wusste. In ihren gelangweilten Blicken spiegelte sich meine eigene Ahnungslosigkeit.
„Wenn ihr fleißig seid, könnt ihr sehr viel erreichen. Ihr müsst nur etwas Geduld haben, dann wird alles besser“, sagte ich. Das war natürlich gelogen. Von selbst würde sich nichts zum Guten wenden. Sie wussten das genauso gut wie ich, und sie ahnten, dass es vieles gab, was man ihnen vorenthielt. Die meisten von ihnen hatten das Firmengelände noch nie verlassen. Da war eine Welt, die es zu entdecken galt. Eine Welt, zu der man ihnen den Zugang verwehrte.
Die Jugendlichen mussten den Workshop besuchen. Sie waren von den jeweiligen Teamleitern aufgrund aggressiver Äußerungen oder zorniger Blicke ausgewählt worden. Manche hatten schon einmal jemanden verprügelt. Sie sahen mehrheitlich harmlos aus. Aber sie alle hielten Gewalt für ein legitimes Mittel, um Probleme zu lösen. Diese Ansicht vertraten sie vehement. Ihre Wut hatte kein klar abgegrenztes Ziel, sie richtete sich vielmehr gegen alles, was ihnen in den Sinn kam und vermeintlich im Weg stand. Ich versuchte, ihren Anführer zu erkennen. Es musste jemanden geben, der die Richtung vorgab. Dem die anderen folgten. Das nahm ich zumindest an. Gleich zu Beginn der ersten Gesprächsrunde fiel mein Blick auf Sven, einen großgewachsenen Achtzehnjährigen, der nicht still sitzen konnte und unruhig atmete. Er bemühte sich, seine Aufgebrachtheit zu verbergen, was ihm nicht gelang. Ich fragte ihn, ob es ihm gut gehe. Zunächst presste er die Lippen zusammen und nickte. Kurze Zeit später fing er aber an zu reden.
„Hier wird sich erst etwas ändern, wenn wir das ganze Gelände niederbrennen. Man behandelt uns nicht besser als den Abfall, den wir entsorgen. Die Alten haben sich vielleicht damit abgefunden, aber wir nicht! Wir werden uns niemals daran gewöhnen, dass man uns für Dreck hält.“
Die anderen Jugendlichen nickten. Sven schaute mir direkt in die Augen. Ich atmete tief durch und sagte erstmal eine Weile nichts. Viel zu lange schwieg ich. Sie merkten mir sicher an, wie verblüfft ich war. Aber so etwas hatte ich noch nicht erlebt. Dass jemand Alpha Solutions derart offen kritisierte, war mir nie zu Ohren gekommen. Jede Form der Unmutsäußerung war streng untersagt. Ich räusperte mich.
„Na, na, na, jetzt übertreib nicht so“, sagte ich. Zu mehr konnte ich mich nicht durchringen. In meinem Kopf ratterte es.
Wieso liebten diese Jugendlichen Alpha Solutions nicht? Waren sie bei den wöchentlich stattfinden Mitarbeitergesprächen auch so kritisch? Hoffentlich waren sie klug genug, ihre Unzufriedenheit ihren Vorgesetzten nicht zu zeigen. Man tat doch so viel für uns. Es war doch ein Privileg, für Alpha Solutions arbeiten zu dürfen. Wir waren stolz, die Werte des Unternehmens zu vertreten. Es erfüllte uns mit Freude, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Nicht alle von uns dachten wirklich so, aber das mussten wir denken. Also taten wir so, als wäre es unsere Meinung. Da hatte man keine Wahl.
Der Kult um das Unternehmen war vergleichbar mit jenem um Tesla oder Apple. Diese beiden Konzerne verehrten wir auch. Alpha Solutions war selbstverständlich unsere Nummer eins, Apple und Tesla liebten wir nebenbei. Die Produkte von Microsoft lehnten wir entschieden ab. Man durfte keine andere Ansicht vertreten. Wer von hier war, hatte sich den Leitgedanken von Alpha Solutions zu fügen. Und diese Jugendlichen waren von hier. Das waren keine Externen, die in den Laboratorien arbeiteten und in Sonderquartieren am Rand des Geländes lebten. Sven und seine sieben Geschwister waren hier geboren worden. Sein Vater war ein stellvertretender Teamleiter auf der Deponie. Die meisten Jugendlichen, die vor mir saßen und zu Boden starrten, stammten aus Familien, die innerhalb der Kollegenschaft hohes Ansehen genossen.
„Es gibt eine Zeit im Leben, da glaubt man, es könnte alles anders sein, als es ist, aber …“, sagte ich und geriet kurz ins Stocken.
„Lächerlich“, zischte Sven. Ich tat so, als irritierte mich seine Bemerkung nicht, und brachte den Satz zu Ende.
„… die geht vorbei. Alles ist, wie es ist. Früher oder später muss man das akzeptieren.“
„Und das ist die Message? Das soll uns aufheitern? Jetzt sollen wir schön brav zurück an die Arbeit gehen?“
„Ja, was denn sonst?“, fragte ich. An diesem Punkt des Gesprächs war ich bereits vollkommen verwirrt. Es lag außerhalb meiner Vorstellungskraft, nicht weiterzumachen wie eh und je.
„Ich hätte gedacht, dass du nicht so gleichgeschaltet bist“, sagte Sven zu mir und schüttelte den Kopf.
„Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Das ist ein freies Land“, erwiderte ich. Langsam sammelte ich mich wieder.
Auf die Illusion von Freiheit legte man bei Alpha Solutions großen Wert. Ein freier Markt in einem freien Land. Wer nicht hier sein wolle, könne gehen, niemand werde aufgehalten, betonte das Unternehmen stets. Wenn man das Firmengelände ohne Erlaubnis verließ, kam das allerdings einer Kündigung gleich. Bei Alpha Solutions war man bedacht darauf, zu zeigen, dass es keinen Grund gab, anderswo hinzugehen. Was man benötigte, war hier. Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung und vieles mehr standen zur Verfügung.
„Wir werden nicht abhauen, wir werden etwas verändern“, sagte Sven.
Am Abend nach dem ersten Termin des Gewaltpräventionsworkshops erzählte ich Thomas, wie entschlossen die Jugendlichen auf mich wirkten. Ich verschwieg ihm, wie kritisch sie sich geäußert hatten. Thomas hätte das sofort gemeldet. Er hätte mir Vorwürfe gemacht, weil ich nicht umgehend die Human-Resources-Manager informiert hatte. Ich berichtete lediglich, dass sich die Jugendlichen offenbar nicht gut behandelt fühlten.
„Wer wird schon gut behandelt“, meinte Thomas und zuckte mit den Schultern. In dieser Phase unserer Beziehung redeten wir nicht viel. Im Grunde hatten wir uns nie angeregt unterhalten. Wir waren von einem niedrigen Niveau gestartet und die Anzahl der gewechselten Worte hatte mit der Zeit weiter abgenommen. Thomas war abends vollauf damit beschäftigt, Artikel für das Intranet zu produzieren. Er schrieb vor allem über Sportveranstaltungen. Über Darts- und Tischtenniswettbewerbe, über das jährliche Sportfest und über die allseits beliebten Boxkämpfe. Er freute sich, diese Beiträge verfassen zu dürfen. Wir hatten keinen freien Zugang zum Internet. Die Systemadministratoren prüften, welche Inhalte zugänglich waren. Im Intranet von Alpha Solutions konnte man sich über die zahlreichen Freizeitaktivitäten informieren, die vom Unternehmen angeboten wurden. Es war das erklärte Ziel, für die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeiter zu sorgen. Als Spezialistin für Gewaltprävention, Stress- und Aggressionsabbau zählte ich nun zum Healthcare-Team. Darauf hätte ich stolz sein sollen. Aber ich war es nicht.
„Mit mir stimmt etwas nicht“, sagte ich.
„Anna, ich hab wirklich keine Zeit“, erwiderte Thomas.
„Ich meine es ernst. Die Jugendlichen haben recht, es hat sich etwas verändert.“
„Am besten gehst du schlafen, morgen sieht die Welt gleich wieder anders aus.“
Am nächsten Morgen wurde ich zu Krause gerufen, dem Leiter des Standorts. Er residierte in einem riesigen Büro im obersten Stockwerk des Hochhauses. Zuvor hatte ich noch nie persönlich mit ihm gesprochen. Als ich aus dem Fahrstuhl stieg, war mir schwindlig. Ich hielt mich an der Wand fest. Seine Assistentin musterte mich abschätzig.
Krause saß hinter einem Tropenholzschreibtisch und trank Kaffee aus einer goldenen Tasse. Zu meiner Verwunderung war sein Büro fast leer. Kein Schrank, kein Regal, kein Beistelltisch, kein Teppich, nichts. Vor dem Schreibtisch standen zwei Stühle aus Glas, die wohl für Besucher gedacht waren. Ich wagte nicht, mich zu setzen, und er forderte mich nicht dazu auf.
„Ist alles gut?“, fragte Krause und kniff die Augen zusammen.
„Äh, ja.“
Krause lehnte sich zurück und lächelte.
„Man muss sich also keine Sorgen machen? Die Arbeiter sind glücklich, oder?“
Ich räusperte mich.
„Na ja, Glück“, antwortete ich. Ich hatte die Hoffnung, er werde daraus schon schließen, was er denken wollte. Krause fing an, davon zu erzählen, wie wichtig es sei, keine Unruhe aufkommen zu lassen. Gewalttätiges Verhalten hätte bei Alpha Solutions keinen Platz. Wenn ich etwas bräuchte, um die Ordnung zu erhalten, solle ich jederzeit zu ihm kommen. Das klang für mich verrückt. Ich konnte doch nicht zu Krause persönlich marschieren und ihn um etwas bitten. Es war in meinen Augen schon absurd, dass er gerade mit mir sprach. Üblicherweise erteilte er den Sektionsleitern Anweisungen. Diese gaben sie an die Abteilungsleiter weiter. Die informierten die Teamleiter, welche sich an die Mitarbeiter wandten.
„Benötigen Sie etwas?“
Ich schwieg.
„Was es auch ist, sagen Sie es mir. Ich werde mich darum kümmern.“
„Also … eine neue Wohnung. Aber ich denke, da wende ich mich direkt an …“
Was erlaubte ich mir da gerade? Ich durfte Krause um nichts bitten, unter keinen Umständen. Mein Herz pochte wie wild.
„Wieso denn das?“, unterbrach mich Krause.
„In meinem Privatleben ist es gerade etwas turbulent“, sagte ich.
„Aha“, murmelte Krause. Ich merkte, wie er sich anspannte.
Ich hatte einen Fehler begangen. Bei Alpha Solutions glaubten wir nicht an die Trennung von Privat- und Berufsleben. Wir hielten die Idee, man könne diese Sphären auseinanderhalten, für überholt. Krause nahm ein goldenes Etui aus der Tasche seines Nadelstreifenanzugs und öffnete es. Er wirkte gar nicht so selbstsicher und imposant, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, sondern eher wie die Karikatur eines Managers. Krause nahm eine Zigarre aus dem Etui und erklärte, er rauche nicht, er sehe sich Zigarren nur gerne an. Er wollte wissen, ob ich das verstehen könne, und ich nickte. Möglicherweise war das ein Test. Mir kam in diesen Tagen vieles seltsam vor, als hätte die Welt zu wanken begonnen. Es machte mir Angst, dass ich anfing, so vieles zu hinterfragen. Die Verhaltensweisen der Vorgesetzten, der Mitarbeiter, meine Beziehung zu Thomas.
„Sie kriegen eine neue Wohnung. Aber kümmern Sie sich nicht zu viel um sich selbst. Niemand darf denken, wichtiger als die anderen zu sein. Verstehen Sie das? Es fällt auf alle hier zurück, wenn einzelne Unruhestifter die Aufmerksamkeit der Vorstände auf sich lenken. Das dürfen wir nicht zulassen. Treiben Sie den Jugendlichen die Flausen aus.“
Daraufhin zeigte Krause zur Tür. Ich verabschiedete mich.
Bei Alpha Solutions wurde stets betont, wie wichtig alle von uns seien. Gleichzeitig wurde uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit mitgeteilt, dass wir nur kleine Rädchen in einer riesigen Maschine waren. Individuelle Bedürfnisse müssten auf die Unternehmensziele abgestimmt werden. Ich verstand nie so recht, wie das zusammenpasste. Aber es gab wohl nicht immer etwas zu begreifen. Wir sollten die Zustände akzeptieren, nicht über sie nachdenken. Alpha Solutions hatte damals Niederlassungen in 80 Ländern. Der jährliche Umsatz betrug mehr als hundert Milliarden Euro. Wir waren ein Teil von etwas Großem. Das sollten wir schön finden. Das Kerngeschäft von Alpha Solutions war die Entsorgung aller Arten von Abfällen. Altstoffe, Gefahrenstoffe, Sperrmüll und so weiter. Auch die Verwertung unliebsamer Erinnerungen wurde angeboten. Die Tabletten gegen das Erinnern erfreuten sich sowohl bei Privat- als auch Firmenkunden großer Beliebtheit. Sie bildeten den Grundstein für das rasante Wachstum des Konzerns. Mit der Erinnerungsentsorgung hatte ich allerdings nichts zu tun. Ich wusste nur, dass in den Laboratorien in diesem Bereich geforscht wurde. Geworben wurde mit dem Versprechen, Alpha Solutions könne alles zum Verschwinden bringen.
Als Thomas erfuhr, dass ich mit Krause persönlich gesprochen hatte, packte er mich am Oberarm und schrie, er wolle endlich wissen, was ich vorhätte.
„Ich musste in seinem Büro erscheinen! Ich hatte keine Wahl!“, verteidigte ich mich, aber Thomas hörte mir nicht zu, er brüllte vor sich hin, es dürfe sich nichts ändern, ich hätte nicht das Recht, unser Glück kaputtzumachen, es sei doch schon alles geplant, wir hätten ein schönes Leben vor uns, er wolle das nicht gefährden, ich dürfe das auch nicht, er werde das nicht zulassen, er habe das nicht verdient, er habe mich immer gut behandelt, ich solle einsehen, wo mein Platz sei, ich hätte im Hochhaus nichts verloren, ich gehörte auf die Deponie und in diese Wohnung, ob mir das denn nicht genüge. Er sah mich gar nicht an, er schrie an mir vorbei.
„Ich werde ausziehen“, sagte ich ruhig.
Seine Aufregung überraschte mich nicht. Er konnte nicht verstehen, was vor sich ging, wieso Krause mit mir sprechen wollte, weshalb ich einen Gewaltpräventionsworkshop leitete. Thomas war jemand, der jede Facette des Alltags unter Kontrolle haben wollte. Sein Leben sollte in klaren Bahnen verlaufen. Alles Unvorhergesehene machte ihm Angst. Er rang nach Luft.
„Das kannst du mir nicht antun“, sagte er. „Wir beide, wir sind doch … wir sind füreinander bestimmt, das weißt du. Das hat man uns gesagt.“
„Genau das ist das Problem!“, rief ich.
Bei Alpha Solutions wurde die Partnerwahl im Zuge der wöchentlichen Mitarbeitergespräche geklärt. Mögliche Lebenspartner wurden einer eingehenden Analyse unterzogen. Man wurde nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen gefragt und musste eine Reihe von Fragebögen ausfüllen, die dabei helfen sollten, die Suche nach der wahren Liebe zu erleichtern. Nichts weniger als die wahre Liebe, die für immer hielt, wurde uns in Aussicht gestellt. Treffen wurden arrangiert und ausgiebig nachbesprochen. In der Belegschaft hatte das konzerneigene Partnervermittlungssystem einen hervorragenden Ruf. Die allermeisten Paare hatten sich auf diese Weise gefunden. Es wurde allgemein erwartet, dass man sich dem Prozedere nicht widersetzte.
Thomas sah mich ratlos und traurig an. Er hatte keine Ahnung, wieso ihm gerade seine sorgfältig skizzierten Zukunftspläne entglitten.
„Ich liebe dich so sehr, Anna.“
„Das stimmt nicht. Es tut mir leid. Wirklich.“
„Hat das etwas mit diesem Gewaltpräventionszeug zu tun?“
Ich schüttelte den Kopf und fing an, meine Sachen zu packen.
„Ich verstehe dich nicht, Anna. Es geht uns doch gut“, murmelte Thomas, ehe er noch einmal wiederholte: „Ich versteh dich nicht.“
„Wir sind uns letztlich egal. Sei ehrlich zu dir selbst. Man hat uns gesagt, dass wir gut zusammenpassen, aber das reicht nicht.“
Thomas schaute mich an, als hätte ich ihm eine Hand abgehackt. Dann wandte er sich ab, starrte zu Boden und schwieg. Ich dachte, er brauche wohl einige Zeit, um zu verarbeiten, was gesagt worden war. Er musste akzeptieren, dass es sich nicht zurücknehmen ließ.
„Übermorgen gehen wir gemeinsam zum Fest“, sagte er schließlich. „Danach kannst du tun, was du willst. Dann wirst du mir nicht mehr wichtig sein.“
Er nickte, als stimme er sich selbst zu. Thomas beschloss wohl, daran zu glauben, über mich bald hinwegzukommen. Er war bisher nie auf die Idee gekommen, sich zu fragen, was er für mich empfand. Ihm hatte es genügt, gesagt zu bekommen, ich sei die Richtige für ihn.
„Gut, wir gehen gemeinsam zum Fest.“
Die Veranstaltungen waren Thomas sehr wichtig. Bei Alpha Solutions wurde viel gefeiert. Wenn es Positives zu vermelden gab, fanden in den Veranstaltungszentren aller Niederlassungen Events statt. Diesmal hatte Alpha Solutions vor einem Schiedsgericht ein Verfahren gegen Portugal gewonnen. Alpha Solutions klagte hin und wieder Staaten auf Schadenersatz, wenn deren umwelt- oder sozialpolitischen Maßnahmen die erwarteten Profite beeinträchtigten. Wir erfuhren nicht, worum genau es ging. Uns vermittelte man vor allem, es bestehe Grund zur Freude. Wir sollten applaudieren. Bei Apple waren Produktpräsentationen inszenatorische Großereignisse. Bei Alpha Solutions jubelten wir, wenn der Konzern einen Staat erfolgreich verklagt hatte. Wir waren überzeugt davon, für einen der mächtigsten Konzerne der Welt zu arbeiten. Wir dachten, nichts und niemand könne Alpha Solutions aufhalten. Schon gar keine Regierung. Kein Gesetz. Das hieß aber auch, dass uns keine Vorschrift dieser Welt schützen konnte. Wir hingen ganz und gar von der Gnade der Entscheidungsträger von Alpha Solutions ab. Sie gaben uns alles und wir waren nichts. Natürlich dauerte es eine Weile, bis man das verstand.
Bis man dachte, was man denken sollte. Wer bei Alpha Solutions anfing, brauchte einige Zeit, um die Leitgedanken des Unternehmens zu verinnerlichen. Viele von uns waren allerdings auf der Geburtsstation des Gesundheitszentrums zur Welt gekommen. Wir waren immer schon hier, wir kannten sonst nichts. Für uns war AS die ganze Welt.
Das Fest war nichts Besonderes. Wir klatschten und johlten, wenn es Zeit dazu war. Wir sagten Leuten, die wir selten sahen, man müsse sich in Zukunft wieder öfter treffen und wir tranken billigen Prosecco. Aus den Boxen drangen dieselben Popsongs wie bei zahllosen Veranstaltungen zuvor. Alle taten so, als sei dieses Event ein tolles gesellschaftliches Ereignis. Thomas amüsierte sich. Er begrüßte seine Kollegen, klopfte ihnen auf die Schultern, riss derbe Witze und grölte bei dem einen oder anderen Lied mit. Ich fühlte mich einsam, was neu für mich war. Bisher hatte ich die Veranstaltungen gemocht. Nun kam mir alles so trist und fremd vor. Hatte ich mich verändert? War ich von dem Wandlungsprozess ergriffen worden, der den Vorständen Sorgen bereitete? Wieso ging ich auf Distanz zu dem, was mir so vertraut gewesen war?
Bei Alpha Solutions kritisierten wir nichts und niemanden – außer uns selbst. Nachts lag ich wach und suchte den Fehler bei mir. Das war eine alte Gewohnheit. Ich dachte über das Fest nach und kam zu dem Schluss, dass alles wie immer gewesen war – nur ich nicht. Vielleicht hatte ich Thomas ungerecht behandelt. War ich zu offen gewesen? Nichts von dem, was ich zu ihm gesagt hatte, war gelogen. Aber ich hätte die Wahrheit anders verpacken, sie ihm in leichter verdaulichen Brocken hinwerfen können, das wäre rücksichtsvoller gewesen. Dann fiel mir ein, Sven und die anderen Jugendlichen nicht gesehen zu haben. Keinen einzigen von ihnen. Ich setzte mich im Bett auf und starrte entsetzt in die Finsternis. Waren sie wirklich alle nicht dort gewesen? Ich redete mir ein, ich hätte sie im Gedränge bloß nicht entdeckt. Aber es gelang mir nicht, mich auf diese Weise zu beruhigen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen war nicht verpflichtend. Aber fast niemand blieb zu Hause, weil das nicht gerne gesehen wurde. Wenn alle Teilnehmer an dem Gewaltpräventionsprogramm geschlossen durch Abwesenheit glänzten, blieb das nicht unbemerkt. Darüber würde in den kommenden Tagen viel gesprochen werden. Durch so ein Verhalten machten sich die Jugendlichen zu Verdächtigen. Man misstraute ihnen ohnehin schon. Deshalb mussten sie an dem Programm teilnehmen. Ich zweifelte nun noch stärker daran, ihnen glaubhaft erklären zu können, weshalb es ein Privileg sei, für Alpha Solutions zu arbeiten. Ein Privileg, das man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen dürfe. Dabei war mir das bei meinen Mitarbeitergesprächen so oft geschildert worden. Ich hätte imstande sein müssen, die Unternehmenspropaganda zu wiederholen. Aber es kam darauf an, wie überzeugend man sie vortrug. Ich traute mir selbst nicht mehr zu, jemanden für Alpha Solutions zu begeistern. Das hätte ich melden sollen. Ich hätte zu Krause gehen und ihm sagen müssen: Tut mir leid, ich bin nicht geeignet, das Gewaltpräventionsprogramm zu leiten. Ich hätte gar nicht für diese Aufgabe ausgewählt werden dürfen, da ist ein Fehler passiert. Ich hinterfrage gerade vieles, was mir unumstößlich erscheinen sollte. Unter keinen Umständen darf ich die Gespräche mit diesen Jugendlichen leiten. Aber ich ging nicht zu Krause, ich behielt meine Gedanken für mich.
Uns wurde andauernd gesagt, nirgendwo sei es so schön wie hier. Kein anderes Unternehmen kümmere sich so aufopferungsvoll um seine Angestellten. Wenn man den Job verliere, habe man keine Chance, anderswo angestellt zu werden. Überall wisse man, dass Alpha Solutions das großzügigste und nachsichtigste Unternehmen aller Zeiten sei. Wer bei Alpha Solutions rausfliege, sei nicht zu gebrauchen. Die Werte von Alpha Solutions seien Respekt, Nächstenliebe und Leistungsbereitschaft. Jeder, der sich anstrenge, werde es in diesem Konzern weit bringen. Wir glaubten daran.
An irgendwas mussten wir glauben und die Unternehmensphilosophie war das einzige Sinnangebot, das uns präsentiert wurde. Sonst gab es nichts. Alles erschien mir lange selbstverständlich. Meistens waren wir mit der Arbeit beschäftigt. Es blieb gar nicht so viel Zeit für anderes. Die Arbeit füllte uns aus. Weil es genug zu tun gab, hielten wir durch. Man ließ uns nicht zu viel freie Zeit. Man gab feste Strukturen vor. Die Arbeit bewahrte uns davor, das Leben unerträglich zu finden. Wo sollte man sich sonst verkriechen, wenn nicht in der Arbeit? Meine Sammlung gefundener Bücher beinhaltete den Roman Irre von Rainald Goetz, in welchem ich las: Nur die Arbeit hilft gegen das ganze schlimme Leben. Will mir einer die Arbeit nehmen, schieße ich den weg oder mich. Bin ich weg, brauche ich auch keine Arbeit mehr. Aber so lange ich da bin, soll mir bitteschön einer was Lebensrettenderes nennen als wie die Arbeit, sofort kriegt er von mir 1 Mark 20.
Die Arbeit und das Lesen füllten mein Leben aus. Die Bücher, die ich fand, wurden zu meinem wertvollsten Besitz. Ich entdeckte sie in regelmäßigen Abständen an entlegenen Ecken des Firmengeländes. Jemand musste sie absichtlich liegen lassen. Ich stellte mir gerne vor, es wäre eine Person, die sich wünschte, nur ich solle sie finden. Das Verschenken von Büchern war natürlich gegen die Firmenordnung. Als Konsequenz drohte die Entlassung. Der Besitz von nicht kontrollierten Kulturgütern war ein Grund für eine offizielle Abmahnung. Aber dieses Risiko ging ich ein, ohne lange darüber nachzudenken. Ich war stolz, Bücher zu besitzen. Außerdem gefiel es mir, ein Geheimnis zu haben. Wenn ich las, spürte ich, wie sich etwas verschob, in mir, in der Welt, wer weiß das schon.
Dabei gab es auf dem Firmengelände sogar eine kleine Bibliothek. Sie befand sich gleich neben dem Einkaufszentrum.
Das Sortiment bestand jedoch größtenteils aus Selbsthilfeliteratur. Manches davon war nicht uninteressant, aber literarische Werke waren leider nicht verfügbar. Die Unternehmensführung vertrat die Ansicht, jede Freizeitbeschäftigung der Mitarbeiter solle auch einen unmittelbaren Nutzen für das Unternehmen haben. Die Lektüre von Romanen wurde als nicht nützlich genug eingeschätzt.
Hin und wieder wurden sogar Bücher an alle Mitarbeiter von Alpha Solutions verteilt.
Zu meiner Überraschung war ich offenbar nicht die Einzige, die über eine geheime Büchersammlung verfügte, wie sich bei der zweiten Einheit des Gewaltpräventionsworkshops herausstellen sollte. Diesmal waren die Jugendlichen nicht mehr so verschlossen. Sie antworteten höflich und geradezu ausschweifend auf meine Fragen, sodass ich mich bald fragte, ob sie mir etwas vorspielten. Sie wirkten gelassen, als sei ihr Zorn verflogen. Aber wie war das möglich? Konnte sich innerhalb von einer Woche ihre Stimmung grundlegend geändert haben? Sven schien gut gelaunt, war allerdings so ruhelos wie beim ersten Termin. Er schnippte andauernd mit den Fingern und fuhr sich nervös durch die Haare. Während wir gerade über ihre Zukunftspläne redeten, drehte er sich ruckartig um und nahm ein Buch aus seinem schwarzen Rucksack. Es hieß Im freien Fall. Er wollte wissen, ob ich es gelesen hätte. Ich schüttelte den Kopf.
„Ist das nicht in deiner Sammlung?“, fragte er und lächelte. Sein linkes Auge zuckte unkontrolliert. In ihm brodelte es. Das konnte er nicht verbergen.
„Welche Sammlung?“, entgegnete ich mit möglichst gelassener Stimme. Ich wollte mir auf keinen Fall meine Verunsicherung anmerken lassen. Aber ich spürte, wie mir heiß wurde. Was wusste Sven über mich?
„Uns kannst du nichts vormachen. Du bist klüger, als ich anfangs dachte. Du hast durchschaut, wie furchtbar das Leben hier ist.“
„Mein Leben ist nicht furchtbar.“
Sven lachte zynisch und steckte das Buch wieder in den Rucksack. Er nahm eine Schachtel Zigaretten heraus. Auf dem Firmengelände galt striktes Rauchverbot.
„Wenn du meinst“, sagte Sven, ehe er sich eine Zigarette anzündete.
„Lass das!“, verlangte ich.
„Warum? Weil Alpha Solutions die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen liegt? Lächerlich. Sie wollen vermeiden, dass wir krank werden, weil das schlecht für das Geschäft ist. Wenn es Profit brächte, uns umzubringen, würden sie keinen Moment zögern. Das weißt du ganz genau.“
„Von wem sprichst du?“, fragte ich mit gespielter Ahnungslosigkeit. Ich wollte endlich wissen, wogegen er rebellierte.
„Krause ist kein schlechter Mensch“, fügte ich noch hinzu.
„Es geht doch nicht um Krause!“, rief Sven. „Das hier ist nur eine kleine Niederlassung eines riesigen, unmenschlichen Imperiums. Es geht um das große Ganze!“
„Oje, das große Ganze“, murrte ich.
Die Jugendlichen wandten sich also tatsächlich gegen Alpha Solutions. Sie waren nicht unzufrieden mit einem Detail, mit ihrem Dienstplan, ihrem Teamleiter, ihrer Unterkunft, sondern sie hassten das Unternehmen, das sie lieben sollten. Das wir alle liebten. So stand es in der Firmenordnung. Grundsatz Nummer eins: Die Liebe zu Alpha Solutions höret nimmer auf. Insgesamt umfasste die Firmenordnung 160 Grundsätze. Sie unterschieden sich nicht in ihrer Wichtigkeit. Das wurde uns immer wieder mitgeteilt.
„Fährst du am Wochenende mit ans Meer?“, erkundigte sich Sven gegen Ende der Einheit.
„Alle fahren mit. Das weißt du.“
Sven nickte. Dann schwieg er eine Weile und lächelte in sich hinein. Einer seiner Freunde erzählte von einer Auseinandersetzung mit einem älteren Kollegen, während ich darüber nachdachte, wieso mich Sven auf die Fahrt ans Meer angesprochen hatte. Die Teilnahme an den Betriebsausflügen war offiziell nicht verpflichtend. Es wäre schön, wenn man sich für solche Teambuildingmaßnahmen freiwillig melde, hieß es seitens des Unternehmens. Also meldeten sich beinahe alle freiwillig, weil sie wussten, wenn sie es nicht taten, hatten sie mit Konsequenzen zu rechnen. Jeder fürchtete eine schlechte Bewertung durch die Vorgesetzten. Selbst Krause, der in seinen Ansprachen vor der Belegschaft allzu gerne betonte, er sei auch nur ein kleines Rädchen. Er wies bei jeder Gelegenheit darauf hin, selbst kaum Befugnisse zu haben. Er stehe in der Unternehmenshierarchie nicht weit genug oben, um Richtungsentscheidungen zu treffen. Diese würden anderswo gefällt. Die Zentrale von Alpha Solutions befand sich in London. Wir hatten Bilder davon gesehen. Uns wurde versprochen, eines Tages dorthin reisen zu dürfen. Aber viele glaubten, dazu werde es nicht kommen. Wir seien nicht wichtig genug, der Standort sei zu klein, man werde uns diese Ehre nicht erweisen, wir alle würden die Zentrale nie betreten.
„Es könnte sein, dass hier etwas passiert, während du am Strand liegst und dich bräunen lässt“, sagte Sven und stand auf. Er schulterte seinen Rucksack und ging davon. Augenblicklich erhoben sich die anderen und folgten ihm. Ich rief ihnen hinterher, aber sie reagierten nicht.
Wieso sagte mir Sven so etwas? Wenn sie etwas Verbotenes planten, hatten sie doch allen Grund, das vor mir zu verschweigen.
Nach dieser Sitzung kehrte ich zurück in meine neue Wohnung. Sie war in einem deutlich schlechteren Zustand als jene, in der ich mit Thomas gewohnt hatte. Im Stillen hatte ich mir mehr erwartet. Ich hatte gedacht, ich sei nun wichtig genug, um eines der besseren Apartments zugeteilt zu bekommen. Immerhin hatte ich mit Krause gesprochen. Ich war in seinem Büro gewesen. Aber das hatte wahrscheinlich nichts zu bedeuten.
Ich versuchte, mir die Wohnung schönzureden, indem ich mir sagte, der Grundriss sei gut. Leider war sie in einem desolaten Zustand. An den Wänden hatte sich Schimmel gebildet. Oft fiel der Strom aus. Wenn ich abends nach Hause kam, zündete ich eine Kerze an, zog den Karton mit den gefundenen Büchern unter dem Bett hervor, suchte mir eines davon aus und fing an zu lesen.
Feuer
Der Strandabschnitt war im Besitz von Alpha Solutions. Die Betriebsausflüge führten uns meistens ans Meer, seltener in die Berge. Sie waren die einzige Möglichkeit, das Firmengelände zu verlassen, ohne die Anstellung bei Alpha Solutions zu riskieren. Thomas blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Er tat so, als versuche er, nicht von mir bemerkt zu werden. Als ich ihm zuwinkte, erschrak er und kam auf mich zu. Dicht neben meinem Liegestuhl blieb er stehen. Ich richtete mich auf.
„Hallo Anna! Das ist ja eine Überraschung.“
„Wieso?“
Er geriet kurz ins Stocken. Dann entschied er sich offenbar dafür, meine Bemerkung zu ignorieren.
„Bist du einsam?“, fragte er.
„Nein.“
Thomas nahm seine Sonnenbrille ab und schaute mich skeptisch an.
„Fehle ich dir noch nicht?“
„Nein“, antwortete ich wahrheitsgemäß.
„Ich könnte dir verzeihen.“
„Nicht nötig.“
„Schön hier, nicht? Das Meer. Die Sonne.“
„Mhm.“
„Romantisch.“
„Na ja“, erwiderte ich.
„Sicher. Sehr romantisch.“
„Wenn du meinst.“
„Gut, ich gehe dann wieder. Mein Handtuch liegt dort drüben“, sagte er und zeigte in die Ferne.
Leider begann es bald zu regnen, weshalb die Vorträge in die Busse verlegt wurden. Ein wesentlicher Bestandteil jedes Ausflugs waren Reden, durch die wir motiviert werden sollten. Diesmal ging es um den Glauben an die eigene Kraft, den man nie verlieren dürfe. Geleitet wurden die Vorträge von den Entertainern. Die mochte ich nicht besonders, weil sie andauernd so taten, als seien sie besonders gut gelaunt. Man konnte ihnen nicht trauen. Sobald man sie nicht anlächelte, war man in ihren Augen bereits ein destruktives Individuum und wurde wegen teamgeistvernichtendem Verhalten gemeldet. Wir saßen dichtgedrängt in den Bussen und schauten ab und zu nach draußen, wo ein Sturm tobte, während die Entertainer erzählten, wir müssten die Kraftquellen aufspüren, die sich in uns befänden. Da erfasste mich die Traurigkeit mit voller Wucht. Ich war mit einem Mal so niedergeschlagen wie noch nie zuvor in meinem Leben. Warum waren wir hergefahren? Was hatten wir hier zu suchen? Wir waren nicht dazu auserkoren, am Strand zu liegen. Unsere Bestimmung war die Arbeit. Nichts sonst. Absolut nichts erschien mir noch sinnvoll. In diesem Augenblick murmelte hinter mir jemand:
„Jetzt reicht es mir endgültig.“
„Was?“, fragte ich, während ich mich umdrehte.
„Schöne Hose. Ich habe gesagt, du hast heute eine schöne Hose an“, sagte eine junge Kollegin, die mich zu kennen schien. Ich versuchte, sie einem Team, einer Abteilung, einem Wohnblock zuzuordnen, aber es gelang mir nicht.
„Das hast du nicht gesagt.“
„Doch.“
„Es muss doch noch mehr geben als das hier, oder?“, flüsterte ich ihr zu.
„Ich weiß nicht, was du meinst.“
„Oh doch.“
„Kann schon sein.“