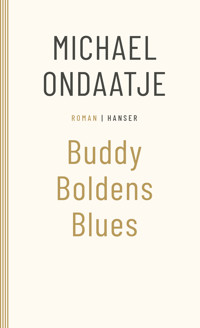Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach vielen Jahren unternimmt Ondaatje eine Entdeckungsreise ins Land seiner Vorfahren. Es ist die Rückkehr ins Ceylon der dreißiger und vierziger Jahre und in die eigene Familiengeschichte, es ist eine Suche nach der verlorenen Zeit, nach den Erinnerungen an die Eltern und Verwandten. Diese Reise in die eigene Vergangenheit ist reich an skurrilen Gestalten und kleinen und großen, grotesken und witzigen Abenteuern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Nach vielen Jahren unternimmt Ondaatje eine Entdeckungsreise ins Land seiner Vorfahren. Es ist die Rückkehr ins Ceylon der dreißiger und vierziger Jahre und in die eigene Familiengeschichte, es ist eine Suche nach der verlorenen Zeit, nach den Erinnerungen an die Eltern und Verwandten. Diese Reise in die eigene Vergangenheit ist reich an skurrilen Gestalten und kleinen und großen, grotesken und witzigen Abenteuern.
Michael Ondaatje
Es liegt in der Familie
Aus dem Englischen von Peter Torberg
Carl Hanser Verlag
Für Griffin und Quintin.
Für Gillian, Janet und Christopher.
»Ich fand auf dieser Insel Federvieh von der Größe unserer Gänse mit zwei Köpfen … und andere wundersame Dinge, von denen ich hier nicht berichten werde.«
Oderich (Franziskanermönch, 14. Jahrhundert)
»Die Amerikaner waren in der Lage, einen Menschen auf den Mond zu schicken, weil sie Englisch verstehen. Die Singhalesen und Tamilen, deren Englischkenntnisse beschränkt waren, glaubten, die Erde sei flach.«
Douglas Amarasekara, Ceylon Sunday Times, 29.1.1978
Dürre seit Dezember.
In der ganzen Stadt schieben Männer Karren mit Eis herum, eingepackt in Sägemehl. Später, noch immer herrscht Dürre, hat er während eines Fieberanfalls einen Alptraum: die harten Wurzeln der Dornensträucher im Garten wuchern unterhalb der Erde bis zum Haus und klettern durch die Fenster, um den Schweiß von seinem Körper zu trinken, den letzten Tropfen Spucke von seiner Zunge zu stehlen.
Kurz vor Tagesanbruch schaltet er das Licht ein. Seit fünfundzwanzig Jahren lebt er nicht mehr in diesem Land, doch bis zu seinem elften Lebensjahr hat er in Zimmern wie diesem geschlafen — statt Gardinen nur dünne Stäbe vor den Fenstern, damit niemand einbrechen kann. Und der Fußboden roter, glattpolierter Zement, kühl unter den nackten Füßen.
Morgendämmerung in einem Garten. Klarheit der Blätter, Früchte, das dunkle Gelb des Königs Kokosnuß. Dieses zarte Licht hält sich nur für einen kurzen Augenblick am Tag. In zehn Minuten wird der Garten in flimmernder Hitze daliegen, summend vor Geräuschen und Schmetterlingen.
Eine halbe Seite — und schon ist der Morgen uralt.
Asiatische Gerüchte
Asien
Ausgelöst wurde alles durch den weißen Knochen eines Traumes, den ich kaum festhalten konnte. Ich schlief im Haus eines Freundes. Ich sah meinen Vater, chaotisch, von Hunden umringt, und alle heulten und bellten sie in die tropische Landschaft hinaus. Der Lärm weckte mich auf. Ich setzte mich auf dem unbequemen Sofa auf und war in einem Dschungel, es war heiß, ich schwitzte. Straßenlaternen reflektierten den Schnee und warfen das Licht ins Zimmer, durch die Ranken der wilden Rebe und den Farn am Fenster meines Freundes. Ein Aquarium leuchtete in der Ecke. Ich hatte geweint, und meine Schultern und mein Gesicht waren erschöpft. Ich wickelte mich in die Decke, lehnte mich gegen die Rückenlehne des Sofas und blieb fast die ganze Nacht so sitzen. Verspannt, ohne mich bewegen zu wollen, während die Hitze langsam aus mir wich, während der Schweiß verdunstete und ich mir wieder des schneidenden Windes draußen vor den Fenstern bewußt wurde, der durch die Straßen und über die eisverkrusteten Autos, die sich wie Schafe aneinanderkauerten, hinwegfegte und heulte, bis hinunter zum Ontariosee. Der Winter fing gerade erst an, und ich träumte bereits von Asien.
Ein Freund hatte mir einmal gesagt, daß ich nur in betrunkenem Zustand genau zu wissen schien, was ich wollte. Und so wußte ich zwei Monate später, mitten während der Abschiedsparty, als ich immer mehr außer Rand und Band geriet — ich tanzte, balancierte ein Weinglas auf der Stirn und ließ mich zu Boden fallen, drehte mich im Kreis und stand wieder auf, ohne das Glas fallen zu lassen, ein Trick, der nur in betrunkenem und entspanntem Zustand möglich schien —, daß ich schon rannte. Draußen hatte der anhaltende Schneefall die Straßen schmaler, fast unpassierbar werden lassen. Die Gäste waren zu Fuß gekommen, in Schals gehüllt, die Gesichter rosig vor Kälte. Sie lehnten am Kamin und tranken.
Ich hatte diese Reise bereits geplant. An ruhigen Nachmittagen breitete ich Karten auf dem Fußboden aus und erkundete mögliche Routen nach Ceylon. Doch erst bei dieser Party in Gesellschaft meiner engsten Freunde, wurde mir klar, daß ich zurück zu der Familie reisen würde, der ich entstammte — zu jenen Verwandten aus der Generation meiner Eltern, die mir im Gedächtnis standen wie eingefrorene Figuren aus einer Oper. Ich wollte sie zu Worten rühren. Ein perverser und einsamer Wunsch. In Jane Austens Persuasion war ich auf folgende Zeilen gestoßen: »Sie war in ihrer Jugend zu Besonnenheit angehalten worden, Romantik lernte sie kennen, als sie älter wurde — die natürliche Folge eines unnatürlichen Anfangs.« Mitte Dreißig wurde mir bewußt, daß ich an einer Kindheit vorbeigeglitten war, die ich ignoriert und nicht begriffen hatte.
Asien. Der Name war ein Seufzer aus einem sterbenden Mund. Ein uraltes Wort, das geflüstert werden mußte und niemals als Schlachtruf verwendet würde. Das Wort kroch dahin. Es hatte nicht den abgehackten Klang wie Europa, Amerika, Kanada. Die Vokale waren übermächtig, schliefen mit dem S und N auf der Karte. Ich rannte nach Asien, und alles würde sich ändern. Es begann in dem Augenblick, als ich inmitten meines komfortablen, geordneten Lebens wild tanzte und lachte. Neben dem Kühlschrank sitzend, versuchte ich, ein paar der Fragmente, die ich über meinen Vater, meine Großmutter wußte, mitzuteilen. »Woran starb deine Großmutter eigentlich?« »An einer natürlichen Ursache.« »Welche?« »Überschwemmung.« Und dann riß mich eine weitere Welle der Party mit sich.
Nachmittage in Jaffna
Viertel nach zwei. Ich sitze in dem riesigen Wohnraum des alten Gouverneurssitzes in Jaffna. Die Wände, vor ein paar Jahren in einem warmen Rosenrot getüncht, ziehen sich links und rechts von mir ungeheuer lang hin und bis hinauf zu der weißen Decke. Als die Holländer dieses Haus bauten, verwendeten sie Eiweiß, um die Wände zu tünchen. Die Türen sind sechs Meter hoch, als warteten sie auf den Tag, an dem eine Akrobatenfamilie von Raum zu Raum gehen wird, seitwärts, ohne daß der eine von des anderen Schulter steigen muß.
Der Ventilator hängt an einem langen Stab und dreht sich lethargisch, die Flügel leicht geneigt, um die Luft einzufangen, die er durch das Zimmer fächelt. Wie mechanisch der Ventilator auch in seinen Bewegungen ist, die Beschaffenheit der Luft richtet sich nicht nach dem Metronom. Die Luft stößt in Böen unregelmäßig auf meine Arme, mein Gesicht und dieses Blatt Papier.
Das Haus wurde um 1700 erbaut und ist das schönste Gebäude in dieser Nordregion Ceylons. Obwohl es innen riesig ist, sieht es von außen bescheiden aus, wie es da in einer Ecke des Forts klebt. Um das Gebäude zu Fuß, mit Auto oder Fahrrad zu erreichen, muß man eine Brücke über den Graben passieren, an den zwei Wachen vorbei, die unglücklicherweise genau dort stehen müssen, wo sich die Sumpfgase sammeln, und über den Hof des Forts. Hier, in diesem geräumigen Zentrum der labyrinthischen holländischen Verteidigungsanlagen aus dem achtzehnten Jahrhundert, sitze ich auf einem der gewaltigen Sofas in der geräuschvollen Nachmittagsstille, während der Rest des Hauses schläft.
Den Vormittag habe ich mit meiner Schwester und meiner Tante Phyllis verbracht, um dem Wirrwarr der Verwandtschaftsbeziehungen unter meinen Vorfahren nachzuspüren. Eine Zeitlang saßen wir in einem der Schlafzimmer, auf zwei Betten und einen Sessel gefläzt. Im dunklen Pendant dieses Schlafzimmers, in einem anderen Flügel des Hauses, spukt es angeblich. Als ich das klamme Zimmer betrat, sah ich die Moskitonetze wie die Kleider erhängter Bräute in der Luft schweben, sah die Skelette der Betten ohne ihre Matratzen und verließ das Zimmer, ohne mich noch einmal umzudrehen.
Später zogen wir drei ins Eßzimmer um, und meine Tante kramte allgemein bekannte Ereignisse aus ihrem Gedächtnis hervor. Sie ist der Minotaurus bei dieser langen Rückreise — all diese Reisevorbereitungen, die Fahrt durch Afrika, dann vor kurzem die siebenstündige Bahnfahrt von Colombo nach Jaffna, die Wachen, die hohen Steinmauern und jetzt diese träge Höflichkeit der Mahlzeiten, Tee, ihr bester Brandy am Abend für meinen schwachen Magen —, der Minotaurus, der den Ort bewohnt, an dem man selbst vor Jahren lebte, und der einen mit Unterhaltungen über den ursprünglichen Kreis der Liebe überrascht. Ich mag sie besonders gern, weil sie sich immer gut mit meinem Vater verstand. Spricht jemand anders, so schweifen ihre Augen zur Zimmerdecke, als würde sie die Architektur dort zum erstenmal bemerken, als würde sie nach Stichworten für Geschichten suchen. Wir müssen uns immer noch erholen von ihrem fröhlichen Resümee über Leben und Tod eines mißratenen Ondaatje, der »von seinem eigenen Pferd in Stücke gerissen wurde«.
Schließlich setzen wir uns in die Rohrstühle auf der Veranda, die sich über fünfzig Meter an der Hausfront entlangzieht. Von zehn bis Mittag sitzen wir da, reden und trinken eiskalten Palmyrah-Toddy aus einer Flasche, die wir im Dorf abfüllen ließen. Palmyrah-Toddy ist ein Getränk, das wie Kautschuk riecht und aus dem Saft von ausgepreßten Kokosnußblüten besteht. Wir nippen langsam und spüren, wie es im Magen weitergärt.
Gegen zwölf döse ich eine Stunde, stehe dann auf und esse Krabbencurry zu Mittag. Es hat keinen Sinn, bei diesem Gericht Gabel und Löffel zu benutzen. Ich esse mit den Händen, schaufle den Reis mit dem Daumen in den Mund, zerbeiße die Schalen mit den Zähnen. Danach frische Ananas.
Doch am meisten liebe ich die Nachmittagsstunden. Jetzt ist es fast Viertel vor drei. In einer halben Stunde werden die anderen aus ihrem Schlaf erwachen, und aufs neue werden verwickelte Unterhaltungen beginnen. Im Herzen dieses zweihundertfünfzig Jahre alten Forts werden wir Anekdoten und verblaßte Erinnerungen austauschen, werden versuchen, sie mit geordneten Daten und Randbemerkungen aufzublähen und alle miteinander zu verknüpfen, als bauten wir einen Schiffsrumpf. Keine Geschichte wird nur ein einziges Mal erzählt. Ob bloße Erinnerung oder komischer, gräßlicher Skandal, wir werden eine Stunde später darauf zurückkommen und die Geschichte neu erzählen, angereichert mit Ergänzungen und diesmal auch mit ein paar wertenden Kommentaren. Auf diese Weise wird Geschichte geordnet. Den ganzen Tag über ist mein Onkel Ned, der einem Untersuchungsausschuß über Rassenunruhen vorsteht (und deswegen dieses Gebäude als Wohnung zugewiesen bekommen hat, solange er in Jaffna ist), in der Arbeit, und den ganzen Tag über präsidiert meine Tante Phyllis über die Geschichte der guten und der schlechten Ondaatjes und der Leute, mit denen sie zu tun hatten. Ihr Auge, das mittlerweile die Zimmerdecke dieses Hauses sehr gut kennt, wird plötzlich aufleuchten, und sie wird sich uns entzückt zuwenden und beginnen: »Und dann ist da noch die schreckliche Geschichte …«
Hier gibt es so viele Gespenster. In dem dunklen, moderigen Flügel, in dem die verrottenden Moskitonetze hängen, lebt die Erscheinung der Tochter des holländischen Gouverneurs. 1734 stürzte sie sich in einen Brunnen, nachdem man ihr gesagt hatte, daß sie ihren Geliebten nicht heiraten könne, und hat seitdem Generationen erschreckt, die das Zimmer mieden, in dem sie sich stumm in einem roten Kleid präsentiert. Und so wie man es vermeidet, in den Räumen zu schlafen, in denen es spukt, so vermeidet man es, sich im Wohnraum zu unterhalten, weil er so groß ist, daß jegliches gesprochene Wort in der Luft verdunstet, noch bevor es den Zuhörenden erreicht.
Die Hunde aus der Stadt, die an den Wachen vorbeigeschlichen sind, schlafen auf der Veranda — einer der kühlsten Orte in ganz Jaffna. Als ich mich erhebe, um die Geschwindigkeit des Ventilators zu regeln, stehen sie auf und trotten ein paar Meter weiter. Der Baum draußen ist voller Krähen und weißer Kraniche, die gurgeln und krächzen. Eine geräuschvolle Stille — all die neuen Geschichten in meinem Kopf, und die Vögel passen ganz genau dazu, doch sie schreien einander an und segeln ab und zu über die Köpfe der dösenden Köter hinweg.
*
In dieser Nacht werde ich keinen richtigen Traum haben, sondern eher ein Bild vor mir sehen, das sich ständig wiederholt. Ich sehe meinen eigenen angespannten Körper, der wie ein Stern ausgebreitet dasteht, und bemerke nach und nach, daß ich Teil einer menschlichen Pyramide bin. Unter mir sind andere Körper, auf denen ich stehe, und über mir sind noch welche, obwohl ich der Spitze recht nahe bin. Schwerfällig und langsam gehen wir von einem Ende des riesigen Wohnraums zum anderen. Wir alle schnattern durcheinander wie die Krähen und die Kraniche, daß man kaum ein Wort versteht. Ich fange aber doch einen Gesprächsfetzen auf. Ein gewisser Mr. Hobday fragt meinen Vater, ob er irgendwelche holländischen Antiquitäten im Hause hat. Und er antwortet: »Nun … da wäre meine Mutter.« Meine Großmutter weiter unten stößt ein wütendes Gebrüll aus. Doch in diesem Moment kommen wir an der .sechs Meter hohen Tür an, durch die wir nur hindurchpassen, wenn die Pyramide sich seitwärts dreht. In stiller Übereinstimmung ignoriert die ganze Familie die Öffnung und geht langsam durch die blaß rosenrotfarbenen Wände hindurch in den anliegenden Raum.
Eine tolle Romanze
Die Brautwerbung
Als mein Vater die Schule beendete, beschlossen seine Eltern, ihn nach England auf die Universität zu schicken. Also verließ Mervyn Ondaatje Ceylon auf dem Seeweg und traf in Southampton ein. Er legte die Aufnahmeprüfungen für Cambridge ab, schrieb einen Monat später nach Hause und teilte seinen Eltern die gute Nachricht mit, daß er im Queen’s College aufgenommen worden sei. Sie wiesen ihm das Geld für drei Jahre Universitätsausbildung an. Endlich hatte er sich gebessert. Er hatte daheim nicht gutgetan, und nun schien es, als hätte er sich zusammengerissen und diese Phase schlechten Benehmens in den Tropen hinter sich gelassen.
Nach zweieinhalb Jahren und mehreren bescheidenen Briefen über seine erfolgreiche akademische Laufbahn fanden seine Eltern heraus, daß er nicht einmal die Aufnahmeprüfung bestanden hatte und auf ihre Kosten in England lebte. Er hatte eine teure Wohnung in Cambridge bezogen und ließ das akademische Element der Universität einfach links liegen, suchte sich seine besten Freunde unter den Studenten, las Gegenwartsliteratur, ging rudern und machte sich einen Namen als jemand, der genau wußte, was in den einschlägigen Kreisen Cambridges in den zwanziger Jahren von Bedeutung und Interesse war. Er amüsierte sich prächtig, war kurze Zeit mit einer russischen Komtesse verlobt und unternahm gar eine kurze Reise nach Irland, als die Universität über die Ferien geschlossen war, angeblich, um gegen die Rebellen zu kämpfen. Niemand wußte von diesem irischen Abenteuer außer einer Tante, die eine Fotografie geschickt bekam, auf der er in Uniform posierte, verschmitzt lächelnd.
Auf die erschütternde Nachricht hin entschlossen sich seine Eltern dazu, ihn persönlich zur Rede zu stellen, also packten seine Mutter, sein Vater und seine Schwester Stephy ihre Koffer und fuhren mit dem Schiff nach England. Jedenfalls hatte mein Vater gerade noch vierundzwanzig Tage des Wohllebens in Cambridge vor sich, bevor die wütende Familie unangemeldet vor seiner Tür stand. Belemmert bat er sie herein, konnte ihnen um elf Uhr früh nur Champagner anbieten. Das beeindruckte sie nicht so, wie er erwartet hatte, und der große Krach, dem mein Großvater seit Wochen entgegengefiebert hatte, wurde durch die wirkungsvolle Angewohnheit meines Vaters, in fast vollständiges Schweigen zu verfallen und nicht den geringsten Versuch zu unternehmen, auch nur eine einzige seiner Untaten zu rechtfertigen, abgewendet, so daß es schwer war, mit ihm zu streiten. Statt dessen ging er abends zur Essenszeit für ein paar Stunden fort, kam zurück und verkündete, daß er sich mit Kaye Roseleap verlobt hatte — der engsten englischen Freundin seiner Schwester Stephy Diese Neuigkeit beschwichtigte einen Großteil der angestauten Wut gegen ihn. Stephy wechselte auf seine Seite über, und seine Eltern waren von der Tatsache beeindruckt, daß Kaye von den bekannten Roseleaps aus Dorset abstammte. Insgesamt war jeder zufrieden, und am folgenden Tag nahmen sie alle den Zug hinaus aufs Land, um die Roseleaps zu besuchen, mit Phyllis, der Cousine meines Vaters, im Schlepptau.
In jener Woche in Dorset benahm sich mein Vater tadellos. Die Schwiegereltern planten die Hochzeit, Phyllis wurde eingeladen, den Sommer mit den Roseleaps zu verbringen, und die Ondaatjes (inbegriffen mein Vater) reisten zurück nach Ceylon, um die vier Monate bis zur Hochzeit abzuwarten.
Zwei Wochen nach seiner Ankunft in Ceylon kam mein Vater eines Abends nach Hause und erklärte, daß er mit einer gewissen Doris Gratiaen verlobt sei. Der in Cambridge aufgeschobene Streit brach nun auf dem Rasen meines Großvaters in Kegalle aus. Mein Vater war gefaßt, unbeeindruckt von den diversen Komplikationen, die er anscheinend ausgelöst hatte, und hatte nicht einmal vor, den Roseleaps zu schreiben. Es war Stephy, die schrieb und eine Kettenreaktion von Briefen auslöste; einer davon ging an Phyllis und machte ihre Ferienpläne zunichte. Mein Vater versuchte es weiterhin mit seiner Technik, ein Problem aus der Welt zu schaffen, indem er ein anderes schuf. Am nächsten Tag kam er heim und erklärte, daß er sich der ceylonesischen Leichten Infanterie angeschlossen habe.
Ich weiß nicht genau, wie lange er meine Mutter vor der Verlobung kannte. Er muß ihr vor seiner Zeit in Cambridge wohl ab und zu in Gesellschaft begegnet sein, denn einer seiner besten Freunde war Noel Gratiaen, der Bruder meiner Mutter. Ungefähr zu jener Zeit kehrte Noel nach Ceylon zurück, da man ihn am Ende seines ersten Jahres in Oxford rausgeworfen hatte, weil er sein Zimmer in Brand gesteckt hatte. Zwar kam so etwas häufiger vor, doch er war noch einen Schritt weiter gegangen, hatte versucht, das Feuer zu löschen, indem er brennende Sofas und Sessel aus dem Fenster auf die Straße katapultierte und sie dann zum Fluß zerrte und hineinwarf — wo sie drei Boote versenkten, die dem Oxforder Ruderclub gehörten. Wahrscheinlich begegnete mein Vater Doris Gratiaen zum erstenmal, als er Noel in Colombo besuchte.
Um diese Zeit führten Doris Gratiaen und Dorothy Clementi-Smith in privatem Kreis radikale Tänze auf und übten täglich. Beide Frauen waren etwa zweiundzwanzig Jahre alt und waren stark von den Gerüchten über Isadora Duncans Tanzkunst beeinflußt. Nach etwa einem Jahr traten sie öffentlich auf. In Rex Daniels Tagebüchern findet sich eine Notiz über sie:
Eine Gartenparty im Park der Residenz … Bertha und ich saßen neben dem Gouverneur und Lady Thompson. Ihnen zu Ehren war eine Aufführung mit verschiedenen Darbietungen vorbereitet worden. Zuerst trat ein Bauchredner aus Trincomalee auf, dessen Nummer nicht vorher begutachtet worden war, weil er zu spät kam. Er war betrunken und begann, beleidigende Witze über den Gouverneur zu reißen. Die Darbietung wurde abgebrochen, und als nächstes traten Doris Gratiaen und Dorothy Clementi-Smith mit einer Nummer auf, die »Tanzende Bronzefiguren« betitelt war. Sie trugen Badeanzüge und hatten sich mit Goldfarbe bemalt. Der Tanz war sehr hübsch, doch die Goldfarbe löste eine Allergie aus, und am nächsten Tag waren die Mädchen über und über mit einem fürchterlichen roten Ausschlag bedeckt.
Mein Vater sah die beiden zum erstenmal in den Gärten des Deal Place tanzen. Er fuhr von seinem Elternhaus in Kegalle hinunter nach Colombo, wohnte in der Kaserne der ceylonesischen Leichten Infanterie, verbrachte die Tage mit Noel und schaute den zwei Mädchen beim Üben zu. Man erzählt sich, er sei in beide verschossen gewesen, doch Noel heiratete Dorothy, als sich mein Vater mit Noels Schwester verlobte. Wohl mehr, um meinem Vater Gesellschaft zu leisten als aus irgendeinem anderen Grund, war Noel ebenfalls in die ceylonesische Leichte Infanterie eingetreten. Diese Verlobung meines Vaters war nicht so populär wie jene mit Kaye Roseleap. Er kaufte Doris Gratiaen einen Verlobungsring mit einem riesigen Smaragd und belastete damit das Konto seines Vaters. Sein Vater weigerte sich, zu zahlen, und mein Vater drohte damit, sich zu erschießen. Schließlich wurde der Ring von der Familie bezahlt.
Mein Vater hatte in Kegalle nichts zu tun. Es war zu weit weg von Colombo und seinen neuen Freunden. Seine Stellung in der Leichten Infanterie brachte nur wenige Pflichten mit sich, war fast ein Hobby Oft fiel ihm mitten während einer Party in Colombo plötzlich ein, daß er diese Nacht der Offizier vom Dienst war, und er fuhr mit einer Wagenladung voller Männer und Frauen, die ein Mitternachtsschwimmen bei Mount Lavinia planten, in die Garnison, stieg im Abendanzug aus, inspizierte die Wachen, sprang zurück in den Wagen voller lachender und betrunkener Freunde und verschwand. Aber in Kegalle war er frustriert und einsam. Einmal bekam er den Wagen und wurde gebeten, Fisch zu besorgen. Vergiß bloß den Fisch nicht! sagte seine Mutter. Zwei Tage später traf bei seinen Eltern ein Telegramm aus Trincomalee ein, meilenweit entfernt am Nordende der Insel, in dem stand, daß er den Fisch habe und bald zurück sei.
Mit seinem ruhigen Leben in Kegalle war es allerdings vorbei, als Doris Gratiaen ihm schrieb, sie wolle die Verlobung lösen. Es gab kein Telefon, was also hieß, daß man nach Colombo fahren mußte, um herauszufinden, was los war. Doch mein Großvater, der wegen des Ausflugs nach Trincomalee tobte, verweigerte ihm den Wagen. Schließlich bot ihm Aelian, der Bruder seines Vaters, eine Mitfahrgelegenheit. Aelian war ein freundlicher und umgänglicher Mensch, und mein Vater war gelangweilt und außer sich. Die Kombination erwies sich beinahe als Katastrophe. Mein Vater war sein Lebtag noch nie an einem Stück nach Colombo gefahren. Es gab eine Reihe von Rasthäusern, an denen man anhalten mußte, also war Aelian gezwungen, alle zehn Meilen einzukehren und einen Drink zu nehmen, zu höflich, sich seinem Neffen zu widersetzen. Als sie in Colombo ankamen, war mein Vater sehr betrunken und Aelian ein wenig, und es war ohnehin zu spät, um Doris Gratiaen aufzusuchen. Mein Vater zwang seinen Onkel, in der Messe der Infanteriegarnison zu bleiben. Nach einer ausgedehnten Mahlzeit und noch mehr Alkohol erklärte mein Vater, daß er sich jetzt erschießen müsse, weil Doris die Verlobung gelöst habe. Aelian hatte allergrößte Mühe, besonders weil er selbst ziemlich betrunken war, alle Gewehre in der Kaserne der ceylonesischen Leichten Infanterie zu verstecken. Am nächsten Tag wurden die Probleme gelöst, und sie verlobten sich erneut. Sie heirateten im darauffolgenden Jahr.
11. April 1932
»Ich erinnere mich noch an die Hochzeit … Sie sollten in Kegalle heiraten, und wir fuhren zu fünft in Erns Fiat. Auf halbem Weg zwischen Colombo und Kegalle stießen wir auf einen Wagen, der im Graben gelandet war, und daneben stand der Bischof von Colombo, der, wie jedermann wußte, ein miserabler Fahrer war. Er sollte die beiden trauen, also mußten wir ihn mitnehmen.
Zuerst einmal mußte sein Gepäck sorgfältig verstaut werden, weil seine Robe nicht zerknittern durfte. Dann seine Mitra und das Szepter und diese speziellen Schuhe und was nicht alles. Und weil wir so wenig Platz hatten und ein Bischof bei niemandem auf dem Schoß sitzen konnte — und eigentlich auch niemand auf dem Schoß eines Bischofs —, mußten wir ihn den Fiat lenken lassen. Wir saßen den Rest der Fahrt über zusammengequetscht da und hatten furchtbare Angst!«
Flitterwochen
Die Nuwara-Eliya-Tennismeisterschaften waren vorüber, und in Colombo setzte der Monsun ein. Die Schlagzeile in den lokalen Blättern lautete: »Lindberghs Baby gefunden — tot!« Fred Astaires Schwester Adele heiratete, und der 13. Präsident der Französischen Republik wurde von einem Russen erschossen. Die Leprakranken von Colombo traten in den Hungerstreik, eine Flasche Bier kostete eine Rupie, und verwirrende Gerüchte besagten, daß Damen in Wimbledon in Shorts spielen würden.
In Amerika versuchten noch immer Frauen, die Leiche Valentinos aus seinem Sarg zu stehlen, und eine Frau in Kansas ließ sich von ihrem Mann scheiden, weil der sie nicht in der Nähe des Valentino-Mausoleums wohnen lassen wollte. Der berühmte Impresario C. B. Cochran erklärte, daß »das ideale Mädchen von heute — die Venus unserer Tage — weder dünn noch mollig sein dürfe, sondern die Formen eines Windhundes haben müsse«. Es ging das Gerücht, daß die Zahl der Pythons in Afrika abnehme.
Charlie Chaplin besuchte Ceylon. Er mied die Öffentlichkeit und wurde nur dabei gesehen, wie er kandysche Tänze beobachtete und fotografierte. Die Filme, die in den Kinos von Colombo gezeigt wurden, waren »Love Birds«, »Caught Cheating« und »Forbidden Love«. In der Mandschurei wurde gekämpft.
Historische Beziehungen
Die frühen zwanziger Jahre waren eine geschäftige und kostspielige Zeit für meine Großeltern. Den größten Teil des Jahres verbrachten sie in Colombo, und in den heißen Monaten April und Mai zogen sie nach Nuwara Eliya. In diversen Tagebüchern der Familie gibt es Hinweise auf die Zeit, die man im »Hochland« verbrachte, weit weg von der Hitze im Flachland. Automobile verließen Colombo und legten die ermüdende Fünf-Stunden-Fahrt mit kochenden Kühlern zurück, während sie die kurvenreiche Straße in die Berge hinauffuhren. Bücher und Pullover und Golfschläger und Gewehre wurden in Koffern verstaut, Kinder aus der Schule genommen, Hunde gebadet und für die Fahrt vorbereitet.