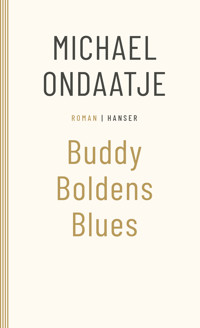Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus den tiefen Wäldern Kanadas kommt Patrick Lewis in den zwanziger Jahren nach Toronto, in die Stadt, die vor Vitalität aus allen Nähten platzt. Zunächst ein Fremder im eigenen Land, wächst er rasch in eine immer unüberschaubarer werdende Welt hinein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Michael Ondaatje
In der Haut eines
Löwen
Roman
Aus dem Englischen von
Peter Torberg
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel
In the Skin of a Lion
bei McClelland and Stewart in Toronto.
Ich danke der John Simon Guggenheim Foundation, die mich beim Schreiben dieses Buches mit einem Stipendium unterstützte, sowie dem Ontario Arts Council, dem El Basha Restaurant, der Multicultural History Society of Ontario und dem Glendon College der York University.
Gleichfalls danken möchte ich Marg Teasdale, George und Ruth Grant, Donya Peroff, Rick Haldenby, Paul Thompson und Lillian Petroff und besonders Ellen Seligman.
***
Dies ist ein Roman, und ich habe mir im Umgang mit Daten und Orten gewisse Freiheiten erlaubt.
ISBN 978-3-446-24830-4
© Michael Ondaatje 1987
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München Wien 1990
Umschlag: Helmut Schade unter Verwendung eines Bildes von Christiopher McCollins
Satz: Fotosatz Reinhard Amann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Dieses Buch ist dem Andenken an
Michel Lambeth, Sharon Stevenson und Bill
und Michal Acres
und Linda und Sarah und David
gewidmet.
Die glücklichen Bürger Uruks sollen trauern
um dich, ich aber bleib, da du dahingegangen,
zurück mit wirrem Haar, und will das Land durchirren,
gekleidet in die Haut eines Löwen.
Aus dem Gilgamesch-Epos
Nie wieder wird eine einzige Geschichte so erzählt werden,
als wäre sie die einzige.
John Berger
Dies ist eine Geschichte, die ein junges Mädchen in einem Auto in den frühen Morgenstunden aufsammelt. Sie hört zu und stellt Fragen, während der Wagen durch die Nacht rollt. Draußen liegt das unberührte Land. Der Mann, der am Steuer sitzt, könnte behaupten: »Auf dem Feld dort steht eine Burg«, und es wäre möglich, daß sie ihm glaubt.
Sie hört dem Mann zu, während er einzelne Bruchstücke der Geschichte aufliest, zusammenbringt und versucht, sie alle in seinen Armen zu tragen. Und er ist müde; manchmal erzählt er ebenso unkonzentriert, wie er die Straße beobachtet, dann wieder ist er überdreht – »Verstehst du?« Er wendet sich ihr im fahlen Licht des Tachometers zu.
Sie fahren die vier Stunden bis Marmora unter sechs Sternen und einem Mond.
Sie bleibt wach, um ihm Gesellschaft zu leisten.
Inhalt
Erstes Buch
Kleine Samen 13
Die Brücke 31
Der Sucher 57
Zweites Buch
Palast der Läuterung 107
Reue 167
Drittes Buch
Caravaggio 179
Maritimes Theater 207
Erstes Buch
Kleine Samen
Wenn er früh genug wach ist, sieht der Junge die Männer, wie sie am Farmhaus vorbei die First Lake Road hinuntergehen. Dann steht er am Schlafzimmerfenster und schaut: zwischen dem Ahorn und dem Walnußbaum hindurch kann er zwei oder drei Laternen erkennen. Er hört ihre Stiefel auf dem Kies. Dreißig Holzfäller, dunkel gekleidet, mit Äxten und kleinen Essenspaketen am Gürtel. Der Junge geht die Treppe hinunter und stellt sich an eines der Küchenfenster, von wo er die Straße überblicken kann. Sie gehen von rechts nach links. Schon jetzt, noch bevor die Sonne mit ihrer Kraft zum Vorschein kommt, scheinen sie erschöpft.
Manchmal, das weiß er, trifft diese Gruppe von Fremden auf die Kühe, die von der Weide zum Melken getrieben werden, und dann bleiben sie still und höflich am Straßenrand stehen und halten die Laternen hoch (ein Schritt zurück, und sie stecken in einer knietiefen Schneewehe), um die Kühe auf dem schmalen Weg gemächlich an sich vorbeiziehen zu lassen. Ab und zu legen die Männer ihre Hände auf die Flanken der Tiere und nehmen ihre Wärme auf, während sie vorbeitrotten. Sie legen ihre dünn behandschuhten Hände auf diese schwarzweißen Geschöpfe, die man in der letzten Dunkelheit der Nacht kaum ausmachen kann. Sie müssen dabei zurückhaltend sein, dürfen kein Zeichen von Aggression oder Anspruch von sich geben. Das Land gehört nicht ihnen, sondern dem Besitzer der Tiere.
Die Holsteinerkühe trotten an der schweigsamen Reihe der Männer vorbei. Der Farmer, der den Kühen folgt, nickt. In den Wintermonaten begegnet er dieser seltsamen Gemeinschaft fast jeden Morgen; diese Gesellschaft ist ihm stiller Trost in der Dunkelheit um fünf Uhr früh – denn über eine Stunde lang hat er die Kühe zusammengetrieben, um sie zum Melken zu führen.
Der Junge, der Zeuge dieser Prozession ist und sogar davon träumt, hat auch die Männer beobachtet, wenn sie eine Meile weiter weg unter den grauen Bäumen arbeiten. Er hat ihre hallenden Rufe gehört, hat ihre Äxte gehört, die in das kalte Holz schlagen wie in Metall, hat das Feuer am Fluß gesehen, wo das Wasser einsam und grau unter dem dünnen Eis ruht.
Der Schweiß rinnt zwischen ihren harten Körpern und den kalten Kleidern hinab. Einige sterben an Lungenentzündung, andere an dem Schwefel in ihren Lungen, der aus den Mühlen stammt, in denen sie zu anderen Jahreszeiten arbeiten. Sie schlafen in den Baracken hinter dem Hotel Bellrock und haben nur wenig Kontakt mit der Stadt.
Weder der Junge noch sein Vater sind jemals in diesen dunklen Räumen gewesen, in dieser Wärme, die der Geruch von Männern ist. Ein roh gezimmerter Tisch, vier Schlafstellen, ein Fenster, groß wie ein Torso. In jedem Dezember werden die Baracken aufgestellt und im darauffolgenden Frühling wieder abgerissen. Niemand in der Stadt weiß so recht, woher die Männer gekommen sind. Es braucht jemand anderen, viel später, der dem Jungen das erzählt. Kontakt zur Stadt haben die Holzfäller nur, wenn sie auftauchen, um den Fluß entlangzugleiten, auf selbstgemachten Schlittschuhen, mit Kufen aus alten Messerklingen.
Für den Jungen ist das Ende des Winters gleichbedeutend mit einem blauen Fluß, mit dem Verschwinden dieser Männer.
***
Er sehnt sich nach den Sommernächten, nach dem Moment, wenn er die Lampen ausschaltet, sogar den kleinen cremefarbenen Trichter im Flur neben dem Zimmer, in dem sein Vater schläft. Dann liegt das Haus im Dunkeln, nur das helle Licht in der Küche brennt noch. Er setzt sich an den langen Tisch, blättert in seinem Geographiebuch mit den Weltkarten, den weißen Bögen der Meeresströmungen und probiert ganz für sich die Namen aus, formt das Exotische mit den Lippen. Kaspisches Meer. Nepal. Durango. Er klappt das Buch zu und fährt mit den Handflächen darüber; er tastet über die Prägung des körnigen Einbands mit den bunten Farben, die eine Landkarte Kanadas bilden.
Später geht er mit vor dem Körper ausgestreckter Hand durch das dunkle Wohnzimmer und stellt das Buch zurück ins Regal. Er steht da in der Dunkelheit und reibt sich die Arme, um wieder Leben in seinen Körper zu bringen. Er zwingt sich, wach zu bleiben, sich Zeit zu nehmen. Es ist noch immer heiß, und er ist nackt bis zur Hüfte. Er geht zurück in die helle Küche und wandert von einem Fenster zum anderen, um nach den Nachtfaltern zu sehen, die am Fliegengitter kleben, an der Helligkeit haften. Von jenseits der Felder werden sie dieses eine beleuchtete Zimmer gesehen haben und darauf zugeflogen sein. Erkundung einer Sommernacht.
Käfer, Heuschrecken, Grashüpfer, rostdunkle Falter. Patrick beobachtet diese Dinge, die sich in der warmen Luft über der Erdoberfläche ihren Weg gesucht und sich mit einem gedämpften, klatschenden Geräusch auf das Gitter geworfen haben. Er hat sie beim Lesen gehört; seine Sinne sind an diese Geräusche gewöhnt. Jahre später wird er in der Bibliothek von Riverdale lernen, wie die glänzenden Blatthornkäfer das Unterholz zerstören und wie sich die Blütenkäfer vom Saft verfaulenden Holzes oder jungen Maises ernähren. Und plötzlich werden diese Nächte Ordnung und Form erhalten. Nachdem er ihnen Phantasienamen gegeben hat, wird er ihre offiziellen Titel lernen, als überflöge er die Gästeliste eines Balls – Der Grashüpfer! Der Erzbischof von Canterbury!
Selbst die richtigen Namen sind wunderschön. Bernsteinflügliger Wasserläufer. Buschgrille. Den ganzen Sommer lang registriert er ihre Besuche und skizziert die Rückkehrer. Ist es dasselbe Tier? Er zeichnet die orangefarbenen Flügel des Spanners in sein Notizbuch, die Mondmotte, das sanfte Braun des Buchenspinners – wie Kaninchenfell. Er wird das Fliegengitter nicht öffnen und ihre pollenbestäubten Körper nicht fangen. Das hat er einmal gemacht, und das panische Flattern des Falters – ein braunrosa Etwas, das farbigen Staub auf seinen Fingern hinterließ – erschreckte sie beide.
Aus der Nähe betrachtet sind sie prähistorisch. Die Insektenkiefer mahlen. Fressen sie irgend etwas Winziges, oder geschieht es unbewußt – so wie sein Vater auf dem Feld an seiner Zunge kaut. Das Küchenlicht scheint durch ihre porösen Flügel; selbst die dickeren Geschöpfe, wie die apfelgrüne Blattlaus, scheinen aus Puder zu bestehen.
Patrick zieht eine Okarina aus der Tasche. Draußen wird er seinen Vater nicht wecken, die Töne werden einfach in die Arme des Ahorns hinaufschweben. Vielleicht kann er diese Wesen verzaubern. Vielleicht sind sie gar nicht stumm, vielleicht kann er sie mit seinen Ohren nur nicht hören. (Als er neun war, fand ihn sein Vater auf dem Boden liegend, mit einem Ohr auf der harten Kruste eines Kuhfladens, in dem er mehrere Käfer klopfen und krabbeln hörte.) Er kennt den kraftvollen Ruf, den die kleinen Körper der Zikaden hervorbringen, doch er sucht das Zwiegespräch – die Sprache der Libellen; sie brauchen etwas, das ihr Atmen übersetzt, so wie er die Okarina braucht, um sich eine Stimme zu geben; irgend etwas, um damit über die Mauer dieses Ortes zu springen.
Kehren sie jede Nacht zurück, um ihm etwas zu zeigen? Oder verfolgt er sie? So wie er sich von dem dunklen Haus entfernt und auf der Schwelle der leuchtenden Küche zu den leeren Feldern sagt: Hier bin ich. Kommt und besucht mich.
Er war in eine Gegend hineingeboren worden, die bis 1910 auf keiner Landkarte verzeichnet war, obwohl seine Familie dort bereits seit zwanzig Jahren lebte und arbeitete und das Land seit 1816 besiedelt war.
Im Schulatlas ist der Ort blaßgrün und namenlos. Der Fluß schlüpft aus einem See ohne Namen und ist eine einfache blaue Linie, bis er fünfundzwanzig Meilen weiter südlich zum Napanee wird, und schließlich wird er, nur wegen der Holzfällerei, Depot Creek genannt. »Deep Eau.«
Sein Vater arbeitet auf zwei oder drei Farmen, schlägt Holz, macht Heu, treibt das Vieh zusammen. Zweimal täglich überqueren die Kühe den Fluß – am Morgen trotten sie zu dem Land, das südlich des Creek liegt, und am Nachmittag werden sie zum Melken zusammengetrieben. Im Winter werden die Tiere die Straße hinunter zu einer Scheune geführt, doch einmal zog es eine Kuh, die zur oberen Weide zurückwollte, zum Fluß.
Zwei Stunden lang vermissen sie sie nicht, und dann errät sein Vater, wo sie geblieben ist. Er rennt zum Fluß und schreit dem jungen Patrick zu, er solle mit den Ackergäulen folgen. Patrick sitzt ohne Sattel auf einem der Pferde und führt das andere am Zügel, treibt sie vorwärts durch den tiefen Schnee. Durch die kahlen Bäume sieht er seinen Vater, der die Böschung zum Badeloch hinabrutscht.
In der Flußmitte, halb ins Eis eingebrochen, ist die Holsteinerkuh des Nachbarfarmers. Da gibt es keine Farbe. Die trockenen Stengel der verblühten Königskerzen, graue Bäume und der nun saubere, weiße Sumpf. Sein Vater kriecht mit einem Seil über der Schulter auf allen vieren übers Eis auf die schwarzweiße Gestalt zu. Die Kuh schreckt auf, bricht noch tiefer ins Eis ein, und das kalte Wasser schwappt hoch. Hazen Lewis hält inne, redet dem Tier gut zu und kriecht dann weiter. Er muß das Seil zweimal unter dem Körper hindurchbekommen. Patrick bewegt sich langsam vorwärts, bis er auf der anderen Seite der Kuh kniet. Sein Vater legt die linke Hand auf den Nacken des Tiers und steckt seinen rechten Arm so tief er kann unter den Körper ins eiskalte Wasser. Auf der anderen Seite taucht Patrick seinen Arm ein und schwenkt ihn hin und her, um an das Seil zu kommen. Sie können einander nicht erreichen. Patrick liegt auf dem Eis, damit Arm und Schulter noch tiefer kommen; sein Handgelenk wird schon taub, und er denkt, daß er das Seil bald nicht mehr fühlen wird, selbst wenn es ihn berührt.
Die Kuh bewegt sich, und das Wasser dringt durch den Mantel des Jungen bis zur Brust. Sein Vater richtet sich auf, und sie knien zu beiden Seiten der Kuh, schwingen ihre nassen Arme und schlagen sie sich gegen die Brust. Sie reden kein Wort. Sie müssen so schnell wie möglich arbeiten. Sein Vater legt die bloße Hand auf das Ohr der Kuh, um sich daran zu wärmen. Er legt sich seitlich auf das Eis und taucht erneut seinen Arm ein, das Wasser ist nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Wie in einem Spiegelbild taucht Patrick seinen Arm ins Wasser, doch wieder kann er das Seil nicht greifen. »Ich tauche jetzt unter. Du mußt schnell zupacken«, sagt sein Vater, und Patrick sieht, wie sich der Oberkörper seines Vaters krümmt und sein Kopf ins eisige Wasser taucht. Patricks Hand packt den freien Arm seines Vaters oben auf der Kuh und hält ihn fest.
Dann taucht Patrick mit dem Kopf unter Wasser und holt weit aus. Unter der Kuh berührt er das Handgelenk seines Vaters. Er wagt nicht loszulassen und bewegt seine Hand vorsichtig, bis er das dickgeflochtene Seil gepackt hat. Er zieht daran, doch es rührt sich nicht. Es wird ihm klar, daß sein Vater beim tieferen Eintauchen irgendwie mit seinem Körper über das Seil gekommen ist und nun darauf liegt. Patrick will nicht loslassen, obwohl er bald keine Luft mehr hat. Sein Vater kommt nach Luft schnappend aus dem Wasser, liegt rücklings auf dem Eis und atmet schwer gegen den Schmerz in den Augen an; dann merkt er plötzlich, worauf er liegt, rollt zur Seite, und das Seil ist frei. Patrick zieht, nimmt dabei seinen Fuß zu Hilfe, um sich aus dem Wasser zu stemmen, und schlittert übers Eis, weg von der Kuh.
Er setzt sich auf, sieht seinen Vater und hebt seine Arme in einer Siegesgeste. Sein Vater versucht verzweifelt, das Wasser aus Ohren und Augen zu bekommen, bevor es an der Luft gefriert; Patrick benutzt seinen trockenen Ärmel, zieht die Hand in die Jacke zurück und stopft sich den Stoff in die Ohren. Er spürt schon, wie sich auf Nacken und Kinn Eis bildet, aber er macht sich darüber keine Gedanken. Sein Vater hastet ans Ufer und kehrt mit einem zweiten Seil zurück. Er knotet es an das erste, und Patrick zieht es auf seiner Seite unter der Kuh hindurch, so daß nun beide Seile um die Kuh gebunden sind.
Patrick sieht auf – sieht den grauen Felsen am Badeloch, die Eiche, die sich über dem schmutzigen Gestrüpp im Schnee erhebt. Der Himmel ist klar und blau. Es kommt dem Jungen vor, als hätte er diese Dinge seit Jahren nicht gesehen. Bis zu diesem Augenblick hat es nur seinen Vater gegeben, die schwarzweiße Gestalt der Kuh und das furchtbare schwarze Wasser, das ihm in den Augen brannte, als er sie dort unten öffnete.
Sein Vater macht die Seile an den Pferden fest. Der Kopf der halb versunkenen Kuh, mit einem riesigen rollenden Auge, scheint unbeteiligt. Patrick wartet darauf, daß sie voller Langeweile wiederzukäuen beginnt. Er hebt ihre Lippe und legt seinen kalten Finger an das Zahnfleisch, um Wärme zu stehlen. Dann kriecht er zum Ufer zurück.
Jeder von ihnen hält ein Pferd am Zügel, und sie feuern sie an. Die Pferde zögern nicht einmal, trotz des Gewichts, das sie ziehen müssen. Vom Ufer aus sieht er die aus dem Maul der Kuh hängende Zunge, und zum erstenmal ändert sich ihr selbstzufriedener Ausdruck, sie wird unruhig, während sie ans Ufer gezogen wird und das Eis zersplittert, durch das sie sich einen Weg bahnt. Etwa zehn Fuß vom Ufer entfernt, dort, wo das Eis dicker wird, widersetzt sich ihr Körper dem Zug des Seils. Die Pferde bleiben stehen. Er und sein Vater geben ihnen die Peitsche, und sie fallen in Trab. Und dann taucht die ganze Kuh, die vier Beine steif in die Höhe gestreckt, wie durch Zauberei aus dem Eis auf und wird unnachgiebig seitwärts ans Ufer und über die braunen Königskerzen geschleift.
Sie lassen die Pferde laufen. Er und sein Vater versuchen, die Knoten in den Seilen um die Kuh zu lösen, doch das ist zu schwer, und sein Vater zieht ein Messer und schneidet die Seile durch. Das Tier liegt schnaubend da, Dampf steigt auf in der kalten Luft; dann kommt es mühsam auf die Beine, steht und schaut sie an. Mehr als über irgend etwas sonst wundert sich Patrick über seinen Vater, der davon besessen ist, nichts zu vergeuden. So oft hat er dem Jungen eingetrichtert, Seil zu sparen. Immer aufknoten. Nie zerschneiden! Das Messer zu ziehen und das Seil in Stücke zu schneiden, ist ein empörender, verschwenderischer Akt.
Sie laufen nach Hause zurück, sehen sich immer wieder nach der Kuh um. Der Junge keucht. »Wenn sie wieder ins Eis einbricht, rühr’ ich keinen Finger.« »Ich auch nicht«, ruft sein Vater lachend. Es ist schon fast dunkel, als sie den Hintereingang erreichen, und der Magen tut ihnen weh.
Im Haus zündet Hazen Lewis die Petroleumlampe an und schichtet Holz für ein Feuer auf. Der Junge zittert während des Essens, und der Vater sagt ihm, er könne bei ihm schlafen. Später im Bett beachten sie einander nicht, teilen sich unter der Bettdecke nur die Wärme. Sein Vater liegt so still, daß Patrick nicht weiß, ob er schläft oder wach ist. Der Junge blickt zur Küche und zu dem dort verglimmenden Feuer.
Er denkt sich durch den Winter, bis er ein weißer Mittsommerschatten neben seinem Vater ist. Im Sommer träufelt sein Vater Benzin auf die Raupenkokons und zündet sie an. Floff. Die grauen Spinnwebenhäute zerstieben in Flammen. Raupen fallen ins Gras, und der beißende Brandgeruch füllt den Gaumen des Jungen. Im Abendlicht durchsuchen sie beide gewissenhaft ein Feld. Patrick deutet auf ein Nest, das sein Vater übersehen hat, und gemeinsam ziehen sie weiter in das Weideland hinaus.
Er ist fast eingeschlafen. In der Dunkelheit züngelt noch eine Flamme auf und vergeht dann.
***
Im Schuppen zog Hazen Lewis die Umrisse des Jungen mit grüner Kreide auf die Bretterwand. Dann spannte er Drähte zwischen den Umrißlinien, als zöge er die Adern nach. Muskeln aus Kordit und die Wirbelsäule ein Nebenfluß der Schwarzpulverzündschnur. So erinnert sich der Junge an seinen Vater, wie er den Umriß des Jungen betrachtet, nachdem dieser eben zurückgetreten ist, während die Zündschnur brennend zischt und ein Stück Balken herausgesprengt wird, wo zuvor sein Kopf gewesen ist.
Hazen Lewis war ein scheuer, zurückhaltender Mann; er hatte sich von der Welt zurückgezogen und interessierte sich nicht für das Leben und Treiben der Zivilisation außerhalb seines Blickfelds. Er bestieg sein Pferd, als wäre es die Eisenbahn, als wäre es nicht aus Fleisch und Blut.
In den Wintermonaten brachte Patrick das Essen in das Gebiet nördlich des Flusses, wo sein Vater, so klein in diesen weißen Räumen, den ganzen Tag über Bäume fällte, allein. Und dann, als Patrick fünfzehn war, machte sein Vater den entscheidenden Schritt in seinem Leben. Irgendwann beim Schlagen der Hemlocktanne, nur die Axt und das hallende Echo waren zu hören, muß er sich vorgestellt haben, wie die Bäume und der gefrorene Boden und die Ahornsirupöfen auf einmal explodieren und der Schnee von allen Ästen im Wald herunterfällt. Er hörte am frühen Nachmittag auf zu arbeiten, ging nach Hause, zog die Bärenfellstiefel aus und stellte die Axt für immer beiseite. Er ließ sich Bücher kommen und fuhr wegen einiger Sachen nach Kingston. Die Explosion, die er im Wald gesehen hatte, war, als er die Axt aus der Hemlocktanne zog, nur eine Idee gewesen. Er kaufte Dynamit und Zündhütchen und Schnüre, malte Diagramme auf die Wände im Schuppen; dann trug er den Sprengstoff in den Wald. Er legte die Sprengladungen an Felsen und Eis und Bäume. Das Zündhütchen spie eine Flamme in die Dynamitstange, und er beobachtete, wie bei der Detonation der Schnee von den Ästen fiel. Das klaffende Loch im Boden stellte ihm die Wucht und den Radius der Explosion bildlich dar.
Bevor der Frühling richtig anfing, fuhr Hazen Lewis hinunter zum Hauptbüro der Rathbun Timber Company. Er führte seine Fähigkeiten vor, bewegte einen Baumstamm exakt zu dem Platz, den er vorherbestimmt hatte, indem er eine halbe Tonne Schiefer sprengte, und wurde zusammen mit den Flößern angeheuert. Er hatte sich in jenem Wirtschaftszweig eine Arbeit besorgt, der entlang der Depot Lakes und des Napanee blühte. Als die Firma ein paar Jahre später dichtmachte, zog er weiter und arbeitete als Sprengmeister im Feldspatabbau in der Gegend um Verona und Godfrey, in den Richardson-Minen. Die längste Rede seines Lebens hielt er vor den Leuten von Rathbun, als er ihnen sagte, was er konnte, und daß es, wenn man ihn frage, nur zwei Berufe im Holzgewerbe gebe, die irgendeinen Sinn hätten – Sprengmeister und Koch.
Im Winter fanden sich die Fäller an den hintereinander liegenden Depot Lakes – vom ersten bis zum fünften Depot – ein, verschwanden in den Barackenlagern und drangen zwanzig Meilen weit zu Fuß in ein Gebiet ein, das ihnen unbekannt war. Den ganzen Februar und März hindurch wuchsen auf den Seen die Pyramiden der Stämme, die auf Schlitten dorthin gebracht worden waren. Schon vor Sonnenaufgang arbeiteten die Männer – in den schlimmsten Stürmen, bei Temperaturen von weit unter minus zwanzig Grad – und hörten erst um sechs Uhr abends auf. Die große Quersäge mit den aufstehenden Griffen legte die Fichten um. Waldarbeiter, tief gebeugt, sägten die Stümpfe knapp über dem Boden ab. Das war Schwerstarbeit. Manche benutzten die Öertersäge. Damit konnte man Fichten doppelt so schnell zersägen wie mit der Quersäge, und wenn sie das nächste Lager aufschlugen, rollten sie die schmalen Sägeblätter zusammen und schnitzten sich im nächsten Wald neue Griffe.
Im April begann mit der Eisschmelze auf den Seen die Flößerei. Das war die leichteste und zugleich gefährlichste Arbeit. Zwischen Bellrock und Napanee waren an allen Flußengen Männer postiert. An den Brücken und Flußfelsen standen stets zwei oder drei Mann für den Fall eines Staus. Fischte man einen verkeilten Baumstamm nicht rechtzeitig heraus, dann türmte sich das Gewicht der anderen dahinter auf, und der ganze Fluß war blockiert. Dann blieb den Flößern nichts anderes übrig, als den Meldereiter loszuschicken, um den Sprengmeister zu holen. Ein acht Meter langer Baumstamm schoß urplötzlich aus dem Wasser, streifte einen Mann und zerschmetterte ihm den Brustkorb.
Hazen Lewis und sein Sohn ritten zu dem Flußfelsen. Der große Mann wanderte um die gestauten Stämme herum. Er bohrte einen Dynamitstöpsel hinein und setzte die Zündschnur in Brand. Dann ließ er den Jungen das Warnsignal geben, die Baumstämme flogen durch die Luft ans Ufer, und der Fluß war wieder frei.
In schwierigen Fällen zog Patrick sich aus und schmierte sich mit dem Getriebeöl der Dampfmaschine ein. Er tauchte in das aufgewühlte Wasser und schwamm zwischen den Stämmen hindurch. Alle halbe Minute mußte er seine Hand hochstrecken, gleich, wo er war, damit sein Vater beruhigt war. Schließlich fand der Junge den Baumstamm, auf den sein Vater gedeutet hatte. Er fing die Sprengladung auf, die dieser ihm zuwarf, preßte mit Hilfe der Zähne die Zündschnur und das Zündhütchen zusammen und zündete das Pulver an.
Er tauchte wieder aus dem Wasser, ging zurück zu den Pferden, trocknete sich mit Handtüchern aus dem Packsack; und wie sein Vater drehte er sich nicht einmal mehr um. Ein Fluß explodierte hinter ihnen, und die Krähen flatterten auf.
Das Flößen dauerte einen Monat, und er sah den vorbeiziehenden Männern nach, die mit ihren langen Stangen auf den Stämmen nach Yarker und auf Napanee zutrieben, wo die zusammengepferchten Stämme zu den Mühlen geschleppt wurden. Er war immer mit seinem Vater zusammen. Patrick döste in einem Flecken Sonne neben der Brücke, während sie beide warteten.
Mittags kam der Koch mit zwei Milchkannen die First Lake Road hinauf. In der einen Kanne war Tee, in der anderen waren dicke Schweinebratensandwiches. Das Krächzen der Krähen, die über dem Essen kreisten, war das Signal, und von den Biegungen des Flusses in der Nähe kamen die Männer herbei. Wenn sie gegessen hatten, nahm der Koch die beiden leeren Kannen, stieg am Ufer auf einen Baumstamm und ließ sich flußabwärts bis zum Camp treiben. Er stand aufrecht in der Flußmitte, und es ging mit der Geschwindigkeit vorwärts, die der Fluß vorgab. Er trieb unter der Brücke hindurch, ohne seine Haltung zu ändern, obwohl er nur ein paar Zentimeter Spielraum hatte, nickte den Holzfällern am Ufer zu, ließ sich nur von den stets anwesenden Krähen die Laune trüben. Beim Camp auf Goose Island ging er ans Ufer; seine Schuhe waren vollkommen trocken geblieben.
Hazen las seine Broschüren. Er trocknete das pulverisierte Kordit auf einem Stein. Selbst in Gesellschaft seines Sohnes war er schweigsam. Seine ganze Aufmerksamkeit richtete er auf die Zündschnur, die mit einer Geschwindigkeit von zwei Minuten pro Meter unter den Bodenbrettern entlangglomm, um Baumstämme herum, bis in jemandes Hosentasche. Immer wieder hatte er diese Vorstellung im Kopf. Konnte er es schaffen? Die Lunte an den Stoff im Hosenbein geheftet. Vielleicht schläft der Mann am Lagerfeuer, die Zündschnur glimmt in gerader Richtung weiter bis in seine Hosentasche und bläst ihm das Herz aus. In seiner Phantasie zog sich die Lunte stets im Zickzack über den Boden, wie eine Hundeschnauze, und entzündete dabei den Bodenbewuchs, der zu einer roten Flechte wurde.
Hazen Lewis brachte seinem Sohn nichts bei, keine Märchen, keine Grundansichten. Der Junge sah ihm beim Anbringen der Sprengladungen zu oder wie er die Ausrüstung wieder sorgfältig in seiner Holzkiste verstaute. Sein Vater trug niemals Metall am Körper – keine Uhr, keine Gürtelschnalle. Er war ein Mann, der nur wenige Dinge brauchte, er war unabhängig und so unsichtbar wie möglich geworden. Die Explosionen hoben die Stämme unbeschädigt aus dem Wasser. Er hinterließ im Granit des Depot-Lake-Systems und entlang des Moira River, wo er ab und zu beschäftigt war, eine Kette von Löchern, je anderthalb Zentimeter tief. Aber sie waren so klein und unauffällig, wie es nur ging. Das Werk eines Spechts. Er trug nie einen Hut. Er war ein großer Mann von knapp zwei Metern, mit schwerem Körperbau. Er war ein schlechter Reiter und später ein schlechter Lastwagenfahrer. Er konnte die Sprengladungen mit geschlossenen Augen zusammenbauen. Er war peinlich darauf bedacht, jeden Abend seine Kleidung zu waschen, für den Fall, daß noch Reste, kleine Sprengstoffsamen, daran hafteten. Patrick fand diese Manie lächerlich. Eines Abends zog sein Vater das Hemd aus und warf es ins Lagerfeuer. Das Hemd zischte und sprühte Funken bis hin zu den Knien der Holzfäller. Es gab noch mehr solcher unvermittelter Lektionen.
Später fand es Patrick sonderbar, daß er erst im nachhinein gemerkt hatte, daß er wichtige Dinge gelernt hatte – wie Kinder durch bloßes Zuschauen lernen, wie Erwachsene einen Hut tragen oder auf einen fremden Hund zugehen. Er wußte, was ein Stück Dynamit von der Größe eines Ochsenfrosches anrichten konnte. Doch er nahm dies alles mit einer gewissen Distanz auf. Nur dann drückte sich sein Vater in Worten aus, wenn er zwischen den Floßfahrten in den Hotels von Yarker und Tamworth die Tänze ausrief. Man forderte ihn immer wieder dazu auf, und er ging auf die Bühne, als wäre es ihm eine saure Pflicht, dann brachen Verse aus ihm, und er wirbelte um die Gitarren und Fiedeln herum und ließ die letzten Worte fallen, kurz bevor er am Versende an den Reim stieß. So wortkarg wie bei allem war sein Vater auch bei diesem Ausrufen des Square dance. Seine Worte glitten unbeteiligt über den Tanzboden, und der Junge stand an der Seite und flüsterte sich selbst die Kommandos zu. Nicht ein Muskel rührte sich in dem massigen Körper seines Vaters, während er dort stand und ausrief: »Little red wagon the axle draggin’.«
Diese emotionslose Sprache. Patrick stellte sich vor, er stünde selbst auf der Bühne, ginge auf und ab, mit verbogenen und verdrehten Armen. »Birdie fly out and the crow fly in – crow fly out and give Birdie a spin«, murmelte er für sich, später, bei Tageslicht.
Eines Nachts im Winter, Patrick war elf, ging er zur großen Küche hinaus. Ein blauer Nachtfalter hatte auf dem Fliegengitter gelegen, mit vibrierenden Flügeln, war kurz in Licht getaucht und dann in der Dunkelheit verschwunden. Er hatte nicht geglaubt, daß er schon weit weg sei. Mit der Petroleumlampe in der Hand ging er hinaus. Ein seltener Winterfalter. Wie verwundet flatterte er über den Schnee, und er konnte ihm leicht folgen. Im Garten hinter dem Haus verlor er ihn aus den Augen, der türkisfarbene Falter war hoch in der Luft, jenseits des Scheins des Petroleumlichts. Was machte ein Falter zu dieser Jahreszeit? Seit Monaten hatte er keine mehr gesehen. Er mußte im Hühnerstall aus seinem Kokon geschlüpft sein. Patrick stellte die Sturmlaterne auf einen Felsen und schaute über die Felder. In einiger Entfernung sah er zwischen den Bäumen eine Menge Käfer. Leuchtkäfer zwischen den Bäumen am Fluß. Aber es war doch Winter! Er ging mit der Laterne weiter.
Es war weiter weg, als er gedacht hatte. Der Schnee reichte bis über die Ränder seiner ungeschnürten Stiefel. Eine Hand in der Hosentasche, in der anderen die Laterne. Und ein Mond, der sich hinter dichten Wolken verbarg, ihm keinen Pfad zu den Bäumen beleuchtete. Nur dieses Bernsteinblinken wies ihm die Richtung. Er wußte schon, daß es keine Leuchtkäfer sein konnten. Die letzten Leuchtkäfer des Sommers waren irgendwo in den Falten eines seiner Taschentücher gestorben. (Jahre später, als Clara mit ihm schlief, in einem Auto, fing sie seinen Samen in einem Taschentuch auf und warf es ins Gebüsch am Straßenrand. »Hallo, Leuchtkäfer!« hatte er gesagt und gelacht, ohne irgendeine Erklärung.)
Er stapfte durch den Schnee an dem bloßliegenden Granit vorbei und durch den Wald, wo der Schnee nicht so tief war. Die Lichter blinkten noch immer vor ihm. Er hörte Lachen. Jetzt wußte er, was es war. Er ging vorsichtig durch den vertrauten Wald, bewegte sich tastend vorwärts wie in einem verwunschenen Haus. Er wußte, wer das war, aber er hatte keine Vorstellung davon, was er sehen würde. Dann war er am Fluß. Er stellte die Lampe an der Eiche ab und ging im Dunkeln auf das Ufer zu.
Das Eis schimmerte hell. Für einen Augenblick war ihm, als wäre er in eine Hexenversammlung oder ein Druidenritual geraten – Bilder in seinem Lieblingsgeschichtsbuch, in die er sich oft vertieft hatte. Doch selbst dem Elfjährigen mitten in den Wäldern, nach Mitternacht, ging auf, daß es sich um eine harmlose Szene handelte, etwas Fröhliches. Ein Geschenk. Etwa zehn Männer glitten übers Eis, in ihr Spiel versunken. Einer jagte den anderen, und sobald einer abgeschlagen wurde, war er der Jäger. Jeder hatte ein Büschel Rohrkolben in der Hand, deren Enden in Brand gesteckt waren. Diese Fackeln beleuchteten das Eis und hatten hinter den Bäumen geblinkt.
Sie rannten, kurvten, fielen und rollten übers Eis, um dem Jäger zu entgehen, doch die Binsen ließen sie nicht los. Wenn sie zusammenstießen, stoben Funken übers Eis und auf ihre dunkle Kleidung. Das war der Grund für ihr Lachen – einer von ihnen stand da, hüpfte, um die Glut loszuwerden, die ihm in den Kragen gefallen war, und er rief den anderen zu, stehenzubleiben.
Patrick war verzaubert. Nachts über den Fluß gleitend, drangen sie wie Keile in die Dunkelheit ein, enthüllten wie von Zauberhand das graue Ufergestrüpp, sein Ufer, seinen Fluß. Ein Ast streckte sich vor, seine Enden waren im Eis eingefroren, und einer der Männer glitt zusammengekauert drunter hindurch, hielt dabei die Rohrkolben hinter sich wie einen brennenden Hahnenschwanz.
Der Junge wußte, das waren Holzfäller aus dem Camp. Er wollte ihre Hände halten und den Fluß hinabgleiten, langsam an den behauenen Felsen vorbei, unter den Brücken hindurch und in die Stadt, mit diesen Männern, von denen er wußte, daß sie zurückkehren müßten in die dunklen Hütten bei der Mühle.
Es war nicht nur die Lust am Schlittschuhlaufen. Das hätten sie auch am Tage gekonnt. Das hier geschah der Nacht zum Trotz. Das harte Eis war so sicher, daß sie in die Luft springen und zu Boden krachen konnten, und es trug sie. Sie ersetzten ihre Fackeln durch neue Binsen, mit denen sie sich weiter vorwagten bis jenseits der Grenzen, Geschwindigkeit! Romantik! Ein Mann tanzte Walzer mit seiner Fackel ...
Für den Jungen, der bald zwölf war, der sein ganzes Leben auf der Farm verbracht hatte, wo der Tag Arbeit bedeutete und die Nacht Schlaf, war nichts mehr wie zuvor. Doch in jener Nacht traute er sich und den Fremden, die eine andere Sprache hatten, nicht genug, um sich vorzuwagen und sich ihnen anzuschließen. Er ging durch den Wald und über die Felder zurück und trug seine eigene Laterne. Mit jedem Schritt die Schneedecke zu durchbrechen schien taktlos und plump.
Dies also war der Augenblick, in dem sein Geist dem Körper vorausjagte.
Die Brücke
Ein Lastwagen fährt um fünf Uhr früh Feuer durch Torontos Innenstadt, die Dundas Street entlang und die Parliament Street weiter nach Norden. Von der Ladefläche starren drei Männer in die vorbeiziehende Dunkelheit – ihre Muskeln sind noch entspannt in dieser letzten halben Stunde vor Arbeitsbeginn –, als gehorchten ihnen die Beine und Arme nicht, die gegen ihre Körper und gegen die Rückwand des Fords schlagen.
Über der grünen Wagentür steht in Gelb: dominion bridge company. Doch im Augenblick kann man nur das Feuer auf der Ladefläche sehen, das in der ein mal ein Meter großen Metallschüssel lodert, und in einem Kessel kocht Teer; dieser Geruch hängt in der Luft für all die, die am frühen Morgen auf die Straße treten und einatmen.
Zügig fährt der Laster unter den zueinander geneigten Bäumen hindurch, hält an bestimmten Straßenecken, wo weitere Arbeiter auf die Ladefläche springen, und bald sind sie zu acht; das Feuer knistert, und ab und zu spritzt heißer Teer auf Nacken oder Ohr. Bald sind es zwanzig, dichtgedrängt und schweigsam.
Langsam steigt das Licht aus der Erde. Sie sehen ihre Hände, den Stoff eines Mantels, die Bäume, von denen sie wußten, daß sie da waren. Am Ende der Parliament Street fährt der Laster nach Osten, am Rosedale-Damm vorbei, auf das halbfertige Viadukt zu.
Die Männer springen ab. Die provisorische Straße ist voller Spurrillen, das Feuer und die Wagenscheinwerfer hüpfen, und die Federung keucht. Der Laster fährt so langsam, daß die Männer zu Fuß schneller sind; die Morgenluft ist kühl, obwohl es Sommer ist.
Später werden sie Mäntel und Pullover ablegen, um elf dann die Hemden, werden sich in Hosen, Stiefeln und Schirmmützen über die schwarzen Teerströme beugen. Doch noch liegt eine dünne Schicht Frost über allem, überzieht Maschinen und Kabel, zersplittert auf den Regenpfützen, durch die sie stapfen. Das schnelle Verdunsten der Dunkelheit. Während das Licht aufsteigt, sehen sie ihren Atem, die Klarheit der Luft wird aus ihnen herausgeatmet. Schließlich hält der Laster am Rand des Viadukts, und jemand schaltet die Scheinwerfer aus.
Die Brücke wächst wie im Traum. Sie wird die Ostseite mit der Innenstadt verbinden. Sie wird Verkehr, Wasser und Strom über das Tal des Don transportieren. Sie wird Eisenbahnzüge transportieren, die noch nicht einmal erfunden sind.
Tag und Nacht. Herbstlicht. Schneelicht. Sie arbeiten immer – Pferde und Wagen und Männer kommen an der Danforthseite am anderen Talende zur Arbeit.
Es gibt mehr als 4000 Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln von der Brücke, ihr Wachstum im Zeitraffer. Die Pfeiler senken sich achtzehn Meter tief durch Erde, Schiefer und Treibsand bis in das Felsgestein – 45 000 Kubikmeter Erde werden ausgehoben. Das Netz der Baugerüste spannt sich immer höher.
Im Gewirr der Bohlen klettern die Männer tief ins zersplitterte Licht des hellen Holzes hinein. Ein Mann ist die Verlängerung von Hammer, Bohrer, Flamme. Bohrschmauch im Haar. Eine Mütze fällt ins Tal, Handschuhe werden vom Steinstaub begraben.
Dann treffen die neuen Leute ein, die »Elektrischen«, verlegen Leitungsnetze über die fünf Brückenbögen, haben ungewohnte dreiflammige Lampen dabei; und am 18. Oktober 1918 ist es soweit. Sie strecken sich wohlig in der Luft.
Die Brücke. Die Brücke. Getauft auf den Namen »Prince Edward«. Das Bloor-Street-Viadukt.
Während der Feierlichkeiten mit den Politikern durchbrach eine Gestalt auf dem Fahrrad die Polizeisperren. Der erste Vertreter der Allgemeinheit. Nicht die erwartete Vorzeigelimousine mit den Offiziellen, sondern dieser Namenlose, der wie vom Teufel gejagt auf die Ostseite der Stadt zustrampelt. Auf dem Foto ist er ein verwischter Fleck der Entschlossenheit. Ihn gelüstet es nach dieser Jungfräulichkeit, nach dem Luxus des Raums. Er dreht zwei Runden, der Zwiebelstrang, den er über der Schulter trägt, flattert ihm nach, und fährt weiter.
Aber er war nicht der erste. Mitternachts zuvor waren die Arbeiter gekommen, hatten die offiziellen Vertreter, die die Brücke in Vorbereitung der Feierlichkeiten des kommenden Tages bewachten, beiseite geschoben und waren mit ihren eigenen flackernden Lichtern – den Kerzen für die Toten der Brücke – wie ein Wink der Zivilisation, ein Schwarm von Sommerinsekten, über die Brücke gezogen.
Und auch der Fahrradfahrer auf seinem Flug beanspruchte die Brücke für sich, in diesem verwischten Augenblick, einsam und illegal. Donnernder Applaus empfing ihn am anderen Ufer.
Auf der Westseite der Brücke liegt die Bloor Street, auf der Ostseite die Danforth Avenue. Ursprünglich Karrenwege, Schlammstraßen, 1910 mit Holzbohlen befestigt, werden sie nun geteert. Ziegelsteine werden in den Boden gerammt und schmale Sandbäche dazwischengegossen. Darüber kommt der Teer. Bitumiers, bitumatori, Teerarbeiter knien sich hin und stemmen sich mit ihrem ganzen Gewicht auf die hölzernen Blockstampfer, die sich biegen und über den Teer gezogen werden. Der Teergeruch dringt durch die Fasern ihrer Kleidung. Das Schwarz bleibt für immer unter den Fingernägeln. Unter ihren Knien spüren sie die Steine, während sie rückwärts auf die Brücke zukriechen; ihre Körper liegen fast auf dem zähen, schwarzen Strom, ihre Köpfe sind benebelt von den Dämpfen.
He, Caravaggio!