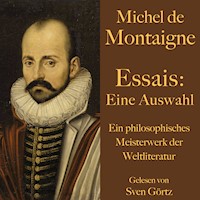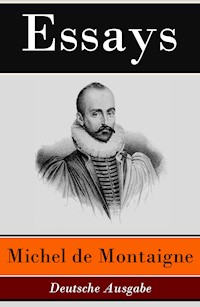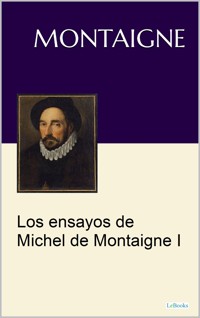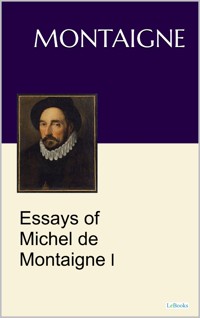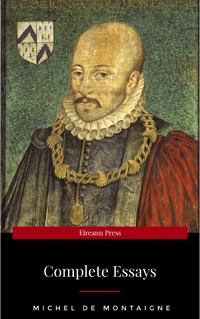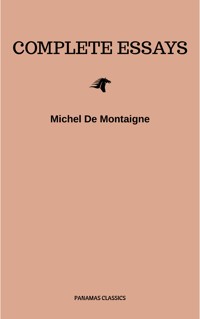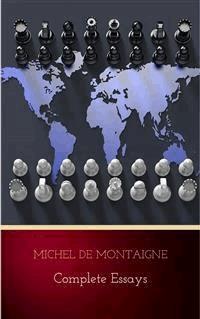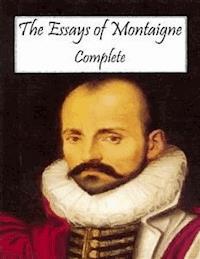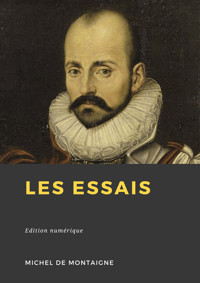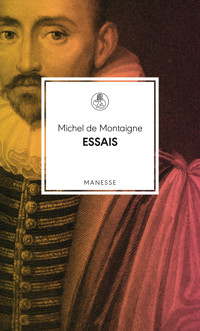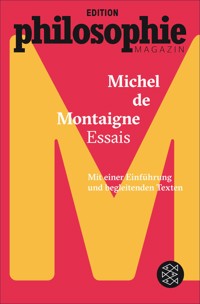
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Edition Philosophie Magazin: Eine exklusive Auswahl zentraler philosophischer Texte durch das »Philosophie Magazin«. Mit einer Auswahl der berühmtesten Essais: ›Von der Freundschaft‹ / ›Dass unsere Empfindung des Guten und Bösen großteils von der Meinung abhängt, die wir davon haben‹ / ›Philosophieren heißt sterben lernen‹ / ›Von der Einsamkeit‹ / ›Von der Schonung des Willens‹ - einer sachkundigen Einleitung von Antoine Compagnon - einer Zeitleiste zu Leben und historischem Kontext - Erläuterungen der Grundbegriffe Montaignes Montaignes ›Essais‹ markieren eine völlig neue Art der Philosophie: persönliche, literarische und subjektive Erkenntnisse anstatt möglichst objektive und ewige Wahrheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Michel de Montaigne
Essais
Mit einer Einführung und begleitenden Texten
Über dieses Buch
Edition philosophie Magazin: Eine exklusive Auswahl zentraler philosophischer Texte durch das »philosophie Magazin«.
Mit einer Auswahl der berühmtesten Essais von Montaigne sowie
– einer sachkundigen Einleitung von Antoine Compagnon
– einer Zeitleiste zu Leben und historischem Kontext
– Erläuterungen der Grundbegriffe des jeweiligen Werks
Montaignes ›Essais‹ markieren eine völlig neue Art der Philosophie: persönliche, literarische und subjektive Erkenntnisse anstatt möglichst objektive und ewige Wahrheit.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hauser lacour kommunikationsgestaltung gmbh, Frankfurt
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403691-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Der große Versucher. Eine Einführung
Die Freiheit eines Skeptikers
Die Herkunft als Vorurteil
Sprechen lernen
Daten zu Montaignes Leben
Daten zum geschichtlichen Kontext
Unterwegs zu einem besseren Ich
Trost des Schreibens
Blüten des Alters
Montaignes Grundbegriffe
Sitten und Gesetze
Der Tod
Philosophie
Vernunft
Das Leiden
Weiterführende Lektüre
MontaigneEssais
Dass Philosophieren sterben lernen heiße
Von der Freundschaft
Von den Kannibalen
Von der Ungleichheit, die zwischen uns ist
Von der Ungewissheit unserer Urteile
Von dem Alter
Von der Unbeständigkeit unserer Handlungen
Von der Völlerei
Von den Büchern
Von der Grausamkeit
Von der Ähnlichkeit der Kinder mit ihren Vätern
An die Frau von Duras
Von dreierlei Umgange
Editorische Notiz
Vorwort
Von Antoine Compagnon
Montaignes Lektion heißt Diversität, Mobilität, Instabilität von Welt und Mensch. Das Erste Buch der im Jahre 1580 zum ersten Mal veröffentlichten »Essais« beginnt mit dem Kapitel »Durch verschiedene Mittel erreicht man das gleiche Ziel«. In ihm entdeckt der Leser folgende Sentenz: »Wahrlich, der Mensch ist ein seltsam wahnhaftes, widersprüchliches, hin und her schwankendes Wesen! Es fällt schwer, ein gleichbleibendes und einheitliches Urteil darauf zu gründen.« (I, 1) Beispielsweise kommt es vor, dass ein Besiegter das Mitleid seines Bezwingers erregt, indem er eine Demutsgeste macht, aber auch, indem er sich mutig zeigt: Eine Regel zum richtigen Betragen lässt sich hieraus also nicht ableiten. Und das Zweite Buch endet mit der verwirrenden Feststellung, dass unsere Gefühle und Absichten fast nie übereinstimmen: »Da im Gang der Natur allgemein die Vielfalt vorherrscht (…), fände ich es weitaus ungewöhnlicher, wenn unsre Vorstellungen und Vorhaben jemals miteinander in Einklang zu bringen wären. Auf der Welt hat es noch nie zwei gleiche Meinungen gegeben – sowenig wie zwei gleiche Haare oder Samenkörner. In nichts ist sich alles gleicher als in der Ungleichheit.« (II, 37) Folglich sollten uns ihre Widersprüche auch nicht allzu sehr beunruhigen. Montaigne interessiert sich für die komplizierten Beziehungen, die unsere Leidenschaften und Handlungen miteinander verbinden. Doch wie soll man vom Menschen reden, wenn doch alles im Fluss ist, und dieser zugleich Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt ist? Dementsprechend resümiert das erste Kapitel des Zweiten Buches schon im Titel die Prämisse von Montaignes Moral: »Über die Wechselhaftigkeit unseres Handelns«. Montaignes Überlegungen gehen von einem Paradoxon aus. Beobachtet man einen Menschen, so versteht man eigentlich nichts von ihm wegen der schreienden Inkohärenz seiner Handlungen und Gesten: Mir scheint »der Wankelmut der augenfälligste und verbreitetste Fehler unsrer Natur zu sein«. (II, 1) Weisheit wäre, wie uns schon die Altvorderen gelehrt haben, Determiniertheit und Beständigkeit, und doch besteht unser Verhalten darin, »den augenblicklichen Neigungen unserer Begierde zu folgen: nach links, nach rechts, bergauf, bergab, wie der Wind der Gelegenheiten uns treibt«. Von einem Augenblick zum nächsten verändert sich unsere Laune; wir bewegen uns im Takt unserer Zeit, die dahinfließt wie der Fluss des Herkules. Nur ein Mann entgeht dem universellen Reigen: Cato der Jüngere, der Widersacher Cäsars, der kühne Stoiker, der sich lieber das Leben nahm als die Freiheit zu verlieren – dies las Montaigne in seinem Lieblingsbuch, Plutarchs »Lebensgeschichten berühmter Männer«. Wer bei ihm »eine Stufe berührt hat, hat alles berührt«. Doch, von dem jungen Cato einmal abgesehen, »nicht nur der Wind der Zufälle treibt mich, wohin er will, sondern ich selbst trage durch meine schwankende Haltung zu diesem verwirrenden Hin und Her bei«. Nichts steht also fest, weder die Umstände noch das eigene Ich. Montaigne setzt die Liste unserer Widersprüche nach Belieben fort: »Schamhaft und unverschämt, keusch und geil, schwatzhaft und schweigsam, zupackend und zimperlich, gescheit und dumm, mürrisch und leutselig, freigebig und geizig und verschwenderisch.« Wir sind all das und doch zugleich der Gegensatz einer jeden Eigenschaft: eine herrliche Aufzählung aller Möglichkeiten eines Menschenlebens.
Daraus lässt sich eine überaus verwirrende Konsequenz ziehen: So »bringt es doch die Absonderlichkeit unseres Wesens mit sich, dass selbst hinter unseren guten Taten oft die böse Absicht als treibende Kraft steckt«. Kurzum, es kommt vor, dass wir Gutes tun, ohne es zu wollen, aus einem Laster heraus, oder wenigstens, ohne das Gute ins Auge gefasst zu haben. Auch wenn »die Tugend verlangt, dass man ihr um ihrer selbst willen folgt«, so erweist sich doch bei genauerem Hinsehen der Zufall oder ein Irrtum als Ausgangspunkt einer Handlung, die eigentlich tugendhaft sein wollte.
Daraus resultiert eine zwanglose Zusammenfassung: »Wir bestehen alle nur aus buntscheckigen Fetzen, die so locker und lose aneinanderhängen, dass jeder von ihnen jeden Augenblick flattert, wie er will; daher gibt es ebenso viele Unterschiede zwischen uns und uns selbst wie zwischen uns und den anderen.« Der Mensch hat keinerlei Beständigkeit: Er ist auf allerlei Art verschieden.
Die Lust, sich von den eigenen Gedanken treiben zu lassen, erhob Michel de Montaigne (1533–1592) zur Lebensform. Mit seinen »Essais« schuf er das erste moderne Zeugnis eines wahrhaft freien Menschen, dem kein Thema zu gering ist, den eigenen Verstand an ihm zu schärfen.
An der Schwelle von der Renaissance zur Moderne wird der adlige Lebemann aus Südfrankreich zum bis heute prägenden Vorbild des europäischen Intellektuellen. Vielreisend, unabhängig, sinnenfroh, scharfzüngig – und in seinem Erkenntnisdrang niemand anderem verpflichtet als der eigenen Urteilskraft. In der Abgeschiedenheit seines Landguts schuf Montaigne, im Dialog mit den Büchern seiner legendären Bibliothek, eigenhändig eine literarische Gattung, die bis heute als edelste Form philosophischen Nachdenkens gilt: den Essay.
Antoine Compagnon ist Professor für französische Literatur an der Universität Sorbonne in Paris. Darüber hinaus hat er den Lehrstuhl »Littérature française moderne et contemporaine: Histoire, critique, théorie« am Collège de France inne. Er veröffentlichte mehrere Essays über Montaigne, darunter »Nous, Michel de Montaigne« (Seuil, 1980).
Der große Versucher. Eine Einführung
Von Henning Ritter
Für Montaigne ist das Zweifeln der Weg zur Wahrhaftigkeit. Sprachlich brillant, breit gebildet und mit der bleibenden Offenheit, sich von eigenen Gedanken überraschen zu lassen, stehen seine »Essais« unter dem Zeichen einer Freiheit, deren letztes Ziel heitere Selbsterkenntnis ist
Über kaum einen Schriftsteller gibt es Äußerungen so vorbehaltloser Nähe. Goethe sprach von Montaignes »unschätzbar heiterer Wendung«, Nietzsche pries seine Redlichkeit und Heiterkeit, durch ihn sei »wahrlich die Lust, auf dieser Erde zu leben, vermehrt worden«. Das allein schon müsste genügen, seine »Essais« als Lebenselixier zu nutzen und sich um des schieren Wohlbefindens willen in sie zu versenken. Jedem seiner Leser wendet Montaigne eine Facette seines Wesens zu, in der er sich ohne Mühe wiedererkennen kann. Sein Selbstsein auskosten, es fühlbar und schmeckbar machen – diese Absicht der »Essais«, die Montaigne das »Register der Versuche seines Lebens« nannte, stiftet über die Jahrhunderte hinweg einen Pakt mit dem Leser. Montaigne lesen heißt sich selbst beobachten.
Es wird leicht nachgesprochen, dass Montaignes »Essais« ein Selbstporträt seien. Tatsächlich enthalten sie eine Fülle von Geständnissen sogar intimer Züge ihres Autors. Er kündigt ja auch an, dass er in diesem Buch ausschließlich von sich selbst rede. Und doch gehört das Buch nicht in die Ahnenreihe der Selbstbekenntnisse und Selbstbeschreibungen, an denen die Literatur seit Rousseaus »Confessions« so reich ist. Montaigne unterscheidet sich von diesen moderneren Autoren. Er entkleidet sich nicht, um als besonders interessantes, originelles Exemplar seiner Spezies zu erscheinen. Intimes berichtet er, um am Gemeinsamen, das ihn mit seinem Leser verbindet, seine persönliche Nuance zu zeigen. Die Leiden und Unzuträglichkeiten, zum Beispiel durch seine Nierensteine, sind für den Leser nicht als Mitteilung über den Autor bedeutsam, sondern weil sie ihm Gelegenheit geben, ihn zu beobachten, wie er mit dem Schmerz umgeht, wie er gegen ihn aufbegehrt, sich ablenkt, sich fügt. Dem Leser Montaignes wird nicht etwas vorgezeigt, sondern er erhält Gelegenheit, den Autor auf den abenteuerlichen Wegen seiner Gedanken zu folgen und zu sehen, wie er das eine Hindernis mühelos nimmt und einem anderen ausweicht, mit keiner anderen Absicht, als seine Art erkennbar zu machen. Er will, wie er sagt, nicht gelobt oder gepriesen, er will nur besser erkannt werden.
Die Freiheit eines Skeptikers
Montaigne legt Wert auf alle Freiheiten seines Denkens und Handelns, aber er preist sie nicht als Äußerungen einer ihm mitgegebenen wesenhaften Freiheit. Eher behandelt er sie wie ein Kapital, das man klug anzulegen hat und bei dem Sorge zu tragen ist, dass es flüssig bleibt. Von späterem, bürgerlichem Freiheitsverständnis unterscheidet ihn, dass ihm das Pathos der Verwirklichung von Freiheit fehlt. Während Freiheit für die Modernen zu einer unerschöpflichen Ressource wurde, die man nur anzuzapfen braucht, damit sie sich endlos regeneriere, ist sie für Montaigne ein knappes Gut, mit dem man nicht prunken soll. Und doch hat kein Wort in seinen »Essais« einen Akzent von vergleichbarer Emphase. In der Vertraulichkeit ihres Umgangs mit Montaigne stoßen seine Leser auf das, was er seine »Freiheitsgier« nennt. Wollte jemand ihm, der über Italien nie hinauskam, den Zutritt zu irgendeinem Winkel im fernen Indien verbieten, sagt er, so wäre er seines Lebens dadurch weniger froh. Wenn jemand ihn nur mit dem kleinen Finger bedrohen würde, würde er, ohne zu zögern, fortgehen, um anderswo zu leben, wo immer es wäre. Die radikalsten Ansichten des Autors der »Essais« treten unverhüllt auf, sind aber dennoch verborgen in der Beiläufigkeit, mit der sie vorgetragen werden.
Die Herkunft als Vorurteil
Die Nähe der »Essais« zu unserer Zeit täuscht. Wir möchten gern mit Montaigne zweifeln, aber wir können es nicht. Denn unser moderner Zweifel ist immer ein methodischer. Selbst in der Entfernung von seinen cartesianischen Ursprüngen bleibt er der Arroganz des Wissenschaftsglaubens verhaftet. Montaignes Skepsis ist alles andere als ein Verfahren der Reduktion, sie ist vielmehr eine erschließende. Sie will auch nicht verändern. Sie kehrt zu dem, was der Zweifel verworfen oder in seinem Anspruch auf Zustimmung in die Schwebe versetzt hat, zurück, um sich ihm nach Maßgabe des Herkömmlichen zu fügen, nicht aber zu beugen. Das Herkommen bleibt für Montaigne »ein mächtiges Vorurteil«, bis der durch unsere täglichen Gewohnheiten verborgene »wahre Gesichtspunkt der Sachen« enträtselt ist. Hat der Mensch aber »diese Larve abgerissen und die Sache auf Wahrheit und Vernunft zurückgeführt, so wird er sein Urteil wie auf den Kopf gestellt und dennoch viel fester begründet finden«. Montaigne hält sich von der Zukunft so weit wie irgend möglich frei. Er empfindet es als Erleichterung, dass er der Zukunft gegenüber nur geringe Verpflichtungen hat. Er ordnet seine Dinge nur so weit, um sie einer ungewissen Zukunft ohne Selbstvorwurf überlassen zu können. Auch den Horizont seiner ehrgeizigen »Essais« zieht er bewusst eng. Er schreibe sein Buch für wenige Menschen und für wenige Jahre, versichert er. Denn hätte er sie zu größerer Dauer bestimmen wollen, hätte er sich »einer dauerhafteren Sprache anvertrauen müssen«, dem Lateinischen. Nach den Veränderungen der französischen Sprache, die er im Laufe seines Lebens erlebt hatte, mochte er nicht glauben, dass sie in ihrer vorliegenden Form in 50 Jahren noch verständlich sein würde.
Sprechen lernen
Während er sonst allem Vorbildlichen entgegenarbeitet, es an einem zum Äußersten getriebenen Bewusstsein der Verschiedenheit zerbrechen lässt, weil kein Ding, kein Mensch, keine Situation sich in anderen Dingen, Menschen, Situationen wiederholt, ist die Sprache für ihn als das Organ grenzenloser Nuancierung und als Instrument des Unterscheidens unangreifbar und jedem Zweifel entzogen: »Distinguo ist das erste und letzte Wort meiner Logik.« Die Sprache der antiken Autoren ist Vorbild, weil keine andere Sprache sich so viele Nuancen erschlossen hat.
Sein Zutrauen zur Sprache bekennt Montaigne in wenigen Sätzen, in denen nichts von seiner sonstigen Biegsamkeit erscheint. Die Sprache ist der Fels, den kein Zweifel erschüttert. Wer dieses Sprachvertrauen untergräbt, greift das Kostbarste an: »Da wir uns miteinander nur durch das Wort zu verständigen vermögen, verrät, wer es fälscht, die menschliche Gemeinschaft. Es ist das einzige Mittel, durch das wir unsern Willen und unsere Gedanken austauschen, es ist der Mittler unserer Seelen; wenn wir es verlieren, so haben wir keinen Zusammenhang und keine Kenntnis mehr voneinander. Wenn es uns betrügt, so zerstört es allen unseren Umgang und zerreißt alle Bande unserer Gesellschaft.« Der Mensch ist auf weniges angewiesen. Wenn man ihn aller falschen Ansprüche und aller Drapierungen entkleidet hat, bleibt dieses eine: die Angewiesenheit auf das nicht betrügerische Wort.
Henning Ritter war von 1985 bis 2008 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verantwortlich für das Ressort »Geisteswissenschaften«. Er veröffentlichte zahlreiche philosophische Publikationen. Sein Buch »Notizhefte« (Berlin Verlag, 2010), ein essayistisches Werk im Geiste Montaignes, erhielt 2011 den Preis der Leipziger Buchmesse. Im Frühjahr 2013 erschien »Die Schreie der Verwundeten: Versuch über die Grausamkeit« (C.H. Beck).
Daten zu Montaignes Leben
Februar: Geburt Michel Eyquem de Montaignes in wohlhabenden Familienverhältnissen
1554Montaigne wird Gerichtsrat am Steuergericht von Périgueux
1568Als sein Vater stirbt, wird Michel Eyquem zum Gutsherrn des Schlosses Montaigne; diesen Namen wird er von nun an führen
1571/1572Montaigne legt sein Amt nieder und zieht sich auf sein Schloss zurück. Er verfasst seine ersten Essays
1580Die erste Ausgabe seiner Essays erscheint
1581Montaigne wird zum Bürgermeister von Bordeaux gewählt
159213. September: Montaigne stirbt in seinem Schloss
1595Marie de Gournay, die alle Notizen Montaignes gesammelt hat, veröffentlicht posthum seine »Essais I« »Edition Bordeaux«
Daten zum geschichtlichen Kontext
Luther schlägt seine 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg
1536Erasmus von Rotterdam, Begründer des europäischen Humanismus, stirbt
1543Kopernikus gibt seine Theorie vom heliozentrischen Weltbild kund
1557Wormser Religionsgespräch: erfolgloser Versuch, zwischen Katholiken und Protestanten zu vermitteln. Gespräche dieser Art setzen sich bis ins 17. Jahrhundert fort
1562In der Champagne werden während einer Heiligenverehrung 80 Protestanten durch den Herzog von Guise umgebracht. Dies ist der Beginn des Religionskriegs zwischen Katholiken und Protestanten
1572Bartholomäusnacht im August: Anlässlich der Hochzeit von Henri de Navarre und Marguerite de Valois leiten die katholischen Machthaber unter Zustimmung von König Charles IX. die Massentötung von 3000 Protestanten ein
1582Einführung des heute gebräuchlichen gregorianischen Kalenders
1584Gründung der ersten englischen Kolonien in Nordamerika
1598Henri IV. unterzeichnet in Anerkennung der Religionsfreiheit für Anhänger der Reformation das Edikt von Nantes, was in der Opposition von Katholiken und Protestanten mündet. Gleichzeitig Höhepunkt der Hexenverbrennung in Europa
Unterwegs zu einem besseren Ich
Von Anne-Vanessa Prévost
Angesehener Diplomat, sinnenfroher Lebemann, stoischer Privatgelehrter – Montaignes Biografie ist so vielschichtig wie seine Schriften. Kein Wunder, war sein bevorzugtes philosophisches Thema doch er selbst.
Michel Eyquem de Montaigne kommt, auf Schloss Montaigne an der Grenze zwischen Bordelais und Périgord, am letzten Tag des Februar 1533 überaus gemächlich – es heißt, seine Mutter sei elf Monate mit ihm schwanger gewesen – zur Welt. Seine ersten Jahre werden von den intensiven Bemühungen seines Vaters Pierre Eyquem geprägt, der ihn in der Überzeugung, die Sinne seines Sohnes bildeten einen der Schlüssel zum Verstand, jeden Tag durch einen Musiker wecken lässt; auch vertraut er ihn einem deutschen Hauslehrer an, der nur auf Latein mit ihm kommuniziert. Noch mit sechs Jahren spricht der junge Michel kein Französisch. Ab 1540 besucht er das äußerst angesehene Collège de Guyenne, um anschließend Jura in Toulouse und später in Paris zu studieren.
Über sein alltägliches Leben, seine Ausbildung, seine Hinwendung zum Hof und zu den literarischen Milieus seiner Zeit ist fast nichts bekannt. Eines nur ist sicher: Sinnenlust spielt in seiner Jugend eine große Rolle, und Paris bildet den Auftakt zu seiner »ausgelassensten Zeit« (I, 20). Er geht zu Bällen, erlebt amouröse Abenteuer und besucht regelmäßig das Bordell – »ein Laster ist es, wenn man nicht mehr herauskommt, nicht aber, wenn man hineingeht« (III, 5). Obwohl die Berufung des Menschen für ihn im Denken liegt, so bleibt doch der sogenannte »monsieur ma partie«, das »ungehorsame« und »aufsässige« männliche Glied, Protagonist seiner zwischenmenschlichen Abenteuer. Folglich schlägt Montaigne im Jahr 1554 ohne große Begeisterung die Laufbahn als Gerichtsrat am Steuergerichtshof von Périgueux ein, bevor er Ratsherr am Parlament von Bordeaux wird. Die politische und religiöse Situation seiner Epoche, in der die Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten immer deutlicher zutage treten, bürden dieser Institution eine schwere Verantwortung auf. Montaigne wird mit politischen Missionen betraut: 1559 begleitet er den König auf einer Reise und unterstützt den Hof durch seine Teilnahme an der Belagerung von Rouen. Auch wenn sein parlamentarisches Amt ihn stets begeistert hat, so kann er seinen Widerwillen gegenüber den Gerichtsverfahren nicht verleugnen. Er prangert den willkürlichen und perversen Charakter der Gesetze an: »Die Macht der Gesetze bleibt ja nicht deswegen unangetastet, weil sie gerecht, sondern weil sie Gesetze sind. (…) Oft werden sie von Hohlköpfen gemacht.« (III, 13) Als Kritiker der Regierung verurteilt Montaigne das System, und zwar sowohl den Einsatz von Folter als auch den juristischen Apparat seines Landes. Dessen ungeachtet bereichern diese Jahre in einem hohen Staatsamt seine Erfahrung der flüchtigen menschlichen Natur, die sich nicht auf normative Prinzipien reduzieren lässt.
In diesem Lebensabschnitt freundet er sich mit Étienne de La Boétie an, dessen heftige Einlassung gegen die Tyrannei mit dem Titel »Von der freiwilligen Knechtschaft des Menschen« ihm bereits aufgefallen war. Eine überwältigende Begegnung. »Wenn man in mich dringt zu sagen, warum ich Étienne de La Boétie liebte, fühle ich, dass nur eine Antwort dies ausdrücken kann: ›Weil er er war, weil ich ich war.‹« (I, 28) Klarer kann man sich nicht zu der absoluten Einzigartigkeit bekennen, die Montaigne dieser unvergleichlichen, sich selbst genügenden Beziehung zuschreibt: »eine Freundschaft, die wir zwischen uns, solange es Gott gefiel, auf derart vollkommene Weise gepflegt haben (…); damit sich ein solch inniger Bund herausbilden kann, müssen zahlreiche Umstände zusammentreffen: es ist folglich bereits viel, wenn dem Schicksal das alle drei Jahrhunderte einmal gelingt.« (I, 28)
Trost des Schreibens
Als die Pest La Boétie 1563 brutal aus dem Leben reißt, bleibt Montaigne völlig gebrochen zurück. Nach Étiennes Tod ändert sich sein Leben, er fühlt sich wie verstümmelt, und wenn er dieses Leben mit der in La Boéties Gesellschaft verbrachten Zeit vergleicht, »so ist es nichts als Rauch, nichts als freudlose dunkle Nacht. Seit dem Tage, da ich ihn verlor, (…) schleppe ich mich mit versiegenden Kräften dahin.« Später, allein in seiner Mansarde, verarbeitet er die Trauer über den verlorenen Freund, indem er an den Abwesenden schreibt: »Alles teilten wir miteinander und mir ist, als raubte mein Überleben ihm seinen Teil.« Diesen Teil nun bietet er ihm in Worten, Gedanken, Lektüren dar.
Nachdem er seines »treuen Spiegels« beraubt ist, sucht Montaigne Trost bei den Frauen. Darunter ist eine Vertraute von Margarete von Valois, der sogenannten »Reinen Margot«, bevor er sich 1565 zur Ehe, einem »Handel, bei dem nur das Eingehen frei ist« (I, 28), mit Françoise de La Chasseigne, der Tochter eines einflussreichen Kollegen, entschließt. Sie wird ihm sechs Kinder gebären, von denen fünf sehr früh sterben: Nur Léonor überlebt. Montaigne erbt nach dem Tod seines Vaters drei Jahre später dessen Namen und das Anwesen. Im Jahr 1570 verkauft er sein Ratsamt und verzichtet auf die Magistratur. Alles sieht nun danach aus, als wende er sich ab vom aktiven gesellschaftlichen Leben zugunsten eines eher besinnlichen Rückzugs auf sich selbst.
In der Abgeschiedenheit seines Bibliotheksturms wird Montaigne zu dem Montaigne, den wir kennen. 1572 beginnt er mit der Niederschrift der »Essais«, an denen er bis zu seinem Tod arbeiten wird: »Wer sähe nicht, dass ich einen Weg eingeschlagen habe, auf dem ich so mühelos wie unermüdlich fortschreiten werde, bis der Welt Papier und Tinte ausgeht?« (III, 9) Ein zuvor nie da gewesenes, fragmentarisches, zeitweilig unterbrochenes und nicht immer leicht zu fassendes Werk nimmt Gestalt an. Bis 1580, dem Jahr der Erstausgabe, verfasst er die ersten beiden Bücher. Ohne sich aber ganz von der politischen Bühne zurückzuziehen: Sein »Ruhestand« wird nichts anderes sein als ein Hin und Her zwischen öffentlichen Eingaben und Phasen des Schreibens. Denn Montaignes Denken wird aus der Erfahrung geboren und möchte diese abbilden: »Einen sittlichen Wandel, nicht Bücher zuwege zu bringen, ist uns aufgegeben; und nicht Schlachten und Provinzen zu gewinnen, sondern Ruhe und Ordnung in unserem täglichen Verhalten: Recht zu leben, das sollte unser großes und leuchtendes Meisterwerk sein!« (III, 13) Zwei Jahre nach der Bartholomäusnacht, in der 1572 Massaker an den französischen Protestanten, den Hugenotten, verübt werden, hält er eine viel beachtete Rede vor dem Parlament in Bordeaux; zwischen 1572 und 1576 führt er heikle Verhandlungen zwischen dem Katholiken Henri de Guise und dem Protestanten Henri de Bourbon, dem zukünftigen Heinrich IV. und König von Navarra.
Doch auch wenn sich der Seigneur d’Eyquem darin gefällt, zwischen zwei diplomatischen Missionen seine innere Freiheit inmitten seiner Bücher zu leben, so fürchtet er doch die geistige Erstarrung. Deshalb verlässt er mit 48 Jahren seine Ländereien und begibt sich auf eine 17 Monate dauernde Rundreise, wo er, »den Hintern im Sattel«, seine Philosophie auf den Straßen Europas, Frankreichs und Navarras spazieren führen wird. Wer ihn nach dem Grund seiner Reisen fragt, dem antwortet Montaigne: »Ich weiß wohl, was ich fliehe, aber nicht, was ich suche.« Zweifelsohne sucht er manche Städte auch auf, in denen dem Harngrieß, einem Nierensteinleiden, Abhilfe geschaffen würde – zum ersten Mal hatte er mit dieser Krankheit 1578 zu kämpfen.
Als er durch Paris reist, präsentiert er dem französischen König Heinrich von Navarra seine »Essais« und freundet sich mit ihm an, führt Gespräche mit Ministern verschiedener Konfessionen und mehreren Botschaftern. In Rom wird er vom Papst persönlich empfangen und erhält den Ehrentitel »römischer Bürger«. Der Hauptbeweggrund für dieses Abenteuer ist jedoch die »Gier auf neue und unbekannte Dinge« (I, 9), das Vergnügen, sein Hirn an anderen Hirnen zu »reiben und zu feilen«: »Aus dem Umgang mit Land und Leuten gewinnt die menschliche Urteilskraft einen ungemeinen Klarblick. Wir sind alle in uns selbst eingezwängt und hineingekrümmt, und unser Blick reicht nicht weiter als bis zur Nasenspitze.« (I, 26) Diese 500 Tage, in denen Michel de Montaigne durch unterschiedliche Länder, Gesellschaften, Konfessionen, Landschaften und Klimagebiete reist, erweitern sein Bewusstsein für die vielfältigen Unterschiede der Sitten und Verhaltensweisen: »Ich wüsste keine bessre Schule, uns im Leben weiterzubilden, als ihm unausgesetzt die Mannigfaltigkeit so vieler andrer Daseinsformen, Anschauungen und Gebräuche vorzuführn.«
Am 7. September 1581, er ist gerade in Florenz, informiert ihn ein Brief, dass er ins Rathaus von Bordeaux gewählt wurde. Nach seiner Wiederwahl zwei Jahre später, muss Montaigne eine von Frankreichs Krone abhängige Region führen, die allerdings gleichermaßen ein lebhaftes Zentrum der Katholischen Liga und Objekt der Begierde seines Freundes, des Königs von Navarra, ist. Er ist ein geschickter Diplomat, und es gelingt ihm, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Als sein Mandat zu Ende geht, wird die Stadt von der Pest heimgesucht und zwingt ihn, die Flucht zu ergreifen. Im Dezember 1585 ist er zurück auf seinen Ländereien und beschäftigt sich mit der Durchsicht der ersten beiden Bücher seiner »Essais«, denen er nun noch ein drittes hinzufügt. Doch bleibt er als hingebungsvoller Diener des Gemeinwesens nach wie vor in die Geschicke seiner Zeit verwickelt. 1588, als er anlässlich einer Neuauflage seiner »Essais« nach Paris reist, wird er auf Befehl von Henri de Guise durch Anhänger der Katholischen Liga, sogenannte »Ligueurs«, in der Bastille gefangen gesetzt, doch schon einige Stunden später dank der Intervention der Königinmutter, Katharina von Medici, befreit.
Blüten des Alters
In seinen letzten Lebensjahren lernt Montaigne Marie de Gournay kennen. Im Zusammensein mit seiner »geistigen Adoptivtochter«, für die er »mehr als väterliche Liebe« empfindet, wird er sein Alter »anwärmen« – 1595 setzt Marie de Montaigne sich für eine posthume Neuauflage der »Essais« ein. Im Alter hält Montaigne nichts mehr von seiner wichtigsten Aufgabe ab: Er überarbeitet, streicht oder ergänzt unermüdlich den Text seiner Manuskripte, die Hinzufügungen, die sogenannten »allongeails«, machen fast ein Viertel des Werkes aus. Die »Essais« sind somit ein work in progress und machen es sich zur Aufgabe, die verlorene Zeit zu rekonstruieren. Montaigne ist gerade dabei, einer neuen Fassung den letzten Schliff zu geben, als ihn während einer in seinem Schlafzimmer gelesenen Messe infolge eines Halsödems am 13. September 1592 der Tod ereilt.
Es ist die wechselseitige Durchdringung von Montaignes Leben und Werk, die den »Essais« einen besonderen Sinn verleiht: Für den Autor sind sämtliche Ereignisse und Umschwünge seiner Existenz zugleich essenziell und doch unbedeutend, weil sie nur Momentaufnahmen in einer endlosen, erst durch den Tod abgeschlossenen Aufgabe sind, gewissermaßen Kapitel eines stets »zukünftigen« Buches, in dem das Geschehene unaufhörlich neu betrachtet wird: allerdings nicht etwa, um es ungeschehen zu machen oder auszulöschen, sondern um es zu ergründen, es »nachzuempfinden«. So sind die »Essais« nicht nur ein »Buch, das mit seinem Autor wesensgleich ist«, sondern auch wesensgleich mit dem Leben, das diesem Buch seinen Stempel aufdrückt.
Montaignes Grundbegriffe
Von Paul Mathias
Montaignes Selbstbeobachtungen sind weit entfernt vom geschwätzigen Narzissmus heutiger Bekenntnisliteratur. Auch handelt es sich nicht um therapeutische Erkundungen des Unbewussten. Montaignes Ich spricht für alle, weil es durch die Untersuchung ureigenster Zweifel und Freuden dem Kern der menschlichen Existenz nachspürt.
Sitten und Gesetze
Sie »beherrschen« uns. Denn nicht nur die Menschen und die Nationen unterscheiden sich, sondern: »In nichts ist die Welt so mannigfaltig wie in den Sitten und Gesetzen.« (II, 12) Was bedeutet, dass die wahren Gründe unserer Gebräuche alles andere als einen rein vernünftigen Ursprung haben. Zwar verleihen Sitten »unserem Leben Gestalt«, doch kennt »jedes Volk (…) viele Sitten und Gebräuche, die irgendeinem anderen, weil damit unvertraut, höchst seltsam, ja barbarisch vorkommen« (III, 13). Die fast erdrückende Macht der Gebräuche hat uns also zu dem gemacht, was wir sind – und gleichzeitig können wir nicht verstehen, aus welchem Holz wir eigentlich geschnitzt sind! Das gilt für sogenannt zivilisierte Völker ebenso wie für Stämme von »Menschenfressern«. Denn das Problem der Sitten betrifft unser innerstes Wesen, das wir nie richtig einordnen können, im Angesicht eines fundamentalen Andersseins, von dem wir kaum mehr als unscharfe Reflexe erhaschen. So muss jeder Einzelne versuchen, sich zu bestimmen oder neu zu schöpfen, seine kulturelle Identität anzunehmen oder zu bestätigen. Meinungen, Anschauungen, Lebens- und Denkweisen, dies alles bildet einen unauflöslichen Wirrwarr aus Missverständnissen und Freundschaften, aus kriegerischer Gewalt und »Ordnungen«, wie man früher die politischen Verfassungen nannte. Montaigne denkt zutiefst pluralistisch und interessiert sich daher nur wenig für die Ursprünge dieser Phänomene, sondern fasst Gebräuche eher als Prozesse auf, unter deren Gewalt wir verdammt sind, unser Leben zu finden.
Der Tod
Zu den bedeutendsten in den »Essais« thematisierten Themen gehört der Tod. Für Montaigne ist er weniger Problem als schlichte Tatsache. Und zwar eine unsere »conditio humana« bedingende Tatsache, weil wir durch sie an der universellen Vergehensbewegung aller Dinge teilhaben. Als schlichter, mechanischer Vorgang fügt sich der Tod ganz natürlich mitten ins Leben ein, nicht als dessen Gegensatz, sondern als ein steter »Übergang«. Dennoch stellt der Tod eine ethische Herausforderung dar, begründet durch die Angst, die wir vor ihm empfinden und von der wir uns niemals vollständig befreien können. Das Ziel: »Denselben Weg, den ihr ohne Furcht und Schrecken vom Tod zum Leben gegangen seid, geht ihn zurück nun vom Leben zum Tod!« (I, 20) Es zeichnet uns Menschen gegenüber dem Tier aus, dass wir »die Fähigkeit, ihn uns vorzustellen und zu vollziehen«, besitzen. Dieses Wissen prägt unseren gesamten Weltzugang. Daher die radikale Wichtigkeit einer »Vorbereitung auf den Tod«, dem man sich »nähern« und den man »zähmen« soll. Die Herausforderung liegt für Montaigne darin, sich auf das Unvorbereitbare vorbereiten zu müssen. Eine Übung des Sterbenlernens, die jeder Mensch für sich vollziehen muss.
Philosophie
»Ein Philosoph aus Zufall, ohne Vorbedacht«, so beschreibt sich Montaigne, für den die Philosophie keine Fleißarbeit ist, sondern das Glück, zu leben und zu denken. Gewiss, manchmal ist in den »Essais« von »Schulen« oder »Genres« der Philosophie die Rede. Allerdings nicht in lobenden Worten. Von den maßlosen Gedankenflügen mancher »Schulen« sollte man nicht auf die Eitelkeit der »wahren und naiven Philosophie« schließen. Denn auf dem Grund dieser »süßen Medizin Philosophie«, wenigstens in dem Teil, »der dem Leben dient, können sie sich jenen Betrachtungen zuwenden, die ihnen dazu verhelfen, sich ein Urteil über unsre Neigungen und Charaktereigenschaften zu bilden, sich gegen die Untreue der Männer zu schützen, die Wildheit ihrer eignen Begierden zu zügeln, mit ihrer Freiheit sinnvoll umzugehen, die Freuden des Daseins zu verlängern sowie die Unzuverlässigkeit eines Verehrers, die Rohheit ihres Gatten, das Ärgernis des Alterns samt Runzeln mit menschlicher Würde zu ertragen« (III, 3). Hierin liegt der Grund, weshalb Montaigne die Philosophie nicht als »Studienfach« betrachtet, sondern als Lebensform und gelehrten Frohsinn. »Den Diogenes wiederum fragte man vorwurfsvoll, warum er, unwissend wie er sei, sich mit der Philosophie befasse. ›Weil ich als Unwissender‹, entgegnete er, ›dafür umso besser geeignet bin.‹« (I, 26)
Vernunft
Hinsichtlich des Vernunftbegriffs bei Montaigne sollten wir uns vor einer zu engen Auslegung hüten. In jedem Fall ist sein Vertrauen in diese Fähigkeit eher gering: »Dieser Verstand (und mit Verstand bezeichne ich immer jene scheinbare Urteilskraft, die sich jeder in sich zurechtmodelt), der aufgrund seiner Beschaffenheit für ein und dieselbe Sache hundert entgegengesetzte Gründe vorzubringen vermag, ist ein Werkzeug aus Weichblei oder Wachs, dehnbar, biegsam und jedem Maß und jeder Richtung anzupassen – man muss nur den richtigen Dreh zu finden wissen.« (II, 12) Anders gesagt, die Vernunft überschreitet die Grenzen von Geradem und Geschwungenem, von Strengem oder Verworrenem und bezeichnet unsere Anstrengung, nicht nur Dinge, sondern auch Handlungen, Benehmen und allgemein den Sinn all dessen, was ist, in Worte zu fassen. Indem sie der Meinung, Vermutung, dem Glauben wie auch der Wissenschaft nahesteht, wird die Vernunft zum Kampfplatz widersprüchlicher Diskurse, aber auch zum Ort der unendlichen Vielfalt des menschlichen Verstands. Denn: »Alles, was unser geistiges Vermögen hervorbringt, das Wahre wie das Falsche, ist ungewiss und anfechtbar.« (II, 12) Heilsam ist immer, zwei Seiten im Blick zu behalten: eine Vernunft, die »der Erfahrung den Boden entzieht«, wenn man sich von schädlichen Gebräuchen befreien muss; und einen Rückgriff auf die Erfahrung, wenn das Denken sich in fernen Abstraktionen verliert. Vernunft meint bei Montaigne also: infragestellen, aufdecken, reproduzieren, seine Überzeugung ändern, auf etwas zurückkommen, endlos sein Werk überarbeiten, interpretieren und so Sinn erschaffen.
Das Leiden
Es gibt so etwas wie einen »Stoizismus« Montaignes. Davon zeugen sein Mut und seine Ausdauer, mit denen er einem Nierensteinleiden und den unausweichlichen Nierenkoliken begegnete. »Man muss lernen zu erdulden, was sich nicht vermeiden lässt«, schrieb er und fügte hinzu, dass Gutes wie Schlechtes zum Wesen unseres Lebens gehören. Doch bleibt ein Gegenmittel: Wenn unsere, die Sinne erweiternde Vorstellungskraft uns mit Schmerzen lähmt, kann der Geist dagegen angehen, indem er uns die Notwendigkeit der Ordnung der Dinge, der wir uns unterwerfen müssen, vor Augen führt. Aber ach, wenn doch nur der Geist »ebenso zu überzeugen wie zu predigen« (III, 13) wüsste! Auch Medikamente bieten letztlich keine Linderung. Denn es gibt kein Mittel gegen »die Beschwerden des Alters«, niemand entgeht dem Schmerz. Eher weist da die Natur einen Ausweg: »Gibt es etwas Wohligeres als den nach den schärfsten Koliken eintretenden Umschwung, wenn man durch den Abgang des Steins aus äußerstem Schmerz blitzartig wieder ins Licht einer völlig beschwerdefreien Gesundheit versetzt wird?« (III, 13) Das beweist, dass Schmerz und Vergnügen nah beieinanderliegen. Ja sogar, dass es möglich ist, Schlechtes in etwas Gutes umzuformen. So schreibt Montaigne einmal in sein Reisetagebuch: »Ich schied meinen Stein nicht ohne Schmerzen und Blutabgang aus (…). Er hatte die Größe eines kleinen Apfels oder eines Tannenzapfens (…) und genau die Form des männlichen Glieds. Es war ein großes Glück für mich, dass ich ihn herausbrachte.«
Weiterführende Lektüre
Montaignes Werk war von Beginn an ein Verkaufserfolg. Die 1580 veröffentlichten »Essais« erlebten noch zu Lebzeiten des Autors mehrere Auflagen. Die hochgelobte Übersetzung von Hans Stilett aus dem Jahre 1998 ist als die »Erste moderne Gesamtübersetzung« in der von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen »Anderen Bibliothek« erschienen. In dieser sind auch die Notizen, mit welchen Montaigne sein Handexemplar ergänzt hat, berücksichtigt.
Zur Einführung in Montaignes Werk eignet sich Jean Starobinskis »Denken und Existenz« (Fischer, 2002). Anregend ist ebenfalls Sarah Bakewells »Wie soll ich leben? oder Das Leben Montaignes in einer Frage und zwanzig Antworten« (C.H. Beck, 2013).
MontaigneEssais
Dass Philosophieren sterben lernen heiße
Cicero sagt, das Philosophieren sei nichts anders, als eine Vorbereitung zum Tode.[1] Dieses kommt daher, weil das Studieren und die tiefsinnigen Betrachtungen unsere Seele einigermaßen außer uns ziehen, und derselben, ohne dass der Körper daran Teil hat, etwas zu tun verschaffen; welches gleichsam eine Anweisung zu dem Tode ist, und eine gewisse Ähnlichkeit mit demselben hat: oder vielmehr daher, weil alle Weisheit und alles Reden der Welt endlich darauf hinauslaufen, uns zu lehren, dass wir den Tod nicht fürchten sollen. In der Tat, entweder weiß die Vernunft selbst nicht was sie will: oder, sie muss bloß auf unser Vergnügen sehen, und alle ihre Bemühungen müssen überhaupt auf nichts anders abzielen, als uns ein glückseliges Leben und Ruhe zu verschaffen, wie die H. Schrift sagt.[2] Die Meinungen der Menschen stimmen darinnen überein, dass die Belustigung unser Zweck sei; ob sie gleich unterschiedene Mittel dazu zu gelangen ergreifen: sonst würde man dieselben gleich anfangs verbannen. Denn, wer wollte einem Gehör geben, welcher unsern Verdruss und unsere Beschwerlichkeit zu seinem Endzwecke wählte? Die Streitigkeiten der Weltweisen kommen also in diesem Falle bloß auf Worte an. Transcurramus, solertissimas nugas.[3] Es zeigt sich hierbei mehr Eigensinn und Zanksucht, als einem so ehrwürdigen Stande geziemet. Allein, der Mensch mag eine Person vorstellen, welche er immer will, so spielt er doch allezeit die seinige mit unter.
Sie mögen sagen, was sie wollen: selbst bei der Tugend ist unsere Hauptabsicht die Wollust. Ich gebe ihnen mit Fleiße dieses Wort an zu hören, welches ihnen so verhasst ist. Und bedeutet dasselbe ein vorzüglich großes Vergnügen und ungemeines Ergötzen: so ist es eher vermittelst der Tugend, als vermittelst sonst etwas, zu erhalten. Diese Wollust ist desto mehr eine wahre Wollust, je lebhafter, stärker und männlicher sie ist: ja, wir sollten ihr den Namen des Vergnügens beilegen, welcher vorteilhafter, angenehmer und natürlicher ist, und sie nicht Munterkeit (vigueur) nennen, wie wir getan haben. Die andere niederträchtigere Wollust müsste, wenn sie anders diesen schönen Namen verdiente, denselben nur gemeinschaftlich, nicht aber vorzüglich führen. Ich finde sie nicht so von Unbequemlichkeiten und Widerwärtigkeiten befreiet, als es die Tugend ist. Ohne daran zu gedenken, dass ihr Genuss nur einen Augenblick dauert, flüchtig und vergänglich ist: so geht sie noch darzu nicht ununterbrochen fort, sie hat ihre Beschwerlichkeiten, und kostet blutsauern Schweiß; überdies aber wird sie von so vielerlei schmerzhaften Leidenschaften begleitet, und hat zur Seite einen so starken Ekel, dass derselbe so gut als die Reue ist. Wir tun sehr unrecht, wenn wir meinen, ihre Unbequemlichkeiten dienten ihrer Süßigkeit statt eines Stachels und Gewürzes, gleichwie in der Natur entgegengesetzte Dinge einander beleben; und hernach, wenn wir auf die Tugend zu reden kommen, sprechen, sie wäre mit dergleichen Folgen und Unbequemlichkeiten überhäuft, und würde dadurch rauh und unzugänglich gemacht: da dieselben doch hier, weit mehr, als bei der Wollust, das göttliche und vollkommene Vergnügen, welches sie uns verschaffet, edler und empfindlicher machen, und erheben. Gewiss! Derjenige ist nicht wert sie kennen zu lernen, welcher derselben Geschmack ihrem Nutzen entgegensetzt, und weder ihre Annehmlichkeiten noch ihren Gebrauch erkennet! Sagen uns diejenigen, welche uns vorstellen, dass sie beschwerlich und mühsam aufzutreiben, ihr Genuss aber angenehm sei, wohl etwas anders, als dass sie allezeit unangenehm? Denn, durch was für menschliche Mittel kann man jemals zu derselben Genusse gelangen? Die Allervollkommensten haben sich wohl begnügt darnach zu trachten, und sich demselben zu nähern, doch ohne denselben zu erhalten. Allein sie betrügen sich: weil bei allen uns bekannten Ergötzlichkeiten sogar das Bestreben nach denselben ergötzlich ist. Die Unternehmung ist von eben der Art, als die Sache, auf welche sie abzielet: denn sie ist ein wichtiger Teil der Wirkung, und gleichen Wesens. Die Glückseligkeit und Wonne, welche in der Tugend hervorleuchtet, erfüllet alle ihr Zubehör und ihre Zugänge; sogar den ersten Eingang, und die äußersten Grenzen.
Allein unter die vornehmsten Vorteile, welche uns die Tugend verschaffet, gehöret die Verachtung des Todes: ein Mittel, welches unserm Leben eine holde Ruhe verschafft, und uns desselben Genuss rein und angenehm macht, ohne welches alle andere Wollust verloschen ist. Dieses ist die Ursache, warum alle Sekten der Weltweisen in diesem Stücke übereinstimmen. Denn, ob sie uns gleich alle einmütig den Schmerz, die Armut, und andere Zufälle, welchen das menschliche Leben unterworfen ist, zu verachten Anleitung geben; so geschieht es doch nicht so sorgfältig: teils, weil diese Vorfälle nicht so unvermeidlich sind, da die meisten Menschen ihr Leben hinbringen, ohne etwas von der Armut zu wissen, und noch andere gar ohne Schmerz und Krankheit zu empfinden, wie Xenophilus, der Tonkünstler, welcher 106 Jahre bei vollkommener Gesundheit gelebet hat; teils, auch deswegen, weil der Tod, wenn es auf das Schlimmste geht, nach unserm Belieben allen Unbequemlichkeiten ein Ende machen, und abhelfen kann.[4] Allein der Tod selbst ist unvermeidlich.
Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna, serius ocius
Sors exitura et nos in aeternum
Exilium impositura cymbae.[5]
Und folglich haben wir, wenn wir uns vor demselben fürchten, beständig Ursache zu einer Marter, die auf keine Art gelindert werden kann. Es ist kein einziger Ort, von welchem sie nicht herkommen sollte. Wir können, wie in einer verdächtigen Gegend, den Kopf immerfort herumdrehen: quae quasi saxum Tantalo semper impendet.[6] Unsere Parlamente lassen öfters die Missetäter auf der Stelle, wo das Verbrechen begangen worden ist, hinrichten. Man führe sie unter Weges durch die schönsten Häuser: man tue ihnen so viel zu gute, als man will,
– Non Siculae dapes
Dulcem elaborabunt saporem;
Non avium cytharaeque cantus
Somnum reducent.[7]
Meint man wohl dass sie sich daran ergötzen werden? Dass ihnen der Endzweck ihrer Reise, welcher ihnen gemeiniglich vor Augen schwebet, nicht allen Geschmack an diesen Ergötzlichkeiten benommen und verdorben hat?
Audit iter, numeratque dies, spatioque viarum
Metitur vitam, torquetur peste futura.[8]
Das Ziel unseres Laufes ist der Tod. Auf diesen Gegenstand müssen wir unumgänglich unsere Absicht richten. Erschrecken wir vor demselben: wie ist es möglich, dass wir ohne Schauer einen Schritt fortsetzen können? Der Pöbel hilft sich dadurch, dass er nicht daran gedenket. Allein, durch was für viehische Dummheit verfällt er in einen so groben Fehler? Er muss den Esel bei dem Schwanze zäumen.
Qui capite ipse suo instituit vestigia retro.
Es ist nicht zu verwundern, wenn derselbe so oft betrogen wird. Man macht die Menschen bloß mit dem Namen des Todes furchtsam, und die meisten kreuzigen und segnen sich davor, wie vor dem Teufel. Und weil desselben in den Testamenten Meldung geschieht: so darf man nicht denken, dass sie eher Hand daran legen werden, als bis ihnen der Arzt das Leben abspricht; und Gott weiß mit was für Überlegung sie bei Schmerz und Schrecken dasselbe schmieden. Die Römer, welchen dieses Wort allzu hart klang, und ein böses Anzeichen zu sein schien, haben dasselbe mildern und umschreiben gelernet. Anstatt zu sprechen, er ist tot, sagten sie, er hat zu leben aufgehöret, er hat gelebet. Sie sind zufrieden, wenn es nur Leben ist, gesetzt, dass es vorbei ist. Von denselben haben wir unser feu Maistre Jehan (weyland Herr Johann) entlehnet.[9] Zum Glücke gelten, wie es heißt, die Worte wie die Münze. Ich bin gegen 11 Uhr und Mittags den letzten Tag des Hornungs geboren, im Jahre 1533, wie wir jetzo rechnen, da wir von dem Wintermonate anfangen. Es sind gerade 15 Tage, dass ich das neun und dreißigste Jahr zurückgelegt habe; und wenigstens muss ich noch einmal so lang leben. Indessen würde es eine Torheit sein wenn man nicht auch an so weit entfernte Dinge denken wollte. Allein, was? Junge und Alte büßen das Leben auf einerlei Art ein. Keiner geht anders aus der Welt, als ob er den Augenblick erst in dieselbe getreten wäre; wozu noch kommt, dass kein so abgelebter Greis ist, der, wenn er es auch so hoch als Mathusalem gebracht hat, nicht noch zwanzig Jahre mitzulaufen gedächte. Überdies, armer Tropf, wer hat denn deinem Leben ein gewisses Ziel gesetzt? Du verlässest dich auf das Geschwätze der Ärzte. Betrachte vielmehr das, was wirklich geschieht, und was die Erfahrung lehret. Nach dem gemeinen Laufe der Natur lebst du aus einer außerordentlichen Gnade lange. Du hast das gewöhnliche Ziel des Lebens überschritten. Lass es sein. Rechne einmal, ob nicht unter deinen Bekannten ungleich mehr gestorben sind, ehe sie in deine Jahre gekommen, als nachdem sie dieselben erreicht. Ja, bring einmal sogar diejenigen, welche ihr Leben durch den erlangten Ruhm geadelt haben, in ein Verzeichnis. Ich will mich verwetten deren mehr zu finden, die vor, als die nach fünf und dreißig Jahren, gestorben sind. Es ist beides der Vernunft und Religion vollkommen gemäß, selbst an der Menschheit des Heilandes ein Beispiel zu nehmen. Allein dieser starb in seinem drei und dreißigsten Jahre. Der größte Mensch, der ein bloßer Mensch gewesen ist, Alexander, starb auch in diesem Alter. Auf wie vielerlei Art pflegt uns der Tod nicht zu überfallen?
Quid quisque vitet numquam homini satis
Cautum est in horas.[10]
Ich will die Fieber und das Seitenstechen übergehen. Wer hätte jemals gedacht, dass ein Herzog von Bretagne in dem Gedränge erdrücket werden sollte, wie es einem bei dem Einzuge des Papsts Clemens zu Lyon begegnete?[11] Hast du nicht einen unserer Könige in einem Lustkampfe das Leben einbüßen sehen?[12] Und starb nicht einer von seinen Vorfahren darüber, dass er von einem Schweine verwundet worden war?[13] Äschylus mag sich immer auf die Beine machen, wenn ihm ein Haus über dem Kopfe einstürzen will: er wird endlich doch von einer Schildkrötenschale, welche einem Adler in der Luft aus den Klauen fällt, erschlagen.[14] Ein anderer stirbt an einem Weinbeerkorne.[15] Ein Kaiser, weil er sich mit dem Haarkamme geritzet hat.[16] Ämilius Lepidus, weil er sich mit dem Fuße an seiner Türschwelle gestoßen hat.[17] Ausidius aber, weil er bei dem Eintritte in die Ratsversammlung gestolpert.[18] Der Prätor Cornelius Gallus, Tigillinus Hauptmann über die Leibwache zu Rom, und Ludewig des Guy von Gonzaga Sohn, Marquis von Mantua, sind in den Armen der Weibespersonen gestorben; und, welches noch ärger ist, Speusipp, ein Platonischer Philosoph, und einer von unsern Päpsten, ebenfalls.[19] Der arme Bebius, ein Richter, gab einer Partei acht Tage Aufschub, ward aber indessen selbst überfallen, und endigte sein Leben.[20] Indessen, dass Caius Julius ein Arzt, einem Kranken die Augen salbete, drückte ihm der Tod seine eigenen zu.[21] Mein Bruder, der Hauptmann S. Martin, wenn ich denselben hier mit erwähnen soll, ward in seinem drei und zwanzigsten Jahre, da er seine Herzhaftigkeit bereits genugsam bewiesen hatte, beim Ballspiele mit dem Balle etwas über dem rechten Ohre getroffen, doch, dem Ansehen nach, ohne Quetschung und Verwundung. Er setzte sich deswegen auch nicht nieder, und ruhte nicht; starb aber fünf oder sechs Stunden darauf an einem Schlagflusse, welchen ihm dieser Wurf zugezogen hatte. Da uns nun diese häufigen und ganz gemeinen Beispiele vor Augen schweben: wie ist es möglich, dass wir uns der Vorstellung des Todes entschlagen können, und dass wir nicht alle Augenblicke denken er habe uns bei der Krause? Was liegt daran, wird man mir antworten, es sei damit wie es wolle, wenn man sich nur keinen Kummer darüber macht? Ich bin selbst der Meinung. Wenn man nur mit ganzer Haut entwischen kann, durch was für Mittel es auch geschehen mag, und sollte es unter dem Kalbfelle sein so würde ich mich darüber nicht lange besinnen: denn ich bin zufrieden, wenn ich mich nur wohl dabei befinde, und mit einer guten Art davonkomme; sie mag übrigens noch so wenig rühmlich und erbaulich sein.
– – Praetulerim delirus inersque videri,
Dum mea delectent mala me, vel denique fallant,
Quam sapere et ringi.[22]