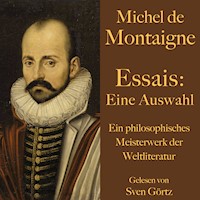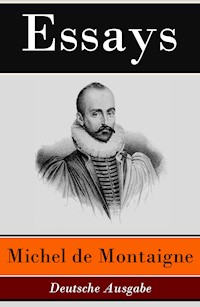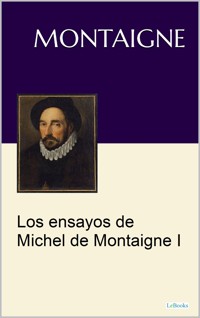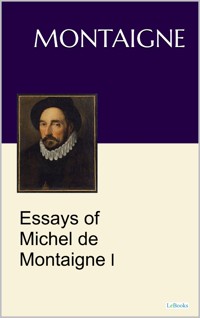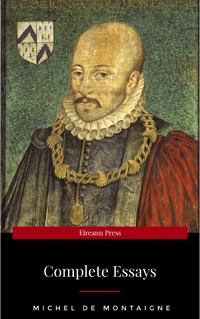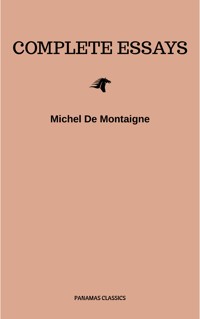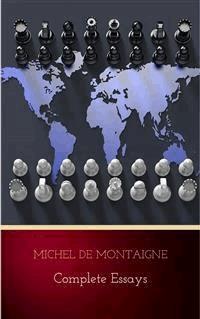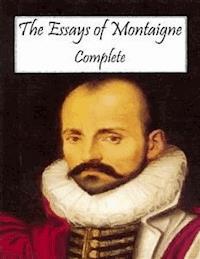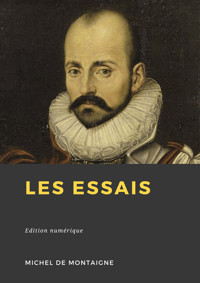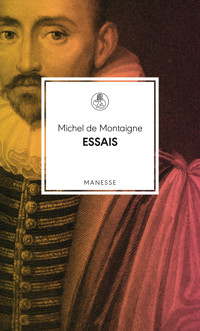
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Was hat es eigentlich mit dem Menschsein auf sich? Worin besteht das spezifisch Humane in uns? – Das fragt sich Michel de Montaigne in seinen «Essais» immer von Neuem und unterhält sein Publikum mit Selbstgesprächen, Anekdoten, geistreichen Aperçus und Zitaten. Im Weinen und Lachen, im Lieben und Hassen, im süßen Nichtstun, im Rausch und im Sterben sucht er nach Aufklärung über die zentralen Grundtatsachen des Menschenlebens. Den Krieg hält er für ein Übel, das Streben nach Erkenntnis für unverzichtbar und innere Wahrhaftigkeit für eine Pflicht. Widersprüchlich und subjektiv wie das Leben selbst, gibt er in klarer Sprache Antworten, die bis heute zum Nachdenken anregen. Montaignes gedankenreicher Skeptizismus, sein heiterer Tiefsinn und seine Gedankenschärfe haben in vier Jahrhunderten nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Diese Neuausgabe der «Essais» enthält die deutsche Referenzübersetzung von Herbert Lüthy, kritisch durchgesehen und neu gesetzt.
Montaignes «Essais» sind von einem zutiefst humanen Gedanken durchdrungen: «Niemand ist davon frei, Dummheiten zu sagen. Das Unglück ist, sie gar feierlich vorzubringen.» Es ist ein erstaunliches Vermächtnis, das uns der Renaissance-Schriftsteller und -Philosoph hinterlassen hat, erstaunlich vor allem wegen seines hohen Gehalts an wahrem Leben. Nie zuvor hatte ein Autor in solch unmittelbarer Frische schreibend über sich nachgedacht, ohne Rücksicht auf konventionelle Formen und ohne Zugeständnisse an Leseerwartungen. «Ich habe mein Buch nicht mehr gemacht, als es mich gemacht hat, ein Buch vom Fleisch und Blut seines Verfassers», heißt es an einer Stelle. Mit den «Essais» schuf Montaigne eine neue, offene Form: den literarischen «Versuch». Getragen von der Freude am Zufälligen, verschränken sich hier auf originelle Weise fundierte Bildung und präzise Beobachtungen zu den Skurrilitäten des Alltags.
«Mit ihm würde ich es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf der Erde heimisch zu machen», urteilte Friedrich Nietzsche über das Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1312
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Was macht Menschen wahrhaft frei? Wie retten wir unser Ich vor den Anfeindungen der Welt? Worin besteht das spezifisch Humane? – Antworten gibt Michel de Montaigne in lebensklugen Selbstgesprächen, Anekdoten und Aperçus. Im Weinen und Lachen, im Lieben und Grollen, im süßen Nichtstun, im Rausch und im Sterben sucht er nach Aufklärung über die Grundtatsachen des Lebens. Den Krieg hält er für ein Übel, das Streben nach Erkenntnis für unverzichtbar und innere Wahrhaftigkeit für eine Pflicht. Montaignes geistreicher Skeptizismus und sein heiterer Tiefsinn haben in viereinhalb Jahrhunderten nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt.
Nie zuvor hatte ein Autor in solch unmittelbarer Frische schreibend über sich nachgedacht, ohne Rücksicht auf konventionelle Formen und ohne Zugeständnisse an Leseerwartungen. «Ich habe mein Buch nicht mehr gemacht, als es mich gemacht hat, ein Buch vom Fleisch und Blut seines Verfassers», heißt es an einer Stelle. Mit den «Essais» schuf Montaigne eine neue, offene Form: den literarischen «Versuch». Getragen von der Freude am Zufälligen, verschränken sich hier auf originelle Weise fundierte Bildung und präzise Beobachtungen zu den Skurrilitäten des Alltags.
Diese Neuausgabe der «Essais» enthält die deutsche Referenzübersetzung von Herbert Lüthy, kritisch durchgesehen und neu gesetzt.
Michel de Montaigne wurde 1533 im Périgord in eine reiche Kaufmannsfamilie geboren und genoss eine humanistische Erziehung. Nach seinem Studium der Rechte war er als Parlamentsrat und Bürgermeister in Bordeaux tätig und unternahm ausgedehnte Reisen in Frankreich, Deutschland und Italien. Dazwischen zog er sich immer wieder in die Einsamkeit zurück und widmete sich seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Sein Hauptwerk sind die «Essais», an denen er von 1571 bis 1585 arbeitete und die eine neue literarische Form begründeten. Das zentrale Thema seiner Reflexionen und Beobachtungen ist die Analyse des Menschen als komplexes, widersprüchliches Wesen. Michel de Montaigne starb 1592.
«Ich sehe ihn als den Erzvater, Schutzpatron und Freund jedes ‹homme libre› auf Erden, als den besten Lehrer dieser neuen und doch ewigen Wissenschaft, sich selbst zu bewahren, gegen alle und alles.» Stefan Zweig
«Mit ihm würde ich es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf der Erde heimisch zu machen.» Friedrich Nietzsche
«Nirgends entwirft Montaigne eine Ideologie oder ein Programm … Auch in politicis ist es ein Buch der geistigen Hygiene.» Herbert Lüthy
Michel de Montaigne
ESSAIS
Ausgewählt, aus dem Französischen übersetzt und kommentiert von Herbert Lüthy
Kritisch durchgesehene Neuausgabe
MANESSE VERLAG
Einleitung
Dass man bei Montaigne nicht suchen soll, was er nicht hat
«Dies hier ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es warnt dich schon beim Eintritt …» Was bliebe da einer Vorrede viel zu sagen? Montaigne und sein Buch sagen selbst alles freiheraus, was sie über einander zu sagen finden, Montaigne über sein Buch und das Buch über ihn; und nichts ließen sie sich so angelegen sein, wie zu verhüten, dass man sie tiefgründig missverstehe. «Montaigne ist unser aller Nachbar», und der offenherzigste, mitteilsamste, ja geschwätzigste, den wir uns wünschen können. Er verheimlicht uns nichts, oder doch nichts Wesentliches; und wenn er, der so eingehend und liebevoll die Züge seines Vaters schildert, der seinem Freund La Boëtie eines seiner berühmtesten Essais widmet und der uns über sich selbst kaum eine Einzelheit seines Speisezettels, seiner Verdauung und seiner Launen verschweigt, von andern Dingen zu reden vergisst – ganz von seiner Mutter, die ihn um fast zehn Jahre überlebte, fast ganz von seiner Gattin, deren Existenz er höchstens einmal beiläufig erwähnt, und von seinen Kindern, deren «zwei oder drei» ihm im Kindbett wegstarben –, dann haben wir daraus nichts anderes zu schließen, als dass dies Dinge sind, die ihn wenig berührten: und auch das rundet sein Bild. Gleicherweise ohne Geheimnis und Hintergründigkeit ist, was er so über Gott und die Welt und die Zeitläufte äußert: nicht feingesponnene Ergebnisse langen spekulativen Nachdenkens, nicht tiefschürfende Schlüsse einer angestrengten Urteilskraft, zu deren Verständnis der Leser eines Wegweisers durch ein esoterisches Gedankensystem bedürfte, sondern die platterdings herausgesagten, unverbundenen und morgen vielleicht wieder wechselnden Meinungen eines Landedelmanns sehr bürgerlichen Geistes und Herkommens, mehr aus Lebenserfahrung und gemeinem Menschenverstand als aus einer Weltanschauung geboren, und ganz ohne Anspruch auf höhere Gültigkeit. Es liegt ihm denn auch viel weniger daran, die Ergebnisse seines Denkens zu zeigen oder überhaupt zu Ergebnissen zu kommen, als diesem Denken selbst in seiner spielerischen Bewegung zu folgen und uns mitgehen zu lassen; und wir können in der Tat mühelos mitgehen, ohne den Atem zu verlieren, denn es geht nie sehr weit, sondern unternimmt nur kleine schlendernde Spaziergänge und kehrt stets wieder um, bevor es außer Sichtweite gelangt. Ziellos, wie das Buch selbst, beginnt jedes einzelne seiner Essais; und wenn er noch seinem Denken einen Gegenstand vorsetzt, dann nur, um es in Bewegung zu setzen, wie man seinem Hund einen Stein vorauswirft, nicht damit er ihn hole, sondern damit er laufe, und man ist es zufrieden, wenn er statt des Steins ein beliebiges Stück Holz oder eine tote Maus herbeischleppt.
So kann man die Essais anblättern, einige Seiten lesen und wieder aufhören nach Lust und Gefallen, wie Montaigne selbst las, wie alle seine besten Leser ihn lasen, ohne Gefahr, den roten Faden zu verlieren: denn da ist keiner. Man lernt ihn durch sein Buch kennen, wie man seinen Nachbar im Leben kennenlernen würde, in zufälligen Begegnungen, deren jede einen kleinen oder großen Strich zum Gesamtbild hinzufügt; und je gewöhnlicher die Begegnungen, je unbedeutender und unzusammenhängender die Striche, desto wahrheitsgetreuer wird endlich das Bild.
So könnte die Einführung einfach heißen: Nimm und lies! oder vielmehr: Lies und nimm! – denn es steht jedem frei, zu nehmen, was ihm behagt, wie Montaigne selbst nahm, wo und was ihm behagte, um es sich zu eigen zu machen, und wie er nach seinem eigenen Wort seinem Plutarch, sooft er ihn zur Hand nahm, lässig einmal ein Bein und ein andermal einen Flügel ausrupfte. So haben alle genommen, die mit Montaigne umgingen, und fast jeder hat das Bein oder den Flügel, den er mitnahm, als den ganzen Montaigne betrachtet. So viele Meinungen über ihn man zusammentrüge, so viele verschiedene Montaignes sähe man. Den Frommen war er ein Frommer und den Freigeistern ein Freigeist, den Heiden ein Heide und den Christen ein Christ; für die Nachfahren der Stoa war er der stoische Tugendlehrer, für die Epikureer der hohen wie der niederen Gattung ein Epikureer ihrer Gattung; die Aufklärer haben seine Urteile über Hexen- und Wundergeschichten mit unermüdlicher Begeisterung zitiert, ihre Widersacher pochten auf die Sebundus-Apologie und ihre Entthronung der Vernunft. Die Konservativen fanden bei ihm die Verteidigung des Hergebrachten, der alten Gesetze und der angestammten Ordnung, die Naturrechtler die Kritik des positiven Rechts, der Konventionen und Tünchen der Zivilisation; die Romantiker liebten seine Unordnung, seine guten Wilden und seine natürliche Pädagogie, und mit gutem Recht haben ihn alle Pragmatiker und Positivisten für sich in Anspruch genommen. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen, und eine ebenso bunte ließe sich über das aufstellen, was seine Gegner an ihm zu verwerfen fanden. Doch wie steht es nun mit seiner Wahrhaftigkeit? Kann einer so viele Gesichter haben, ohne sich zu verstellen, und so vielerlei Wahrheiten, ohne zu lügen?
Zwar hat Montaigne auch darüber alles gesagt, doch es hat ihm wenig geholfen. Seine Anrede an den Leser ist ganz wörtlich zu nehmen; doch gerade dies hat ihm kaum jemand geglaubt. Wenn also die Essais kaum einer Einleitung bedürfen, so bedürfen sie vielleicht doch einer Anleitung, nicht in ihnen zu suchen, was sie gar nicht geben wollen: nämlich Wahrheiten über irgendetwas oder irgendjemand außer Herrn Michel de Montaigne. Seine Gedanken und Meinungen mögen falsch oder richtig sein; wahr sind sie, sofern sie seine Gedanken sind. Ihre Wahrheit liegt nicht da, wo sie hingehen, denn er lässt sie überall hingehen, sondern von wo sie ausgehen und wohin sie zurückkehren. «Ramener à soi» ist eines der in ihrer vollen Begriffsweite unübersetzbaren Schlüsselworte der Essais: auf sich zurückbeziehen, an sich ziehen, zu sich nehmen, mit dem logischen Sinn der Denkbewegung vom Gegenstand auf sich selbst und mit der physischen Gebärde des Ergreifens, Festhaltens und Umfangens. So zieht er an sich, was ihm entschlüpfen will: sein Leben, seine Gefühle, seine Gedanken, sein Buch und sich selbst; und nichts anderes ist sein Vorwurf gegen die «Zügellosigkeit des Denkens», als dass es über ihn selbst und seine Begrenztheit hinauswill, um sich ins Objektive, Unbedingte und Unbegrenzte zu setzen. Er, Montaigne, will bei sich bleiben. Darum bleiben seine erkenntniskritischen Exkurse, selbst gemessen am Stand seiner Zeit, dürftig und hingeworfen, eine bloße lässige Abwehrgebärde; ihn kümmert nicht die Erkenntnis der Dinge, sondern nur die Kenntnis und Erkenntnis seiner selbst. Auch wo er sich einmal ernstlich darum bemüht, wie in der Apologie des Raimund Sebundus, bleibt seine Epistemologie im Zirkelschluss und im bloßen Kopfschütteln: wie sollte der Mensch etwas erkennen können, da er nicht einmal sich selber begreift? Alle seine philosophischen Argumente sind solche Argumente ad hominem, so unphilosophisch wie nur möglich: was hat die objektive Wahrheit eines philosophischen Satzes mit dem Philosophen zu tun, der ihn aufstellt, mit seinen Verdauungsbeschwerden, seinen Leidenschaften und seiner persönlichen Wahrhaftigkeit? So reiht er auch das heliozentrische System des Kopernikus gleichmütig unter die astronomischen Phantasien seiner Narrenchronik der Vernunft ein: was hat es mit den Altersgebrechen und Schrullen des Kopernikus zu tun, die allein ihn zu interessieren vermöchten?
Das sind frivole Argumente für den, der nach Erkenntnis der Dinge strebt. Doch Montaigne hat ein anderes Vorhaben, bei dem er sich nicht aus den Augen verlieren will, und ein anderes Bezugssystem, das die Wahrheit nicht an dem misst, worüber ausgesagt wird, sondern an dem, der aussagt – nicht nach ihrer objektiven Wahrheit, sondern nach ihrer subjektiven Wahrhaftigkeit. Jede Disziplin, von der Physik bis zur Theologie, kann aus einmal gegebenen Prämissen Schritt für Schritt zu Schlussfolgerungen gelangen, die weit über die Einsicht und Vorstellungskraft des Schließenden hinausgehen und jeden Bezug auf ihn verloren haben. Nichts ist unpersönlicher als eine richtig gelöste Rechnung oder ein logisch richtig gebauter Schluss. Eine solche Erkenntnis, die sich vom Erkennenden loslöst und sich an das Objekt heftet, hat ihm, Michel de Montaigne, nichts mehr zu sagen: sie ist zur Selbsterkenntnis nicht brauchbar. Darum auch ist die Sprunghaftigkeit, Willkürlichkeit und äußere Ziellosigkeit seiner Essais, diese schlendernde, unschlüssige und unberechenbare Bewegung seines Denkens nicht nur Eigenwilligkeit oder gar Unfähigkeit. Systematik und Wahrhaftigkeit schließen sich bei seinem Experiment aus: ein Denken oder ein Stil, der sich einer Disziplin unterwürfe, würde aufhören, ganz unmittelbar und unvermittelt sein eigen zu sein. Sorgsam scheint er stets darüber zu wachen, dass nirgends, selbst nicht aus Versehen, ein Gedankengebäude entsteht, das ohne seine Dazwischenkunft auf sich selber stünde, nirgends eine Methode sich zwischen ihn und seine Einfälle schiebt, nirgends eine Kette von Schlüssen sich folgerichtig einer aus dem andern entwickelt, ohne dass er noch seine Hand im Spiele hätte. Lieber lässt er, ironisch beobachtend, sein Denken mit Trivialitäten und hohlen Nüssen spielen und kleine Kartenhäuser bauen, die er wieder umbläst, bevor sie groß werden. Ihre großartigste, vor ihm und lange nach ihm nie auch nur annähernd erreichte Wahrheit und Tiefe aber gewinnen seine «geistigen Übungen», wo er sich selbst in die dämmernden Grenzzustände seines Bewusstseins, an den Grenzen des Schlafs, des Traums, der Betäubung, der Verstörtheit und des Todes folgt, in jene Engen, in denen sich das Bewusstsein nicht mehr vom physischen Sein abzulösen vermag – und wo es darum im Sinne der Montaigne’schen Selbsterkundung völlig wahr wird, nämlich gelöst von jeder Beziehung auf Fremdes. Das sind äußerste Vorstöße, die uns auch dies lehren, uns nicht allzu leicht bei Montaignes scheinbarer Vordergründigkeit und Oberflächlichkeit zu beruhigen; doch auch manches Trödeln und Tändeln der Essais mit Beliebigem und Banalem ist ein solcher Halbschlaf des Bewusstseins, in dem es sich unbemerkt beobachten lässt. Und gewiss fördert es dabei immer wieder Gedanken über mancherlei zutage, die ihr Interesse und sogar ihre Größe in sich selbst haben, denn es ist doch Montaigne, der denkt; aber das sind Nebenprodukte eines auf anderes gerichteten Denkens. Nicht darum geht es ihm, das Maß der Dinge zu erkennen, sondern das Maß seiner Augen. Wie er die Dinge sieht, bald so, bald anders, lässt nicht auf die Dinge schließen, sondern auf ihn, und das irrige oder schattenhafte Sehen vielleicht noch besser als das richtige. Seine Schlüsse interessieren ihn nur so weit, als sie auf ihn zurückschließen lassen; und wenn sie sich widersprechen, wird das Bild seiner selbst dadurch schärfer und plastischer, wie im stereoskopischen Sehen.
«Montaigne gegen die Wunder; Montaigne für die Wunder», notierte Pascal: erst beides zusammen ist Montaigne. Er hat wahllos und unermüdlich ein ganzes Kuriositätenkabinett aller möglichen Vernunftschlüsse seiner eigenen und der Philosophie aller Philosophen zusammengetragen, nicht um sie gegeneinander auszuspielen, sondern um die Möglichkeiten und die Reichweite des menschlichen Denkens auszukundschaften; und wenn man ihn nur ein wenig stieße, ließe er sie alle gelten, die ausgefallensten am liebsten. Sie widersprechen sich? – nun wohl, aber ihr Ganzes steckt die Grenzen des menschlichen Bewusstseins in all seinen vielfältigen Möglichkeiten ab. «Die Wahrheit ist das Ganze.» Auch für die Essais gilt der Hauptsatz Hegels, doch abgewandelt: die Wahrheit Michel de Montaignes ist die Summe seiner Widersprüche. Und diese seine Wahrheit hat er, wie Dionys der Kyniker die Bewegung durch das Gehen, durch sein Buch erwiesen: da steht er, ein ganzer Mensch, in dem all diese Widersprüche in Einklang kommen.
Eine andere, allgemeine, überpersönliche Wahrheit hat er nicht und sucht er nicht. «Denn ich sehe von nichts das Ganze»; und lächelnd fügt er hinzu: «noch sehen es jene, die es uns zu zeigen versprechen.» Dieser Verzicht auf die Kategorie der Ganzheit – die Totalität, das oberste Prinzip, die allgemeine Idee, der absolute Geist – beschwert ihn so wenig, dass ihm fast jede Meinung darüber gleich gilt; lieber, als sich darüber den Kopf zu zerbrechen, hält er sich an die, die in seinem Land und in seiner Familie herkömmlich und gewiss so gut ist wie eine andere. Er stellt sie sorgfältig außerhalb des Bereichs alles menschlichen Erkenntnisvermögens – das ist der ganze Inhalt der Sebundus-Apologie –, um sie sich umso besser vom Leibe zu halten: sie ist unerreichbar, und sie beunruhigt ihn nicht. Seine Essais, diese kleinen Spaziergänge des Denkens, sind nie unterwegs nach solcher Wahrheit, sondern immer nur nach Montaigne. Das Ganze, das er fast unterschiedslos Gott oder Natur, Schicksal oder Ordnung nennt, kommt sehr gut ohne ihn aus, und er sehr gut ohne es; oder vielmehr, wissend oder unwissend ist er darin eingebettet und geborgen, wie der Maulwurf oder die Blattlaus, die auch nicht weiß, wie ihr geschieht.
Diese ruhige, fraglose Selbstverständlichkeit ist es, die Pascal empörte, den ersten vielleicht, der Montaigne als Suchender las, der mit ihm bis an die Grenzen der Skepsis ging und sich dann voll Zorn gegen ihn wandte, als er ihn gleichmütig umkehren und sich auf seiner Suche jenseits der Skepsis allein bleiben sah. «Es gibt nur drei Arten von Menschen: jene, die Gott dienen, da sie ihn gefunden haben; jene, die sich mühen, ihn zu suchen, da sie ihn nicht gefunden haben; jene, die leben, ohne ihn zu suchen und ohne ihn gefunden zu haben.» Es ist klar, zu welcher dieser Kategorien Pascals Michel de Montaigne gehört. Man mag noch lange über die Gläubigkeit Montaignes streiten, doch es ist ein müßiger Streit: was immer er war, ein Gottsucher war er nicht. Er hat seine Glaubenspflichten erfüllt, wie seine amtlichen, staatsbürgerlichen, ehelichen, und es ist kein Grund, zu bezweifeln, dass er es ehrlich und ernstlich tat: doch nicht als etwas ihm Eigenes, nicht aus einer ihm zuteilgewordenen Erkenntnis und nicht als Ausdruck seines eigenen Wesens, sondern als das in seinem ihm durch Geburt und Herkunft zugewiesenen Lebenskreis übliche Verhalten gegenüber der unerkennbaren Ordnung des Ganzen, über die ein eigenes Urteil zu bilden ihm fern lag. Die Scheidung geht erstaunlich klar durch die ganzen Essais, und es bedarf großer Voreingenommenheit, sie nicht zu sehen: Wo Montaigne im Allgemeinen und von Allgemeinem spricht, da unterlässt er es selten, das in seiner Zeit der Glaubensverfolgungen besonders ratsame Bekenntnis zur Rechtgläubigkeit einzuflechten; wo er von seinem äußeren Verhalten, seinen Sitten und Gewohnheiten redet, da vermerkt er auch das Kreuzschlagen, das Tischgebet und den Messgang; doch wo er wirklich bei sich selber einkehrt, wo er nicht mehr vom Menschen, vom Leben und vom Tod im Allgemeinen, sondern von sich, seinem Leben und seinem Sterben spricht, da bleibt der Glaube draußen, wie die Philosophie und die Sitte draußen bleiben, und er ist allein mit sich selbst. Auch der Glaube gehört im Grunde zu den allgemeinen Wahrheiten, die nichts mit ihm zu tun haben und nichts über ihn aussagen.
Das also ist die Montaignesche Skepsis. Doch dieses philosophische Etikett will nicht recht auf ihn passen; denn es kommt aus einem ihm fremden Beziehungssystem und trifft darum nur etwas Beiläufiges: seinen Zweifel an der Möglichkeit objektiver Erkenntnis. Dies wäre ein wesentlicher Zug, wenn er solche Erkenntnis gesucht hätte und daran gescheitert wäre; so aber ist der Zweifel an der Erkennbarkeit der Dinge mehr eine Bequemlichkeit als ein Postulat: er schiebt damit ein Vorhaben von sich, das nicht das seine ist. Gewiss klingt die Beschreibung des skeptischen Denkens, wie sie Hegel in der Phänomenologie des Geistes gibt, fast Wort für Wort wie auf Montaigne gemünzt, doch eben nur in diesem Negativen: gewiss, er «hat es nur mit Einzelnem zu tun und treibt sich mit Zufälligem herum»; gewiss, sein Denkstil ist «diese bewusstlose Faselei, von dem einen Extrem des sichselbstgleichen Selbstbewusstseins zum andern des zufälligen, verworrenen und verwirrenden Bewusstseins hinüber- und herüberzugehen», und «es erkennt seine Freiheit einmal als Erhebung über alle Verwirrung und alle Zufälligkeit des Daseins und bekennt sich ebenso das andre Mal wieder als ein Zurückfallen in die Unwesentlichkeit und als ein Herumtreiben in ihr»; auch es geht «sozusagen nur an das Denken hin, und ist Andacht …, das gestaltlose Sausen des Glockengeläutes oder eine warme Nebelerfüllung, ein musikalisches Denken, das nicht zum Begriffe, der die einzige immanente gegenständliche Weise wäre, kommt», und «so sehen wir nur eine auf sich und ihr kleines Tun beschränkte und sich bebrütende, ebenso unglückliche als ärmliche Persönlichkeit …» Wie treffend ist diese Beschreibung des skeptischen Denkstils – und wie wenig trifft sie Montaigne! Der in der fröhlichen Wissenschaft der Essais vor uns tritt, ist ebenso wenig ein Vertreter des Hegel’schen «unglücklichen Bewusstseins», wie er der gnadenlose und verzweifelte Mensch Pascals ist. Und eben das ist vielleicht sein Skandal: so wach, so bewusst seiner Endlichkeit, die «das Ganze» nicht zu fassen vermag und sich mit Stückwerk und Stückwissen begnügt, und doch so gänzlich untragisch zu sein. Seine Skepsis, die philosophische wie die religiöse, ist kein schmerzvoller Verzicht, weil sie keine Philosophie, sondern eine geistige Hygiene ist: ein Behelf, Fremdes von sich fernzuhalten und dem Eigenen Raum zu geben. Seine Wahrhaftigkeit setzt der Wahrheit andere, doch nicht weniger strenge Kriterien: gehört sie mir? ist sie mir gemäß? bleibt sie mein auch in der Krankheit, im Schmerz und im Sterben? Wenn er sie nicht «auf sich zurückführen» kann, wenn sie nicht mit seiner Persönlichkeit verwächst und ihm zur Lebenswahrheit wird, so mag sie unabhängig von ihm gültig sein, und er leugnet sie nicht; aber was geht sie ihn an? «Ich bin kein Philosoph …»
*
Auch diese «Anleitung zum Lesen Montaignes» ist eine Systematisierung und führt als solche irre. Sie mag ein Stück weit helfen, über die ersten Verwunderungen und Missverständnisse hinweg, auf das zu achten, was für ihn das Wesentlichste ist; doch dann vergesse man sie, um nicht dem umgekehrten Missverständnis zu verfallen. Man kann von Montaigne nur in Widersprüchen reden, und wie er selbst vom Hundertsten ins Tausendste kommt, so kommt man, wenn man von ihm spricht, vom Hundertsten ins Tausendste; denn sein Gegenstand ist er selbst, in dem sich alle Gegenstände spiegeln. Er hat sich keine Methode auferlegt, auch keine Methode der Selbsterkenntnis, und es gibt keine solche Methode außer der unbedingten Ehrlichkeit gegen sich selbst. Hätte er es auch gewollt, er hätte sich nicht sich selbst gegenüberstellen und sich belauschen können; er hätte sich nicht teilen können in ein sich beobachtendes und ein sich unbeobachtet wähnendes Bewusstsein. Er war weder ein Schizophrener noch ein selbstversunkener Nabelbeschauer. Er hat auf sich geachtet, doch ohne Scheuklappen; und jene erstaunlichen Erkundungsfahrten an die Grenzen des Unbewussten waren ihm nur möglich, weil er im langen Umgang mit sich selbst die rechte Distanz zu sich gefunden hatte, um sich, wie er einmal sagt, unbefangen betrachten zu können «wie einen Nachbar, wie einen Baum». Gerade dies lässt sich im Fortschreiten der Essais verfolgen: wie er diese Distanz zu sich gewinnt, diese Unvoreingenommenheit gegen sich selbst, die der schwerste Teil der Wahrhaftigkeit ist. Er hat sie nicht gewonnen, indem er über sich selbst brütete. Montaigne hat sehr ernsthaft über anderes als sich nachgedacht, über das Wesen und das Los des Menschen, über den Staat, über das Recht, die Tugend, die Ehe, über Erziehung und Bildung, über den Wunderglauben, über die Leidenschaften und durchaus auch über die Möglichkeit der objektiven Erkenntnis: immer mehr mit Bezug auf sich selbst, doch keineswegs mit Beschränkung auf sich selbst.
Die beiden ersten Bücher der Essais in ihrer ersten Form sind voll von allgemeinen Wahrheiten der stoischen Weisheit; das sind die Essais, von denen er später sagt, dass sie «ein wenig nach fremdem Gut riechen». Doch dann schaltet sich jene geistige Hygiene ein, die skeptische Frage an die eigene Weisheit: wie komme ich dazu? Ich, Michel de Montaigne, perigordinischer Landedelmann, fünfzigjährig, nicht ganz mittelgroß, mit beginnendem Nierenstein behaftet? Was bedeutet sie mir? Das ist das Aufleuchten der großen Wahrhaftigkeit, die Rückwendung zu sich, das Zurückführen der Wahrhaftigkeit auf sein persönliches Maß; und die Essais sind einzigartig geblieben in der Konsequenz, mit der sie diesen Weg zur Ehrlichkeit gegen sich selbst gehen – das persönlichste Buch der Weltliteratur. Einzigartig vielleicht darum, weil sie sich diesen Weg nicht vorgenommen hatten, sondern ihn erst arglos und absichtslos, dann mit wachsender Entdeckerfreude beschritten. Denn auch die Persönlichkeit gehört zu den Dingen, die man nicht erreicht, indem man absichtsvoll nach ihr strebt; das Ich, das ohne weiten Umweg geradewegs auf sich selbst zuginge, hätte sich in Wirklichkeit überhaupt nicht vom Ausgangspunkt entfernt, der sein Nullpunkt ist, und bliebe leer mit all seiner Selbsterkenntnis, die nichts zu erkennen fände; und um das Maß seiner Augen zu finden, muss man versuchen, das Maß der Dinge zu erkennen. So ist dieses Buch der Selbsterkenntnis kein Bekenntnisbuch, keine Autobiographie, keine Selbstrechtfertigung und keine Selbstanklage, kein Ecce homo. Montaigne geht nicht von sich aus, er kommt ganz schlicht und sachlich zu sich, wie man zur Sache kommt. Er greift nur zur Selbstdarstellung, weil er kein anderes Bezugssystem der Erkenntnis findet. Im Schwanken der Wahrheiten setzt er sich selbst als festen Punkt, und indem er sie zu sich in Beziehung setzt, findet er seinen eigenen Standort: denn in Bewegung bleibt beides.
Die Unerhörtheit dieses Unternehmens der Selbstdarstellung, die ihm noch das Jahrhundert nach ihm nicht verzieh, ist heute kaum mehr fühlbar: eine Flut von Selbstdarstellungen und Selbstbetrachtungen ist seitdem über die Welt gegangen. Und doch haben die Essais in der Reinheit und Unbefangenheit ihrer Entdeckerfreude wenig wirkliche Nachfolge gefunden, und vielleicht können sie keine finden, weil alle Nachfolge belastet ist. Bei Montaigne fehlen alle uns gewohnten Motive der Selbstdarstellung. Er hat nicht aus einem Bewusstsein seiner eigenen Ungewöhnlichkeit, seines «Andersseins» oder seiner Beispielhaftigkeit, weder im Guten noch im Bösen, geschrieben; im Gegenteil, sein Experiment war umso gültiger, ein je gewöhnlicherer Mensch er war, und es ist oft zu spüren, wie er auf dieser Gewöhnlichkeit beharrt und sich gewöhnlicher macht, als er ist. So ist er den Gefahren aller gewollten Selbstdarstellung entgangen, der Gefahr der Selbsterhöhung und der vielleicht noch größeren Gefahr der Selbsterniedrigung, jener «listigen Demut» der Bekenntnisbücher, deren Verfasser sich selbst mit Füßen treten, um zu zeigen, wie hoch sie sich über sich selbst erhoben haben. Da ist nichts von Weltschmerz, Reue, Auflehnung, Anklage, Zerrissenheit, Leiden an andern und an sich selbst, nichts von all dem, was seit Rousseau so viele Missratene dazu treibt, sich der Welt ins Gesicht zu speien, so viele Gescheiterte, ihr De Profundis zu schreiben, so viele Sünder, die Welt zum Jüngsten Gericht über sich zu laden, so viele Genies, ihr Genie zu behaupten statt zu beweisen. Montaigne ist kein Unverstandener und Verkannter, der darin Trost fände, wenigstens sein eigener Held zu sein, kein Unglücklicher und Verstoßener, der die Welt zum Zeugen des ihm angetanen Unrechts anruft. Das ist das Seltsame: hier gibt sich ein Reicher, Gesunder und leidlich Glücklicher zu erkennen, der sein Leben durchaus gemeistert und im öffentlichen Leben seines Landes und seiner Stadt seine Rolle mit Ehren gespielt hat. Er schreibt nicht, um sich eine Rolle zuzulegen, sondern um seine Rolle von sich abzulegen und zu sich zu kommen. Die Distanz zu sich selbst, die er gewinnt, ist eben diese Distanz zu seiner Rolle, sei es als Politiker oder als Philosoph, als Weltmann oder als Weltflüchtiger, zu seinen Handlungen wie zu seinen Meinungen, Grundsätzen und Ansichten, kurz, zu allem, was nach außen hin gerade die Persönlichkeit ausmacht. Es ist wiederum diese umgekehrte Bewegung von außen nach innen, von den Dingen zu sich.
«Mundus universus exercet histrioniam»; «die Person» selbst ist etymologisch «die Maske». In dieser Komödie, die ein jeder zu spielen hat, in auferlegter oder angenommener Rolle, aus der zu fallen das schlimmste aller gesellschaftlichen Verbrechen ist, in Charaktermasken, die jeder schließlich für sein wirkliches Gesicht hält, mit Parteinahmen, Glaubenssätzen und Lehrmeinungen, die wir «zu glauben glauben» und zu denen wir aus Treue zu uns selbst stehen müssen, ohne meist recht zu wissen, wie wir eigentlich zu ihnen gekommen sind: in dieser Komödie war seine Rolle durchaus in Ordnung, wenn nicht eine der ersten, so doch der besten, die zu vergeben waren, und er hätte sich wohl in ihr gefallen können. Sie hat ihm auch nicht missfallen, und er hat gerade, um sich von den «Büchermachern» zu distanzieren, das Weltmännische gelegentlich recht dick unterstrichen; er hat seine Herkunft mit einem Glanz alten Schwertadels umgeben, der ihr keineswegs zukam; er hat mit Stolz vermerkt, dass er als Bürgermeister seiner Stadt einen Marschall zum Vorgänger und einen andern zum Nachfolger hatte, und mit einer Eitelkeit voll unmerklicher Selbstironie gibt er ausgerechnet im Essai von der Eitelkeit den ganzen lateinischen Text seiner römischen Ehrenbürgerurkunde zum Besten. Auch diese von seinen jansenistischen Kritikern mit galligem Hohn vermerkten Züge sind Züge seines Wesens, das sich unverstellt in den Essais spiegelt. Er hat nicht der Welt entsagt, um sich zu finden: er hat sich in der Welt zu finden gesucht. Man soll, sagt er, seine Rolle spielen, wie es sich gehört, doch eben als Rolle, ohne sich mit ihr zu identifizieren und in ihr aufzugehen. Und wirklich spielt sich in den drei Büchern der Essais der gleiche Vorgang ab, der auf den Titelblättern der Erstausgaben zu verfolgen ist: wenn die zwei ersten Ausgaben noch gemäß der Übung der Zeit die ganze Titelpracht des königlichen Ordensritters, Kammerherrn und Bürgermeisters Michel de Montaigne ausbreiten, so ist auf dem Titelblatt der letzten von ihm selbst besorgten Ausgabe sein Name allein geblieben; nicht der Bürgermeister und nicht der Kammerherr hat sie geschrieben, sondern Michel de Montaigne.
So schaltet sich auch hier die geistige Hygiene der Skepsis gegen sich selber ein, eine Selbstironie, die sich auch von sich nichts vormachen lässt. Doch wo bleibt nun die Persönlichkeit, die er sucht? All das, was sie zusammenhält: Herkommen, Erziehung, Umgang, Sitte, Konventionen, Grundsätze, Bindungen, Glauben, Stand, Name und Stellung, ist ihr von außen zugespült, ihr zugefallene, «zufällige» Rolle, und ist doch zumeist das ganze bewusste Ich. Je näher er sich betrachtet, desto mehr verschwimmen seine Umrisse, desto mehr löst sich die Individualität in dieses buntscheckig zusammengestückte, unzusammenhängende, schillernde und fließende Unwesen auf, das in seiner Widersprüchlichkeit zu beschreiben er nicht müde wird – als hätte er es darauf angelegt, «sich durch seine Unkenntlichkeit kenntlich zu machen». Das Ich ist keine isolierbare Substanz, die übrig bliebe, wenn man die ihm zufallenden Elemente und Einflüsse abzieht: es ist die Struktur, nach der sich diese wechselnden Elemente und Einflüsse ordnen, durch sie verdeckt und doch nur an ihnen erkennbar. «Da ist keiner, wenn er auf sich horcht, der nicht in sich eine ihm eigene Form, eine Grundform entdeckte, die gegen die Erziehung ankämpft.» Doch dazu bedarf es eines aufmerksamen Hinhörens auf die Neben- und Untertöne des Bewusstseins, auf die Brechungen der Rolle, in denen sich der Schauspieler verrät. Und er verrät sich besser im Beiläufigen, im Alltäglichen, Unbeachteten, Privaten, in den Schwächen und Niederungen, in Augenblicken der Zerstreutheit und der Entspannung, besser in der Garderobe als auf der Bühne, gelegentlich und unabsichtlich, wie alles Echte unabsichtlich ist. Die ganze herrliche Lebendigkeit der Essais entspringt aus diesem gespannten, hellhörigen Lauschen Montaignes auf sein entspanntes, im Äußeren und Äußerlichen treibendes Ich.
Gewiss, dieses Denken geht im Kreis. Doch der Kreis zieht sich immer enger, bis es am Ende nur noch um den einen Punkt kreist, an dem sich Montaigne ganz mit sich allein findet: den Tod. Hier hört alles Schauspielen auf; «das ist eine Handlung für eine Person allein». Früh hat ihn der Todesgedanke beschäftigt, und an nichts lässt sich der Gang seiner Selbstentdeckung so klar verfolgen wie an seiner Beziehung zum Tode. In ihm fand er das letzte Kriterium der Wahrhaftigkeit. Mit dem Tode fertigzuwerden, das ist es, was Montaigne anfangs von der Philosophie verlangte: Hic Rhodus, hic salta! «Philosophieren heißt sterben lernen», betitelt er, ganz erfüllt von antiker Lebens- und Sterbensweisheit, das große Todeskapitel des ersten Buches, und alle Tröstungen der stoischen Philosophie, die den Menschen in seinem Bewusstsein über die Endlichkeit seines physischen Seins erhebt, sind hier aufgeboten. Unter Philosophie hat er immer diese geistige Erhebung des Menschen über seine arme, verworrene und befristete Menschlichkeit verstanden, und sie meint er auch noch, wo er später von sich sagt: «Ich bin kein Philosoph.» Und der Weg ist zu Ende gegangen, wo er angesichts des selbstverständlichen, gefassten Sterbens der Einfältigsten im Pestjahr 1585 den Satz Ciceros vom philosophischen Sterbenlernen als eitles Großtun von sich abschüttelt: was ist es schon, auch zu können, was jeder Tor und jedes Tier kann und muss? sich groß in Pose zu setzen, um zu erleiden, was jeder erleidet? Wenn Philosophieren sterben lernen heißt, «so lasst uns fortan in die Schule der Dummheit gehen». Nicht sterben lernen, leben lernen ist Weisheit. Endlos ließen sich die Sätze der ersten und der letzten Periode der Essais einander gegenüberstellen; denn mit der Einstellung zum Tode ändern sich alle Perspektiven und Maßstäbe des Lebens.
Doch die letzten Sätze streichen die ersten nicht durch: da ist nichts zurückgenommen, da ist hinzugefügt und vertieft. Am Anfang ist es «der» Mensch, «das» Leben und «der» Tod, was ihn beschäftigt; am Ende ist es er selbst, «mein» Leben, «mein» Sterben, und er blickt nicht mehr einer philosophischen Allegorie des Todes ins Auge, sondern erfährt und erlebt sein eigenes langsames Erlöschen. Er, Michel de Montaigne, kann sich nicht in seinem Bewusstsein darüber hinwegsetzen; denn er selbst ist es, der stirbt, mitsamt seinem Bewusstsein, und keine Spekulation führt darüber hinaus. Da gönnt er sich auch nicht mehr den Zweifel, der sonst alles, auch das Wunder, gelten lässt: der Tod ist das Ende, und was immer jenseits sein mag, er, Michel de Montaigne, bleibt diesseits. Die Tröstungen der Philosophie, wie die der Religion, leugnet er nicht einmal, er lässt sie dahingestellt; er nimmt die Letzte Ölung und die Worte der Freunde, doch sie betreffen ihn nicht: es sind die letzten Handlungen des Lebens nach Sitte und Brauch, da es ihm nicht vergönnt war, unbelästigt, unterwegs und fern den Seinen zu sterben, «ganz bei sich», wie er es sich oft wünschte. Das Leben bleibt in seiner Rolle bis zum letzten Augenblick. Zum Tode bereit sein oder nicht bereit sein ändert am Akt des Todes nichts; doch sein Bedenken vermag das Leben in die rechte Perspektive der Endlichkeit zu rücken. Nicht im Sterben – doch was wissen wir davon? –, in der physischen Nähe und wissenden Erwartung des Sterbens ist Montaigne ganz zu sich gekommen, zur Bejahung seiner selbst und des Lebens, «wie es ist». Die stoische wie die christliche Verachtung des Todes gründet in Verachtung des physischen Lebens; doch je mehr er sich entschwinden fühlt, desto inniger fühlt er, dass dieses Leben alles ist, was er hat, und dass es viel und köstlich ist. In aller Verachtung des Lebens findet er nun die Hybris des menschlichen Geistes, sich über und außer sich zur Unbedingtheit, zur Dauer, zum allgemeinen Sein zu erheben, eine Auflehnung gegen den ihr unerträglichen Gedanken, heute zu sein und morgen nicht mehr – gegen die natürliche Ordnung, die Leben und Sterben umschließt. Mit einem Hymnus auf dieses Dasein schließt sein letztes, schon ganz von Todesnähe und Todesbereitschaft erfülltes Essai: «C’est une absolue perfection, et comme divine …» An der Nähe des Todes hat Montaigne das Leben lieben, es festhalten «mit Zähnen und Klauen», es auskosten bis zum letzten Zuge gelernt. Die absolute Grenze des Todes erst gibt ihm seine Intensität, durch seine Begrenztheit erst gewinnt es die Dimension der Tiefe, in seiner Endlichkeit ist es der Erfüllung fähig; irdisch, doch darum nicht nichtig, vergänglich, doch darum nicht verächtlich, verlierbar, doch nicht absurd: unschätzbar köstlich gerade in seiner Gebrechlichkeit und Bedrohtheit.
Aus dieser Perspektive erhält sein Lebensgefühl diese beglückende Ruhe und Heiterkeit, die seine letzten Sätze erfüllt: gefasst, ohne Reue, ohne Schrecken und ohne Verzweiflung. Die Lebens- und Todesweisheit, die in diesen letzten Zwiegesprächen mit Alter, Krankheit und Tod spricht, ist unendlich viel mehr als «Lebenskunst» und «Lebensklugheit»; da ist keine Kunst und keine Klugheit mehr, sondern fügsames Einwilligen in die rätselhafte Ordnung des Lebens und des Sterbens, die sich der Vernunft nicht unterordnet und der darum die Vernunft sich unterordnen muss – Amorfati. Doch wenn dies Weisheit ist, dann ist es die anspruchsloseste und demütigste, die Weisheit aller Kreatur, die fraglos dahingeht, ohne über die Ordnung zu rätseln, in der sie lebt und stirbt, die Weisheit des Gehorsams. Und wenn solch dankbarer Gehorsam gegen das Unerkennbare Frömmigkeit ist, dann ist dies – wenn auch ganz weltliche – Frömmigkeit. Wie viel von der Schönheit der Essais kommt daher, dass ihre Bahn so getreulich den Bogen des Lebens zur Reife und zum Tode beschreibt – das Ganze des Lebens?
Warum hat Montaigne sie geschrieben? Er hat sich selbst immer wieder diese Frage gestellt, ohne eine rechte Antwort zu finden, die den Widerspruch zwischen ihrer Privatheit und ihrer Publizität auflöste. Dennoch dürfen wir seiner Anrede glauben: er hat sie nicht für uns geschrieben. Er schrieb sie für sich, um seinetwillen, aus innerer Notwendigkeit; und doch brauchte er den unbekannten Leser, um sich ihm und dadurch sich selbst zu entdecken. Die Selbstdarstellung war das Instrument seiner Selbsterfahrung. Denn dies ist der letzte Widerspruch: es gibt keine Selbsterkenntnis, die sich nicht zu erkennen gibt, und keine Wahrhaftigkeit ohne Mitteilung. «Wer nicht ein wenig für andere lebt, der lebt kaum für sich.» Das Selbstbewusstsein, das stumm und ohne Ausdruck bleibt, kann sich seiner selbst nicht bewusst werden: es muss sich hervorbringen als Werk seiner selbst, um Wirklichkeit zu gewinnen. Vielleicht steht am Anfang seines Entschlusses, seine Gedanken niederzuschreiben, der Tod seines Freundes Étienne de La Boëtie, mit dem Montaigne seine Ideen und Ideale geteilt hatte: es ist die Fortsetzung des abgebrochenen Gesprächs. Die ganze erste Periode der Essais ist ein Nachklang dieses vertrauten Umgangs zweier humanistischer Geister, die sich gemeinsam auf den Höhen antiker Größe und stoischer Weisheit ergingen. Nun war er allein, jenes «andern Ichs» beraubt, das «allein mein wahres Bild besaß und es mit sich fortnahm»; und es war, «als wäre ich nur noch halb». Doch dieses verlorene Bild seiner selbst «im andern», das wiederherzustellen er sich bemüht, war schwerlich das der Essais; das Unternehmen hat weiter geführt, als es sich vorsetzte. Nach der vollkommenen Gegenseitigkeit dieser Freundschaft dürfen wir aus dem Bilde, das Montaigne von La Boëtie zeichnet, auf sein eigenes Spiegelbild schließen: wie unpersönlich, wie deklamatorisch in all seiner echten Ergriffenheit ist dieses Freundschaftsessai, aus dem kein einziger greifbarer Zug des Freundes uns entgegentritt, ein Bild der Vollkommenheit, über die sich eigentlich nichts aussagen lässt, weil alle nähere Bestimmung eine Verringerung wäre. Es liegt im Wesen echter Liebe und Bewunderung, keine Distanz zu haben, und sie muss zu den absoluten Gemeinplätzen greifen, um sich auszudrücken; echt ist der Klang, in dem sie sagt, dass sie unsäglich sei. Wir spüren die humanistische Begeisterung für antike Menschengröße, «wie unser Jahrhundert sie nicht mehr kennt», in der sich diese beiden trafen, den Geist der Nachfolge der Scipionen und Catonen, der auch aus La Boëties nachgelassenem Contr’un spricht. Nur langsam löst sich Montaigne aus dem Bann des idealen Menschenbildes der Stoa, das für ihn in Étienne de La Boëtie verkörpert war. Allein kann er sich auf solcher Höhe – in solcher Rolle – nicht halten, und die großen allgemeinen Worte der Tugend, der Wahrheit, der Freiheit bleiben leer, weil sie ohne Echo bleiben. Doch auch wenn er nun zur Erniedrigung des Menschen übergeht, misst er ihn noch am Maßstab dieses Ideals, vor dem er nicht bestehen kann. Nur zögernd, in einzelnen Anläufen, deren Kühnheit für einen vom antiken Geist erfüllten Menschen der Spätrenaissance wir kaum mehr ermessen, beginnt er, statt den Menschen selbst, diese Maßstäbe des Menschen infrage zu stellen und die Kriterien der Menschenkenntnis und Menschenbeurteilung in sich selbst zu suchen. Dieser Mut zu sich selbst, «wie ich bin», war das revolutionäre Wagnis, das seinen Zeitgenossen und der nächsten Nachwelt so unerhört war, dass sie es zu übersehen oder nachsichtig als Altersschrulle zu entschuldigen vorzogen. Indem er dieses neue und ganz eigene Menschenbild schafft, gewinnt er nicht nur seine Wirklichkeit, sondern seine Freiheit zu sich selbst zurück: sein Buch ist der triumphale Durchbruch des freien Menschen durch das Epigonentum des Späthumanismus geworden. Und Montaigne selbst ist durch es geworden, was er war. Es ist die Dialektik der Selbsterkenntnis, zugleich Selbstwerdung und Selbsterschaffung zu sein. Montaigne hat den Prozess, der sich zwischen ihm und seinem Buch abspielt, sehr schön vermerkt: «Und wenn mich niemand läse, hätte ich meine Zeit verloren? … Ich habe mein Buch nicht mehr gemacht, als mein Buch mich gemacht hat …» Es ist ein wirklicher Partner geworden, und durch es sind wir es; «mein Buch», sagt er, wie er sagen würde: «mein Freund», und durch es sind wir in diese Vertrautheit einbezogen. Daher die unerschöpfliche Frische, die nach mehr als dreieinhalb Jahrhunderten aus diesem Buche zu uns spricht, wie aus keinem Buche seiner Zeit und aus wenigen aller Zeiten. «Die Wahrhaftigkeit ist der Anfang einer großen Tugend.»
*
Am Ende ist der Reichtum dieses Buches der Reichtum der Persönlichkeit, die sich ihm ganz und rückhaltlos mitgeteilt hat. Es ist nicht das Selbstgespräch eines Eigenbrötlers in seiner Bücherstube, der sich in sich selbst hinein grübelt. Der dies schrieb, stand mit beiden Beinen in seiner Zeit, am Ende dieses ungeheuren Jahrhunderts, das die Welt des Altertums neu entdeckte und die Neue Welt entdeckte, das die Umwälzung des anthropozentrischen Weltbilds erlebte und die christliche Kirche in ihren Grundfesten wanken sah, das Jahrhundert der Konquistadoren und der Aufrührer: Cortez und Kopernikus, Luther und Machiavelli, Calvin, Loyola und Giordano Bruno; er lebte offenen Auges unter den Menschen im Spannungsfeld des unbarmherzigsten Bürger- und Glaubenskrieges, und was er war, das war er wirklich, wie er einmal fast grimmig bemerkt, anderswo als auf dem Papier.
Auch das Buch selbst steht in dieser Zeit – und welcher Zeit! Montaigne begann seine Essais im Jahr der Pariser Bluthochzeit zu schreiben, der Bartholomäusnacht, die das Signal zur Schlächterei in ganz Frankreich gab und die als unauslöschliches Brandmal des Verrats, der Niedertracht und des Meuchelmords im Namen der höchsten Glaubensgewissheiten in die Geschichte eingegangen ist: die Mordnacht von Paris und das TeDeumlaudamus der großen Dankmesse, mit der sie in Rom begrüßt wurde. Sein ganzes Leben lang hat Montaigne die Glaubenskämpfe um sich schleichen oder toben sehen, in seiner Stadt, in seiner eigenen Familie, unter seinen Geschwistern, deren drei dem Calvinismus anhingen. Die zwanzig Jahre, in denen er die Essais schrieb, sind zwanzig Jahre des Bürgerkriegs, kaum unterbrochen von faulen Friedensschlüssen und von Toleranzedikten, die gebrochen wurden, ehe sie in Kraft traten. Montaignes Rückzug von 1571 «in den Schoß der gelehrten Musen», «wo er in Ruhe und Sicherheit die Tage verbringen wird, die ihm zu leben bleiben», war von kurzer Dauer: im Jahr darauf war er bei der königlichen Armee im Poitou, die gegen das aufständische La Rochelle aufmarschierte, dann Überbringer der königlichen Befehle an das Parlament von Bordeaux, und in den folgenden Jahren begegnen wir ihm immer wieder als Unterhändler und Vermittler zwischen den feindlichen Lagern. Auf seiner «großen Reise» erreicht ihn in Italien die Nachricht von seiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt Bordeaux, und König Heinrich III. schreibt ihm nach Rom, um ihn dringend zur sofortigen Übernahme dieses Amtes aufzufordern – eines schwierigen Amts in einer von äußeren und inneren Fehden zerrissenen Stadt, in einem Wetterwinkel der Hugenottenkriege. Doch der kirchen- und königstreue Michel de Montaigne ist auch der Vertrauensmann und Ratgeber Heinrichs von Navarra, des Chefs der protestantischen Partei, der ihn auf seinem Schloss besucht und ihn, den Kammerherrn Heinrichs III., ex officio auch zu seinem Kämmerer ernennt. Eine unpathetische, schwer zu erfassende Rolle, wie die Rolle all derer, die nicht zum Kampf rufen und Schlachten schlagen, sondern Frieden zu stiften suchen, verdächtig wie alle Mäßigung, gefährdet wie aller Mut zur Mitte in Zeiten des Fanatismus; so galt auch Montaigne, wie er einmal klagt, «dem Ghibellinen» als «ein Guelfe» und «dem Guelfen» als «ein Ghibelline» – den Calvinisten als Papist und den Eiferern der Katholischen Liga als Ketzer oder doch als Lauer, was fast dasselbe war. Montaigne war kein Parteigänger, und das haben ihm die Parteigänger damals und bis auf diesen Tag nicht verziehen.
Man hat ihn mit Recht, wenn auch mit einiger Übertreibung, den Philosophen Heinrichs IV. genannt, des Befrieders und Wiederherstellers des französischen Staates, den er in einem seiner letzten Essais mit den Versen begrüßt, die Vergil an Augustus richtete; doch er war der Philosoph Heinrichs IV. vor dessen Sieg, den er nicht mehr erlebte. Er hat loyal Partei genommen, doch nicht die Partei eines Dogmas, sondern der alten Ordnung, verkörpert in der Monarchie, die unter den Schlägen beider Glaubensparteien, der Calvinisten wie der Katholischen Liga, in Trümmer fiel. Wenn man ihn einer Partei zuordnen will, dann gehörte er zur «parti des politiques», wie seine Zeit jene «dritte Partei» gemäßigter und toleranter Geister nannte, die – daher ihre Bezeichnung als «Politiker» – den Trennstrich zwischen religiöser Überzeugung und politischer Praxis zogen und den Glaubenszwist, der Frankreich zum Spielball fremder Mächte werden ließ, in einer über den Konfessionen stehenden nationalstaatlichen Ordnung zu überwinden suchte. Als die Erbfolgeordnung den protestantischen Bourbonen Heinrich von Navarra zum nächsten Anwärter auf den Thron der schwachen und degenerierten Valois werden ließ, wurde der Riss offenbar: während die Katholische Liga die französische Krone dem spanischen Habsburger Philipp II. oder den lothringischen Herzögen von Guise zuzuspielen suchte, wurde die legitimistische Königspartei der «Politiker» zur patriotischen Partei schlechthin. Doch erst durch seinen Übertritt zum Glaubensbekenntnis der Mehrheit seines Volkes konnte Heinrich IV. endlich der Friedensfürst, der «gute König» werden, der in die Legende eingegangen ist. Zwischen den calvinistischen Adels- und Städterepubliken und der demokratischen Fratze, welche die Liga in der jahrelangen Terrorherrschaft eines fanatisierten Pöbels in Paris verwirklichte, erschien die Monarchie als Rettung. Dass das väterliche und tolerante Regiment Heinrichs IV. den Weg zur absoluten Monarchie bereitete, die weniger als ein Jahrhundert nach ihm sein Werk wieder zu zerstören und zu verschleudern begann, das gehört schon einer andern Epoche an, die zu neuen Problemen weitergeschritten war; denn die Geschichte kennt keine «Lösungen», bei denen alles glatt aufgeht wie im Rechenbuch und in den ideologischen Kinderfibeln, sondern nur die Überwindung alter Fragestellungen durch neue, religiöser durch politische, politischer durch soziale, die doch stets nur eine neue Form der alten sind. Was Montaigne zu den politischen Problemen seiner Zeit sagt, ist aus seiner Zeit und aus seinem persönlichen Erfahrungskreis heraus gesagt, inaktuell – und doch aktuell in einem weit tieferen Sinne.
Denn nirgends ist die Politik Gegenstand dieses Buches, nirgends entwirft Montaigne eine Ideologie oder ein Programm auch nur im bescheidensten Maße: auch hier handelt es sich einzig um sein Verhalten zu Politik und Ideologie. Als Bürger und Amtsherr, nicht als Michel de Montaigne, war er in diese Wirren verwickelt, und die Selbstbesinnung der Essais ist einmal mehr das Mittel, in dieser Zeit des ideologischen Mords und Totschlags Distanz zu gewinnen vom Kampfe selbst, zu sich zu kommen im vollen Sinne des Wortes, die innere Freiheit zu gewinnen, die dem Parteigänger verloren geht. Auch in politicis ist es ein Buch der geistigen Hygiene.
Wieder erfüllt hier zunächst die Skepsis ihre reinigende Funktion. In der tiefsten Auswegslosigkeit des Bürgerkriegs, der durch den Verrat der Bartholomäusnacht zu letzter Erbitterung geschürt worden war und erstmals die Einheit des Königreichs selbst infrage stellte, als die naturrechtlichen Theorien des Aufstandsrechts und des legitimen Königsmords nacheinander von den calvinistischen Theoretikern und von den Zeloten der Liga aufgegriffen wurden, um endlich in den Händen der Jesuiten zu enden und in der Ermordung des letzten Valois wie des ersten Bourbonen praktische Anwendung zu finden, las Montaigne die Pyrrhonischen Grundzüge des Sextus Empiricus, ließ seine philosophische Wappenmünze mit der im unentschiedenen Gleichgewicht schwankenden Waage und dem Wahlspruch «Que sais-je?» schlagen und begann die Niederschrift seiner Sebundus-Apologie, des einzigen eigentlich polemischen Essais seines Werks. Mit wahrer Zerstörungslust und unersättlicher Wahllosigkeit werden da alle Gewissheiten entthront, alle Lehrmeinungen zum bloßen Meinen, Wähnen und Vermuten erniedrigt, eine so gut wie die andere, jede eine bloße Kuriosität im Kabinett menschlicher Phantasterei. Da ist alles eingeebnet, Mensch und Tier, Weiser und Narr, Intellekt und Instinkt, Glaube und Irrwahn, Wissenschaft, Spekulation und die Hirngespinste alter Weiblein, und jede vermeintliche Erkenntnis ist durch die bloße Gegenüberstellung eines Dutzends gegenteiliger und ebenso einleuchtender Erkenntnisse entwertet: 288 Sekten des Altertums sind allein aus dem Streit um das höchste Gut entstanden, notiert er sarkastisch, und Pascal hat es sich später aus den Essais in seine Pensées hinübergeschrieben. Auch die Religion ist in diesen Bereich des menschlichen Wähnens einbezogen; denn «es ist klar und deutlich, dass wir unsern Glauben nur nach unserer Weise und aus unsern eigenen Händen aufnehmen, und nicht anders, als die andern Religionen aufgenommen werden», nach dem Zufall des Ortes, der Geburt, der Erziehung; «ein anderer Himmelsstrich, andere Zeugen, ähnliche Verheißungen und Drohungen könnten uns auf gleiche Weise einen ganz entgegengesetzten Glauben einflößen. Wir sind Christen im gleichen Sinne, wie wir Schwaben oder Perigordiner sind …» Seltsame Verteidigung des guten Sebundus, der «die Wahrheit unserer Religion aus Vernunftschlüssen erweisen» wollte!
Es wird wohl nie ganz gelingen, die seltsamen Labyrinthe dieser Streitschrift eindeutig zu durchleuchten; denn Montaigne selbst hat seine Vorsichtsmaßregeln dagegen getroffen, dass man ihn irgendwo – und wäre es selbst beim Zweifel – festnagle. Ein derartiges Scheingefecht mit verkehrter Schlachtordnung, das den sebundischen Vernunfterweis der Religion zu verteidigen unternimmt, indem es die Vernunft in den Abgrund stößt und alle menschliche Glaubensgewissheit mit ihr, war vielleicht die einzige Möglichkeit für einen freien Geist jener Zeit, sich zwischen unerbittlich feindlichen Dogmen Raum zum Atmen zu schaffen – man denke an die ganz anders gezielte, doch völlig ähnlich aufgebaute ApologiefürHerodot von Henri Estienne, der es unternahm, die Glaubwürdigkeit der tollsten Fabeleien des alten Griechen zu erweisen, indem er eine Blütenlese noch groteskerer Wundergeschichten und Lügenmärchen zusammenstellte, welche die Pfaffen dem gläubigen Volk seiner Zeit weismachten … Doch braucht man deshalb nicht gleich abgründige Hinterlist zu vermuten: hier wie überall in den Essais wurde der Anlass und Ausgangspunkt des Gedankengangs, die «natürliche Theologie» des Sebundus, schnell zum bloßen Vorwand, den eigenen Gedanken auf alle Ab- und Seitenwege zu folgen. Auch geht es nicht um aufklärerische Verneinung oder Bezweifelung der Glaubensgewissheit selbst. Die Möglichkeit der unmittelbaren Offenbarung für seltene und auserwählte Geister bleibt offen; doch es ist klar, dass es nicht solche Geister sind, die Frankreich mit Krieg überziehen, morden, sengen und brennen und sich die Herrschaft streitig machen; und selbst die aufrichtig Wähnenden, die «glauben, zu glauben» und ehrlich für ihre vermeintliche Erkenntnis kämpfen, wären kaum zahlreich genug, um ein Fähnlein Landhut zu bilden. Die andern – und sind diese andern nicht in Wirklichkeit alle? – sind nicht von der Wahrheit, sondern vom Veitstanz, vom Blutrausch, von Raub- und Machtgier besessen. Wenn sie recht die Gebrechlichkeit ihrer Überzeugungen, die Ungewissheit ihrer mörderischen Gewissheiten erwögen, wenn sie bei sich wären und nicht außer sich, würden sie da nicht ihr Schwert einstecken?
Auch er, Michel de Montaigne, gehört keineswegs zu den Begnadeten, die das Licht der göttlichen Wahrheit empfangen haben; auch er ist Christ wie der große Haufe, wie er Perigordiner ist, aus Herkommen und Gewohnheit. Gerade daran hält er sich fest: gerade weil er aus eigener Erkenntnis nicht entscheiden kann, was Wahrheit ist, hält er sich an die, die ihm in die Wiege gelegt wurde, und «weil ich nicht imstande bin, zu wählen, folge ich der Wahl anderer und bleibe in dem Geleise, in das Gott mich gesetzt hat. Sonst müsste ich ohne Ende rollen und rollen …» Damit begnügt er sich, daran klammert er sich, doch mit Bescheidenheit; es ist eine persönliche, lokale, historisch bedingte Gläubigkeit, die keinen Anspruch erhebt, für andere verbindlich zu sein, die Gott in ein anderes Geleise gesetzt hat: «Was für eine Wahrheit, die bei diesem Bergzug endet und für die Welt dahinter Lüge ist?» Es ist eine Regel des Verhaltens, ein «Lokalgesetz», dem sich Montaigne in seiner Unwissenheit unterwirft, nicht weil er es so weiß, sondern weil er es nicht anders weiß, blind, doch seiner Blindheit bewusst.
So lehnt er die Reformation ab, nicht als Irrtum und Sünde, sondern als Unruhe und sektiererische Anmaßung des Geistes, sich über die letzten Wahrheiten ein eigenes Urteil herauszunehmen: nicht weil seine Gewissheit besser wäre, sondern weil er die Fragwürdigkeit aller Gewissheit erkennt. Es bedurfte leidenschaftlicher Überzeugung, seinen Glauben zu wechseln, doch nur geringer Überzeugung, beim alten zu bleiben. Umso mehr, als das Genfer Papsttum Calvins anspruchsvoller und unduldsamer war als der vortridentinische Katholizismus – und der Einführung des Tridentinums haben sich die gallikanischen «politiques» in Frankreich noch lange mit Erfolg widersetzt –, der sich mit der äußeren Unterwerfung unter den kirchlichen Brauch begnügte und der denn auch die Essais als Verteidigungsschrift des alten Glaubens billigte, bis zwei Menschenalter später eine neue Welle des Fanatismus sie und bezeichnenderweise zugleich auch die religiöse Toleranz des Edikts von Nantes als widerchristlich verwarf. Freilich, die Eiferer irrten nicht: Montaigne war wohl, nach dem zugespitzten Wort Sainte-Beuves, ein guter Katholik genau in dem Maße, in dem er ein lauer Christ war. Er persönlich war bereit, jeden Glauben und jeden Aberglauben gelten zu lassen, «dem heiligen Michael die eine Kerze» darzubringen «und seinem Drachen die andere», und mit Sokrates hält er es für «die richtigste Meinung über das Himmlische, sich gar keine Meinung darüber zu machen». Weil ihm der Streit über die letzten Dinge zuwider war, entschied er persönlich gegen jene, die ihn aufwarfen.
Montaignes Treue zum alten Glauben widerspricht also nicht seiner Skepsis, sie gründet in ihr. Er hat die angestammte Kirche als Konservativer verteidigt, nicht als Kämpfer des rechten Glaubens, als «Politiker», nicht als Ketzerrichter und nicht als gegenreformatorischer Eiferer der Liga, deren Anmaßung, den Irrtum mit Feuer und Schwert auszurotten, ihm noch weit tiefer verhasst war. Seine Parteinahme ist frei von allem Manichäismus: er weiß nicht das Licht auf der einen und die Finsternis auf der andern Seite, er wahrt sich die Freiheit, um sich zu blicken und zu sehen, was aus seiner Überzeugung in den Fäusten und Mäulern des wüsten Haufens ihrer Parteigänger wird, «die glauben, zu glauben, weil sie nicht wissen, was Glauben ist», und die menschlichen Vorzüge und Tugenden ihrer Gegner anzuerkennen. Dem seltsamen Phänomen der Parteileidenschaft, diesem Sichverlieren der Menschen an ihre «Rolle», dank dem sie sich für Dinge, die sie überhaupt nichts angehen, bis zum Verbrechen und bis zum Scheiterhaufen ereifern, hat er in seinen Essais oft mit Neugier und Verwunderung nachgespürt. Die Pflicht, seine Überzeugung mit Scheuklappen zu schützen, anerkennt er nicht. «Je m’engage difficilement» ist ein Schlüsselwort der Essais; «weder leicht bereit zum Glauben noch zum Nichtglauben»; und das Essai, in dem er von der Ausübung seines Bürgermeisteramts berichtet, trägt den herrlichen Titel «Von der Schonung des Willens». Sein politisches Ethos ist die Verweigerung der Leidenschaft.
Er verweigert sie auch der Tradition, für die er eintritt. Jede legitime Ordnung ist eine Herkömmlichkeit und weiter nichts. Kirche, Krone, Staat, Recht, Familie und Ehe sind Institutionen, die als solche die Achtung des Bürgers verdienen, doch in seiner Rolle als Bürger; Gewalt über seine Gesinnung und sein Gewissen können sie nicht fordern. Montaignes Konservativismus hindert ihn nicht, ihre Gebrechlichkeit mit radikal kritischen Augen zu sehen. Das Bestehende ist weder heilig noch gut, noch auch nur vernünftig; es hat keinen andern Vorzug, als dass es besteht. Ordnung, Staat, Gesetz und Recht sind nichts anderes als etablierte und durch hohes Alter ehrwürdig gewordene Unordnung, Rechtlosigkeit und Gewalttat, oft genug lächerlich, unmenschlich und absurd. Die Gesetze sind nicht Gesetze, «weil sie gerecht, sondern weil sie Gesetze sind». Jede menschliche Ordnung ist sinnstörend, fragwürdig, aus der Vernunft weder abzuleiten noch zu rechtfertigen; jeder Schuljunge kann ihre Sinnwidrigkeit beweisen und mag es zur intellektuellen Übung auch tun, aber er lasse sie stehen: er weiß keine bessere. Denn es gibt keine rationale Ordnung. Nicht aus der Retorte der Vernunft, sondern aus der Verwirrung der Geschichte ist sie gewachsen, nicht als logisch abstrakte Konstruktion für logisch abstrakte Menschen, sondern als empirisch gefundene Form des Zusammenlebens von Menschen, die zugleich mit ihr aus dieser Geschichte gewachsen und mit allem, was sie sind, meinen und glauben, mit ihrer Sprache, ihrer Hautfarbe und ihren Sitten in ihr verwurzelt sind. Auch für die staatliche Ordnung ist Wahrheit diesseits der Pyrenäen, was jenseits Lüge ist. Wie alle gewordene Wirklichkeit hält sie der prüfenden Vernunft nicht stand, denn sie gründet nicht auf Wahrheit, sondern auf Gewohnheit; und doch ist sie ihr unendlich überlegen, weil sie wirklich ist. Und je älter und gewohnter sie ist, desto besser, weil sie ihre gewalttätigen Geburtswehen überstanden und ihr inneres Gleichgewicht gefunden hat, weil sie durch ihre Dauer ihre Tauglichkeit und Lebensfähigkeit erwiesen hat und zum Rechtszustand geworden ist: das heißt zur gewohnten Spielregel, in der sich jeder zurechtfindet, weil er darein geboren ist, und die darum das Höchstmaß von Freiheit gewährt. Wer sie antastet, riskiert den Rückfall ins Faustrecht. Montaignes ganze Polemik gegen die «Neuerungssucht» ist ein Prozess gegen den Machtanspruch der Ratio, eine vernunftgemäße Ordnung jenseits der historischen Zufälligkeit zu schaffen, und er hat nur Spott für die Idealstaaten der Philosophie, die ohne Ort und Zeit sind. Der Geist schweift frei und verändert die Welt, wie er will; doch das praktische Handeln und Verhalten ist an die historische Wirklichkeit gebunden. Kein Glaubenssatz und kein Vernunftschluss ist eine Unordnung wert; jede Idee, die als Ideologie daherkommt und als allgemein gültiges Ordnungsprinzip Gewalt über Menschen beansprucht, ist Hybris und Tollheit, anmaßende Überschreitung der Grenze zwischen Theorie und Praxis. Denn alle gewaltsame Umwälzung, geschähe sie auch im Namen der Freiheit oder der Gerechtigkeit, ist Zwang, Willkür, Terror und Faustrecht und vergewaltigt unter dem Vorwand des öffentlichen Heils, der Tugend oder der Vernunft die wesentlichste und persönlichste Freiheit des Menschen, seiner Gewohnheit – selbst seiner schlechten Gewohnheit – zu folgen und zu sein, wie er ist, nicht wie er sein soll.
Auch dies ist eine Systematisierung, die Montaigne selbst nicht vollzogen hat. Er stellt keine Postulate und keine Staatslehre auf: er bestimmt seine eigene, persönliche Haltung zu seiner Zeit, und er hat gegenüber dieser Zeit, in der alles im Umsturz und aus den Fugen war, zweifellos die konservative Seite seines Denkens polemisch überbetont. Doch seine Kritik der praktischen Vernunft ist keine Hintertür, durch die er die Axiome und Apriori wieder einlässt, die er durch die Kritik der reinen Vernunft entthront hat. Dieser Konservative hat sich kühn und deutlich genug über die politischen Sitten und die Großen seiner Zeit, über den Ämterkauf, über die Justiz und ihre Ausübung, über die Barbarei der Folter und der Hexenprozesse, über die Lüge und die Bosheit der Macht geäußert, um zu zeigen, dass er keiner bestehenden Ordnung Ewigkeitswert beimaß, sondern den relativen Wert des kleineren Übels gegenüber dem Chaos sah, in dem sein Land zu versinken drohte. Auch ihr gesteht er nicht das Recht zu, seine private Freiheit zu beeinträchtigen: «Wenn die, denen ich mich unterwerfe, mich nur mit dem kleinen Finger bedrohten, ich ginge ungesäumt von dannen, unter andern zu leben, wo immer es wäre … Ich bin so unbändig voll Gier nach Freiheit, dass ich, wenn mir jemand den Zutritt zu irgendeinem Winkel Indiens verböte, um ein Stück unfroher leben würde.» Gerade um dieser Freiheit willen fügt er sich in die äußere Ordnung: auch die Freiheit hat er auf sich bezogen, an sich gezogen als seine Freiheit, nicht als öffentliches Postulat, und der praktische Konformismus schien ihm ein geringer Preis, um sich diese Freiheit zu wahren. Er spielte seine Rolle, wie sie ihm in böser Zeit zugefallen war, als Franzose, Katholik, Perigordiner, Bürger und Maire von Bordeaux, pflichtgemäß und ohne Leidenschaft, mit gelassener Einwilligung in seine historische «Zufälligkeit», und wahrte sich damit die innere Freiheit, Michel de Montaigne, Weltbürger und Skeptiker zu bleiben. So mündet diese politische Haltung in die Selbsterkenntnis, von der sie ausstrahlt, wieder zurück, in die durchdachte und bejahte Widersprüchlichkeit von Freiheit und Bindung, Individualismus und Konformismus, in der er sich selber findet: «So bin ich.» Das ist Lebenskunst, gewiss, doch mehr als das: es ist die souveräne Weigerung eines ganzen Menschen, sich anwerben, mobilisieren, einreihen und durch ideologische Alternativen einschüchtern zu lassen.
Die schönste Frucht dieses Zusichkommens ist die absolute Offenheit gegenüber anderem und anderen. Dieser zutiefst liberale Geist ist tolerant ohne den Beigeschmack einer Duldsamkeit von oben herab, eines großmütigen Zugeständnisses der Wahrheit an den Irrtum, der dem Wort Toleranz so oft anhaftet – er selbst kennt es nicht und postuliert es nicht einmal, so selbstverständlich entspringt sie aus seiner Aufrichtigkeit und Unbefangenheit gegen sich selbst. Dieser Feind aller Ideologie hat eine unersättliche, vorurteilslose Neugier für alle Ideen, dieser Verächter aller Besserwisserei hat eine unbegrenzte Belehrbarkeit gegenüber fremdem Wissen, dieser Skeptiker gegenüber jedem Dogma ist aufgeschlossen für die ganze unendliche Vielfalt der geistigen Möglichkeiten, der Lebensformen und Lebenswahrheiten anderer Menschen und anderer Völker, und er begegnet mit Achtung auch jenen, die ihm selbst verschlossen sind. Gern und spielerisch erprobt er seine Fähigkeit, in eine andere Meinung hineinzuschlüpfen und ihre Rechtfertigungen zu suchen, wobei es ihm oft widerfährt, dass das Spiel ernst wird und er die eigene fallen lässt, um sich die anfangs bekämpfte zu eigen zu machen. Seine «Kunst des Gesprächs» ist nicht nur eine beherzigenswerte Spielregel der Diskussion: sie ist eine Anleitung zur Offenheit, die im Widerspruch nicht einen feindlichen Angriff, sondern eine Bereicherung findet.
Gewiss ist diesem Geist, der so vieles erfasste, nur um sich selbst zu erfassen, auch vieles entgangen. Die Höhenflüge der Begeisterung, die mystische Weltschau, die Leidenschaft der Erkenntnis und vielleicht die Leidenschaft schlechthin ahnt er in dichterischem Nachempfinden, ohne sie zu kennen; die Grenzformen des menschlichen Seins, der Seher, Held und Heilige wie der radikal Böse, sind ihm fremd und als krankhafte Abnormitäten verdächtig. Das Hingerissensein und Außersichkommen sind Erscheinungen, denen er bei sich und andern immer wieder neugierig und abwehrend zugleich nachgeht; doch seine ganze Anstrengung geht in der umgekehrten Richtung: zu sich zu kommen, sich nicht hinreißen zu lassen, nüchtern und ehrlich bei sich zu sein. Er hat diesen Weg zu sich nicht durch die Verneinung, sondern durch die Bejahung des andern gefunden, die Bejahung auch des ihm Fremden, Geheimnisvollen und Unbegreiflichen.
Aus der Einsicht in die Relativität des eigenen geistigen Bezugssystems, das nur eines unter unzähligen ist, schöpft er den wachen Sinn für das Geheimnis der Menschen und der Dinge, die Scheu vor der geistigen Eigengesetzlichkeit des andern, die wir nur von außen, nicht aber in ihrem Wesen und ihren Motiven erfassen und erfahren können, und seine ganze Sprach-, Vernunft- und Wissenskritik ist letzten Endes nichts als die Kritik jener rationalistischen Plattheit, welche die Welt in Begriffen und Formeln zu erschöpfen meint und «uns das Geheimnisvolle der Dinge unterschlägt». Diese so seltene und köstliche Fähigkeit, sich in das Gegenüber zu versetzen und das innere Gesetz des andern als gleichrangig zu achten, hat er bis zur äußersten Grenze getrieben: «Wenn ich mit meiner Katze spiele, wer weiß, ob sie sich nicht noch mehr die Zeit mit mir vertreibt als ich mir mit ihr?» Der ganze Montaigne steckt in diesem hingeworfenen Satz.