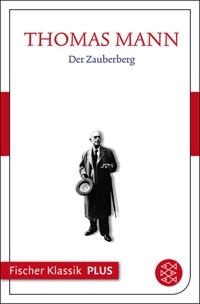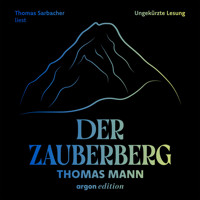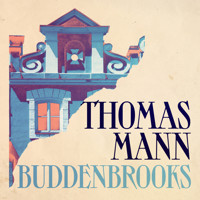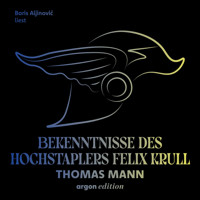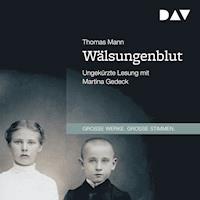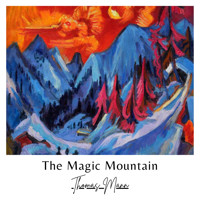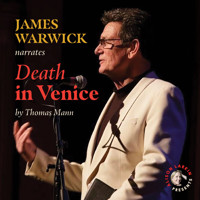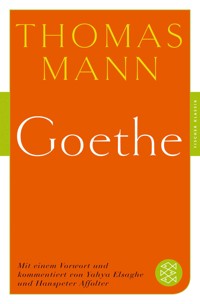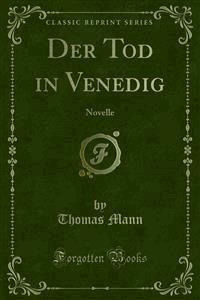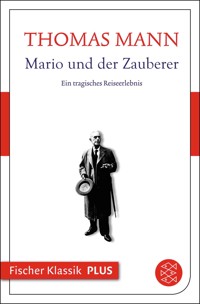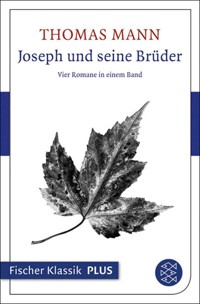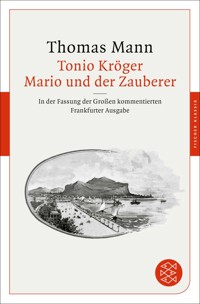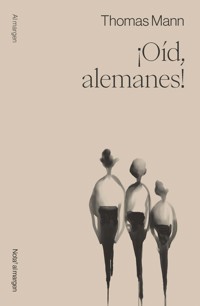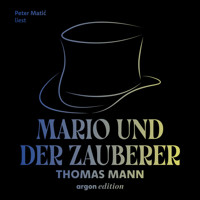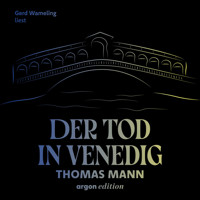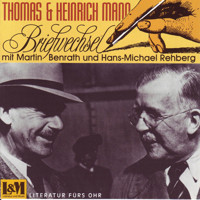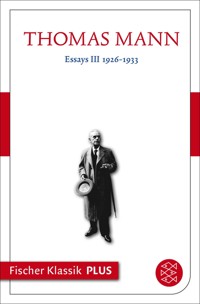
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erstmals vollständig ediert und kommentiert: Thomas Manns Essays aus den späten Jahren der Weimarer Republik Am turbulenten kulturellen und politischen Leben der späten Weimarer Republik beteiligte sich Thomas Mann so intensiv wie wenige andere: mit Stellungnahmen, Reden, Buchbesprechungen und Essays. Seine Warnungen vor der nationalsozialistischen Bewegung machten ihn zur Zielscheibe wüster politischer Angriffe. Sie wurden in seiner Münchner Polizeiakte vermerkt und 1934 für den Antrag auf »Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit« genutzt. Zu lesen ist dieser neue Band der GKFA daher auch als fortlaufender, kritischer Kommentar zu den Wahlerfolgen der NSDAP, zum grassierenden Antisemitismus in Deutschland – und damit zur Erosion der ersten deutschen Demokratie. In seiner Vielstimmigkeit zeichnet er ein neues Bild des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Thomas Mann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1468
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Mann
Essays III 1926–1933
Text
In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA)
Mit Daten zu Leben und Werk
Über dieses Buch
Erstmals vollständig ediert und kommentiert: Thomas Manns Essays aus den späten Jahren der Weimarer Republik
Am turbulenten kulturellen und politischen Leben der späten Weimarer Republik beteiligte sich Thomas Mann so intensiv wie wenige andere: mit Stellungnahmen, Reden, Buchbesprechungen und Essays. Seine Warnungen vor der nationalsozialistischen Bewegung machten ihn zur Zielscheibe wüster politischer Angriffe. Sie wurden in seiner Münchner Polizeiakte vermerkt und 1934 für den Antrag auf »Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit« genutzt. Zu lesen ist dieser neue Band der GKFA daher auch als fortlaufender, kritischer Kommentar zu den Wahlerfolgen der NSDAP, zum grassierenden Antisemitismus in Deutschland – und damit zur Erosion der ersten deutschen Demokratie. In seiner Vielstimmigkeit zeichnet er ein neues Bild des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Thomas Mann.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thomas Mann, 1875–1955, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Mit ihm erreichte der moderne deutsche Roman den Anschluss an die Weltliteratur. Manns vielschichtiges Werk hat eine weltweit kaum zu übertreffende positive Resonanz gefunden. Ab 1933 lebte er im Exil, zuerst in der Schweiz, dann in den USA. Erst 1952 kehrte Mann nach Europa zurück, wo er 1955 in Zürich verstarb.
Impressum
Thomas Mann
Große kommentierte Frankfurter Ausgabe
Werke – Briefe – Tagebücher
Herausgegeben von
Heinrich Detering, Eckhard Heftrich†, Hermann Kurzke†,
Terence J. Reed, Thomas Sprecher, Hans R.Vaget,
Ruprecht Wimmer in Zusammenarbeit mit dem
Thomas-Mann-Archiv der ETH,
Zürich
Band 16.1
Dieser Band wurde von der S. Fischer Stiftung gefördert.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Stefan Gelberg
Coverabbildung: © Archiv S. Fischer Verlag
ISBN 978-3-10-492361-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Hinweis]
LÜBECK ALS GEISTIGE LEBENSFORM
[GRUSSWORT ZUM REPUBLIKANISCHEN TAG]
[ERLEBNISSE, DIE ZU WERKEN WURDEN]
[GEGEN DAS SCHMUTZ- UND SCHUNDGESETZ I]
VORWORT [ZU FRANS MASEREELS ›MEIN STUNDENBUCH‹]
MEIN VERHÄLTNIS ZU WIEN
[ÜBER ›VOLK UND HEIMAT‹]
ÜBER PLATEN
EINLEITUNG ZU ›DER GEHEIMAGENT‹ VON J. CONRAD
[GEGEN DAS SCHMUTZ- UND SCHUNDGESETZ II]
GUTACHTEN ÜBER ARNACS »IM TOLLHAUS DER FREUDE«.
[ZUM I. PANEUROPA KONGRESS IN WIEN]
DIE UNBEKANNTEN
[DEMENTI EINES INTERVIEWS]
ABSCHIED VON BERTHOLD LITZMANN
REDE ZUR GRÜNDUNG DER SEKTION FÜR DICHTKUNST
[GEGEN DAS SCHUND-GESETZ]
REDE ZUR ERÖFFNUNG DER ›MÜNCHNER GESELLSCHAFT‹
[ÜBER DIE WEISEN VON ZION]
[IN SACHEN FRITZ RAU]
[ÜBER DIE ›ROTE HILFE DEUTSCHLANDS‹]
GERHART HAUPTMANNS LEBENSWERK
DER KAMPF UM MÜNCHEN
VORWORT [ZU ›DER DEUTSCHE GENIUS‹]
[DIE BESTEN BÜCHER DES JAHRES 1926]
[ANTWORT AUF EINE UMFRAGE ZUM WELTFRIEDENSTAG 1926]
[ÜBER ›UNORDNUNG UND FRÜHES LEID‹]
[AN DAS ›DEUTSCHES COMITÉ]
[WAS TÄTEN SIE, WENN SIE MIT IHREN HEUTIGEN ERFAHRUNGEN NOCHMALS ACHTZEHN JAHRE ALT WÄREN?]
[›KAMPF UM MÜNCHEN ALS KULTURZENTRUM‹]
[DICHTUNG UND CHRISTENTUM]
[LESUNG AUS ›GOETHE UND TOLSTOI‹]
[GEGEN DIE VERNICHTUNG DER BARKENHOFF-FRESKEN
WORTE AN DIE JUGEND
GLAUBENSBEKENNTNIS
AN KARL ARNOLD
[EIN MEISTER DER PRODUKTIVEN KRITIK]
[›WAS INTERESSIERT UND WAS LANGWEILT SIE AM MEISTEN?‹]
›ROMANE DER WELT‹ [GELEITWORT]
[REDE IM WARSCHAUER PEN-CLUB]
VERJÜNGENDE BÜCHER.
FRAGMENT
[ÜBER WILLY SEIDELS ›SCHATTENPUPPEN‹]
GASTSPIEL IN MÜNCHEN
[GLÜCKWUNSCH ZUM 75. GEBURTSTAG VON IDA BOY-ED]
[ZUR BESTATTUNG DER SCHWESTER JULIA]
DIE ›ROMANE DER WELT‹
[GRUSS ZUR ›DEUTSCHEN SHAKESPEARE-WOCHE BOCHUM‹]
[MAX LIEBERMANN IM URTEIL EUROPAS]
[EXPOSÉ ÜBER DIE SEKTION FÜR DICHTKUNST]
[HENRIK PONTOPPIDAN ZUM 70. GEBURTSTAG]
THOMAS MANN ÜBER DIE BAYERISCHE JUSTIZ
[HINRICHTUNG VON SACCO UND VANZETTI]
[JOHN GALSWORTHYS 60. GEBURTSTAG]
[SCHLAF UND ZIGARETTEN ZUM DICHTEN?]
[»DIE WELT IST IN SCHLECHTESTER VERFASSUNG«]
[ZUM REICHSSCHULGESETZENTWURF]
GELEITWORT [ZUM ›JAHRBUCH DER THEATER KIEL‹]
[ÜBER DEN FALL HOELZ]
[WIE STEHEN WIR HEUTE ZU RICHARD WAGNER?]
[DICHTER UND IHRE WERKE]
DIE ÜBERHOLTHEIT DER REICHSVERFASSUNG
[WIE STEHST DU ZU KLEIST?]
[DARF DER DICHTER IN SEINEM WERK PRIVATPERSONEN PORTRÄTIEREN?]
UNSERE JUGEND – MEINE KINDER
[ÜBER DAS INFORMATIONSBLATT ÜBER POLEN ›DER KURIER‹]
[UM DIE TODESSTRAFE. FÜR UND WIDER]
[SOLL DEUTSCHLAND KOLONIALPOLITIK TREIBEN?]
[ÜBER DIE BALKAN-FÖDERATION‹]
[DIE BESTEN BÜCHER DES JAHRES]
GEGEN DICKFÄLLIGKEIT UND RÜCKFÄLLIGKEIT
[VERSTAND ODER INSTINKT?]
[AN DEN ›ZWIEBELFISCH‹]
[BEKENNTNIS ZU WILHELM SCHÄFER]
[DEM ANDENKEN MICHAEL GEORG CONRADS]
[GLOSSEN ZUR ZEITGESCHICHTE]
[ÜBER JOSEPH CONRAD]
THOMAS MANN GEGEN DIE ›BERLINER NACHTAUSGABE‹
[ZUM 60. GEBURTSTAG MAXIM GORKIS]
[ÜBER DEN JOSEPH-ROMAN]
[FÜR LAJOS HATVANY]
IBSEN UND WAGNER
BRIEF AN DEN VERTEIDIGER L. HATVANYS
[HABEN SIE MIKROFIEBER?]
KULTUR UND SOZIALISMUS
DÜRER
[GLÜCKWUNSCH ZUR PRESSE-AUSSTELLUNG 1928]
[FÜR MAGNUS IRSCHFELD ZU SEINEM 60. GEBURTSTAGE]
[PROTEST GEGEN DIE VERSCHÄRFUNG VON § 175]
VON DER LANDESFILMBÜHNE ZUR URANIA
[WARUM WERDEN IHRE BÜCHER VIEL GELESEN?]
[WORAN ARBEITEN SIE?] [II]
[FESTGRÜSSE ZUM DOPPELJUBILÄUM DES ›PESTER LLOYD‹]
KLEISTS AMPHITRYON
MEINE ANSICHT ÜBER DEN FILM
[ADELE GERHARD ZUM SECHZIGSTEN GEBURTSTAG]
BRIEF AN DR. SEIPEL
[WAS ERWARTEN SIE VON DEN … FESTSPIELEN?]
EINE ERKLÄRUNG [I]
ZUM GELEIT [DER MÜNCHNER FILM-FESTWOCHEN]!
[ANTWORT AN ARTHUR HÜBSCHER]
›POLITISCHE NOVELLE‹
[DER SPIELPLAN]
KONFLIKT IN MÜNCHEN
DIE FLIEGER, COSSMANN, ICH
[DEUTSCHLANDS ZUKUNFT]
TOLSTOI
[THEODOR FONTANE]
VORWORT [ZU ›DER FALL HERBERT CRUMP‹]
HUNDERT JAHRE RECLAM
DER STÄRKSTE EINDRUCK
[ÜBER DAS MUSIKALISCHE ERLEBNIS]
[ZUR PHYSIOLOGIE DES DICHTERISCHEN SCHAFFENS]
[ÜBER ›KRIEGSBRIEFE GEFALLENER STUDENTEN‹]
[GLÜCKWUNSCH ZUM FEST DER HAMBURGER GRUPPE]
[GLÜCKWUNSCH FÜR DIE ZEITSCHRIFT ›DER BAZAR‹]
[ANSPRACHE ZUR GOLDENEN HOCHZEIT PRINGSHEIM]
DEUTSCHLANDS WIEDERAUFRICHTUNG
MEIN ROMAN ›JOSEPH UND SEINE BRÜDER‹
[SELMA LAGERLÖF ZUM SIEBZIGSTEN GEBURTSTAG]
[›ROMANE DER WELT‹. ANTWORT AN WINIFRED KATZIN]
VORWORT [ZU ›ZWEI FESTREDEN‹]
DIE BESTEN BÜCHER DES JAHRES 1928]
WEIHNACHTSBÜCHER [I]
DIE WELT IST SCHÖN
VORWORT [ZUM ROMAN ›DIE TIEFEN DES MEERES‹]
VOM SCHÖNEN ZIMMER
ZU LESSINGS GEDÄCHTNIS
REDE ÜBER LESSING
[WORTE ZUM GEDÄCHTNIS LESSINGS]
ZUM FALL FRIEDERS
EINE STIMME ZUR »THEATERKRISIS«
ANSPRACHE BEIM MÜNCHNER ROTARY-CLUB
FIORENZA IN BIELITZ
[BEGRÜSSUNGSREDE ZUR JAHRESVERSAMMLUNG 1929 ]
[ÜBER DEN FILM ›JOHANNA VON ORLÉANS‹]
DER TAG DES BUCHES
[VOM WESEN DES ZEITUNGSROMANS]
[ÜBER DIE ZEITUNG ›DIE GRÜNE POST‹]
TISCHREDE AUF WASSERMANN
[DIE WICHTIGSTEN ZEHN DEUTSCHEN BÜCHER]
[VOM VATER HAB’ ICH DIE STATUR]
DIE STELLUNG FREUDS IN DER GEISTESGESCHICHTE
[WORAN ARBEITEN SIE?] [III]
[ZUM TONKÜNSTLERFEST DUISBURG 1929]
[DURCH WELCHE ART VON WERK … DAS INTERESSE … ZU WECKEN?]
[DIE PARTEI DER BILDUNG UND PREUSSENS KULTUSMINISTER]
WAS MICH NACH OSTPREUSSEN ZIEHT. EIN BEKENNTNIS
[DER LEBENDIGE SCHILLER]
[WELCHES WAR DAS LIEBLINGSBUCH IHRER KNABENJAHRE?]
DAS THEATER IN SEINER HEUTIGEN SITUATION
IN MEMORIAM [HUGO VON HOFMANNSTHAL]
REDE ÜBER DAS THEATER
ZU HAMSUNS SIEBZIGSTEM GEBURTSTAG
GRUSS AN DAS REICHSBANNER
[ÜBER ROBERT C. SHERRIFFS ›DIE ANDERE SEITE‹]
[ANSPRACHE BEIM GOETHE-BUND]
[FELIX SALTEN ZUM 60. GEBURTSTAG]
[GRUSSWORT ZUR TAGUNG DER WELTLIGA FÜR SEXUALREFORM]
[ANSPRACHE VOR BAYERISCHEN BUCHHÄNDLERN]
DIE FORDERUNG DES TAGES [SAMMLUNG]
[ZUR FRIEDENSBEWEGUNG UND ZUR POLITISCHEN EINIGUNG MIT FRANKREICH]
[ÜBER VOLKSAUSGABEN]
DAS JUBILÄUM DER BUKUM
[ARTHUR ELOESSER ›DIE DEUTSCHE LITERATUR‹]
»SI LE GRAIN NE MEURT –«
[›BÜRGERLICHKEIT‹]
[ÜBER HABIMAH]
[NOBELPREISREDE IN STOCKHOLM]
[ÜBER FRANK THIESS ›ERZIEHUNG ZUR FREIHEIT‹]
[ZU S. FISCHERS 70. GEBURTSTAG]
[DIE BESTEN BÜCHER DES JAHRES 1929]
VOR DEM JAHRESENDE
EUROPA-FRIEDEN 1930
[VORWORT ZUM KATALOG ›UTLÄNDSKA BÖCKER 1929‹]
[GELEITWORT ZU GALSWORTHYS ›FORSYTE SAGA‹]
[TECHNIFIZIERUNG DES KÜNSTLERISCHEN]
[WAS WAR UNS DIE SCHULE?]
VORWORT [ZU C. F. MEYERS ›DER HEILIGE‹]
AN DIE PREUSSISCHE AKADEMIE DER KÜNSTE
[DIE VERNACHLÄSSIGTEN]
[ÜBER DIE THÜRINGISCHE REGIERUNG]
[ÜBER FINKELNBURGS] ›AMNESTIE‹
[ARTHUR ELOESSERS 60. GEBURTSTAG]
[ANSPRACHE IM CERCLE ›AL DIAFA‹ IN KAIRO]
[LEGEN SIE WERT AUF GUTE AUSSTATTUNG IHRER BÜCHER?]
[ÜBER GRENZTHEATER]
[LEBENSLAUF 1930]
[ÜBER NIDDEN]
PROTEST GEGEN DIE VERHAFTUNG DR. UJHÉLYI]
EUROPA ALS KULTURGEMEINSCHAFT
LEBENSABRISS
[ZUM JUBILÄUM MAX REINHARDTS]
FRIEDEN ZWISCHEN DEN ALTEN UND DEN JUNGEN
[AN DIE REDAKTION DER ›POLOGNE LITTÉRAIRE‹]
ANSPRACHE ZUR EINFÜHRUNG FÜR JOHN GALSWORTHY
ZWEI BÜCHER
[ZUR RÄUMUNG DES RHEINLANDES I]
[ZUR RÄUMUNG DES RHEINLANDES II]
THEODOR STORM
ERINNERUNGEN ANS LÜBECKER STADTTHEATER
[GRUSS AN DIE LESER DER DEUTSCHEN BUCH-GEMEINSCHAFT]
[SOLL DIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG REFORMIERT WERDEN?]
[WAS HALTEN SIE VOM NATIONALSOZIALISMUS?]
[ÜBER DIE VÖLKISCHE RASSENTHEORIE UND –FORSCHUNG]
[ZUM GELEIT FÜR DAS KABARETT LITASSSÄULE]
[THOMAS MANN AN JOHANNES ECKARDT]
DIE GEISTIGE SITUATION DES SCHRIFTSTELLERS
PLATEN – TRISTAN – DON QUICHOTTE
HERMANN UNGAR
DEUTSCHE ANSPRACHE. EIN APPELL AN DIE VERNUNFT
[ÜBER DIE WAHLEN IN ÖSTERREICH]
[RETTET DIE KROLL-OPER]
[TOLSTOI UND DIE HEUTIGEN]
[DIE BESTEN BÜCHER DES JAHRES]
[DAS BILD DER MUTTER]
ANMERKUNG ZUR ›GROSSEN SACHE‹
[ZEITSCHRIFT ›ECHO DER JUNGEN DEMOKRATIE‹]
[KRIEG UND FRIEDEN IM SPIEGEL GROSSER GEISTER!]
[GLÜCKWUNSCH ZUM JUBILÄUM DER ›TEMESVARER ZEITUNG‹]
[GLÜCKWUNSCH AN DAS BREMER SCHAUSPIELHAUS]
JUNGFRANZÖSISCHE ANTHOLOGIE
[OSKAR FRANKL ZUM FÜNFZIGSTEN GEBURTSTAG]
APATHIE ODER SYMPATHIE?
[›UR UND DIE SINTFLUT‹]
[ZU THOR GOOTES ›WIR FAHREN DEN TOD‹]
DIE WIEDERGEBURT DER ANSTÄNDIGKEIT
[ZUM PROZESS PENZOLDT-LOCH]
[BEGRÜSSUNGSREDE ZUR JAHRESVERSAMMLUNG 1931]
[KUNSTBETRIEB UND JUDENFRAGE]
[JUGENDZIELE PROMINENTER]
VOM BERUF DES DEUTSCHEN SCHRIFTSTELLERS
WIE WIRD MAN SCHRIFTSTELLER?
[ÜBER ERICH EBERMAYERS ›DIE GROSSE KLUFT (JÜRGEN RIED)‹]
[ÜBER GUSTAV STRESEMANN]
RITTER ZWISCHEN TOD UND TEUFEL
A LIVING AND HUMAN REALITY
[MEINE ERSTE LIEBE]
[WO VERBRINGEN SIE DEN SOMMER?]
[ÜBER DAS LIED ›DREI VATERUNSER BET’ ICH NICHT‹]
[AN DIE ZEITSCHRIFT ›DIE SCHULGEMEINDE‹]
[DER WEISHEIT LETZTER SCHLUSS]
[LE PRIX LITTÉRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS]
DIE ZUKUNFT EUROPAS
[ÜBER ›WÄLSUNGENBLUT‹]
NOCH EINMAL ›WÄLSUNGENBLUT‹
FRAGMENT ÜBER DAS RELIGIÖSE
ANSPRACHE AN DIE JUGEND
[SOLL DAS GOETHE-JAHR 1932 GEFEIERT WERDEN?]
PO SOUMRAKU – SVÍTÁNÍ
[ZUM JUBILÄUM DER ›FRANKFURTER ZEITUNG‹]
[ÜBER DIE ÜBERSETZUNG DES ›ZAUBERBERG‹ DURCH MAURICE BETZ]
WAS AN SCHNITZLER UNSTERBLICH IST
MEIN SOMMERHAUS
[DIE BESTEN BÜCHER DES JAHRES 1931 I]
[DIE BESTEN BÜCHER DES JAHRES 1931 II]
[»WIR GLAUBEN AN EINE ZUKUNFT DES DEUTSCHEN THEATERS«]
[DAS HAMBURGER EHRENMAL VON ERNST BARLACH]
[PAX MUNDI]
[ÜBER DIE LITERARISCHE ZUKUNFT]
[ZUM URTEIL GEGEN CARL VON OSSIETZKY]
DIE EINHEIT DES MENSCHENGEISTES
KRIEGSFOLGEN FÜR KINDER. EIN BRIEF
DER ALLGELIEBTE
[ÜBER GOETHES ELTERNHAUS]
GOETHE UND DAS BÜRGERLICHE ZEITALTER
GOETHES LAUFBAHN ALS SCHRIFTSTELLER
AN DIE JAPANISCHE JUGEND
HITLERS NIEDERLAGE.
[ÜBER DEN RUNDFUNK]
[GLÜCKWUNSCH DER AUGSBURGER LITERARISCHEN GESELLSCHAFT]
DAS WAHLRECHT DER ZWANZIGJÄHRIGEN
MEINE GOETHEREISE
SIEG DEUTSCHER BESONNENHEIT!
ANSPRACHE ZUR ERÖFFNUNG DES GOETHE-MUSEUMS
MEINE LIEBLINGSPLATTEN
[AFTER RETRENCHMENT-REFORM]
CONTRASTES DE GOETHE – GOETHE ET L’ALLEMAGNE
ICH GLAUBE AN DIE DEMOKRATIE
MEINE HEIMAT
WAS WIR VERLANGEN MÜSSEN
[ÜBER DEN KULTURFILM]
ANTI-SEMITISM REVOLTS CIVILIZED MAN
DER GEIST IN GESELLSCHAFT
ARTHUR SCHNITZLER ALS VORBILD
[REDE VOR ARBEITERN IN WIEN]
DEMOKRATIE UND FÜHRUNG
[AN GERHART HAUPTMANN ZUM 70. GEBURTSTAG]
MÜNCHEN UND DAS WELTDEUTSCHE
[ZU GERHART HAUPTMANNS 70 GEBURTSTAG]
[DIE BESTEN BÜCHER DES JAHRES 1932]
EINEM DICHTER DES VOLKES
TYSKLAND ER MED EN VIS MELANKOLSK …
ELOESSERS ZWEITER BAND
[IN SACHEN DER KUNDGEBUNG DER AKADEMIE]
[ZUM LEIHBÜCHEREIGEWERBE]
BEKENNTNIS ZUM SOZIALISMUS
Daten zu Leben und Werk
Hinweis zur Zitierfähigkeit dieser Ausgabe:
Die Zahlen in geschweiften Klammern markieren jeweils den Beginn einer neuen, entsprechend paginierten Seite in der genannten Buchausgabe.
{37}LÜBECK ALS GEISTIGE LEBENSFORM
Rede gehalten am 5. Juni im Stadttheater zu Lübeck aus Anlaß der 700 Jahrfeier der freien und Hansestadt.
»Wie alles war in der Welt entzweit
Fand jeder in Mauern gute Zeit:
Der Ritter duckte sich hinein,
Bauer in Not fand’s auch gar fein.
Wo kam die schönste Bildung her,
Und wenn sie nicht vom Bürger wär’?«
GOETHE
Meine lieben Mitbürger!
Wollen Sie mir erlauben, daß ich mich heute dieser Anrede bediene, dieser und keiner anderen? Wenn ich sonst vor Ihnen stand – es geschah ja schon das eine und andere Mal in den letzten Jahren –, so benutzte ich die übliche, sagte »Meine Damen und Herren«. Aber als die ehrenvolle Einladung an mich erging, zu diesem Feste zu Ihnen zu kommen, und ich zu überlegen begann – droben in Arosa, in Decken auf meinem Zauberberg-Balkon, hinter dessen Gitter Berge und Fichtenwald in wenig mailichem Schneegedünste lagen – wie und was ich bei dieser Gelegenheit zu Ihnen reden sollte, da stand mir das Eine zuerst und vor allem fest, daß ich unter so landsmännisch-heimatlich-festlichen Umständen noch niemals vor Ihnen gestanden sei, und daß ich nicht wie sonst überall beginnen, sondern Sie als meine Mitbürger anreden wollte.
Ich gestehe, mehr wußte ich lange nicht und – Sie werden {38}lächeln – viel mehr weiß ich auch heute und jetzt nicht, da ich vor Ihnen stehe und sprechen soll. Mein sogenannter Vortrag, für den einen Titel zu finden schwer war, ist schon enthalten in dieser intimen und herzlichen Anrede; er ist eigentlich nur daraus zu entwickeln; und wenn ich ihm endlich die Überschrift gegeben habe: »Lübeck als geistige Lebensform«, so ist das ein Nottitel, der im Voraus keine Vorstellung gibt von der Vertraulichkeit der Unterhaltung, die ich in dieser Nachmittagsstunde mit Ihnen, meinen Landsleuten, zu pflegen im Begriffe bin. Von Lübeck sollte natürlich die Rede sein, aber Sie haben von mir gewiß keine gelehrte Auseinandersetzung historischer Art erwartet, wie Ihnen dergleichen in diesen Jubiläumstagen wahrscheinlich gedruckt und mündlich vielfach geboten wurde. Persönlicherer Aeußerungen haben Sie sich von mir versehen, besonders, da man Ihnen, glaube ich, angekündigt hat, ich würde »Jugenderinnerungen« an Lübeck zum Besten geben. Aber das ist nicht das richtige Wort. Ich habe mit Jugenderinnerungen in meiner Produktion ja nie gespart und könnte mich hier nur wiederholen. Von Jugenderinnerungen lebt der ganze Roman, der unter meinen Büchern zu Lübeck die unmittelbarsten stofflichen Beziehungen besitzt: »Buddenbrooks«; und Jugenderinnerungen spielen stark in die Künstlernovelle hinein, die, ihm atmosphärisch nächstverwandt, auf ihn folgte, den »Tonio Kröger«. Nicht um direkte und anekdotische Kindheits- und Ursprungsreminiscenzen ist es mir hier und heute zu tun, sondern um Geistigeres und Wesentlicheres, um ein Bekenntnis, abzulegen vor Ihnen, meinen Mitbürgern, ein Bekenntnis zu Lübeck »als Lebensform«. Denn offen gestanden, wenn ich für meinen Vortrag eben diesen Titel wählte: »Lübeck als geistige Lebensform«, so ist die Lebensform und Lebensauswirkung eines Lübeckers gemeint, des Lübeckers, der vor Ihnen spricht, der ein Künstler, ein {39}Schriftsteller, ein Dichter, wenn Sie wollen, geworden und als Künstler, als Schriftsteller ein Lübecker geblieben ist. Insofern allerdings ist das, was ich heute zu geben habe, Autobiographie, Erinnerung: Selbsterinnerung und Selbsterkenntnis, die Sie mir, bitte, nicht als Selbstgefälligkeit auslegen wollen. Vielmehr muß ich hoffen, daß Sie sie mit mir in ihrer Vertraulichkeit als gerechtfertigt empfinden werden durch den Stolz und die Festlichkeit unseres gemeinsamen historischen Gedenkens.
Vielleicht haben manche von Ihnen schon von einem Gelehrten, einem Literaturforscher gehört, der den neuen, merkwürdigen und übrigens sehr deutschen Versuch unternommen hat, eine kritische Ordnung unseres Schrifttums nicht nach Schulen und Richtungen, sondern nach Stämmen, eine landschaftliche Literaturgeschichte also, aufzustellen. Nun denn, wenn ich sagte, daß ich als Künstler Lübecker geblieben sei, so meine ich damit und bin mir dessen bewußt, daß ich im Nadlerschen Sinn das Patrizisch-Städtische, das stammesmäßig Lübeckische oder das allgemein Hanseatische heute, und zwar nicht nur durch den Lübecker Roman »Buddenbrooks«, literarisch-dichterisch darstelle und vertrete, wobei nur zu begreiflich ist, daß meine Landsleute eine solche Repräsentation lange Zeit durchaus nicht anerkennen wollten und viel eher den Eindruck der Mißratenheit und des Verrats, als den der Echtheit und Treue hatten. Sie waren an anderes gewöhnt. Sie hatten ihr Repräsentanten-Denkmal auf dem Platze hier in der Nähe (in Lübeck ist ja alles »in der Nähe«): den thronenden Poeten, zu dessen Füßen der klassizistische Genius mit der gebrochenen Schwinge lehnt, das Standbild dessen, der gesungen hatte:
»Wie steigst, o Lübeck, du herauf
In alter Pracht vor meinen Sinnen,
An des beflaggten Stromes Lauf usw.« –
{40}gesungen, sage ich, in dem pompösen Sinn, in dem heute niemand mehr singt. Ich habe Emanuel von Geibel als Kind noch gesehen, in Travemünde, mit seinem weißen Knebelbart und seinem Plaid über der Schulter, und bin von ihm um meiner Eltern willen sogar freundlich angeredet worden. Als er gestorben war, erzählte man sich, eine alte Frau auf der Straße habe gefragt: »Wer kriegt nu de Stell? Wer ward nu Dichter?« – Nun, meine geehrten Zuhörer, niemand hat »de Stell« bekommen, »de Stell« war mit ihrem Inhaber und seiner alabasternen Form dahingegangen, der Laureatus mit dem klassisch-romantischen »Saitenspiel« konnte keinen Nachfolger haben, das erlaubte die Zeit, die fortschreitende, sich wandelnde Zeit nicht, und was sich nunmehr als literarischer Ausdruck lübeckischen Wesens auszugeben wagte, das war als solcher zunächst wahrhaftig nicht wiederzuerkennen.
Vor allem war es nicht Lyrik mehr und klingendes Hochgefühl, es war psychologische Prosa, es war ein naturalistischer Roman, in seinem literarischen Habitus stark international bestimmt, und statt jenes priesterlichen Schönheitsidealismus, der der guten alten Trave so kleidsam zustatten gekommen war, erzählte er auf teils düstere, teils komische Art von Lebensdingen, von Geburten, Taufen, Hochzeiten und bitteren Sterbefällen, vermischte er pessimistische Metaphysik mit einer satirischen Charakteristik, die im ersten Augenblick, und nicht nur im ersten, als das Gegenteil von Liebe, Sympathie, Verbundenheit wirken mußte, so sehr als das Gegenteil, daß hierzuhause dem viel angeführten Wort von dem Vogel, der sein eigenes Nest beschmutzt, nur wenige zu widersprechen wagten.
Vielleicht wagte nicht einmal der junge Autor und Uebeltäter selbst, ihm zu widersprechen. Ihm war es ja, offen gestanden, wirklich nicht um eine Glorifikation Lübecks zu tun gewesen, sondern um den aus allen literarischen Zonen und {41}außerdem von Wagner her beeinflußten Versuch eines Prosa-Epos, in das er die recht unlübeckischen geistigen Erlebnisse einströmen ließ, die seine zwanzig Jahre erschüttert hatten: den musikalischen Pessimismus Schopenhauers, die Verfallspsychologie Nietzsches, und dessen örtlich-stoffliches Teil ihn im Grunde wenig begeisterte. Dieses hatte sich ihm angeboten als das, was er beherrschte, womit er sein ernstes Spiel treiben mochte; es war, wie es in »Dichtung und Wahrheit« heißt, »das Nächstvergangene, das in vermögender Jugendzeit der Genius ihn antrieb, festzuhalten, zu schildern und kühn genug zu günstiger Stunde öffentlich aufzustellen.«
Werde ich Sie langweilen, wenn ich Ihnen ein wenig von der Entstehungsgeschichte des Buches erzähle? Ein paar novellistisch präludierende Versuche waren schon vorangegangen, und die psychologische short story war es, die ich endgültig für mein Genre hielt: ich glaubte nicht, daß ich es je mit einer großen Komposition werde aufnehmen können und wollen. Da geschah es, daß ich in Rom, wo ich damals mit meinem Bruder vorläufig lebte, einen französischen Roman, die »Renée Mauperin« der Brüder Goncourt, las und wieder las, mit einem Entzücken über die Leichtigkeit, Geglücktheit und Präzision dieses in ganz kurzen Kapiteln komponierten Werkes, einer Bewunderung, die produktiv wurde und mich denken ließ, dergleichen müsse doch schließlich auch wohl zu machen sein. Nicht Zola also, wie man vielfach angenommen hat – ich kannte ihn damals gar nicht –, sondern die sehr viel artistischeren Goncourts waren es, die mich in Bewegung setzten, und als weitere Vorbilder boten skandinavische Familienromane sich an, legten sich als Vorbilder darum nahe, weil es ja eine Familiengeschichte, und zwar eine handelsstädtische, der skandinavischen Sphäre schon nahe, war, die mir vorschwebte. Auch dem Umfang nach wurde dann etwas den Büchern Kiellands {42}und Jonas Lies Entsprechendes konzipiert: 250 Seiten, nicht mehr, in 15 Kapiteln, – ich weiß es noch, wie ich sie aufstellte. Und so ging es denn an ein Notizenmachen, ein Entwerfen chronologischer Schemata und genauer Stammbäume, ein Sammeln psychologischer Pointen und gegenständlichen Materials, – ich wußte nicht genug, ich wandte mich mit allerlei geschäftlichen, städtischen, wirtschaftsgeschichtlichen, politischen Fragen nach Lübeck, an einen nun längst verstorbenen Verwandten, einen Vetter meines Vaters, den soldatisch liebenswürdigen Konsul Wilhelm Marty, an den vielleicht einige unter Ihnen sich noch erinnern, und ich vergesse nie, mit welcher Gefälligkeit er, der Lübecker Kaufmann, von dem doch viel Verständnis für meine offenbar brotlosen Pläne wirklich nicht zu verlangen war, in langen Schreibmaschinen-Ausführungen meiner Ignoranz abzuhelfen suchte.
In Rom also schichtete ich langsam Blatt für Blatt die ersten Teile auf, und ein schon auffallend stattliches Manuskript begleitete mich nach München, wo ich zu schreiben fortfuhr. Ja, was war im Begriffe aus den 250 Seiten zu werden! Die Arbeit schwoll mir unter den Händen auf; alles nahm ungeheuer viel mehr Raum (und Zeit) in Anspruch, als ich mir hatte träumen lassen; während ich mich eigentlich nur für die Geschichte des sensitiven Spätlings Hanno und allenfalls für die des Thomas Buddenbrook interessiert hatte, nahm all das, was ich nur als Vorgeschichte behandeln zu können geglaubt hatte, sehr selbständige, sehr eigenberechtigte Gestalt an, und ein wenig fühlte sich meine Sorge über dies Wachstum erinnert an das Ring-Erlebnis Wagners, dem aus der Conception von »Siegfrieds Tod« die leitmotivdurchwobene Tetralogie geworden war.
Es ist etwas höchst Merkwürdiges um diesen Eigenwillen eines Werkes, das werden soll, das ideell eigentlich schon da ist, und bei dessen Verwirklichung den Autor selbst die größten {43}Ueberraschungen treffen. Ein erstes Werk, welche Schule der Erfahrung für den jungen Künstler, – der objektiven und subjektiven Erfahrung! Was das eigentlich sei, das Element des Epischen, ich erfuhr es erst, indem es mich auf seinen Wellen dahintrug. Was ich selber sei, was ich wolle und nicht wolle, nämlich nicht südliche Schönheitsruhmredigkeit, sondern den Norden, Ethik, Musik, Humor; wie ich mich zum Leben verhielte und zum Tode: ich erfuhr das alles, indem ich schrieb – und erfuhr zugleich, daß der Mensch auf keine andere Weise sich kennen lernt als indem er handelt. So wuchs die Achtung vor dem Unternehmen, das so, wie es sich da machte, von mir gar nicht unternommen worden war, eine Achtung freilich mit Einschaltungen tiefer Gleichgültigkeit, gelangweilten Unglaubens. Lektüre mußte die schwanke Kraft stützen: russische namentlich, die geliebte, westöstliche Turgenjews immer wieder, Tolstois moralistisches Gigantenwerk und Gontscharow, den ich in Aalsgaard am Sunde las, wo ich einen Urlaub verbrachte, den ich als Lektor des Verlages Albert Langen in München genommen, und wo der »Tonio Kröger« unbewußt entworfen wurde. Endlich denn, nach einer Arbeitszeit von drei Jahren, längere Unterbrechungen eingerechnet, war der Roman geschlossen: die erste und einzig vorhandene Niederschrift, das ungeschickteste Manuskript, auf liniiertem Geschäftspapier doppelseitig geschrieben, und so schickte ich es an Fischer, ohne viel Hoffnung, ohne viel Verzweiflung: hier denn, ich hatte getan, was ich konnte.
Ich hatte lange zu warten. Dann – ich lag eben als Einjähriger im Münchener Garnisonlazarett, mit Sehnenscheideentzündung, die ich mir beim Parademarsch zugezogen – kam ein Schreiben des Verlages, des Inhalts, er glaube nicht an die Aufnahmebereitschaft der Oeffentlichkeit für ein so umfängliches Werk. Er erkläre sich aber erbötig, das Buch zu übernehmen, {44}wenn ich bereit sei, es um die Hälfte zu kürzen. – Nun, der melancholische Soldat, der da auf dem Rücken lag, hatte weder ein äußeres noch ein inneres Recht, beleidigt zu sein; er war wenig geneigt, viel Wesens von seinem Werk zu machen. Aber seine sachliche Ueberzeugung verbot ihm, auf diesen Vorschlag einzugehen und hätte es ihm verboten, auch wenn er nicht sein bescheidenes Auskommen gehabt und auf den Absatz des unpraktischen Manuskripts wirtschaftlich hätte brennen müssen. Er schrieb dem Verlage mit Bleistift einen langen Brief, worin er ihm auseinandersetzte, daß der große Umfang eine wesentliche Eigenschaft des Buches sei und daß man es verpfusche, wenn man damit nach seinem Willen umgehe. Es gebe Bücher, die nichts seien, wenn sie nicht ausgiebig seien, Kurzweiligkeit habe nichts mit der Länge zu tun usw. Ich glaube der Brief war gut; die sachliche Not machte auch beredt; und jedenfalls hatte er zur Folge, daß Fischer, der jetzt vielleicht erst persönlich in Aktion trat, beschloß, den Roman, wie er war, zu drucken.
Die beiden Bände erschienen, und es sah recht sehr danach aus, als sollte des Verlages und meine eigene geheime Skepsis recht behalten. Wie? hieß es, sollen die dicken Wälzer wieder Mode werden? Ist es nicht die Zeit der Nervosität, der Ungeduld, die Zeit des Kurzen, der keckkünstlerischen Skizze? Vier Generationen Bürgertum, zum Auswachsen. Die Kritik verglich den Roman mit einem im Sande mahlenden Lastwagen. – Freilich, es gab sogleich auch andere Stimmen. Da war ein armer jüdischer Kritiker und Theoretiker, Samuel Lublinski mit Namen – er war krank und ist nun schon lange tot. Der schrieb im »Berliner Tageblatt« mit sonderbarer Bestimmtheit: »Dieses Buch wird wachsen mit der Zeit und noch von Generationen gelesen werden«. Wenn es Leute gab, die ihm glaubten, – der Autor von »Buddenbrooks« gehörte kaum zu ihnen. {45}Es dauerte ein Jahr, bis die ersten tausend Exemplare verkauft waren. Dann beschloß Fischer die wohlfeile einbändige Ausgabe auf Dünndruckpapier, und sie schlug durch. Das Buch wurde vom Erfolg ergriffen; Auflage folgte auf Auflage, und heute ist es wahrhaftig die zweite Generation, die sich mit ihm beschäftigt: Sonderbar zu denken, daß junge Leute ihn in Händen halten, die in der Wiege lagen, noch jüngere Seminaraufsätze darüber schreiben, die nicht auf der Welt waren, als ich ihn zu Papier brachte.
Eine Dame, Münchener Künstlerin, sagte damals zu mir: »Ich habe mich nicht gelangweilt beim Lesen Ihres Buches und habe mich auf jeder Seite gewundert, daß ich mich nicht langweilte«. Ich antwortete ihr: »Wissen Sie, daß Sie mir da ein großes Kompliment gemacht haben?« Wirklich deuteten ihre Worte auf einen Triumph über den Stoff, mit dem sich der junge Autor nicht wenig wußte. Oft genug hatte ich mich selber gelangweilt, und die Virtuosengenugtuung, es dennoch möglich gemacht zu haben, bestimmte im höchsten Grade mein Verhältnis zu dem Werk und seiner Wirkung. Kein Gedanke daran, daß etwas überartistisch und mehr als autobiographisch Verdienstliches darin liegen könnte, ein Bild hanseatischen Lebens aus dem 19. Jahrhundert, Kulturgeschichtliches also, gegeben zu haben. Kein Gedanke, dies Verdienstliche könne etwa darin liegen, daß damit zugleich ein Stück der Seelengeschichte des deutschen Bürgertums überhaupt gegeben war. Und am allerwenigsten ließ ich mir ein Drittes träumen: Daß das Interesse an diesem Buch, sachlich, seelisch, über Deutschland hinausreichen, daß von dieser Geschichte des »Verfalls einer Familie« ausländisches Bürgertum sich berührt, getroffen fühlen, daß es sich darin wieder erkennen könnte; kurz, daß ich, indem ich ein nach Form und Inhalten sehr deutsches Buch gab, zugleich ein {46}überdeutsch-europäisches Buch, ein Stück Seelengeschichte des europäischen Bürgertums überhaupt gegeben haben könnte.
Dies alles erfuhr ich erst viel später, zu einer Zeit, als der Roman als persönliche Leistung mir schon so fern stand, mir so sehr zum Objekt geworden und von meinem Subjekt getrennt war, daß sich dieses mein Ich kaum noch in einer Beziehung des Verdienstes dazu fühlte: Namentlich die letzte Erfahrung, die von der hochgradigen Gültigkeit einer scheinbar spezifisch deutschen Gestaltung für internationale Verhältnisse, machte tiefen Eindruck auf mich. Diese Gültigkeit wurde mir weniger durch die Tatsache demonstriert, daß der Roman nach und nach in die meisten europäischen Sprachen übersetzt wurde (auch die französische Ausgabe ist jetzt beschlossen), nein, sondern ich bekam es mit eigenen Ohren zu hören, auf Reisen, im Gespräch mit Menschen verschiedener Länder. Wie oft, etwa in der Schweiz, in Holland, in Dänemark, habe ich junge Leute ausrufen hören: »Dieser Prozeß der Entbürgerlichung, der biologischen Enttüchtigung durch Differenzierung, durch das Überhandnehmen der Sensibilität, – genau wie bei uns!« Als ich jetzt in Paris war, hatte ich bei einem Abendessen einen bekannten französischen Kritiker und Essayisten zum Nachbarn: Edmond Jaloux. Er erzählte mir, daß er aus Marseille stamme, dieser südfranzösischen Hafen- und Handelsstadt, deren Leben und materielle Kultur er mir als lübeckisch schilderte, mit dem Hinzufügen, er sei erstaunt gewesen, wie sehr meine Erzählung ihn, den Künstler, Schriftsteller gewordenen, den »entarteten« Marseiller, an heimische Verhältnisse und an seine Emanzipation davon gemahnt habe.
Meine geehrten Zuhörer, wenn ich mich zu denen stelle, denen der Gedanke »Europa« am Herzen liegt, wenn ich einem internationalen Nationalismus widerstrebe, der eine Weltlage zu begreifen sich weigert, welche eine neue Solidarität der {47}Völker Europas gebieterisch und jedem verständigen Sinn erkennbar fordert – so mögen wohl solche persönlich verbindenden Erfahrungen dabei im Spiele sein: das Erlebnis europäischer Solidarität, das Erlebnis, daß die Völker Europas nur Abwandlungen und Spielarten einer höheren seelischen Einheit darstellen. Eine solche Einsicht, meine Damen und Herren, ist weit genug entfernt von kulturwidrigem Demokratismus. Man gibt das Persönlichste und ist überrascht, das Nationale getroffen zu haben. Man gibt das Nationalste – und siehe, man hat das Allgemeine und Menschliche getroffen, – mit viel mehr Sicherheit getroffen, als wenn man sich den Internationalismus programmatisch vorgesetzt hätte.
Was ich also mit den »Buddenbrooks« in jungen Jahren gegeben hatte, das hatte ich wie von ungefähr, unbewußt gegeben. Aber ich irrte mich sehr, wenn ich etwa glaubte, ich hätte es zufällig gegeben. Wir wissen heute, was es mit den Kräften des Unbewußten, des Unterbewußten auf sich hat und wie sehr alles Entscheidende aus dieser wesentlichen Sphäre stammt, die die Philosophie »den Willen« nannte, und die vom Intellekt nur notdürftig und nachträglich kontrolliert und erörtert wird. Es kam der Tag und die Stunde, wo mir klar wurde, daß niemals der Apfel weit vom Stamme fällt; daß ich als Künstler viel »echter«, viel mehr ein Apfel vom Baume Lübecks war, als ich geahnt hatte; daß diejenigen, die, beleidigt durch gewisse kritische Schärfen des Buches, einen Abtrünnigen und Verräter, einen Entfremdeten hatten in mir sehen wollen, tatsächlich im Unrecht gewesen waren und daß es sich nicht nur bei diesem Buch, sondern auch bei allen anderen, bei meinem ganzen Künstlertum, meiner ganzen Produktivität, so bedeutend oder unbedeutend sie nun sein mochte, nicht um irgendwelches bohêmisierte und entwurzelte Virtuosentum, sondern um eine Lebensform, um Lübeck als geistige Lebensform handelte.
{48}Künstlertum, meine Damen und Herren, ist etwas Symbolisches. Es ist die Wiederverwirklichung einer ererbten und blutsüberlieferten Existenzform auf anderer Ebene. So schrieb Schopenhauer an Goethe, daß »Treue und Redlichkeit«, das Erbteil seiner kaufmännisch hanseatischen Vorfahren im alten Danzig, die von ihm aus dem Praktischen ins Theoretische und Intellektuelle übertragenen Eigenschaften seien, die das Wesen seiner Leistungen und Erfolge ausmachten. Indem man ein Denker oder Künstler wird, »entartet« man weniger, als die Umwelt, von der man sich emanzipiert, und als man selber glaubt; man hört nicht auf zu sein, was die Väter waren, sondern ist eben dieses in anderer, freierer, vergeistigter, symbolisch darstellender Form nur noch einmal. Dies, wie gesagt, wurde mir klar in schwerer, strenger, bedeutender Zeit, die jeden seine Wurzeln spüren ließ, jeden anhielt, seinen Platz einzunehmen und sich zu bekennen: in der Zeit des Krieges. »Man forscht in den Büchern«, schrieb ich damals, »man forscht in der Not der Zeit nach den fernsten Ursprüngen, den legitimen Grundlagen, den ältesten seelischen Ueberlieferungen des bedrängten Ich, man forscht nach Rechtfertigung. … Wer bin ich, woher komme ich, daß ich bin, wie ich bin, und mich nicht anders machen noch wünschen kann? Ich bin Städter, Bürger, ein Kind und Urenkelkind deutsch-bürgerlicher Kultur. Waren meine Ahnen nicht Nürnberger Handwerker von jenem Schlage, den Deutschland in alle Welt und bis in den fernen Osten entsandte, zum Zeichen, es sei das Land der Städte? Sie saßen als Ratsherren im Mecklenburgischen, sie kamen nach Lübeck, waren »Kaufleute des römischen Reiches«, – und indem ich die Geschichte ihres Hauses, eine zum naturalistischen Roman entwickelte städtische Chronik schrieb, ein Buch, das man wohl auf ein Bord mit den Schriftwerken der bürgerlichen Vorzeit stellen mag, erwies ich mich als viel weniger aus der Art geschlagen, als ich selber mir träumen ließ.«
{49}Das sind Worte aus den »Betrachtungen eines Unpolitischen«, und sie würden in Dingen geistiger Ausprägung nicht gelten, wenn sie nicht vor allem im Persönlich-Menschlichen ihre Geltung hätten. Wie oft im Leben habe ich mit Lächeln festgestellt, mich geradezu dabei ertappt, daß doch eigentlich die Persönlichkeit meines verstorbenen Vaters es sei, die als geheimes Vorbild mein Tun und Lassen bestimme. Vielleicht hört heute der eine oder andere mir zu, der ihn noch gekannt, ihn noch hat leben und wirken sehen, hier in der Stadt, in seinen vielen Aemtern, der sich erinnert an seine Würde und Gescheitheit, seinen Ehrgeiz und Fleiß, seine persönliche und geistige Eleganz, an die Bonhommie, mit der er das platte Volk zu nehmen wußte, das ihm in noch ganz echt patriarchalischer Weise anhing, an seine gesellschaftlichen Gaben und seinen Humor. Er war kein einfacher Mann mehr, nicht robust, sondern nervös und leidensfähig, aber ein Mann der Selbstbeherrschung und des Erfolges, der es früh zu Ansehen und Ehren brachte in der Welt, – dieser seiner Welt, in der er sein schönes Haus errichtete. Wir Brüder, der Aeltere und ich, wissen wohl, was unser Wesen der Mutter und ihrer südlichen »Frohnatur« zu danken hat; aber vom Vater haben auch wir »des Lebens ernstes Führen«, das Ethische, das mit dem Bürgerlichen in so hohem Grade zusammenfällt. Denn das Ethische, im Gegensatz zum bloß Aesthetischen, zur Schönheits- und Genußseligkeit, auch zum Nihilismus und zur Todesvagabondage – das Ethische ist recht eigentlich Lebensbürgerlichkeit, der Sinn für Lebenspflichten, ohne den überhaupt der Trieb zur Leistung, zum produktiven Beitrag an das Leben und an die Entwicklung fehlt; das, was einen Künstler anhält, die Kunst nicht als einen absoluten Dispens vom Menschlichen aufzufassen, ein Haus, eine Familie zu gründen, seinem geistigen Leben, das oft abenteuerlich genug sein mag, eine feste, würdige, ich finde wieder {50}nur das Wort: bürgerliche Grundlage zu geben. Wenn ich in diesem Stile handelte und lebte, so ist gar kein Zweifel, daß das Beispiel meines Vaters bestimmend mitwirkte, und wenn auch äußere Auszeichnungen und Titel für das Schicksal eines Künstlertums wenig bedeuten, so entbehrte meine Amüsiertheit doch nicht der Zustimmung, als man auch mich, jetzt kürzlich, wer hätte es gedacht, zum »Senator« machte, – nämlich der deutschen Akademie in München. Ja, unbeschadet aller Ironie gegen das bürgerlich Offizielle hatte es im väterlich-traditionellen Sinn meine innere Zustimmung, daß mein fünfzigster Geburtstag dort in dem mit Fahnen und Emblemen geschmückten Saale des Alten Rathauses begangen wurde –
Ich sprach da von menschlich-privaten Dingen, von Lübeck als persönlicher Lebensform und -stimmung und -haltung. Ich möchte hinzufügen, es ist mein Ehrgeiz, nachzuweisen, daß Lübeck als Stadt, als Stadtbild und Stadtcharakter, als Landschaft, Sprache, Architektur durchaus nicht nur in »Buddenbrooks«, deren unverleugneten Hintergrund es bildet, seine Rolle spielt, sondern daß es von Anfang bis zu Ende in meiner ganzen Schriftstellerei zu finden ist, sie entscheidend bestimmt und beherrscht.
Als Landschaft? – Es ist oft kritisch bemerkt und mir angekreidet worden, daß die Landschaftsschilderung nicht meine starke Seite ist, daß sie zu kurz kommt in meiner Produktion, und ich werde noch allgemeiner zu sagen haben, welche Bewandtnis es damit hat. Es ist eine urbane, eine städtische Bewandtnis, um es für jetzt mit einem Worte vorwegzunehmen, und man könnte erklären, die Landschaft einer Stadt, das sei ihre Architektur, die Lübecker Gotik also in unserem Fall, von deren Einwirkung auf meine Schreiberei, von deren Spiegelung darin zu sprechen ich denn auch vorhabe. Aber nicht so möchte ich hinweggehen über das lübeckisch Landschaftliche, {51}möchte nicht resignieren und wahrhaben, daß es nicht anders vorkomme, mitspreche und fühlbar werde in dem, was ich zu gestalten versuchte. Da ist das Meer, die Ostsee, deren der Knabe zuerst in Travemünde ansichtig wurde, dem Travemünde von vor vierzig Jahren mit dem biedermeierlichen alten Kurhaus, den Schweizerhäusern und dem Musiktempel, in dem der langhaarig-zigeunerhafte kleine Kapellmeister Heß mit seiner Mannschaft konzertierte, und auf dessen Stufen, im sommerlichen Duft des Buchsbaums, ich kauerte, – Musik, die erste Orchestermusik, wie immer sie nun beschaffen sein mochte, unersättlich in meine Seele ziehend. An diesem Ort, in Travemünde, dem Ferienparadies, wo ich die unzweifelhaft glücklichsten Tage meines Lebens verbracht habe, Tage und Wochen, deren tiefe Befriedung und Wunschlosigkeit durch nichts Späteres in einem Leben, das ich doch heute nicht mehr arm nennen kann, zu übertreffen und in Vergessenheit zu bringen war, – an diesem Ort gingen das Meer und die Musik in meinem Herzen eine ideelle, eine Gefühlsverbindung für immer ein, und es ist etwas geworden aus dieser Gefühls- und Ideenverbindung –, nämlich Erzählung, epische Prosa: – Epik, das war mir immer ein Begriff, der eng verbunden war mit dem des Meeres und der Musik, sich gewissermaßen aus ihnen zusammensetzte, und wie C.F. Meyer von seiner Dichtung sagen konnte, allüberall darin sei Firnelicht, das große stille Leuchten, so möchte ich meinen, daß das Meer, sein Rhythmus, seine musikalische Transcendenz auf irgendeine Weise überall in meinen Büchern gegenwärtig ist, auch dann, wenn nicht, was oft genug der Fall, ausdrücklich davon die Rede ist. Ja, ich will hoffen, daß ich ihm einigen Dank abgestattet habe, dem Meer meiner Kindheit, der Lübecker Bucht. Seine Palette war es am Ende, derer ich mich bediente, und wenn man meine Farben matt fand, glutlos, enthaltsam, nun, so mögen gewisse {52}Durchblicke zwischen silbrigen Buchenstämmen in eine Pastellblässe von Meer und Himmel daran schuld sein, auf denen mein Auge ruhte, als ich ein Kind und glücklich war.
Aber das städtische Lübeck hat ja noch einen anderen Naturrahmen als den der Ostsee, eine Landschaft im eigentlicheren Sinn des Wortes und zwar eine, die sich an Schönheit mit dem allermeisten, wenn es nach mir geht, mit all und jedem messen kann, was Deutschland und nicht nur dieses zu bieten hat. Da ist die Holsteinische Schweiz, die Gegend von Eutin, von Mölln, der Ukleisee – es wäre unnatürlich, wenn Bilder, wie diese, spurlos an dem Gemüt des Lübecker Kindes sollten vorübergegangen sein, – und so wenig ist dies wirklich der Fall, daß tatsächlich kein späterer Eindruck, kein überblauer Wonnesüden etwa, der frischen und reinen Idyllik dieser Szenerien in meiner Seele hat Abbruch tun können. – Aber wo sind sie in meinen Büchern? Ich habe sie nicht beschrieben, sie sind nicht da!
Doch, meine geehrten Zuhörer. Sie müssen da sein, und sie sind da, irgendwie da, wenn auch nicht direkt, als Schilderung und Beschreibung. Es gibt verschiedene Arten des Daseins: die atmosphärische zum Beispiel, statt der körperlichen, die akustische, statt der visuellen. Man hat die Menschen und besonders die Künstler eingeteilt in Augenmenschen und in Ohrenmenschen, in solche, deren Welterlebnis vorzugsweise durch das Auge geht, und solche die wesentlich mit dem Ohr erleben. Ich möchte das erstere die Empfänglichkeit des Südens, das zweite die Sensibilität des Nordens nennen. Gibt es denn nun ein Empfangen der Landschaft durch das Ohr, musikalisch rezipierte Landschaft, gehörte und wieder hörbar gemachte Landschaft sozusagen? Doch, es gibt dergleichen, und woran ich nun denke und schon dachte – ich nannte es gleich mit Architektur und Landschaft zusammen, wie es immer mit {53}ihnen zusammen genannt werden muß – das ist die Sprache. Ja, wenn ich meinte, die Landschaft einer Stadt, das sei ihre Architektur, so scheint mir nun fast, die Sprache sei es, die sie spricht, ihre Sprache als Stimmung, Stimmklang, Tonfall, Dialekt, als Heimatlaut, Musik der Heimat, und wer sie hörbar mache, der beschwöre auch den Geist der Landschaft, mit der sie so innig verbunden, deren akustische Erscheinungsform sie ist. Wir stellten früher fest, daß Künstlertum die Wiederverwirklichung einer ererbten und blutsüberlieferten Existenzform auf anderer Ebene sei. Das, scheint mir, trifft ganz besonders und vor allem für die Sprache zu. Der Stil eines Schriftstellers ist letzten Endes und bei genauem Hinhorchen die Sublimierung des Dialektes seiner Väter. Wenn man den meinen als kühl, unpathetisch, verhalten charakterisiert hat, wenn man lobend oder tadelnd geurteilt hat, ihm fehle die große Geste, die Leidenschaft, und er sei, im Großen, Ganzen wie in der Einzelheit, das Instrument eines eher langsamen, spöttischen und gewissenhaften als genialisch stürmenden Geistes, – nun, so mache ich mir kein Hehl daraus, daß es niederdeutsch-hanseatische, daß es lübeckische Sprachlandschaft ist, die man so kennzeichnet, und ich gestehe, daß ich mich literarisch immer am wohlsten gefühlt habe, wenn ich einen Dialog führen konnte, dessen heimlichster Silbenfall durch einen Unterton von humoristischem Platt bestimmt war.
Lübeck als Stadtbild – wir sprachen im engeren, architektonischen Sinne noch nicht davon. Damit ich aber in der besonderen und fast mysteriösen Beziehung davon sprechen kann, die ich im Sinne habe, müssen Sie mir erlauben, ein wenig auszuholen.
Wenn man von Schicksals wegen ein Dichter, ein Schriftsteller ist, meine Damen und Herren, so hält man das anfangs – namentlich falls man in Lübeck aufwächst – für etwas ganz {54}Eigentümliches und Unverbundenes; man ist weit entfernt zu denken, daß man sich damit einer Gesellschafts- und Berufsklasse einfügt, in der es also auch die Erscheinungen des Berufslebens, Konkurrenz, Wettstreit, Eifersucht, Medisance und Bosheit gibt. Davon gibt es nun im literarischen Berufsleben, in das einen der produktive Trieb überraschender Weise stellt, vielleicht noch mehr, als in anderen Berufen, und wenn einer in dem ungesuchten Wettstreit unwillkürlich und in seiner Einsamkeit gut abschneidet, so braucht er für den Haß und den Spott nicht zu sorgen. Will nun einer an mir sein Mütchen kühlen und mir eins auswischen, so kann ich mit Sicherheit darauf rechnen, daß meine Lübecker Herkunft und der Lübecker Marzipan aufs Tapet kommt: Fällt einem garnichts ein, so fällt ihm doch im Zusammenhang mit mir der komische Marzipan ein, und ich werde als Lübecker Marzipan-Bäcker hingestellt, was man dann literarische Satire nennt. Sie tut mir aber garnicht weh; denn was Lübeck betrifft, so muß man irgendwoher ja sein, und ich sehe nicht ein, weshalb Lübeck eine lächerlichere Herkunft sein sollte, als eine andere, – ich rechne es sogar zu den besseren Herkünften. Durch den Marzipan aber kann ich mich nun schon garnicht gekränkt fühlen, denn erstens ist er eine sehr wohlschmeckende Substanz und zweitens eine nichts weniger als triviale, sondern geradezu merkwürdige und, wie ich sagte, geheimnisvolle. Marci-pan, das heißt ja offenbar, oder wenigstens nach meiner Theorie, panis Marci, Brot des Marcus, des heiligen Marcus, der der Schutzheilige von Venedig ist. Und sieht man sich diese Süßigkeit genauer an, diese Mischung aus Mandeln und Rosenwasser und Zucker, so drängt sich die Vermutung auf, daß da der Orient im Spiele ist, daß man ein Haremskonfekt vor sich hat, und daß wahrscheinlich das Rezept zu dieser üppigen Magenbelastung aus dem Morgenlande über Venedig nach {55}Lübeck an irgend einen alten Herrn Niederegger gekommen ist. Venedig und Lübeck: Einige von Ihnen entsinnen sich, daß ich eine Novelle geschrieben habe: »Der Tod in Venedig«, worin ich mich in der verführerisch totverbundenen Stadt, der romantischen Stadt par excellence einigermaßen zu Hause zeige, – und ich gebrauche das Wort »zu Hause« in seinem ganz vollen, eigentlichen Sinn: im Sinn nämlich eines anderen Gedichtes, eines idyllischen, das Hexameter halb scherzhaft andeutet und das davon spricht, wie die Vaterstadt mir zwiefach stehe: einmal im Ostsee-Hafen, gotisch und grau, doch als Wunder des Aufgangs noch einmal, entrückt, die Spitzbögen maurisch verzaubert, in der Lagune, – vertrautestes Kindheitserbe und dennoch
Fabelfremd, ein ausschweifender Traum. O Erschrecken des Jünglings,
Als ihn die ernste Gondel zuerst, der ruhend hinschwebte,
Trug den großen Kanal entlang, vorbei der Paläste
Unvergleichlicher Flucht, als zum ersten Male sein scheuer
Fuß betrat jenes Prachthofs Fliesen, welchen der Traumbau
Abschließt, golden bunt, der byzantinische Tempel,
Reich an sich spitzenden Bögen und Pfeilern und Türmchen und Kuppeln,
Unter dem seidenen Gezelt von meerwinddurchatmeter Bläue!
Fand er nicht, heimischen Wasserruch witternd, die Rathausarkaden,
Wo sie Börse hielten, die wichtigen Bürger der Freistadt,
Wieder am Dogenpalast, mit seiner gedrungenen Bogen-
Halle, worüber die leichtere schwebet in zierlichen Lauben?
Nein, nicht leugne man mir geheimnisvolle Beziehung
Zwischen den Handelshäfen, den adligen Stadtrepubliken,
{56}Zwischen der Heimat nicht und dem Märchen, dem östlichen Traume!
- Sie sehen, meine Herrschaften, hier tritt einmal das Bild Lübecks, zusammenfließend mit dem der südlichen Schwester, unverhüllt aus dem Unbewußten hervor, und es zeigt sich, daß jene Witzbolde nicht so unrecht haben, wie sie selber glauben, daß der »Tod in Venedig« wirklich »Marcipan« ist, wenn auch auf eine tiefere Weise, als sie meinten, und daß eine gewisse Lebensform nicht nur die in Lübeck lokalisierten »Buddenbrooks« gezeitigt hat. Ich will nicht vom »Tonio Kröger« sprechen, der gleichfalls zum Teile Lübeck direkt zum Hintergrunde hat, und dessen ganze Thematik sich aus dem Gegensatze von nordischer Gefühlsheimat und südlicher Kunstsphäre heraus entwickelt. Aber ich frage mich, ob ein Schriftsteller, der so sehr das Willkürliche und innerlich Unzugehörige zu meiden gewohnt, so sehr an das – im weiteren und übertragenen Sinne – Autobiographische gebunden ist, wie der, der vor Ihnen spricht, sich ohne persönlichen Fug an die patrizisch-stadtherrschaftliche Existenzform des Lorenzo Magnifico herangetraut hätte: in den Fiorenza-Dialogen, die uns an dieser Stelle kürzlich in einer so liebevollen Aufführung vor Augen gestellt wurden, einer Aufführung, für die man bei aller Notwendigkeit zu kürzen zu meiner heiteren Genugtuung ein unnötiges Detail hatte stehen lassen: das Kloster zu Lübeck, aus dem der Florentiner Mäzen und Tyrann eine kostbare Pliniusausgabe käuflich bezogen hat. –
Wenn Sie mir erlauben, meine Damen und Herren, noch zwei Worte an ein weiteres Buch von mir in diesem Zusammenhang zu wenden, an das letzte, den »Zauberberg«, so werden Sie es mir erleichtern, ein paar Gedanken zu entwickeln, {57}die den Schluß meines kleinen Gespräches bilden sollen. Der Held, wenn man so sagen kann, dieser aus der Enge heraus furchtbar weitläufigen Geschichte eines Bergverzauberten, Hans Castorp also, ist ein simpler junger Mann und ausdrücklich ein übers andere Mal als solcher gekennzeichnet. Aber bei aller Simplicität hat er es hinter den Ohren, und ich möchte sagen: das, was er hinter den Ohren hat, ist sein Hanseatentum – denn zur Abwechselung und ausredeweise ist er aus Hamburg – sein Hanseatentum, sage ich, das sich nur nicht mehr nach Art seiner Urväter im höheren Seeräubertum, sondern anders, sondern stiller und geistiger bewährt: in einer Lust am Abenteuer im Seelischen und Gedanklichen, die den schlichten Jungen ins Kosmische und Metaphysische trägt und ihn wahrhaftig zum Helden einer Geschichte macht, welche auf wunderliche, ironische und fast parodistische Weise den alten deutschen Wilhelmmeisterlichen Bildungsroman, dieses Produkt unserer großen bürgerlichen Epoche, zu erneuern unternimmt. Einmal, in einem gefährlichen Kapitel, nimmt der naive junge Abenteurer es sogar mit den Elementen, mit der Natur auf; und ich komme darauf, weil sich gerade hier so recht deutlich zeigt, wes Geistes er ist, – er und der Verfasser. Nichts ist für unsere Lebensform charakteristischer, als unser Verhältnis zur Natur, genauer, da ja auch der Mensch Natur ist, zur außermenschlichen Natur. Es wurde schon eingeräumt, daß diese, als Landschaftsschilderung, Erdgeruch, als Feld und Flur und Wald nicht gar reichlich vorkommt in den Büchern Ihres Landsmannes: sie spielen unter Menschen und handeln vom Menschlichen, auf dieses ist fast alles Interesse gesammelt, alle Blickschärfe gerichtet, das Landschaftliche tritt zurück, und wo es einmal hervortritt, da erscheint es in seinen überwältigendsten und elementarsten Formen, als unendliche Meeresweite und als die Ungeheuerlichkeit des verschneiten Hochgebirges – wie {58}denn Hans Castorp vom Meere stammt und seinen Roman im Hochgebirge erlebt – in Formen also, zu denen bei aller Erschütterung und Ehrfurcht, die sie hervorrufen, eine gewisse Verhältnislosigkeit des staunenden Menschenkindes von vornherein gegeben ist, welche wohl zur Tiefe des Erlebnisses, aber nicht zur Intimität, zur Vertraulichkeit verpflichtet, denn diese ist fürchterlich ausgeschlossen. Das Meer ist keine Landschaft, es ist das Erlebnis der Ewigkeit, des Nichts und des Todes, ein metaphysischer Traum; und mit den luftverdünnten Regionen des ewigen Schnees steht es sehr ähnlich. Meer und Hochgebirge sind nicht ländlich, sie sind elementar im Sinne letzter und wüster, außermenschlicher Großartigkeit, und es sieht fast aus, als ob der civile, der städtische, der urbane, der bürgerliche Künstler, wenn es Natur gilt, geneigt wäre, das Ländlich-Landschaftliche zu überspringen und direkt das Elementare zu suchen, weil diesem gegenüber sein Verhältnis zur Natur sich mit vollem menschlichen Recht als das bekennen und offenbaren kann, was es ist: als Furcht, als Fremdheit, als unzukömmliches und wildes Abenteuer. Sehen Sie den kleinen Hans Castorp an, wie er in seinen civilen Breeches und auf seinen Luxus-Ski hineinschlittert in die Urstille, das Hochbedrohliche und Nichtgeheuere, das nicht einmal Feindselige, sondern erhaben und verhältnislos Gleichgültige! Er nimmt es auf damit, wie er es mit den Geistesproblemen naiv aufnimmt, zu denen sein Schicksal ihn emportreibt, aber was ist in seinem Herzen? Nicht »Natursinn«, der irgendwie Zugehörigkeit bedeutete. Nein, Furcht, Ehrfurcht meinetwegen, religiöse Scheu, physisch-metaphysisches Grauen – und noch etwas mehr: Spott, wirkliche Ironie gegenüber dem übergewaltig Dummen, ein mokantes Achselzucken angesichts gigantischer Mächte, die ihn in ihrer Blindheit zwar physisch vernichten können, denen er aber noch im Tode menschlichen Trotz bieten würde. Wer {59}davon erzählt, in diesem Geiste erzählt, meine Damen und Herren, ist ein Erzähler von städtischer, von bürgerlicher, von – im allgemeinsten Sinn – lübeckischer Lebensform.
Es ist mir mit dem »Zauberberg« nicht anders ergangen, als mit dem ersten Roman, mit »Buddenbrooks«. Wie damals war die Conception bescheiden. Was ich plante, war eine groteske Geschichte, worin die Fascination durch den Tod, die das Motiv der venezianischen Novelle gewesen war, ins Komische gezogen werden sollte: etwas wie ein Satyrspiel also zum »Tod in Venedig«. Dann ging es wie schon einmal; das Buch schwoll mir unter den Händen, wurde zweibändig, wie jenes; es hielt Winterschlaf gleichsam im Kriege, kam wieder in Fluß, zeigte sich aufnahmefähig wie ein Schwamm, schoß zusammen, wie ein Krystall, aus allen Erlebnissen der Zeit und ist tatsächlich zu dem literarischen Gegenstück von »Buddenbrooks« geworden, zu einer Wiederholung dieses Buches auf anderer Lebensstufe, die der Verfasser mit seiner Nation gemeinsam hat. Inwiefern aber Gegenstück und Wiederholung? Insofern als auch dieses Buch, diese groteske und zum Teil recht schlimme, recht bedenkliche Geschichte, in der eine junge Seele sich gefährlich tief über geistige und sittliche Abgründe neigt, ein bürgerliches Buch ist, ein Ausdruck bürgerlicher, symbolisch gesprochen: lübeckischer Lebensform. Nicht, weil es einen jungen Hanseaten zum Helden hat, – das liegt außen und obenauf, und ich erwähnte es nur im Vorübergehen. Nein, aber welche Idee ist es, die dem »Sorgenkind des Lebens«, dem zwischen die pädagogischen Extreme gestellten und ins tödlich Extreme hinaufverschlagenen jungen Abenteurer in seinem Frosttraume aufgeht, und die er so glücklich mit der Seele ergreift, weil sie ihm als die Idee des Lebens selbst und der Menschlichkeit erscheint? Es ist die Idee der Mitte. Das ist aber eine deutsche Idee. Das ist die deutsche Idee, denn ist nicht deutsches Wesen {60}die Mitte, das Mittlere und Vermittelnde und der Deutsche der mittlere Mensch im großen Stile? Ja, wer Deutschtum sagt, der sagt Mitte; wer aber Mitte sagt, der sagt Bürgerlichkeit, und er sagt damit, wir wollen das aufstellen und behaupten, etwas genau so Unsterbliches, wie wenn er Deutschtum sagte.
Diejenigen, die das Ohr am Herzen der Zeit haben, wissen heute Epochales zu melden. Mit der bürgerlichen Lebensform, melden sie, sei es am Ende. Sie sei ausgeleert, ausgelebt, todgeweiht, verurteilt und bestimmt, von einer neuen, im Osten heraufgestiegenen Welt mit Stumpf und Stiel verschlungen zu werden. Ist etwas Wahres daran? O, manches! Ueber Europa geht heute, wir fühlen und erfahren es alle, eine gewaltige Welle der Veränderung hin, eben das, was man die »Weltrevolution« nennt, eine grundstürzende, mit allen Mitteln, moralischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen, technischen, künstlerischen Mitteln betriebene Umwälzung unseres gesamten Lebensbildes, fortschreitend mit solcher Geschwindigkeit, daß unsere Kinder, vor dem Kriege oder nach ihm geboren, tatsächlich schon in einer neuen Welt leben, die von unserer ursprünglichen wenig mehr weiß. Die Weltrevolution ist eine Tatsache. Sie leugnen hieße das Leben und die Entwicklung leugnen; sich konservativ gegen sie zu verstocken, hieße sich selber ausschließen vom Leben und der Entwicklung. Aber ein anderes ist es die Weltrevolution anerkennen und ein anderes zu meinen, die Lebensform deutscher Bürgerlichkeit sei durch sie im Ernste gerichtet und vernichtet. Viel zu eng ist diese Lebensform verbunden mit der Idee der Menschlichkeit, der Humanität und aller menschlichen Bildung selbst, um in irgend einer Menschenwelt je fremd und entbehrlich sein zu können, und eine irreführende Uebertonung von Wirtschaftlich-Klassenmäßigem ist hier im Spiel, eine Verwechselung bourgeoiser Klassenmitte mit {61}deutsch-bürgerlicher Geistes- und Weltmitte liegt dem Irrtum zu Grunde.
Wir reden von einer geistigen Lebensform, meine geehrten Zuhörer, und das bedeutet, daß wir, indem wir »Bürgerlichkeit« sagen, nichts Klasseninteressenmäßiges, nichts Antisozialistisches etwa im Sinne haben. Der Geist ist etwas sehr Reines, und wer eine Lebensform im Geistigen hält, der hält sie rein, der schützt sie vor jeder Entartung und Verhärtung, die sie in der Wirklichkeit erleiden mag. Wenn wir »deutsch« sagen und »bürgerlich«, so üben wir uns nicht im Partei-Jargon und reden nicht dem internationalen kapitalistischen Bourgeois zum Munde. Hier werden die Deutschen nicht eingeteilt in Bürger und Sozialisten. Hier heißt Deutschtum selbst Bürgerlichkeit, Bürgerlichkeit größten Stils, Weltbürgerlichkeit, Weltmitte, Weltgewissen, Weltbesonnenheit, welche sich nicht hinreißen läßt und die Idee der Humanität, der Menschlichkeit, des Menschen und seiner Bildung nach rechts und links gegen alle Extremismen kritisch behauptet. Der Deutsche, zwischen die Extreme der Welt gestellt, kann selber kein Extremist sein; das ist eine seelische Gegebenheit, an der kein Radikalismus etwas ändert. »Nicht dem Deutschen«, heißt es in Goethes Lied, »nicht dem Deutschen ziemt es, die wilde Bewegung fortzuleiten und auch zu schwanken hierhin und dorthin.« Das ist weltbürgerlich und weltgewissenhaft gesprochen, ein Wort standhafter Humanität. Aber wie thöricht wäre es, eine solche Standhaftigkeit, die die Freiheit selber ist, zu verwechseln mit Mangel an Freiheit, mit kümmerlicher Gebundenheit, mit der Unfähigkeit zur Kühnheit, zum Wagemut, zur sprengenden Tat! Wo sind die großen Befreiungstaten des umwälzenden Geistes denn hergekommen, »und wenn sie nicht vom Bürger gewesen wären«? Der Wille und die Berufung zur höchsten Entbürgerlichung, zum {62}höchstgefährlichen, ja vernichtenden Abenteuer des versuchenden Gedankens: das ist der Freibrief, den kein Kaiser dem bürgerlichen Menschen, den der Geist selber ihm ausgestellt hat. Noch jener Sohn und Enkel protestantischer Pfarrhäuser, in dem die Romantik des neunzehnten Jahrhunderts sich selber überwand, und mit dessen Opfertode am Kreuz des Gedankens unsäglich Neues sich anbahnte, noch dieser Friedrich Nietzsche – wo lagen denn seine Wurzeln, als im Erdreich bürgerlicher Humanität? Und um in bescheidenere Sphäre zurückzukehren, zu Lübeck als Lebensform –, nun, so sprach ja heute vor Ihnen ein bürgerlicher Erzähler, der eigentlich sein Leben lang nur eine Geschichte erzählt: die Geschichte der Entbürgerlichung – aber nicht zum Bourgeois oder auch zum Marxisten, sondern zum Künstler, zur Ironie und Freiheit ausflug- und aufflugbereiter Kunst.
Ein bürgerliches Menschentum, das sich im Ueberklassenmäßig-Künstlerischen ironisch bewährt, ist unfähig der Renitenz gegen das sich verjüngende Leben. Aber ebenso wenig ist es fähig, aus Feigheit und Anschlußangst an das Neue seine Wurzeln und Herkunft, seine tausendjährige Ueberlieferung, die bürgerliche Heimat zu verleugnen. Pietas gravissimum et sanctissimum nomen. Wir feiern ein Heimatfest, ein Fest städtisch-bürgerlichen Gedenkens. Da sind auch die weitgewanderten Künstler zur Stelle. Wie alles ist in der Welt entzweit, bergen sie sich in den Mauern der siebengetürmten Väterstadt, um unter ihren Mitbürgern gute Zeit zu finden.
{63}[GRUSSWORT ZUM REPUBLIKANISCHEN TAG AM 6. JUNI 1926]
Man überschätzt mich stark, wenn man mich für einen Politiker oder Parteimann hält. Es mag cynisch klingen, aber ich bin nur ehrlich, wenn ich erkläre, daß ich gar keine politischen Ideale besitze und weit davon entfernt bin, an eine allein selig machende oder überhaupt selig machende politische Form – z.B. die Republik – zu glauben. Daß die demokratische Republik heute für unser Deutschland praktisch die einzig mögliche Form ist, erscheint mir als eine Selbstverständlichkeit, durch deren Anerkennung ich nicht weiter in meiner Selbstachtung steige; wie denn heute auch keinerlei geistiges Verdienst mehr verbunden ist mit der Einsicht in die Notwendigkeit, daß Europa wirtschaftlich und sehr weitgehend auch politisch eins werde. Wer es weiß, braucht nicht stolz darauf zu sein, denn die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Wer es nicht wissen will, begibt sich selbst jedes Anteils an der Gestaltung der Zukunft, und die Entwicklung geht über ihn hinweg.
Verzeihen Sie die Trockenheit meines Tones, aber ich habe das Gefühl, daß es Sache des Schriftstellers heute kaum noch ist, über diese Dinge viele Worte zu verlieren. Doch ich weiß wohl, wie hoch man es dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold anrechnen muß, daß es die Massen lehrt, mit einem gesunden und natürlichen Nationalgefühl die Einsicht in gewisse klare Welt-Notwendigkeiten zu verbinden. Nehmen Sie in diesem Sinne zu Ihrem Fest am 6. Juni meine herzlichen Wünsche.
{64}[ERLEBNISSE, DIE ZU WERKEN WURDEN]
… daß mir der Begriff der Erfindung künstlerisch niemals sehr hoch gestanden hat und daß ich die Deutung des Erlebnisses immer für die eigentliche produktive Leistung gehalten habe. Ich darf oder muß von mir sagen, daß ich niemals etwas erfunden habe. Szenen und Gestalten meiner Bücher, von denen man glauben sollte, daß sie durchaus um der Komposition willen erfunden sein müßten, weil sie so auffallend gut hineinpassen, sind von mir einfach aus der Wirklichkeit übernommen. So ist z.B. die offenbar symbolische Verhaftungsszene im »Tonio Kröger« und so sind sämtliche Erscheinungen des »Tod in Venedig« genau der Reisewirklichkeit nachgeschrieben. Goethe hat erklärt, daß ihm das Leben immer genialer erschienen sei, als das poetische Genie, und in den »Meistersingern« heißt es: All Dichtkunst und Poeterei ist nichts als Wahrtraumdeuterei.
{65}[GEGEN DAS SCHMUTZ- UND SCHUNDGESETZ I]
Es ist auffällig, daß gerade jetzt unter der Republik sich die Proteste gegen die Angriffe auf die Geistesfreiheit mehren. Das liegt aber nicht an der Republik, sondern an der allgemeinen Atmosphäre der geistigen und seelischen Zustände, in die die Republik hineingestellt wurde. Charakteristisch für diese Atmosphäre ist die unter dem Namen Fascismus weitverbreitete Zusammenfassung von Altem und Aeltestem mit scheinbar Neuem und Jugendlichem, um relative Begriffe wie Vaterland, Klasse, Macht zu absoluten zu machen. Wir müssen dem gegenübertreten mit einer geistigen Einstellung, bedingt durch das Grundgefühl einer standhaften Humanität. Mir scheint, daß wir uns auf den Liberalismus zurückbesinnen müssen. Man mag den Liberalismus als politische Partei ablehnen, als Gesinnung und geistige Grundlage ist er unentbehrlich. Aus diesem Grundgefühl des Liberalismus und der standhaften Humanität aber protestieren wir gegen diesen Gesetzentwurf als Versuch einer Knebelung des freien deutschen Geistes, als welchen mein Bruder Heinrich das Gesetz bezeichnete.
{66}VORWORT [ZU FRANS MASEREELS ›MEIN STUNDENBUCH‹]
Zuerst übersetze ich, so gut es geht, die beiden Anführungen aus Dichterschriften, die Masereel seinem »Livre d’Heures«, seinem »Stundenbuch«, als Wahl- und Leitsprüche voranstellt. Es könnte sein, daß nicht jeder, der dies Bilderbuch zur Hand nimmt – und mit Recht zur Hand nimmt! – seinem »Bildungsgange« nach in der Lage ist, sie zu lesen, denn man braucht nicht polyglott zu sein wie ein Riviera-Kellner oder wie ein Pensionsbackfisch aus dem 19. Jahrhundert, um befähigt und berufen zu sein, das Werk dieses großen Künstlers und besonders dies vorliegende Werk zu genießen und zu lieben. Man kann zum Beispiel ein Arbeiter sein oder ein junger Chauffeur oder eine kleine Telephonbeamtin und nicht sprachenkundig, dabei aber aufgeschlossen und bedürftig genug, in hinlänglicher Fühlung mit den Bewegungen der europäischen Geistesdemokratie, um den Namen Masereel schon gehört, gelesen zu haben und neugierig zu sein, welche Bewandtnis es mit ihm hat, während der Herr Brotgeber und Vorgesetzte auf seinem Bildungsgange soweit nicht gelangt ist und auch gar nicht gelangen will, da er so etwas wie »Masereel« unglücklicherweise für Bolschewismus hält. Diese flämisch-europäische Kunst ist so voraussetzungslos menschlich, sie rechnet so wenig mit einem »Bildungsgange«, der nicht rein innerlich und etwa mit Hilfe der demokratisch-offenen und unprivilegierten Bildungsmittel der Zeit vonstatten gegangen wäre, daß man gut tut, auch noch eine solche letzte Voraussetzung, wie sie in der Fremdsprachigkeit von Leitworten liegt, aus dem Wege zu räumen. Denn wiewohl es sich um ein Geistesprodukt von solcher Voraussetzungslosigkeit handelt, daß man, um es {67}aufzunehmen, nicht einmal lesen oder schreiben zu können brauchte; um einen Roman in Bildern, um einen Film, welcher, die Motti ausgenommen, völlig auf das Wort, die »Titel«, die Legenden verzichtet und sich rein nur an die Anschauung wendet, so ist es entschieden von Vorteil, wenn man diese vom Künstler zur Verdeutlichung seiner Absichten entliehenen und übrigens ganz einfachen Dichteräußerungen versteht: man ist damit sozusagen gleich besser »im Bilde«.