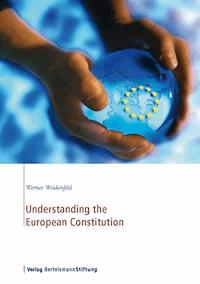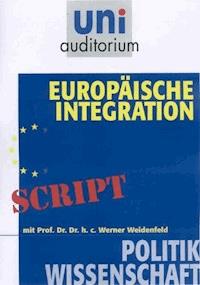18,99 €
Mehr erfahren.
Europa von A bis Z ist Europa zum Nachschlagen: In über 70 Sachbeiträgen erklären renommierte Europaexperten wissenschaftlich fundiert und zugleich verständlich alle wichtigen Themen und Begriffe aus Politik, Wirtschaft und Geschichte der europäischen Einigung. Es wendet sich an alle Europa-Interessierten, die sich gezielt und zuverlässig über den neuesten Stand in europapolitischen Fragen informieren wollen. Die überarbeitete Neuauflage bietet: einen umfangreichen Lexikonteil zur europäischen Einigung Überblicksdarstellungen zu Arbeit und Funktionsweise der EU-Organe eine historische Einführung und eine Chronologie Hinweise auf Vertragsgrundlagen, weiterführende Literatur sowie auf Informationen im Internet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Europa von A bis Z
Taschenbuch der europäischen Integration
Herausgegeben von Werner Weidenfeld und Wolfgang Wessels
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8452-5974-1
13. Auflage 2014
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2014. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Einleitung
Zur Handhabung des Taschenbuchs
Konzepte und Wege der europäischen Einigung
Organe und Einrichtungen der Europäischen Union
Verfahren und Organisation der Europäischen Union
Politikbereiche der Europäischen Union
Wirtschaft und Währung
Sektorpolitiken
Soziales und Kultur
Justiz und Inneres
Erweiterung, Außenbeziehungen, Sicherheit
Weitere Organisationen
Zur Entstehung des Taschenbuchs
Europäische Einigung im historischen Überblick
1 Ausgangslage: Motive und Interessen nach dem Zweiten Weltkrieg
2 Gründungsmoment und Entwicklungsgeschichte
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
Europäische Verteidigungsgemeinschaft und Europäische Politische Gemeinschaft
Die Römischen Verträge
Integrationspolitische Erfolge, Krisen und Reformversuche in den 1960er und 1970er Jahren
Dialektik von Krise und Reform: Der Problemkatalog zu Beginn der 1980er Jahre und der Weg zur Einheitlichen Europäischen Akte
3 Das Ende der Spaltung: Reformmarathon und die größte Erweiterung in der Geschichte der EU
Die Begründung der „Europäischen Union“ mit dem Vertrag von Maastricht
Der Vertrag von Amsterdam: ungenutzte Chance zur Kurskorrektur
Der Versuch von Nizza
„Europa XXL“: Erweiterungsvorbereitungen und die Entgrenzung Europas
4 Der Verfassungsprozess: das erste Großprojekt der erweiterten EU
Innovatives Reformgremium: der Europäische Konvent
Die Referenden in Frankreich und den Niederlanden: Jähes Ende des Verfassungsprojekts
5 Vom Verfassungsvertrag zum Vertrag von Lissabon
Die Reflexionsphase: Suche nach möglichen Auswegen aus der Verfassungskrise
Führungsimpuls unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft
6 Die Wirtschafts- und Finanzkrise
Die Euro-Rettungsschirme: Von der EFSF zum ESM
Intensivere Koordinierung der Wirtschaftspolitik
Auf dem Weg zur Fiskalunion
7 Die Baustelle Europa
Afrikapolitik
Inhalte und Ziele
Hoffnung auf regionale Initiativen und nachlassende Dynamik
Agenturen
Exekutivagenturen
Dezentrale Agenturen
Agrarpolitik
Markt- und Preispolitik bis 1999
Agrarstrukturpolitik bis 1999
Agenda 2000
Halbzeitbewertung der Agenda 2000 im Jahr 2003 und weitere Marktordnungsreformen
„Gesundheitscheck“ der GAP im Jahr 2008
Das Abkommen über Landwirtschaft der Uruguay-Runde des GATT und WTO-Verhandlungen
Antidiskriminierungspolitik
Gleichstellung der Geschlechter und Gender Mainstreaming
Die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien
Grenzen rechtlicher Regelungen
Asienpolitik
Assoziierungs- und Kooperationspolitik
Rechtsgrundlage und Verfahren
Qualitative Unterschiede
Bilanz und Ausblick: doppelseitige Verpflichtung
Asyl-, Einwanderungs- und Visapolitik
Vergemeinschaftung des Asyl-, Einwanderungs- und Visarechts
Die politische Entwicklung des Asyl-, Einwanderungs- und Visarechts
Asylrecht
Einwanderungsrecht
Visarecht
Perspektiven
Ausschuss der Regionen
Entstehung und Entwicklung: ‚Maastricht‘ als konstitutioneller Startpunkt
Kernkompetenzen und Funktionen: Beratung und Kontrolle
Zusammensetzung und Arbeitsweise: zunehmende Politisierung
Bilanz und Ausblick: Anhaltende Profilierungssuche
Außenhandelsbeziehungen
Entstehung und rechtliche Grundlagen
Autonome Handelspolitik
Vertragliche Handelspolitik
Perspektiven
Bankenunion
Beschäftigungspolitik
Fragmentarische Beschäftigungspolitik
Beschäftigungspolitik – eine koordinierte Strategie zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit
Bildungspolitik
Etappen der EU-Bildungspolitik
Instrumente der EU-Bildungspolitik
Binnenmarkt
Unterschiedliche Instrumente zur Verwirklichung des Binnenmarkts
Die Binnenmarktpolitik im Vertrag von Lissabon
Neuer Schwung für den Binnenmarkt
Charta der Grundrechte
Stärkung des EU-Grundrechteschutzes in den Vertragsreformen
Die EU-Grundrechtecharta
Der Beitritt der EU zur Menschenrechtskonvention
Deutschland in der EU
Politikformulierung und Regierungshandeln
Rolle von Bundesrat und Bundestag
Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu den Verträgen von Maastricht und Lissabon
Auswirkungen der Eurokrise
Kontinuität im Wandel
Differenzierte Integration
Konzepte und Kategorisierung differenzierter Integration
Differenzierungsrealität: Formen und Bereiche differenzierter Integration
Verstärkte Zusammenarbeit
Opt-outs
Formen der Differenzierung außerhalb des EU-Rechtsrahmens
Bewertung und Ausblick
Energiepolitik
Strom- und Erdgasbinnenmarkt
Versorgungssicherheit
Erneuerbare Energien
Energieeffizienz
Energietechnologien
Europäische Energienetze
Internationale Energiepolitik
Ausblick
Entscheidungsverfahren
Vielfalt und Komplexität der Verfahren
Vorschriften für zentrale Politikfelder
Interne Beschlussfassungsregeln zentraler Organe
Verfahren zwischen den Organen
Verfahren zur Feststellung des EU-Haushalts
Verfahren in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
Verfahren im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
Systemrelevante Akte: Verfahren zur Vertragsänderung und zum Beitritt
Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit
Verfahren und die Rolle nationaler Parlamente
Zur Zukunft und Gestaltung der Verfahren
Entwicklungszusammenarbeit
Entstehung und Grundlagen
Instrumente und internationale Verpflichtungen
Wandel der EU-AKP-Entwicklungszusammenarbeit
Erweiterung
Bisherige Etappen der Erweiterung
Rechtliche Grundlagen
Beitrittsverfahren
Aktuelle Beitrittskandidaten: Island, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei
Potentielle Beitrittskandidaten
Bilanz und Ausblick
Europäischer Auswärtiger Dienst
Europäische Bürgerinitiative
Europäische Identität
Europäische Identität als Postulat und Problem
Sinngehalte und Wirkfaktoren europäischer Identität
Europäische Kommission
Geschichte
Aufgaben
Aufbau, Benennung und Beschlussfassung
Wissenschaftliche Einordnung
Europäische Menschenrechtskonvention
Konventionsrechte
Durchsetzung der Rechte
Arbeitsweise
Reformen
Europäische Nachbarschaftspolitik
Rechtliche und institutionelle Grundlagen
Regionale Ausdifferenzierung: Mittelmeerunion und Östliche Partnerschaft
Die Instrumente der Europäischen Nachbarschaftspolitik
Finanzielle und technische Unterstützung im Rahmen der ENP
Bilanz und Ausblick
Europäisches Parlament
Arbeitsweise – das EP als „Arbeitsparlament“
Befugnisse, Macht, Verantwortung
Funktionsbilanz – Entwicklungslinien eines Arbeitsparlaments
Europäische Parteien
Entwicklungslinien transnationaler Parteienkooperation in Europa
Anerkennungskriterien der Parteien auf europäischer Ebene
Organisation und Strukturen
Finanzreformen und Gründung politischer Stiftungen
Auf dem Weg zum europäischen Parteiensystem?
Europäischer Rat
Der Vertragstext: Zurückhaltende Funktionenbeschreibung
Die Praxis: Extensive Rolleninterpretation einer Schlüsselinstitution
Die interne Dynamik: Entscheidungsfindung durch Verhandlungspakete
Auswirkungen auf die institutionelle Architektur: Der Europäische Rat als Motor einer horizontalen und vertikalen Fusion
Europäische Union
Bauphasen der Integrationskonstruktion (1951 bis 2010)
Zur Begriffsgeschichte: konstruktive Mehrdeutigkeit und zunehmende Konflikthaftigkeit
Vertragliche Bestimmungen und institutionelle Architektur: zwei Verträge, eine Union
Die Europäische Union: die Finalität als Teil des Prozesses
Europäische Zentralbank
Struktur und Beschlussverfahren
Unabhängigkeit als Kernelement
Europarat
Struktur der ersten europäischen Staatenorganisation
Beitrittspolitik
Monitoring
Reformen
Fischereipolitik
Marktordnung
Fischereistrukturpolitik
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischbestände
Beziehungen zu Drittländern
Fiskalvertrag
Forschungs- und Technologiepolitik
Entwicklung
Spitzenforschung und wissenschaftliche Exzellenz im 21. Jahrhundert
Innovationsraum Europa
Gesundheitspolitik
Auf dem Weg zur öffentlichen Daseinsvorsorge durch Gewährleistungsstaatlichkeit
Auf dem Weg zur komplex-hybriden Logik der Sozial-und Gesundheitspolitik im „Binnenmarkt-Sozialmodell“ der EU
Gerichtshof der Europäischen Union
Aufbau und Organisation
Zuständigkeit und Verfahren
Wahrung der Rechtseinheit
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Geschichte und Entwicklung der GASP
Reichweite und Ausdifferenzierung der GASP/GSVP
Instrumente und Entscheidungsverfahren
Die institutionelle Struktur der GASP
Ausblick: wachsende Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Geschichte und Entwicklung
Strukturen der GSVP
GSVP-Missionen
Grundlagendokumente der GSVP
Bilanz und Perspektiven
Haushalt und Finanzen
Finanzierung der EU: Die Eigenmittel
Der Mehrjährige Finanzrahmen 2014-2020
Der jährliche Haushalt
Ausblick und Reformen
Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik
Humanitäre Hilfe
Grundlagen, Ziele und Instrumente
Industriepolitik
Anfänge einer Industriepolitik der Gemeinschaft
Von Maastricht nach Lissabon
Eine neue Politik für Unternehmen
Integrationstheorien
Komplexität des Untersuchungsobjekts
Begriffe, Ansätze und Strömungen
Trotz Pluralismus: Gemeinsame Grundannahmen
Offene Fragen
Jugendpolitik
Jugendpolitik als Gemeinschaftsaufgabe
Auf dem Weg zur EU-Jugendstrategie
Jugend in Aktion
Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
Die Rechtsgrundlagen nach Lissabon
Die justizielle Zusammenarbeit
Die polizeiliche Zusammenarbeit
Ausblick
Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen
Begriff der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen
Die Rechtsgrundlagen
Integrationsstand und Entwicklungsperspektiven
Katastrophenschutz
Klimapolitik
Beschlussverfahren
Instrumente
Zentrale Programme und Maßnahmen
Die EU in der internationalen Klimapolitik
Kulturpolitik
Vertragliche Grundlagen
Aktionen und Förderprogramme
Audiovisuelle Medien
Perspektiven der europäischen Kulturpolitik
Lateinamerikapolitik
Lobbying und Interessenvertretung
Vertragsgrundlage
Ziele und Probleme der Interessenvertretung
Praxis der Interessenvertretung
Die Transparenzinitiative
Menschenrechtspolitik
Entwicklung der Zuständigkeiten im Inneren und Äußeren
Institutionalisierung und Mainstreaming des Anliegens
Menschenrechts- und Demokratieklauseln in den Gemeinschaftsabkommen
Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik und in internationalen Organisationen
Bilanz und Ausblick: Glaubwürdigkeit und Besonnenheit
Mittelmeerpolitik
Der Barcelona-Prozess und die Euro-Mediterrane Partnerschaft
Union für das Mittelmeer
Die EU und der Arabische Frühling
Europäische Unterstützung für den Nahostfriedensprozess
Ausblick
Nationale Parlamente
Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips
Kontrolle der nationalen Regierung
Ausblick
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
Geschichte
Wesensmerkmale
Verhandlungsgremien und Institutionen
Missionen und Feldoperationen
Beziehungen zur EU und Perspektiven
Präsident des Europäischen Rates
Auf der Suche nach Effizienzsteigerung und Führung
Wahl und Amtsdauer
Aufgaben und Funktionen
Wirken und Wirkungen
Rat
Historische Entwicklung
Institutionelle Struktur und Arbeitsweise
Abstimmungsmodi
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
Die eigenständige Entwicklung
Rechnungshof
Zusammensetzung und Stellung der Mitglieder
Aufgabe und Zuständigkeiten
Verfahren der Rechnungsprüfung
Berichte, Stellungnahmen und Zuverlässigkeitserklärung
Sozialpolitik
Reformen des Vertrags von Lissabon
Etappen der europäischen Sozialpolitik
Instrumente der europäischen Sozialpolitik
Sportpolitik
Struktur- und Regionalpolitik
Begründung für Unionsvorgehen
Strukturpolitische Instrumente und Entscheidungsverfahren
Die fünf Förderprinzipien der Strukturfonds
Finanzielle Ausstattung
Die Zukunft europäischer Strukturpolitik jenseits 2013
Strukturfonds als Ausdruck europäischer Solidarität
Tourismuspolitik
Zielsetzung
Umweltpolitik
Vier Phasen der vertragsrechtlichen Entwicklung
Beschlussverfahren
Instrumente
Unionsbürgerschaft
Vom „Europa der Bürger“ zur Unionsbürgerschaft
Reformen durch die Verträge von Amsterdam, Nizza und Lissabon
Rechte und Pflichten der Unionsbürger
Die europäische Bürgerinitiative
Bürgerjahr 2013
Verbraucherpolitik
Etappen der europäischen Verbraucherpolitik
Durchsetzung des Einzelhandelbinnenmarkts
Das neue Verbraucherprogramm
Verkehrspolitik
Programm und Fortschritte
Ausblick: Herausforderungen für die europäische Verkehrspolitik
Vertrag von Lissabon
Die Struktur des Vertrags von Lissabon
Abgrenzung von Zuständigkeiten: Fortentwicklung zu einer „staatsähnlichen Agenda“
Schaffung und Ausbau von Führungspositionen in der institutionellen Architektur
Ausbau parlamentarischer Rechte auf mehreren Ebenen
Neuregelung der qualifizierten Mehrheit im Rat
Der Vertrag von Lissabon: Die Krisenperiode löst die Verfassungsdekade ab
Wahlen zum Europäischen Parlament
Wahlen als Spiegel der Interaktionsfunktion des Parlaments
Die Wahlen 2009
Die Ursachen des geringen Wahlinteresses
Ein einheitliches Wahlverfahren des Parlaments
Weltraumpolitik
Entwicklung
Die wachsende Bedeutung des Weltraums im 21. Jahrhundert
Wettbewerbspolitik
Kartellverbot und Fusionskontrolle
Staatliche Beihilfen
Reformen und Entwicklungen
Bewertung und Ausblick
Wirtschafts- und Sozialausschuss
Ernennung der Mitglieder und Zusammensetzung
Kompetenzen, Aktivitäten und Einfluss
Binnenorganisation
Wirtschafts- und Währungsunion
Entstehung
Konvergenzkriterien, fiskalpolitisches Regelwerk
Das Regelwerk in der Praxis
Krise der Eurozone und Reform der WWU
Wirtschaftspolitik
Marktwirtschaftliche Ordnung
Wirtschaftspolitische Koordinierung vertraglich angelegt
Wachstumsstrategie „Europa 2020“
Steuerpolitik bleibt nationale Kernkompetenz
Zuständigkeiten: Kompetenzen und Instrumente
Begriff und Zuweisung der Zuständigkeiten in der Europäischen Union
Entwicklung der Zuständigkeitsordnung
Die Kompetenzordnung in der Europäischen Union
Ziele der Union und Kompetenzordnung
Kompetenzbegründung und Kompetenzausübung
Sachbereiche von Unionskompetenzen
Kompetenzen der Europäischen Atomgemeinschaft
Handlungsermächtigungen in der GASP und GSVP
Instrumente
Chronologie
Autoren
Einleitung
Die Europäische Union ist zum Kern politischer Machtarchitektur auf dem europäischen Kontinent geworden. Das Skript dazu wurde vor kaum mehr als einem halben Jahrhundert mit den Römischen Verträgen geschrieben. Dieses große Vertragswerk bot den Grundriss für die Architektur des neuen, integrierten Europa. Die Dichte der europäischen Integration hat inzwischen ein Niveau erreicht, das die Frage nach der Finalität des Integrationsprozesses aufwirft und nach institutioneller Zuverlässigkeit und demokratischer Legitimation verlangt. Mit dem am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon wurde eine dringend notwendige Justierung der strategischen Ausrichtung Europas vorgenommen. Tiefgreifende Reformen sollen die Handlungsfähigkeit und die demokratischen Grundlagen der Europäischen Union deutlich verbessern.Gleichzeitig werden Reichweite und Auswirkungen der europäischen Integration durch das Krisenmanagement in der Wirtschafts- und Finanzkrise immer umfassender und damit schwerer nachvollziehbar. Das „Europa von A bis Z“ wendet sich daher an alle, die gezielt schnelle, umfassende und präzise Informationen zu zentralen Begriffen und Sachverhalten der europäischen Einigung suchen. Diese dreizehnte, aktualisierte Auflage des „Europa von A bis Z – Taschenbuch der europäischen Integration“ informiert über die Grundzüge der europäischen Einigung, das politische System der EU und führt kritisch in die gegenwärtigen Entwicklungen und zukünftigen Herausforderungen ein.
Zur Handhabung des Taschenbuchs
Der Beitrag Europäische Einigung im historischen Überblick zeichnet die Stationen der europäischen Integration nach und bilanziert deren Folgen. Mit zahlreichen Beiträgen, verfasst von Experten der europäischen Politik aus Praxis und Forschung, bildet das Europa zum Nachschlagen das Kernstück des Taschenbuchs. Nach einer einheitlichen Systematik verfasst, analysieren und erklären die Beiträge Organisationen und Institutionen, Gegenstand und Aufgaben der Europapolitik. Hinweise auf Vertragsgrundlagen, weiterführende Literatur sowie auf Informationen im Internet ermöglichen dem Leser, seine Kenntnisse rasch und gezielt zu vertiefen. Ein dichtes Netz von → Verweisen verbindet die Beiträge und eröffnet so einen einfachen Weg des thematisch vertieften Weiterlesens. Auf die Beiträge kann alphabetisch zugegriffen werden sowie mithilfe der thematischen Übersicht. Diese gruppiert sachverwandte Beiträge und ermöglicht so den gebündelten Zugang zu Politikfeldern und Problemzusammenhängen:
Konzepte und Wege der europäischen Einigung
Europäische Union
Deutschland in der EU
Differenzierte Integration
Europäische Identität
Integrationstheorien
Organe und Einrichtungen der Europäischen Union
Europäisches Parlament
Europäischer Rat
Rat
Europäische Kommission
Gerichtshof der Europäischen Union
Europäische Zentralbank
Rechnungshof
Wirtschafts- und Sozialausschuss
Ausschuss der Regionen
Agenturen
Verfahren und Organisation der Europäischen Union
Europäische Bürgerinitiative
Entscheidungsverfahren
Europäische Parteien
Haushalt und Finanzen
Lobbying und Interessenvertretung
Nationale Parlamente
Präsident des Europäischen Rates
Vertrag von Lissabon
Wahlen zum Europäischen Parlament
Zuständigkeiten: Kompetenzen und Instrumente
Politikbereiche der Europäischen Union
Wirtschaft und Währung
Bankenunion
Binnenmarkt
Fiskalvertrag
Wettbewerbspolitik
Wirtschafts- und Währungsunion
Wirtschaftspolitik
Sektorpolitiken
Agrarpolitik
Energiepolitik
Fischereipolitik
Forschungs- und Technologiepolitik
Industriepolitik
Klimapolitik
Sportpolitik
Struktur- und Regionalpolitik
Tourismuspolitik
Umweltpolitik
Verkehrspolitik
Weltraumpolitik
Soziales und Kultur
Antidiskriminierungspolitik
Beschäftigungspolitik
Bildungspolitik
Gesundheitspolitik
Jugendpolitik
Kulturpolitik
Sozialpolitik
Verbraucherpolitik
Justiz und Inneres
Asyl-, Einwanderungs- und Visapolitik
Charta der Grundrechte
Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
Unionsbürgerschaft
Erweiterung, Außenbeziehungen, Sicherheit
Afrikapolitik
Asienpolitik
Assoziierungs- und Kooperationspolitik
Außenhandelsbeziehungen
Entwicklungszusammenarbeit
Erweiterung
Europäische Nachbarschaftspolitik
Europäischer Auswärtiger Dienst
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Humanitäre Hilfe
Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheits-politik
Katastrophenschutz
Lateinamerikapolitik
Menschenrechtspolitik
Mittelmeerpolitik
Weitere Organisationen
Europäische Menschenrechtskonvention
Europarat
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
Die Chronologie gibt detailliert Auskunft über die zentralen Etappen der europäischen Integration – von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Zur Entstehung des Taschenbuchs
Das „Europa von A bis Z“ ist ein Projekt des Instituts für Europäische Politik (www.iep-berlin.de), das in Kooperation mit dem Centrum für angewandte Politikforschung der Universität München (www.cap-lmu.de) und dem Jean Monnet Lehrstuhl für Politische Wissenschaft an der Universität zu Köln (www.politik.uni-koeln.de) verwirklicht wird. Besonderer Dank gilt dem Auswärtigen Amt für die großzügige Förderung des Projekts. Der Erfolg des Taschenbuchs hat sich bestätigt durch dreizehn Auflagen, durch die Übersetzung einer leicht gekürzten Fassung in viele Amtssprachen der Europäischen Union durch die Europäische Kommission sowie durch mehrere Sprachfassungen. Unser Dank gilt insbesondere den Autorinnen und Autoren, deren großes Expertenwissen die solide Grundlage und das unverkennbare Profil des Taschenbuchs bildet. Für die sachkundige Redaktion danken wir Isabelle Tannous herzlich.
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld
Prof. Dr. Wolfgang Wessels
Centrum für angewandte Politikforschung Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München
Jean Monnet LehrstuhlInstitut für Politische Wissenschaftund Europäische FragenUniversität zu Köln
Europäische Einigung im historischen Überblick
Werner Weidenfeld
1 Ausgangslage: Motive und Interessen nach dem Zweiten Weltkrieg
Von Beginn an war die europäische Integration die Antwort auf die bis dahin gesammelten historischen Erfahrungen und zugleich Ausdruck interessenorientierter Politik. Diese lässt sich nur dann verstehen, wenn man sich die Lage in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung ruft: Eine geschichtliche Sondersituation, gekennzeichnet durch den Niedergang der europäischen Staaten und ihre unmittelbar danach entstandene Frontstellung zur Sowjetunion. In dieser Lage waren es vor allem fünf Motive, welche die Europäer zum großen Experiment der Integration antrieben:
Der Wunsch nach einem neuen Selbstverständnis: Nach den nationalistischen Verirrungen sollte Europa die Möglichkeit neuer Gemeinschaftserfahrung bieten. Ein demokratisch verfasstes Europa als Alternative zur abgelehnten nationalistischen Herrschaft.
Der Wunsch nach Sicherheit und Frieden: Die einzelnen Nationalstaaten hatten den Zweiten Weltkrieg nicht zu verhindern vermocht, und man hoffte, dass ein geeintes Europa hierbei erfolgreicher sein und zugleich Schutz vor der Gefahr einer kommunistischen Expansion gewähren werde. Europa sollte eine Friedensgemeinschaft sein.
Der Wunsch nach Freiheit und Mobilität: Über etliche Jahre hinweg hatten die Menschen unter kriegsbedingten nationalen Beschränkungen des Personen-, Güter- und Kapitalverkehrs gelitten. Insofern war es nur allzu verständlich, dass man sich nun die ungehinderte, freie Bewegung von Personen, Meinungen, Informationen und Waren wünschte.
Die Hoffnung auf wirtschaftlichen Wohlstand: Das vereinigte Europa sollte die Menschen in eine Ära großer wirtschaftlicher Stabilität und Prosperität führen. Ein gemeinsamer Markt sollte den Handel intensivieren und effizientes ökonomisches Verhalten möglich machen.
Die Erwartung gemeinsamer Macht: Die europäischen Staaten, die vor 1914 lange Zeit eine international dominierende Rolle gespielt hatten, hatten sich in zwei Weltkriegen zerfleischt. Die neuen Weltmächte USA und UdSSR zeigten Maßstäbe für neue internationale Machtgrößen, die weit über die Einheiten der vergleichsweise kleinen europäischen Nationalstaaten hinausgewachsen waren. Die westeuropäischen Staaten hofften, durch die politische Einigung vieles von der Macht gemeinsam zurückerlangen zu können, die sie einzeln verloren hatten.
Bereits in Winston Churchills Züricher Rede vom 19. September 1946 drückte sich kurz nach dem Krieg die entscheidende Orientierung an einer Vision der „Vereinigten Staaten von Europa“ aus, deren erster Schritt die Bildung eines Europarats sein sollte. Churchill sprach von einer Union aller beitrittswilligen Staaten Europas unter der Führung Frankreichs und Deutschlands. Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Ost-West-Konflikts erhielt die sich 1948 organisierende Europäische Bewegung nachhaltigen Auftrieb. Die Gründung der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) im Zusammenhang mit der Durchführung des Marshall-Plans zeigte zudem deutlich, dass die internationale Konstellation ein erhebliches Druckpotenzial enthielt, das den Prozess der europäischen Einigung forcierte: das Gefühl der Bedrohung durch den Kommunismus mit zunehmender Etablierung des Ostblocks, die amerikanische Unterstützung des Projekts der europäischen Einigung in Erwartung weltpolitischer Entlastung und der Öffnung neuer, großer Märkte, der wechselseitige Wunsch der westeuropäischen Staaten, sich gegenseitig zu binden, um neue, gefährliche Alleingänge einzelner Nationalstaaten auszuschalten.
Diese gemeinsame Grundhaltung verhinderte jedoch nicht, dass sich nach der Gründung der Europarats am 5. Mai 1949, die auf dem Europa-Kongress von Den Haag im Mai 1948 unter anderem von Politikern wie Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak und Konrad Adenauer gefordert worden war, unterschiedliche Integrationsansätze herauskristallisierten. Diese folgten zwei Organisationsprinzipien: dem des Staatenbundes und dem des Bundesstaates. Der Gedanke der europäischen Einigung war unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wie auch in der Folgezeit zu keinem Zeitpunkt mit nur einem politischen Konzept oder einem einzigen Integrationsmodell gekoppelt. Ohne eine starre Fixierung auf ein geschlossenes Europa-Modell konnte der Einigungsprozess je nach gegebener Situation an völlig unterschiedlichen Materien der Politik ansetzen – von dort aus versuchte man, Fortschritte zu erzielen.
Das Ringen um die Einigung Europas ist insofern durch die Jahrzehnte hindurch gekennzeichnet von einem ausgeprägt pragmatischen Grundzug. Integration nicht auf dem Reißbrett, sondern entlang des politisch Notwendigen und Möglichen – dieser Charakter der Integration hat den Nebeneffekt, dass sie dem Laien oftmals als plan- und zielloses Unterfangen erscheint. Die tiefere Logik erschließt sich dabei oftmals nicht, erst das Gesamtbild mag weiterhelfen. Und dieses beginnt Anfang der 1950er Jahre Gestalt anzunehmen.
2 Gründungsmoment und Entwicklungsgeschichte
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
Auf Initiative des französischen Außenministers Robert Schuman (Schuman-Plan vom 9. Mai 1950) unterzeichneten die Vertreter der sechs Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und der Niederlande am 18. April 1951 den Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Die Grundidee stammte vom französischen Planungskommissar Jean Monnet. Die EGKS (auch Montanunion genannt) sollte für Kohle und Stahl einen gemeinsamen Markt schaffen und damit eine gemeinsame Kontrolle, Planung und Verwertung dieses kriegswichtigen Industriezweigs ermöglichen. Hauptmotive für diesen Vorschlag bildeten die Überlegungen zur Beseitigung der deutsch-französischen Erbfeindschaft und der Wunsch nach Schaffung eines Grundsteins für eine europäische Föderation. Die perzipierte deutsche Bedrohung Frankreichs sollte auf diesem Weg ebenfalls ausgeschlossen werden und zusätzlich eine Mitverfügung Frankreichs über die deutschen Kohlereserven gesichert werden.
Adenauer sprach sich für den Schuman-Plan aus: Zum einen diene dieser der deutsch-französischen Verständigung und zum anderen ermögliche er der noch nicht souveränen Bundesrepublik Deutschland, auf der internationalen Bühne Verhandlungen zu führen. Der Vertrag zur Gründung der EGKS trat am 23. Juli 1952 in Kraft. Laut Vertrag sollte eine Hohe Behörde die Exekutivrechte wahrnehmen. Eine gemeinsame Versammlung besaß die Qualität eines Diskussionsgremiums mit eingeschränkten Kontrollrechten. Die politischen Richtlinien- und Legislativrechte lagen beim so genannten „Besonderen Ministerrat“. Ein elfköpfiger Gerichtshof wachte über die Vertragsauslegung, ein Beratender Ausschuss bestand aus Vertreten der beteiligten Interessengruppen.
Erstmals war damit die supranationale Organisation eines zentralen Politikbereichs in bislang nationalstaatlicher Kompetenz gelungen. Man war dabei nach dem funktionalistischen Integrationstyp vorgegangen. Der Funktionalismus geht davon aus, dass sich durch die Integration einzelner Sektoren ein gewisser sachlogischer Druck zur Übertragung immer weiterer Funktionen ergibt, bis sich schließlich eine umfassende Union erreichen lässt. Die umfassende ökonomische Integration des zentralen Wirtschaftssektors Kohle und Stahl sollte also eine spätere politische Einigung nach sich ziehen. In diese Richtung erfolgten schon bald erste Schritte.
Europäische Verteidigungsgemeinschaft und Europäische Politische Gemeinschaft
Am 27. Mai 1952 unterzeichneten Vertreter der sechs Mitgliedstaaten der EGKS den Vertrag zur Errichtung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG). Die Anregung zu diesem Vorhaben ging auf den damaligen französischen Premierminister René Pleven zurück, der eine gemeinsame europäische Armee unter einem europäischen Verteidigungsminister anstrebte. Dieser Ansatz berührte nationale Rechte tief greifend, denn die Streitkräfte zählen bekanntermaßen zu den Bereichen originär nationalstaatlicher Souveränität. Im Vertrag wurde in dieser Frage ein Kompromiss zwischen den Strukturprinzipien der Supranationalität und der Konföderation festgehalten. Organisatorisch war die EVG damit der EGKS vergleichbar.
Als Antwort auf das Gelingen einer Teilintegration der EGKS und der angestrebten EVG erfolgte zugleich das Bemühen um eine allgemeine politische Ergänzung: das konstitutionelle Modell. Am 10. September 1952 beschlossen die sechs Außenminister bei ihrem ersten Treffen als Rat der EGKS, deren erweiterte Versammlung solle als Ad-hoc-Versammlung die Verfassung einer Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) ausarbeiten. Diese neu zu schaffende Gemeinschaft sollte über Zuständigkeiten im Montanbereich und in Verteidigungsfragen verfügen, sowie „die Koordinierung der Außenpolitik der Mitgliedstaaten (...) sichern”. Die Entwicklung des Gemeinsamen Markts in den Mitgliedstaaten, die Anhebung des Lebensstandards und die Steigerung der Beschäftigung sollten weitere Zielsetzungen der EPG sein. Binnen zwei Jahren sollten die bestehende EGKS und die vorgesehene EVG in die EPG integriert werden.
Der am 10. März 1953 dem Rat vorgelegte Verfassungsentwurf sah in seinen 117 Artikeln ein dichtes Geflecht institutioneller Regeln mit stark supranationalen Akzenten vor. Neben einem Parlament mit zwei Kammern sollten ein Exekutivrat, ein Rat der nationalen Minister, ein Gerichtshof und ein Wirtschafts- und Sozialrat eingerichtet werden. Das EPG-Projekt sollte mit einem ausgeprägt konstitutionellen Fundament einerseits die EGKS und die EVG verknüpfen, andererseits auch in anderen Bereichen (Außen- und Wirtschaftspolitik) tätig werden.
Der Entwurf des EPG-Vertrags wurde im März 1953 von der Versammlung der Montanunion einstimmig gebilligt. Die im gleichen Jahr geführten Verhandlungen der Außenminister kamen jedoch nicht zu einer Einigung über den Umfang des nationalen Souveränitätsverzichts. Als Frankreich im März 1954 eine Vertagung der Verhandlung verlangte, zeigten sich die anderen Regierungen mehrheitlich nicht mehr interessiert.
Im August 1954 scheiterte die EVG in der französischen Nationalversammlung. Für den europäischen Verfassungsentwurf entfiel damit die Grundlage und das Vorhaben der Europäischen Politischen Gemeinschaft wurde vorerst aufgegeben. Danach erfolgte der Rückgriff auf das in Ansätzen bewährte funktionalistische Modell, wenn auch mit stark föderalistischen Begleitüberlegungen. Die Einrichtung von EWG und Euratom setzte die Grundlinie sektoraler Integration fort. Doch der Versuch der Verfassungsgebung wurde in der Folgezeit nie ganz aufgegeben. Insofern hat der Verfassungsprozess, der zur Jahrtausendwende angestoßen wurde und in die Unterzeichnung der EU-Verfassung im Herbst 2004 mündete, seinen ersten Vorläufer bereits in den 1950er Jahren.
Die Römischen Verträge
Auf der Konferenz der Außenminister der EGKS in Messina am 1./2. Juni 1955 wurde beschlossen, Verhandlungen über die Integration zweier weiterer Bereiche zu beginnen. Die konzeptionelle Grundlage hierzu enthielt der Spaak-Bericht, benannt nach dem belgischen Politiker Paul-Henri Spaak. Daraus entstanden dann die am 25. März 1957 unterzeichneten „Römischen Verträge“ zur Gründung der EWG und der Euratom, deren 50sten Jahrestag unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 gefeiert werden konnte. Die sechs Gründerstaaten der EGKS strebten im Rahmen der EWG eine Zollunion an, die Handelshemmnisse abbauen und einen gemeinsamen Außenzoll ermöglichen sollte. Zusätzlich wurde im EWG-Vertrag das Ziel festgeschrieben, einen Gemeinsamen Markt mit freiem Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zu schaffen sowie die dafür notwendige Koordinierung und Harmonisierung unterschiedlicher Politiken vorzunehmen. Organisatorisch orientierte sich die EWG an der Montanunion (EGKS). Die Kommission erhielt gewissermaßen die Exekutivgewalt, der Ministerrat fungierte als Legislative, die Versammlung debattierte über die Berichte und sorgte für die Verbindungen zu den nationalen Parlamenten, der Gerichtshof kontrollierte die bestimmungsgemäße Anwendung des Vertrags. Euratom diente dem Zweck, Aufbau und Entwicklung der Nuklearindustrie in den sechs Mitgliedstaaten zu fördern. Per Fusionsvertrag vom 8. April 1965, der am 1. Juli 1967 in Kraft trat, wurden die Organe der drei Europäischen Gemeinschaften (EG) EGKS, EWG und Euratom integriert.
Wie dicht die beiden Vorhaben EWG und Euratom zusammenhängen, belegt die enge Verknüpfung im Sinne der politischen Verhandlungsstrategie, „europäische Pakete“ zu schnüren. Die Tagesordnungspunkte, die Interessen und Einzelkonflikte blieben nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern sie wurden in einen dichten politischen Zusammenhang gestellt: Euratom kommt nur zustande, wenn der Gemeinsame Markt realisiert wird; die militärischen Vorbehalte der Franzosen gegen eine Ausdehnung von Euratom werden nur akzeptiert, wenn die EWG angemessen ausgestattet wird. In der Verschnürung des Pakets werden selbst gegenläufige Interessen europapolitisch produktiv gemacht. Was als Einzelvorstoß geradezu aussichtslos erscheint, kann im Gesamttableau der Themen kompromissfähig werden. Diese Strategie der Kompromisssuche durchzieht wie ein roter Faden die Geschichte der Integration.
Die Konstellationen, die sich in den Verhandlungen zu den Römischen Verträgen herauskristallisierten, hatten historisch-prägenden Charakter. Hier prallten die divergierenden nationalen Interessen der Staaten hart aufeinander: Frankreichs Interesse an einem Schutzzaun um die eigene Wirtschaft und sein Interesse an Kontrolle der Atompolitik, vor allem des östlichen Nachbarn, bei gleichzeitiger Aussparung der militärischen Atomkomponenten aus der europäischen Gemeinschaftsbildung; das deutsche Interesse an ungehinderter Bewegung im großen Gemeinsamen Markt; das englische Interesse, lediglich eine Freihandelszone zu etablieren und möglichst wenig Supranationalität in Europa entstehen zu lassen; das sowjetische Interesse, die Aufmerksamkeit der europäischen Staaten ganz auf den Bau einer gesamt-europäischen Friedensordnung zu konzentrieren. All dies prägte in einer ungewöhnlichen dokumentarischen Dichte die Verhandlungen um die Römischen Verträge. Zwischen den sechs Verhandlungspartnern kam es zum Durchbruch, als sich Frankreich und Deutschland einigten. In der Folgezeit erwies sich das „deutsch-französische Tandem“ immer wieder als Triebkraft der Integration – die trotz gelegentlicher Interessendifferenzen auch nach der großen Erweiterungswelle 2004/2007 ihre Dynamik beibehalten hat.
Ende der 1950er Jahre war mit EGKS, EWG und Euratom ein architektonischer Dreiklang geschaffen, der wichtige Weichenstellungen für die wirtschaftliche Integration der Mitgliedstaaten in zentralen Politikfeldern vornahm. Die Idee einer politischen Integration aber wurde auch weiterhin verfolgt.
Integrationspolitische Erfolge, Krisen und Reformversuche in den 1960er und 1970er Jahren
Nachdem die Römischen Verträge recht zügig umgesetzt zu werden versprachen – was sich allerdings bereits in den 1960er Jahren in letzter Konsequenz als zunehmend schwierig erwies –, erfolgte der erneute Versuch, einen politischen Rahmen für die Integration zu schaffen. Die Fouchet-Verhandlungen, benannt nach dem französischen Diplomaten Christian Fouchet, aufgrund eines Beschlusses der Bonner Gipfelkonferenz vom 18. Juli 1961 aufgenommen, folgten nun allerdings nicht dem früheren supranationalen, konstitutionellen, sondern dem intergouvernementalen Konzept, das die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen ins Zentrum rückt. Die Fouchet-Pläne sahen ein Verfahren der lockeren politischen Abstimmung der EWG-Mitgliedstaaten vor, das eher herkömmlichen internationalen Prozeduren entsprach.
Als man sich 1962 nicht über eine solche Perspektive und ebenso wenig über den möglichen Beitritt Großbritanniens zur EWG einigen konnte, waren die Fouchet-Verhandlungen gescheitert. Doch die Integration brach sich in einer „Ersatzlösung“ Bahn: Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag wurde am 22. Januar 1963 von Adenauer und de Gaulle in der Absicht unterzeichnet, zunächst zwischen Deutschland und Frankreich eine dichte politische Zusammenarbeit zu schaffen, der sich auf Dauer die übrigen EWG-Mitgliedstaaten nicht würden entziehen können. Die Vertragsväter strebten eine politische Verbindung an, die auch die sicherheitspolitische Komponente umfassen sollte. Die Verklammerung von Deutschland und Frankreich sollte zum Motor der politischen Union Europas werden. Selbst wenn Initiativen wie die Fouchet-Pläne scheiterten, dachte die europäische Integration also immer auch in Alternativen.
Ein Einbruch in der Erfolgsgeschichte der europäischen Integration geschah mit dem so genannten „Luxemburger Kompromiss“ von 1966. In der vertraglich vorgesehenen Übergangszeit wären ab dem 1. Januar 1966 im Ministerrat Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit zu wichtigen Sachgebieten möglich geworden. Diesen Übergang suchte Frankreich mit seiner „Politik des leeren Stuhls“ zu verhindern, indem es an den Sitzungen der EWG-Gremien seit dem 1. Juli 1965 nicht mehr teilnahm. Im Luxemburger Kompromiss wurde daraufhin am 27. Januar 1966 festgehalten, dass man in kontroversen Angelegenheiten den Konsens suchen solle. Falls es aber nicht gelänge, diesen Konsens herzustellen, ging Frankreich davon aus, dass das einzelne Mitglied eine Veto-Position besitze, falls vitale Interessen berührt seien. Die fünf restlichen EWG-Staaten dagegen wollten die vertraglich vorgesehenen Abstimmungsprozeduren verwirklichen. In der Interpretationsgeschichte des Luxemburger Kompromisses gelang es Frankreich, seine Sicht durchzusetzen, so dass danach faktisch für jedes EWG-Mitglied die Möglichkeit des Vetos bestand. Im Ministerrat blieben daher viele Entwicklungsfäden einer dynamischen Integrationspolitik hängen.
Unter der Führung von General Charles de Gaulle lehnte Paris darüber hinaus auch die autonome Zuständigkeit der EWG in bestimmten Fragen sowie den Beitritt des Vereinigten Königreichs zur EG ab. Erst unter Georges Pompidou, Nachfolger de Gaulles im Präsidentenamt, zeigte sich die Regierung in Paris flexibler. Die Haager Gipfelkonferenz vom 1./2. Dezember 1969 beschloss daraufhin die Norderweiterung der Europäischen Gemeinschaften. Die Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien, Dänemark, Norwegen und Irland konnten am 22. Januar 1972 mit der Unterzeichnung der Beitrittsverträge abgeschlossen werden. Volksabstimmungen in Großbritannien, Irland und Dänemark ergaben Mehrheiten für einen Beitritt zur EG, die norwegische Bevölkerung lehnte allerdings die EG-Mitgliedschaft ab. Anfang der 1970er Jahre war die EG damit von sechs auf neun Mitgliedstaaten angewachsen.
Die Krisen der 1960er Jahre hatten zunehmend zu einem Rückgriff auf intergouvernementale Strukturen geführt. Vertiefungsschritte schienen nur noch dann möglich, wenn jedem Mitgliedstaat das nationale Veto in der Hinterhand verblieb. So beschlossen etwa die EG-Außenminister am 27. Oktober 1970 auf der Grundlage des Davignon-Berichts die Grundsätze und Verfahrensweisen der so genannten „Europäischen Politischen Zusammenarbeit“ (EPZ). Die EPZ mit stark intergouvernementalem Charakter sollte das zentrale Instrument der Koordinierung der Außenpolitiken der Mitgliedstaaten der EG darstellen. Auch wenn diese nicht immer zu einer Vergemeinschaftung führte, so blieb die Tendenz zur Intensivierung zwischenstaatlicher Kooperationen durch eine Ausweitung auf neue Bereiche der Zusammenarbeit doch zu jeder Zeit erhalten.
Mit der Erfüllung der zentralen Pfeiler der Römischen Verträge – der Einrichtung gemeinsamer Institutionen, der Vergemeinschaftung so wichtiger Politikfelder wie der Landwirtschaft, der (friedlichen) Nutzung der Atomenergie, dem Gemeinsamen Markt und der Freizügigkeit – verlangte die Integration seit Anfang der 1970er Jahre nach der Ergänzung durch weitere Maßnahmen:
Die institutionelle Stagnation ließ nach der Einrichtung neuer Institutionen und der Reform einzelner Organe rufen: 1974 wurde der Europäische Rat durch einen Beschluss der Staats- und Regierungschefs der EG begründet. Dieser sollte in Zukunft mindestens zweimal jährlich tagen und die Grundlinien der EG-Politik festlegen. Die Schaffung des Europäischen Rats war nicht zuletzt eine Reaktion auf die Führungsschwäche der Kommission, die zunehmend den Konflikt mit dem Ministerrat scheute. Darüber hinaus fand vom 7. bis 10. Juni 1979 die erste allgemeine und unmittelbare Europawahl in den damals neun Mitgliedstaaten der EG statt. Zum ersten Mal konnten die Bürger der EG direkt Einfluss auf die Gestaltung der europäischen Politik nehmen, auch wenn das Parlament zu diesem Zeitpunkt noch vergleichsweise schwache Kompetenzen besaß. Der erste Schritt hin zu einem von den Bürgern legitimierten europäischen Einigungswerk war damit getan. Europa fand seitdem nicht mehr nur am Verhandlungstisch statt. Die Akteure europäischer Politik mussten ab sofort den Willen der Bürger Europas stärker in ihr Denken und Handeln einbeziehen. Der Aufbau einer europäischen Identität mittels des Kommunikations-, Interaktions- und Kontrollorgans „Parlament“ erhielt eine neue Perspektive.
Der Gemeinsame Markt bedurfte der Ergänzung durch eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik: Auf der Haager Gipfelkonferenz und in zwei Ratsentschließungen vom März 1971 und vom März 1972 wurde das Ziel der Realisierung einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) bis 1980 formuliert. Geplant waren nicht nur die vollständige Verwirklichung der in den Römischen Verträgen verankerten Freizügigkeiten und eine feste Wechselkursstruktur mit uneingeschränkter Währungskonvertibilität, sondern auch die Übertragung zentraler wirtschafts- und währungspolitischer Zuständigkeiten der EG-Mitglieder auf die Gemeinschaftsorgane. Die Umsetzung dieses Konzepts sollte in mehreren Stufen erfolgen. Im Werner-Plan vom Oktober 1970, benannt nach dem damaligen luxemburgischen Ministerpräsidenten und Finanzminister, wurden diese Schritte zu einer WWU präzisiert. Grundsätzlich unterschiedliche wirtschafts- und integrationspolitische Ansätze und die krisenhafte Entwicklung in den Mitgliedstaaten verhinderten jedoch die Koordinierung der Wirtschafts- und Währungspolitik und das angestrebte gemeinschaftliche Festkurssystem. Die seit Mitte der 1970er Jahre in den EG-Staaten durchgeführte Inflationsbekämpfung erwirkte im Laufe der Zeit jedoch eine Annäherung der Wirtschafts- und Währungspolitiken. Dies kam einer deutsch-französischen Initiative von Helmut Schmidt und Valéry Giscard d’Estaing zugute, die auf die Gründung eines Europäischen Währungssystems (EWS) zielte. Kern war dabei das Konzept eines gemeinsamen Wechselkursmechanismus. Am 13. März 1979 trat das EWS rückwirkend zum 1. Januar 1979 in Kraft.
Die Neuordnung der EG-Finanzierung forderte die Kompetenzerweiterung des Europäischen Parlaments, speziell in der Haushaltspolitik: Die 1970 beschlossene Einführung von Eigenmitteln für die EG-Finanzierung brachte in mehreren Stufen bis 1975 eigene Einnahmen für die EG. Als Einnahmequellen wurden Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- und Ausgleichsbeträge aus der gemeinsamen Agrarpolitik, Zölle des gemeinsamen Zolltarifs, Abgaben an die EG sowie ein Mehrwertsteueranteil aus den Mitgliedstaaten festgelegt. Ministerrat und Europäisches Parlament bilden die Haushaltsbehörde der EG, wobei der Rat für die obligatorischen Ausgaben (weitgehend Agrarmarktgelder), das Parlament hingegen für die nichtobligatorischen Ausgaben zuständig ist. Seit 1975 wird der Haushalt nur mit der Unterschrift des Präsidenten des Europäischen Parlaments rechtsgültig, was also eine Ablehnungsmöglichkeit bei entsprechenden Mehrheiten im Parlament einschließt. Die Aufteilung in obligatorische und nichtobligatorische Ausgaben wurde erst mit dem Entwurf des Verfassungsvertrags 2004 aufgehoben. Nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags in den Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Frühjahr 2005 wurde diese Regelung in den Vertrag von Lissabon übernommen.
Trotz der Fortschritte in Einzelbereichen blieben aber Unsicherheiten in der großen Zielperspektive bestehen. Daher beauftragten die Staats- und Regierungschefs im Jahr 1974 den damaligen belgischen Ministerpräsidenten Leo Tindemans, ein Gesamtkonzept zur Umwandlung der EG in eine „Europäische Union“ vorzulegen. Der am 29. Dezember 1975 vorgelegte Bericht enthielt unter anderem die Forderung nach einer einzigen Entscheidungszentrale mit ausreichender Autorität sowie nach einer Verstärkung der gemeinsamen Außenpolitik. Tindemans formulierte mit starker Betonung der inhaltlichen Fragen der europäischen Politik einen eigenen Zugang, den man mit dem Stichwort des „pragmatischen Minimalismus“ kennzeichnen kann. So hob er die Notwendigkeit der schrittweisen Vertiefung der europäischen Integration, wenn erforderlich mit „zwei Geschwindigkeiten”, hervor. In der Folgezeit versäumten es die Mitgliedstaaten jedoch, aus dem Bericht ein konkretes Programm zur Schaffung der Europäischen Union vorzulegen und umzusetzen.
Eine Bestandsaufnahme des europäischen Integrationsprozesses am Ende der 1970er Jahre zeigt, dass neben Erfolgen auch Versäumnisse festzuhalten waren. Zweifellos hatte die EG die in den Römischen Verträgen verankerten Grundfreiheiten weitgehend verwirklicht. Wesentliche Hindernisse für einen freien Warenverkehr waren beseitigt, ein gemeinsamer Zolltarif war eingeführt. Die Vergemeinschaftung zentraler politischer Bereiche war vollzogen und hatte zum wirtschaftlichen Wohlstand und zur demokratischen Stabilität Westeuropas beigetragen. Die Ergänzung des Gemeinsamen Markts durch eine gemeinschaftliche Außenhandelspolitik war ebenfalls gelungen.
Einige Zielsetzungen waren jedoch nicht oder nur unzureichend realisiert. So bestanden weiterhin Zollformalitäten, die Freizügigkeit war immer noch eingeschränkt und unterschiedliche indirekte Steuersätze belasteten die Effektivität des Binnenmarkts. Darüber hinaus war ein wirklicher Durchbruch zu einer WWU nicht erreicht. Es hatte sich allerdings gezeigt, dass die Mitgliedstaaten gezielt über die vertraglich fixierten Politikbereiche hinauszugreifen bereit waren, wenn es von der Aufgabenstellung her sinnvoll erschien. Dies traf insbesondere für die Etablierung neuer Instrumente und Institutionen zu, die zum Teil neben der EG, aber in enger politischer Zuordnung eingerichtet worden waren (z.B. die EPZ, der Europäische Rat und das EWS). Aus dem Überschreiten der Kernbereiche der Römischen Verträge ergaben sich jedoch neue Integrationsprobleme. Denn um Fragen von nicht originärer EG-Zuständigkeit einzubeziehen, war es notwendig, nationale Politiken zu koordinieren. Das Spektrum politischer Strategien wies also zwei konkurrierende Ansätze auf: Supranationale Entscheidungsfindung und internationale Koordination standen nebeneinander. Es entwickelte sich daraus die Gefahr, dass die Strategie internationaler Koordination die supranationale Strategie unterlaufen konnte. Dieses Spannungsverhältnis blieb prägend für die Geschichte der Integration.
Dialektik von Krise und Reform: Der Problemkatalog zu Beginn der 1980er Jahre und der Weg zur Einheitlichen Europäischen Akte
Eine Dialektik von Krise und Reform sollte in den 1980er Jahren prägend für die Europäischen Gemeinschaften sein. „Krise“ und „Reform“ traten im Prozess der europäischen Einigung in eine letztlich produktive Wechselwirkung: Versäumte Reformen trugen wesentlich zu den Krisenerfahrungen bei, verschärfte Krisen und ein komplexer Problemberg erhöhten den Reformdruck.
Die Wirtschaft aller EG-Mitgliedstaaten befand sich seit Mitte der 1970er Jahre in einer Krise. Die Gefahr wuchs, dass erfindungsreicher nationaler Protektionismus den Gemeinsamen Markt aushöhlte. Die ungünstige Entwicklung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die ökonomischen Probleme innerhalb der EG führten zu immer stärkeren Widersprüchen zwischen Gemeinschaftsinteressen und nationalstaatlichen Anliegen. Ein Prozess der Entsolidarisierung war unübersehbar. Das Vorhaben der Süderweiterung stieß so auf starken Widerstand.
In dieser wirtschaftlich schwierigen Situation wirkte sich die institutionelle Schwäche der Gemeinschaft besonders ungünstig auf die Handlungsfähigkeit aus. Die Kommission war zu einem Verwaltungszentrum der intergouvernementalen Kooperation geworden. Die Arbeit des Ministerrats, jenes zentralen Entscheidungsorgans der EG, war durch mangelhafte Effektivität gekennzeichnet. Es verschwamm im Halbdunkel des geheimen Beschlussverfahrens und zu Hause in der kollektiven Regierungsverantwortlichkeit.
Der Haushalt der EG war seit vielen Jahren mit strukturellen Mängeln belastet. Die Gemeinschaft hatte mittlerweile die Grenze ihrer Finanzierbarkeit erreicht. Das verfügbare Finanzvolumen war im Blick auf die anstehenden Aufgaben zu knapp bemessen. Vor allem die Konzentration von etwa zwei Dritteln aller Haushaltsausgaben auf den Agrarmarkt schränkte die Möglichkeiten zu einer aktiven Europapolitik in den anderen Bereichen drastisch ein. Das Wort von der „Eurosklerose“ machte die Runde. Der Europagedanke hatte sichtlich an Fahrt verloren.
Rückblickend lassen sich zu Beginn der 1980er Jahre fünf zentrale „Baustellen“ im Integrationsprozess benennen:
Die Gemeinschaft musste Wege finden, um ihre Identität zu stärken und damit gegenüber Einzelinteressen von einzelnen Mitgliedstaaten oder starken gesellschaftlichen Interessenvertretern durchsetzungsfähiger zu werden.
Das institutionelle Gefüge der Gemeinschaft musste weiterentwickelt werden, um die Effektivität und die demokratische Legitimation europäischer Politik zu gewährleisten.
Die Reform des Agrarmarkts, die Weiterentwicklung der Eigeneinnahmen, der Ausbau der Haushaltskompetenzen des Europäischen Parlaments sowie die Steigerung des Anteils der Regional- und Sozialpolitik am Gesamthaushalt der EG waren überfällig.
Die Gemeinschaft sah sich gezwungen, einen größeren Beitrag zum innergemeinschaftlichen Ressourcentransfer zu leisten. Die Mitgliedstaaten standen damit vor der Aufgabe, für einen höchst unterschiedlich strukturierten Wirtschaftsraum eine gemeinsame Strukturpolitik zu entwerfen.
Der Gemeinschaft stellte sich angesichts der internationalen Herausforderungen die schwierige Aufgabe, ihre außenpolitische Zusammenarbeit und Handlungsfähigkeit wesentlich zu steigern.
Der Beginn der 1980er Jahre war von einer Reformdiskussion gekennzeichnet wie selten zuvor. So kündigte der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher am 6. Januar 1981 eine neue Europa-Initiative an. Genscher nahm dabei einen seit vielen Jahren benutzten, aber immer noch sehr unscharfen Zielbegriff der Europapolitik auf: Die „Europäische Union”. Er schlug vor, dieses Ziel durch einen Vertrag – eine „Europäische Akte“ – inhaltlich zu fixieren. Die Grundgedanken dieser Akte waren eine stärkere Verbindung von EG und EPZ unter dem gemeinsamen Dach des Europäischen Rats, die Steigerung der Effizienz im Entscheidungsprozess durch den Ausbau der Führungsposition des Europäischen Rats, durch Kompetenzerweiterungen des Europäischen Parlaments und durch die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip des Ministerrats, die Einbeziehung der Sicherheitspolitik in die EPZ sowie eine engere Zusammenarbeit im kulturellen und im rechtspolitischen Bereich. Die italienische Regierung griff diese Überlegungen auf und ergänzte sie durch konzeptionelle Darlegungen zur wirtschaftlichen Integration. Am 4. November 1981 legten die deutsche und die italienische Regierung einen gemeinsamen Entwurf für eine Europäische Akte vor, der ausdrücklich auf konsensfähige Punkte konzentriert sein sollte. Mit dieser Initiative begann ein schwieriger Verhandlungsprozess mit den übrigen Partnern, in dessen Verlauf sich bald herausstellte, dass die konsensfähigen Bereiche doch enger abzustecken waren, als es die Autoren zunächst annahmen. Der Gedanke, einen Vertrag abzuschließen, wurde frühzeitig aufgegeben.
Die europäische Tagespolitik brachte Anfang der 1980er Jahre Bewegung in die Reformdebatte: In der Frage der Einführung von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat kam es zu einem ersten Präzedenzfall. Die Landwirtschaftsminister waren nicht in der Lage, sich bis zum vorgesehenen Stichtag, dem 1. April 1982, auf die Agrarpreise zu einigen. Tagungen des Agrarministerrats im April und Anfang Mai brachten keine Entscheidung. Insbesondere Frankreich pochte auf eine Einhaltung des Luxemburger Kompromisses. Eine neue Dimension erhielt das Thema plötzlich, als Großbritannien eine Blockade der Agrarpreise zum Vehikel seiner Haushaltsforderungen machte. Das Veto Großbritanniens sollte als Hebel für Forderungen dienen, die gar nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Entscheidungsmaterie standen. Großbritannien war nicht zu einem Nachgeben in der Beitragsfrage bereit. In der Beratung der Außenminister am Abend des 17. Mai 1982 bewegte sich nichts. Einen Tag später entschied dann der Ministerrat doch mit der laut Vertrag erforderlichen qualifizierten Mehrheit. Großbritannien, Dänemark und Griechenland nahmen an der Abstimmung nicht teil. Damit hatte eine subtile Verschiebung der politischen Akzente stattgefunden: Die Feststellung des Gemeinschaftswillens wurde zwar nicht schematisch unter das kompromisslose Diktat der Mehrheit, aber auch nicht mehr automatisch dem Veto der Minderheit unterworfen. Entscheidend war vor allem die Interpretation, die Frankreich der Mehrheitsabstimmung im Ministerrat gab. Die französische Regierung ließ erklären, der „Luxemburger Kompromiss“ gebe jedem Mitglied zwar die Sicherheit, dass ihm keine Entscheidung aufgezwungen werde, gegen die es ein vitales Interesse vorbringen könne. Es könne aber nicht Sinn dieses Vorbehalts sein, einem Mitglied die Möglichkeit zu geben, das Funktionieren der Gemeinschaftsprozeduren zu verhindern. Frankreich hatte damit seine Interpretation des „Luxemburger Kompromisses“ gemeinschaftsfreundlich akzentuiert. Dieser Präzedenzfall, der herausragende Bedeutung für das Binnenmarktprogramm erlangen sollte, verdeutlicht, dass sich die Reformdebatten keinesfalls im luftleeren Raum abspielten, sondern konkrete Bezüge zur europäischen Politik besaßen: Der Problemdruck machte Reformen schlicht unausweichlich.
Das Europäische Parlament beteiligte sich intensiv an den Reformdiskussionen. Dabei entwickelte es Überlegungen von sehr unterschiedlicher Reichweite. Bei allen Initiativen war das Parlament jedoch bemüht, seine politische Rolle zu stärken, die Effizienz seiner Verfahren zu verbessern und den Weg zu durchgreifenden Kompetenzerweiterungen zu ebnen. Von besonderem Ehrgeiz war zweifellos das Vorhaben, eine europäische Verfassung auszuarbeiten. Der institutionelle Ausschuss unter dem Vorsitz von Altiero Spinelli erarbeitete den Entwurf eines Vertrags zur Gründung der Europäischen Union, der am 14. Februar 1984 im Europäischen Parlament mit einer Mehrheit von 237 Stimmen bei 34 Gegenstimmen und 54 Enthaltungen angenommen wurde. Der Text blieb aber letztlich in den Debatten der nationalen Institutionen hängen. Nutzlos war die Spinelli-Initiative jedoch nicht: Sie wurde zu einem der Auslöser für die Einheitliche Europäische Akte, mit der Ende der 1980er Jahre das große Werk der Binnenmarktvollendung organisiert wurde.
Das Jahr 1984 brach auch mit der Spirale dramatischer Kostenexplosion auf dem Agrarsektor. Es machte – wenn auch nur vorsichtig und sektoral begrenzt – ein Ende mit dem Gedanken der unbegrenzten Absatzgarantie. Nach Vorvereinbarungen der Agrarminister in Bezug auf die Überproduktion bei Milch und Getreide sowie den Abbau der Währungsausgleichsbeträge fixierte der Gipfel von Fontainebleau am 25./26. Juni 1984 unter Hinzufügung von Ausnahmeregelungen für Irland die Vereinbarungen und bestätigte damit vor allem eine Beschränkung der Garantiemengen für Milch. Der Europäische Rat in Fontainebleau einigte sich neben den schlichtenden Beschlüssen in der Agrarpolitik außerdem auf eine vorläufige Lösung des seit Jahren schwelenden Haushaltskonflikts. Bis dahin hatte man Jahr für Jahr eine Minderung der britischen Haushaltsbelastungen in Form von Ad-hoc-Regelungen vereinbart. Die in Fontainebleau gefundene Lösung hob demgegenüber auf eine längerfristige, wenn auch nicht unbedingt weitsichtige Regelung eines Rabatts ab. Dieses Ausgleichssystem kam erstmals 1985 zur Anwendung. Der Europäische Rat setzte in Fontainebleau außerdem zwei Reform-Kommissionen ein, den Adonnino-Ausschuss für das „Europa der Bürger“ und den Dooge-Ausschuss zur Ausarbeitung von Vorschlägen zu institutionellen Fragen, deren Reformvorschläge jedoch auf den nachfolgenden Gipfeln kaum Gehör fanden.
Nicht zuletzt stellte der Gipfel in Fontainebleau die letzten Weichen für die Süderweiterung. Auf beiden Seiten gab es gemischte Gefühle, als die letzten Steine zum Beitritt Spaniens und Portugals aus dem Wege geräumt wurden. Als die Beitrittsverträge am 29. März 1985 unterzeichnet und am 1. Januar 1986 vollzogen wurden, herrschte dennoch Feiertagsstimmung. Die Süderweiterung wurde als selten gewordenes Erfolgserlebnis der Europapolitik begrüßt. Doch die politische Architektur der EG wandelte sich durch die Erweiterungen. Der gemeinsame Entwicklungstrend mit der Perspektive der politischen Einigung Europas war durch die Beitritte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre einem stärker ökonomisch akzentuierten Ansatz gewichen. Die Süderweiterung verschob nun nicht nur die Akzente in Richtung Mittelmeer, sondern machte auch eine Erhöhung der Ausgaben der Gemeinschaft notwendig. Bereits am Beispiel der Süderweiterung zeigte sich die enge Verbindung zwischen Reformdruck auf der einen und Erweiterungsprozess auf der anderen Seite – ein Zusammenhang, der sich vor allem im Kontext der Erweiterungen infolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion als zentrale Triebfeder für die Systementwicklung der EU erweisen sollte.
In der Reformdiskussion erfolgte auf dem Mailänder Gipfel am 28./29. Juni 1985 trotz aller Querelen zwischen den Mitgliedstaaten ein entscheidender Schritt: Der Europäische Rat beschloss, eine Regierungskonferenz einzuberufen, in deren Rahmen die bestehenden Reformvorschläge präzisiert und entscheidungsreif gemacht werden sollten. Dieser Durchbruch konnte vor allem auch deshalb erzielt werden, weil Bundeskanzler Helmut Kohl und Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand schon vor dem Mailänder Gipfel vereinbart hatten, ein gemeinsames Konzept zur politischen Fortentwicklung vorzulegen. Beide machten öffentlich deutlich, dass sie den Weg zur Politischen Union Europas auch dann zu gehen bereit seien, wenn nicht alle EG-Mitglieder folgten.
Die Bundesregierung wollte den von allen Mitgliedern geteilten Wunsch, den Binnenmarkt endlich zu realisieren, nicht als Absichtserklärung versanden lassen. Dazu waren Änderungen der Römischen Verträge notwendig. Der EWG-Vertrag legte in zentralen Feldern des Binnenmarkts Einstimmigkeit fest. Dies hatte alle Bemühungen, den Binnenmarkt zu vollenden, bisher entscheidend beeinträchtigt. Hier sollte die Einführung von Mehrheitsentscheidungen wirksam Abhilfe schaffen. In einem zweiten Bereich erschienen Korrekturen der Römischen Verträge notwendig: bei den Kompetenzen des Europäischen Parlaments. Den direkt gewählten Repräsentanten der europäischen Bürger war noch immer eine effektive Mitwirkung in weiten Bereichen verwehrt. Angesichts vielfältiger Widerstände bei den Partnern schlug die deutsche Seite vor, wenigstens in wichtigen, ausgewählten Bereichen (unter anderem Erweiterung, Assoziierung) die Mitwirkung des Europäischen Parlaments zu verankern, um damit einen ersten Schritt auf dem Weg des Europäischen Parlaments zu einer echten Zweiten Kammer im Gesetzgebungsprozess der EG zu vollziehen. Daneben wurden die Bemühungen fortgesetzt, den politischen Rahmen des Integrationsprozesses zu festigen. Der dazu formulierte deutsch-französische Vertragsentwurf, der neben die Römischen Verträge gestellt werden sollte, versuchte, die bis dahin recht erfolgreiche Kooperation im Rahmen der EPZ in eine feste Form zu gießen und zu kodifizieren.
Der Mailänder Gipfel hatte also Weichen gestellt. Aber in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit würde sich der europäische Zug nun in Bewegung setzen? Würde er einzelne Waggons abkoppeln, zumindest aber deren Bremsklötze entfernen? – Fragen, die in den Monaten zwischen Mailänder und Luxemburger Gipfel immer wieder aufgeworfen wurden. Die zwischen diesen beiden Gipfeln tagende Regierungskonferenz, an deren Vorbereitung und Durchführung alle zwölf EG-Mitgliedstaaten mitwirkten, erarbeitete schließlich die Einheitliche Europäische Akte (EEA), die auf dem Luxemburger Gipfel am 2./3. Dezember 1985 verabschiedet wurde und deren Detailformulierungen die dazu ermächtigten Vertreter der Mitglieder in den Wochen danach endgültig fixierten. Langfristige und strukturelle Bedeutung erhielten folgende Elemente der EEA:
Der Binnenmarkt sollte bis zum 31. Dezember 1992 vollendet werden. Dieser Fahrplan war bereits im Weißbuch der Kommission zur Vollendung des Binnenmarkts vom Juni 1985 unter der Ägide von Kommissionspräsident Jacques Delors entwickelt worden. Im Weißbuch wurden sämtliche existierenden Hindernisse für einen wirklich freien Markt in der EG benannt und eine Gesamtstrategie zu dessen Verwirklichung vorgelegt.
Die Regierungskonferenz und der Luxemburger Gipfel fixierten für den Bereich des Binnenmarkts ein neues Beschlussverfahren und korrigierten so die Römischen Verträge. Dieses neue Verfahren sah zusätzliche qualifizierte Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat vor, stärkte die Stellung des Parlaments, formulierte jedoch zugleich eine Fülle von Ausnahmen, bei denen die Einstimmigkeitsregel bestehen bleiben sollte. Der Luxemburger Kompromiss blieb unangetastet.
Die Regierungskonferenz und der Luxemburger Gipfel setzten nicht den Weg der Schaffung neuer Organisationsformen fort. Sie betrieben vielmehr den Versuch einer Bündelung der bestehenden Organisationsvielfalt unter einem rechtlichen Dach: Die EEA führte die EPZ mit der EG zusammen. So gab die EEA dem Verfahren der EPZ eine rechtliche Form.
Die EEA legte weitere Kompetenzen der Gemeinschaft in Bereichen fest, die in den Römischen Verträgen nicht oder nur am Rande erwähnt worden waren, z.B. im Bereich der Umwelt-, der Forschungs- und Technologie- und der Sozialpolitik.
Im Februar 1986 wurde die EEA von – seit dem Beitritt Griechenlands Anfang 1981 – nunmehr zwölf Regierungen der Mitgliedstaaten unterzeichnet und trat am 1. Juli 1987 in Kraft. Und das Binnenmarktprogramm nahm Fahrt auf: Standen jahrelang Fragen der institutionellen Fortentwicklung, der Finanzausstattung und der Reform des Agrarmarkts im Vordergrund, so wurden diese nun abgelöst von einem zugkräftigen neuen Thema, der Vollendung des Binnenmarkts. „Europa ‘92“ hieß das Kürzel für diesen europapolitischen Motivationsschub. Die sozialpsychologische Kraft dieses Themenwechsels löste jedoch zugleich Besorgnis aus – innerhalb der EG wegen der Gefährdung sozialer Besitzstände und der Frage, ob man dem Tempo des Wandels und der Verschärfung des Wettbewerbs gewachsen sei, außerhalb der Gemeinschaft wegen der Befürchtung von Wettbewerbsnachteilen und einer Abschottung des EG-Binnenmarkts.
Mitten in diese Lage hinein sah sich die EG jedoch plötzlich mit einem Ereignis konfrontiert, das in der Folgezeit die Entwicklung der Gemeinschaft maßgeblich prägen und Europa ein völlig neues Gesicht verleihen sollte: Die politischen Umwälzungen in Europa Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre.
3 Das Ende der Spaltung: Reformmarathon und die größte Erweiterung in der Geschichte der EU
Die markante Zäsur des Mauerfalls 1989 veränderte die europäische Bühne tief greifend. Mit dem Ende des Kommunismus schien plötzlich die Vision einer Rückkehr Mittel- und Osteuropas in ein freies, friedliches und prosperierendes Gesamteuropa ebenso möglich wie der Alptraum eines Rückfalls Europas in den Streit der Nationalstaaten, genährt durch soziale und ethnische Spannungen.
Nach dem Ende des ideologischen Konflikts zwischen Ost und West kam den Europäischen Gemeinschaften eine neue Schlüsselfunktion für den Kontinent zu. Die jungen Nationalstaaten lenkten ihre Interessen rasch auf die erfolgreiche Integrationsgemeinschaft im Westen. Die EG wurde aufgrund ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit und politischen Stärke zum Magneten Gesamteuropas. Nach schwierigen Verhandlungen wurden zunächst Europaabkommen mit den mittel- und osteuropäischen Staaten abgeschlossen. Nach den Beschlüssen von Kopenhagen 1993 wurde die Beitrittsperspektive dieser Abkommen zu einem moralischen Versprechen des Westens und der Beitritt wurde energisch vorangetrieben. Der Beitritt der bisher in der Europäischen Freihandelszone (EFTA) organisierten Länder Österreich, Schweden und Finnland Anfang 1995 zeugte vom Erfolg der Gemeinschaften, die weit über die einer wirtschaftliche Interessengemeinschaft hinausragte.
Die bevorstehenden Erweiterungen gingen Hand in Hand mit der Vertiefung der bestehenden Gemeinschaften. Die Vollendung des Binnenmarkts wurde von den neuen Herausforderungen, die der Umbruch im Osten und die deutsche Einheit an die Gemeinschaft stellten, angetrieben. Die EG stand angesichts von Vertiefung und Erweiterung Anfang der 1990er Jahre vor einem Berg an unerledigten Aufgaben. Die Europäische Union glich damit ein Jahrzehnt lang mehr denn je einer „Baustelle“.
Die Begründung der „Europäischen Union“ mit dem Vertrag von Maastricht
Die Erfüllung der Verpflichtungen der Einheitlichen Europäischen Akte, die innen- wie außenpolitischen Folgewirkungen des Binnenmarkts, der Umbruch im östlichen Teil Europas und das Wiederaufbrechen der deutschen Frage ließen die Europäer näher zusammenrücken. Die Integrationslogik des Binnenmarkts und den Drei-Stufen-Plan des Delors-Berichts zur Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) von 1989 aufgreifend, begann im Dezember 1990 in Rom die Regierungskonferenz zur WWU. Parallel wurde eine Regierungskonferenz zur Gründung einer Politischen Union eröffnet.
In Maastricht fand die bis zu diesem Zeitpunkt weitgehendste Reform der Römischen Verträge am 9. und 10. Dezember 1991 ihren Abschluss. Das Leitbild einer „Europäischen Union“ wurde durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Union vom 7. Februar 1992 verwirklicht: Die Gemeinschaften wurden von einer hauptsächlich wirtschaftlich integrierten und auf der politischen Zusammenarbeit beruhenden Einrichtung in eine Union weiterentwickelt, die durch den neu geschaffenen EU-Vertrag auch eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und eine Zusammenarbeit in der Justiz- und Innenpolitik (ZJIP) umfassen sollte. Diese Konstruktion war letztlich eine Konsequenz der unterschiedlichen Auffassungen über die Finalität der Union. GASP und ZJIP verblieben in der intergouvernementalen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, wenn auch im formalen Strukturrahmen der Union, von der Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union ausgeklammert und fielen nicht unter die Entscheidungsverfahren der Gemeinschaft.
Innerhalb der EG – der EWG-Vertrag wurde in „EG-Vertrag“ umbenannt – sind vor allem zwei entscheidende Schritte hervorzuheben: Die Festlegung des Fahrplans zur Vollendung der Währungsunion und die substanzielle Einbeziehung des Europäischen Parlaments in den Entscheidungsprozess:
Auf der Grundlage des Delors-Berichts wurde ein Drei-Stufen-Plan beschlossen, der die Verwirklichung der WWU in behutsamen, doch evolutionären Schritten zum großen Sprung vorzeichnete. Die erste Stufe begann bereits am 1. Juli 1990 mit einer Kapitalverkehrsliberalisierung und einer verstärkten Koordinierung der Währungspolitiken, die zweite Stufe umfasste ab dem 1. Januar 1994 insbesondere die Errichtung des Europäischen Zentralbanksystems. Mit der dritten Stufe wurden am 1. Januar 1999 die Wechselkurse in zunächst elf Teilnehmerstaaten (Griechenland kam erst am 1. Januar 2001 hinzu) endgültig fixiert. Der Euro wurde 2002 alleiniges gültiges Zahlungsmittel in den zwölf WWU-Staaten.
Die Kompetenzen des Europäischen Parlaments wurden erheblich ausgebaut. Seit dem Vertrag von Maastricht muss eine neu eingesetzte Kommission vom Parlament bestätigt werden. Die Wahlperioden von Parlament und Kommission wurden angeglichen. Das Parlament erhielt Untersuchungs- und Petitionsrechte. Im Rahmen der gemeinschaftlichen Gesetzgebung wurde dem Parlament das Mitentscheidungsverfahren für die Bereiche Binnenmarkt, Verbraucherschutz, Umwelt und gesamteuropäische Verkehrsnetze vertraglich zugesichert.
Die beiden Formen intergouvernementaler Zusammenarbeit im einheitlichen institutionellen Rahmen der EU markierten den Beginn einer qualitativ intensivierten Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Innen- und Justizpolitik:
Die Mitglieder verpflichteten sich, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in allen Bereichen zu entwickeln. Dem Rat der EU stand durch Maastricht nun ein Instrumentarium zur Verfügung, das der bisherigen Koordinierung im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit gefehlt hatte.
Bereiche der Innen- und Justizpolitik wurden erstmals vertraglich als Gegenstände von gemeinsamem Interesse konkretisiert. Der Vertrag von Maastricht umfasste die Asyl-, Einwanderungs- und Visapolitik, die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen sowie die Bekämpfung von Terrorismus, illegalem Drogenhandel und internationaler Kriminalität. Darüber hinaus wurde der Aufbau eines Europäischen Polizeiamts (EUROPOL) vereinbart.
Die Ratifizierung des Maastrichter Vertrags innerhalb der EG-Mitgliedstaaten erwies sich als mühsamer und langwieriger als erwartet. Volksentscheide über den Unionsvertrag gab es in Dänemark, Irland und Frankreich. Während sich die beiden letztgenannten für das Vertragswerk entschieden, führte die Abstimmung in Dänemark zu einer Krise: 50,7 Prozent der Dänen stimmten gegen die Beschlüsse von Maastricht und drohten die darin enthaltenen wichtigen Reformen zu blockieren. 1992 – das magische Jahr der Binnenmarkt-Vollendung – wurde zum Wechselbad der Gefühle. Zwar konnte das „Nein“ der Dänen nach Zugeständnissen in ein „Ja“ umgewandelt werden. Aber die geradezu mythologische Undurchschaubarkeit der Vertragsrevision von Maastricht bestimmte auch in der Folge die zähen Debatten, vor allem in Deutschland und Großbritannien. Nachdem das britische Unterhaus endlich zugestimmt und in Deutschland die eingereichten Verfassungsklagen zurückgewiesen worden waren, war die letzte Hürde genommen. Mit fast einem Jahr Verspätung konnte der Vertrag von Maastricht im November 1993 in Kraft treten.
Der Ratifizierungsprozess von Maastricht verstärkte einen schon länger anhaltenden Trend der Europamüdigkeit in der europäischen Bevölkerung. Bereits in den 1980er Jahren war die Beteiligung an den Europawahlen deutlich zurückgegangen. Lag sie im Jahr der ersten Wahl (1979) EU-weit noch bei ca. 63 Prozent, so betrug sie 1984 rund 61 Prozent und 1989 nur noch knapp 59 Prozent im EG-Mittel. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 1999 fiel die Beteiligung mit knapp 50 Prozent auf einen historischen Tiefstand, der mit den Wahlen im Juni 2004 noch einmal unterboten wurde: Lediglich 45 Prozent der EU-Bürger in den damals 25 Mitgliedstaaten machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Dieser eher lustlose Vollzug der Wahlen kann als Ausdruck der Geringschätzung der Rolle des Europäischen Parlaments, aber auch als eine Konsequenz der fehlenden Politisierung der Europawahlen gedeutet werden. In den 1990er Jahren war sie groß wie nie: Die Kluft zwischen dem Interesse der Bürger am Integrationsprozess auf der einen und der unvergleichlichen Dynamik von Vertiefung und Erweiterung auf der anderen Seite. Denn mit Maastricht schien nicht mehr als ein Zwischenschritt geschafft. Bereits in Maastricht einigten sich die Zwölf daher darauf, schon1996 den Vertrag auf Notwendigkeiten zur Revision zu überprüfen.
Der Vertrag von Amsterdam: ungenutzte Chance zur Kurskorrektur
Die Ergebnisse der Vertragsrevision von Amsterdam wurden dem in Maastricht vorgegebenen Auftrag kaum gerecht. Die Analyse der mitgliedstaatlichen Positionen zur Reformagenda deutete bereits frühzeitig auf keinen durchschlagenden Erfolg der Regierungskonferenz hin. Als die Staats- und Regierungschefs am 16. und 17. Juni 1997 zu den abschließenden Verhandlungen zusammentraten, einigten sie sich erwartungsgemäß nur auf einen minimalen gemeinsamen Nenner. EG- und EU-Vertrag wurden konsolidiert und neu nummeriert. Durch die Kontroverse um Beschäftigungspolitik und Stabilitätspakt im Vorfeld des Gipfels wurde das eigentliche Ziel der Vertragsreform – die Wahrung der Handlungsfähigkeit der EU-Institutionen mit Blick auf die anstehende Erweiterung – in den Hintergrund gedrängt. Dennoch trug der Vertrag von Amsterdam in zentralen Bereichen zur weiteren Vertiefung der EU bei:
Die GASP wurde durch die Schaffung des Amtes eines „Hohen Vertreters“ gestärkt. Dieser sollte die Außenpolitik der EU repräsentieren und zusammen mit der Kommission die jeweilige Ratspräsidentschaft unterstützen.
Die in Maastricht begonnene Zusammenarbeit in der Justiz- und Innenpolitik gewann durch die Überführung des Bereichs der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen in die EG an Integrationsdichte. Die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen verblieb in der intergouvernementalen Zusammenarbeit, wurde aber optimiert. Die Grundlagen für eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik wurden gelegt.
Um die Effizienz und Handlungsfähigkeit der EU zu steigern, wurden Mehrheitsentscheidungen im Rat ausgeweitet und dem Parlament weitere Rechte übertragen. Neben einem größeren Mitspracherecht bei der Auswahl des Kommissionspräsidenten wurde das Mitentscheidungsrecht des Parlaments auf über 20 neue Bereiche erweitert.
Als entscheidende Zäsur und wohl einzig kreative Entscheidung ist rückblickend die Einführung von allgemeinen Flexibilitätsklauseln in das Vertragswerk anzusehen. Die „Verstärkte Zusammenarbeit“ unterlag jedoch im Vertrag von Amsterdam noch einer Reihe von Einschränkungen, so dass die Anwendbarkeit der Klauseln zweifelhaft blieb.
Das größte Versäumnis des Vertrags von Amsterdam waren jedoch die verschleppten institutionellen Weichenstellungen, die im Nachgang zur Regierungskonferenz verniedlichend als die „Left-overs“ (Überbleibsel) von Amsterdam bezeichnet wurden. Insbesondere handelte es sich dabei um die künftige Größe und Zusammensetzung der Kommission, die Stimmengewichtung im Ministerrat sowie die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen bei Abstimmungen im Ministerrat. Um die sich bereits zu diesem Zeitpunkt abzeichnende Erweiterung um bis zu zwölf weitere Staaten verkraften zu können, musste die EU diese ungelösten Fragen dringend in Angriff nehmen. Auf den ersten Blick erscheinen diese Themen fast technisch-banal, doch handelt es sich bei genauerem Hinsehen um Fragen von Macht und Einfluss, die sich erfahrungsgemäß nur unter größten Anstrengungen und Zeitdruck lösen lassen. Mit den „Left-overs“ waren die zentralen Reformthemen der nächsten Vertragsrevision auf dem Tisch: Wenige Monate nach In-Kraft-Treten des Vertrags von Amsterdam im Mai 1999 begann zur Jahrtausendwende die Regierungskonferenz von Nizza.
Der Versuch von Nizza
Bereits die Vorbereitungen der Regierungskonferenz 2000, die im Februar 2000 unter portugiesischer Präsidentschaft feierlich eröffnet und mit der Einigung auf den Vertrag von Nizza im Dezember 2000 unter französischer Präsidentschaft abgeschlossen wurde, zeigten: Die strategische Kraft der Europapolitik war nahezu erschöpft. Grabenkämpfe zwischen großen und kleinen, alten und neuen, armen und reichen Mitgliedstaaten hatten die Regierungskonferenz zur Institutionenreform und den entscheidenden Gipfel bestimmt. Fünf Tage lang verhandelten die Staats- und Regierungschefs in Nizza nahezu 100 Stunden lang, und doch war das Ergebnis ernüchternd:
Die Verkleinerung der Kommission wurde vertagt: Zwar sah der Vertrag von Nizza vor, dass von 2005 an jedes Land nur noch einen Kommissar stellen darf, so dass die großen Mitgliedstaaten ab diesem Zeitpunkt auf ihren zweiten Kommissar verzichten müssten. Erst wenn die EU 27 Mitgliedstaaten umfasst, sollte jedoch das Prinzip „weniger Kommissare als Mitgliedstaaten“ gelten. Die Details der Regelung müssten die Mitgliedstaaten dann einstimmig beschließen.
Die Stimmengewichtung im Rat der EU wurde verkompliziert: Mehrheitsentscheidungen wären gemäß Nizza nur noch dann möglich, wenn eine Mehrheit der Stimmen, der Staaten und der Bevölkerung erreicht wird („dreifache Mehrheit“).
Trotz dieser dreifachen Absicherung wurde eine deutliche Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen im Rat nicht gewagt. Es wurden zwar in einigen Politikfeldern sowie bei personellen Entscheidungen die Mehrheitsbeschlüsse ausgeweitet, doch der große Durchbruch gelang nicht.
Die Lösung der drei großen „Left-overs“ von Amsterdam fiel damit wenig zukunftsträchtig aus. Und auch in weiteren Reformbereichen wurden lediglich Kompromisse auf einem kleinen gemeinsamen Nenner gefunden. So wurde die Sitzverteilung im Europäischen Parlament zwar den neuen Verhältnissen nach der Erweiterung angepasst, doch auch hier blieben sachliche Unstimmigkeiten bei der Sitzverteilung bestehen. Das im Vertrag von Amsterdam verankerte Vetorecht beim Einstieg in eine „Verstärkte Zusammenarbeit“ fiel zwar in Nizza – aber nicht für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Die Öffnung der Flexibilisierung geschah darüber hinaus unter dem Vorbehalt, dass sie sich nicht auf neue Politikfelder beziehen dürfe.
Trotz aller halbherzigen Reförmchen haben die Staats- und Regierungschefs in Nizza auch einen richtungsweisenden Beschluss gefasst. Auf eine deutsch-italienische Initiative wurde dem Vertrag von Nizza die Erklärung Nr. 23 zur Zukunft der EU angehängt. In dieser sprachen sich die Mitgliedstaaten für die Aufnahme eines breit angelegten Dialogs aus, der insbesondere vier Themen umfassen sollte:
den Status der in Nizza nur feierlich proklamierten EU-Grundrechte- charta;
die trennscharfe Abgrenzung der Zuständigkeiten im Mehrebenensystem;
die Rolle der nationalen Parlamente im Einigungsprozess und
die Vereinfachung der Verträge.
Was in der Folgezeit noch etwas umständlich als so genannter „Post-Nizza-Prozess“ daherkam, entwickelte sich innerhalb weniger Monate zu einer veritablen europäischen Zukunftswerkstatt.
„Europa XXL“: Erweiterungsvorbereitungen und die Entgrenzung Europas
Parallel und eng verzahnt mit den Reformanstrengungen der Europäischen Union nahm ab Mitte der 1990er Jahre auch der Beitrittsprozess an Fahrt auf. Mit der Entscheidung des Europäischen Rats in Luxemburg vom 12./13. Dezember 1997 wurde die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien, Estland und Zypern beschlossen. Auf dem Gipfel von Helsinki im Dezember 1999 fiel der Beschluss zu Verhandlungen mit sechs weiteren EU-Anwärtern – Lettland, Litauen, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien und Malta –, darüber hinaus wurde der Türkei der Status eines Beitrittskandidaten verliehen. Am Ende der 1990er Jahre zeichnete sich damit ein Beitritt von insgesamt zwölf neuen Staaten – sowie möglicherweise der Türkei – ab. Die EU setzte zum quantitativen Sprung an: Die Vergrößerung der EU von 15 auf 27 Mitgliedstaaten.
Gegenstand der Verhandlungen mit den Beitrittsaspiranten war der in 31 Kapitel unterteilte gesamte rechtliche Besitzstand der EU, darunter 14.000 Rechtsakte, verteilt auf 80.000 Seiten. Die Beitrittsverhandlungen verliefen – mit den Ausnahmefällen Bulgarien und Rumänien – zügiger als erwartet. Die Kommission empfahl daher in ihrem Fortschrittsbericht vom Oktober 2002 die Aufnahme von zunächst zehn der Beitrittskandidaten. Die Brüsseler Behörde bescheinigte diesen Staaten eine große Übereinstimmung mit dem gemeinschaftlichen Besitzstand (acquis communautaire