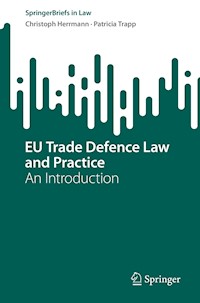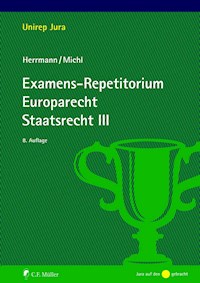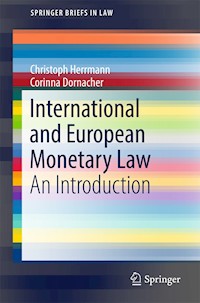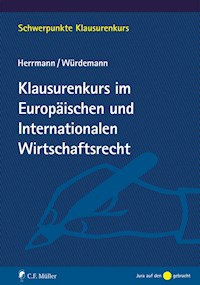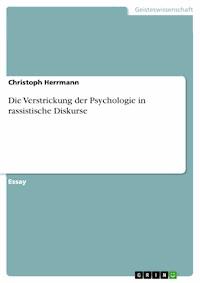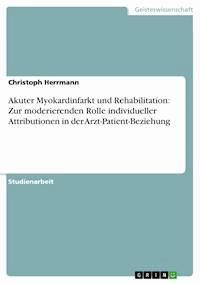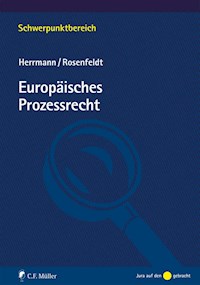
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schwerpunktbereich
- Sprache: Deutsch
Dieses neue Lehrbuch stellt konzentriert die ausbildungsrelevanten Fragen und Zusammenhänge des Europäischen Prozessrechts dar. Einzelne Abschnitte widmen sich den Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (GHEU): dem Vertragsverletzungsverfahren, der Nichtigkeits-, Untätigkeits- und Amtshaftungsklage, dem Vorabentscheidungsverfahren und weiteren Verfahrensarten (Gutachtenverfahren, Beamtenstreitigkeiten, Schiedssachen), dem einstweiligen Rechtsschutz, Rechtsmittelverfahren und der Inzidentrüge. Daneben nimmt das Lehrbuch die Einflüsse des Unionsrechts auf das Prozessrecht der Mitgliedstaaten in den Blick und beleuchtet das Rechtsschutzsystem des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), das mit dem Unionsrecht in vielfältiger Weise verknüpft wird. Umfangreichen Literaturangaben zum Abschluss der jeweiligen Abschnitte erleichtern eine weitere Vertiefung. Neun integrierten Fälle mit Lösung und zahlreiche Beispiele machen die abstrakte Materie anschaulich, die 90 Lernerfolgskontrollfragen dienen der Übung und Selbstkontrolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Europäisches Prozessrecht
von
Dr. Christoph Herrmann, LL.M. European Law (London)o. Professor an der Universität Passau
und
Ass. jur. Herbert RosenfeldtRichter auf Probe am Verwaltungsgericht Karlsruhe
1. Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9589-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.de
© 2019 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Während an Lehrbüchern zum allgemeinen Europarecht kein Mangel herrscht, fristet das Europäische Prozessrecht in der Ausbildungsliteratur ein relatives Schattendasein, obwohl es für die Ausbildung im vertieften Europarecht von besonderer Bedeutung sein muss.
Mit dem vorliegenden Werk möchten wir das diesbezügliche Angebot ergänzen, aktualisieren und dabei den Blickwinkel auf das Europäische Prozessrecht erweitern. Mit in den Blick genommen werden neben den Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (GHEU) auch die Einflüsse des Unionsrechts auf das Prozessrecht der Mitgliedstaaten. Zusätzlich wird das Rechtsschutzsystem des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) beleuchtet, das mit dem Unionsrecht in vielfältiger Weise verknüpft wird.
Die Ausgangsbasis für dieses Buch bildet ein Onlinekursangebot der virtuellen hochschule bayern (vhb). Der vhb gilt unser Dank für die Unterstützung bei der Kursentwicklung sowie für die Einwilligung in die vorliegende Buchpublikation. Für diese haben wir den Kurs in Buchform gebracht, umfassend überarbeitet und aktualisiert sowie inhaltlich gestrafft. Nach der Konzeption der Schwerpunktbereichs-Reihe behandelt das Werk nicht sämtliche Fragen des europäischen Prozessrechts und geht an manchen Stellen auch nicht in die mögliche Tiefe, sondern konzentriert sich auf die für die Ausbildung (aus unserer Sicht) relevantesten Fragen und Zusammenhänge. Weitere Vertiefungen erlauben die umfangreichen Literaturangaben zum Abschluss der jeweiligen Kapitel. Zur Selbstkontrolle und besseren Verständlichkeit dienen die insgesamt neun integrierten Fälle, zahlreiche Beispiele sowie die 90 Lernerfolgskontrollfragen.
Ohne die Unterstützung zahlreicher anderer Menschen wäre dieses Buch naturgemäß nicht zustande gekommen. Unser Dank gilt dem gesamten Team des Lehrstuhls, darunter namentlich insbesondere Frau Wiss. Mitʼin Gesa Kübek und Frau Wiss. Mitʼin Julia Münzenmaier für die Mitwirkung an der vhb-Kurserstellung sowie Herrn Wiss. Mit. Christopher Hook für die Hilfe bei der Überarbeitung des Kurses und Transformierung ins Buchformat. Herrn stud. iur. Tim Ellemann danken wir sehr herzlich für die Unterstützung bei der Fahnenkorrektur.
Für Kritik und Anregungen – bitte per Mail an [email protected] – sind wir jederzeit dankbar.
Passau/Karlsruhe im März 2019
Prof. Dr. Christoph Herrmann, LL.M.
Ass. iur. Herbert Rosenfeldt
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
§ 1Einführung
A.Bedeutung des Prozessrechts
B.Thematische Begrenzung
I.Gerichtliche Rechtsdurchsetzung
II.Europäisches Prozessrecht
III.Europäisierung des nationalen Prozessrechts
C.Komplementärer und kooperativer Rechtsschutz in Europa
I.Rein nationale Verfahren
II.Rein unionale Verfahren
III.Mischformen in Vollzug und Rechtsschutz
IV.Zentrale Rolle des GHEU
§ 2Die EU als Rechtsgemeinschaft
A.Begriffsgenese und Adaption durch die Rechtsprechung
B.Rechtsstaatlichkeit in der EU
I.Rechtsstaatliche Verbürgungen
II.Adressaten und Durchsetzbarkeit des Rechtsstaatsprinzips
III.Kopenhagen-Dilemma und Rechtsstaatsmechanismus
C.Unionaler Rechtsschutz durch Gerichte
I.Rolle des GHEU
1.Wahrung der Kompetenzordnung
2.Konkretisierung des Rechts
3.Fortbildung des Rechts
II.Rolle der nationalen Gerichte
D.Recht auf effektiven Rechtsschutz
I.Rechtsgrundlagen
II.Adressaten und Gewährleistungen
E.Zusammenfassung
§ 3Der Gerichtshof der EU
A.Rechtsgrundlagen
B.Aufbau der Unionsgerichtsbarkeit
I.Gerichtshof (EuGH)
1.Zusammensetzung
2.Spruchkörper
II.Gericht (EuG)
1.Zusammensetzung
2.Spruchkörper
3.Fachgerichte
C.Zuständigkeit des GHEU
I.Verbandszuständigkeit der EU
II.Organzuständigkeit des GHEU
III.Zuständigkeitsbeschränkungen
IV.Verteilung der sachlichen Zuständigkeit
1.Zuständigkeit des Gerichtshofs
2.Zuständigkeit des Gerichts
3.Zuständigkeit der Fachgerichte
D.Verfahrensablauf vor dem EuGH
I.Verfahrenseinleitung
II.Schriftliches Verfahren
III.Mündliches Verfahren
IV.Verfahrensabschluss
E.Auslegung des Unionsrechts
I.Anerkannte Auslegungsmethoden
1.Grammatikalische Auslegung
2.Systematische Auslegung
3.Historische Auslegung
4.Teleologische Auslegung
II.Grenzen der Auslegung
F.Reformen am GHEU
I.Vergrößerung des Europäischen Gerichts
II.Parlamentarische Mitwirkung bei der Richterwahl
III.Änderung der GHEU-Verfahrensvoraussetzungen
G.Ausblick: Auswirkungen des Brexits
H.Zusammenfassung
§ 4Das Vertragsverletzungsverfahren
A.Charakter und Funktion des Verfahrens
B.Zulässigkeit des Vertragsverletzungsverfahrens
I.Zuständigkeit
II.Parteifähigkeit
III.Ordnungsgemäße Durchführung des Vorverfahrens
1.Das Vorverfahren der Aufsichtsklage
a)Das Mahnschreiben der Kommission
b)Die begründete Stellungnahme der Kommission
2.Das Vorverfahren der Staatenklage
a)Der Antrag eines Mitgliedstaats und das kontradiktorische Verfahren
b)Die abschließende Stellungnahme der Kommission
IV.Klagegegenstand
V.Ordnungsgemäße Klageerhebung
VI.Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis
C.Begründetheit des Vertragsverletzungsverfahrens
I.Verstoß gegen Unionsrecht
II.Nachweispflichten/Beweislast
III.Rechtfertigung des Vertragsverstoßes
D.Entscheidung des EuGH
E.Die Durchsetzung des Urteils
F.Zusammenfassung
§ 5Die Nichtigkeitsklage
A.Funktion und Bedeutung der Nichtigkeitsklage
B.Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage
I.Zuständigkeit
II.Parteifähigkeit
1.Parteifähigkeit des Klägers
a)Privilegiert Klageberechtigte
b)Teilprivilegiert Klageberechtigte
c)Nicht-privilegiert Klageberechtigte
2.Parteifähigkeit des Beklagten
III.Tauglicher Klagegegenstand (Statthaftigkeit)
1.Rechtlich existente Handlung der EU
2.Rechtswirkung nach außen
IV.Richtiger Beklagter
V.Klageberechtigung
1.Privilegiert klageberechtigte Kläger (Abs. 2)
2.Teilprivilegiert klageberechtigte Kläger (Abs. 3)
3.Nicht-privilegiert klageberechtigte Kläger (Abs. 4)
a)Adressatenstellung
b)Unmittelbare und individuelle Betroffenheit
c)Klagen gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter
VI.Geltendmachung von Klagegründen
VII.Ordnungsgemäße Klageerhebung
VIII.Rechtsschutzbedürfnis
C.Begründetheit der Nichtigkeitsklage
D.Entscheidung und Urteilswirkungen
I.Grundsatz der kassatorischen Urteilswirkung
II.Ausnahmen von der kassatorischen Urteilswirkung
E.Zusammenfassung
§ 6Die Untätigkeitsklage
A.Funktion und Bedeutung der Untätigkeitsklage
B.Zulässigkeit der Untätigkeitsklage
I.Zuständigkeit
II.Parteifähigkeit
III.Tauglicher Klagegegenstand
1.Klagen der EU-Organe und der Mitgliedstaaten
2.Individualuntätigkeitsklagen
IV.Richtiger Beklagter
V.Klageberechtigung
VI.Geltendmachung von Klagegründen
VII.Ordnungsgemäßes Vorverfahren
1.Aufforderung zum Tätigwerden
2.Ergebnisloser Fristablauf
VIII.Ordnungsgemäße Klageerhebung
IX.Rechtsschutzbedürfnis
C.Begründetheit der Untätigkeitsklage
D.Entscheidung und Urteilswirkungen
E.Zusammenfassung
§ 7Die Amtshaftungsklage
A.Funktion der Amtshaftungsklage
B.Zulässigkeit der Amtshaftungsklage
I.Zuständigkeit
II.Parteifähigkeit
1.Aktive Parteifähigkeit
2.Passive Parteifähigkeit
III.Ordnungsgemäße Klageerhebung
IV.Rechtsschutzbedürfnis
1.Verhältnis zu innerstaatlichem Rechtsschutz
2.Verhältnis zur Nichtigkeitsklage
C.Begründetheit der Amtshaftungsklage
I.Abgrenzung zu vertraglichen Haftungsansprüchen
II.Voraussetzungen des Amtshaftungsanspruchs
1.Handeln eines Organs oder Bediensteten der Union
2.Verletzung der Rechte Einzelner
3.Qualifizierter Rechtsverstoß
4.Schaden
5.Kausalzusammenhang zwischen Rechtsverstoß und Schaden
D.Entscheidung des GHEU
E.Zusammenfassung
§ 8Das Vorabentscheidungsverfahren
A.Funktionen des Vorabentscheidungsverfahrens
I.Objektivrechtliche Dimension
II.Individualrechtsschützende Dimension
B.Zulässigkeit des Vorabentscheidungsverfahrens
I.Zuständigkeit
II.Zulässiger Vorlagegegenstand
1.Auslegungsfragen
2.Gültigkeitsfragen
a)Prüfungsumfang
b)Verhältnis zur Nichtigkeitsklage
3.Formulierung der Vorlagefragen
III.Vorlageberechtigung
IV.Entscheidungserheblichkeit
1.Doppelte Folgenbewertung
2.Beurteilungsperspektive und Ausnahmen
V.Ordnungsgemäße Vorlage
VI.Allgemeines Vorlageinteresse
C.Beantwortung der Vorlagefragen
D.Entscheidungswirkungen des Vorabentscheidungsverfahrens
I.Entscheidungswirkung für den Ausgangsrechtsstreit
II.Allgemeine Entscheidungswirkungen
1.Auslegungsfragen
2.Gültigkeitsfragen
a)Bestätigung der Gültigkeit
b)Feststellung der Ungültigkeit
E.Vorlagepflicht mitgliedstaatlicher Gerichte
I.Vorlagepflicht letztinstanzlich entscheidender Gerichte
1.Adressaten der Vorlagepflicht
2.Ausnahmen von der Vorlagepflicht
a)Gesicherte Rechtsprechung des EuGH
b)Acte-Clair-Doktrin
c)Acte éclairé
d)Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes
II.Annahme der Ungültigkeit einer Unionsrechtsnorm
III.Vorlagepflicht im vorläufigen Rechtsschutz
IV.Folgen eines Verstoßes gegen die Vorlagepflicht
1.Vertragsverletzungsverfahren
2.Unionsrechtlicher Staatshaftungsanspruch
3.Nationalrechtliche Rechtsbehelfe
F.Zusammenfassung
§ 9Weitere Verfahrensarten
A.Gutachtenverfahren
I.Zulässigkeit
II.Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen
III.Prüfungsumfang
IV.Wirkungen des Gutachtens
B.Beamtenstreitigkeiten
C.Klagen in Schiedssachen
I.Zuständigkeitsbegründende Schiedsklauseln
II.Zuständigkeitsbegründende Schiedsverträge
D.Sonstige Verfahren
E.Zusammenfassung
§ 10Der einstweilige Rechtsschutz
A.Zulässigkeit
I.Zuständigkeit
II.Anhängiges Hauptsacheverfahren
III.Antragsberechtigung
IV.Keine offensichtlich unzulässige Klage in der Hauptsache
V.Keine Vorwegnahme der Hauptsache
VI.Ordnungsgemäße Antragstellung
B.Begründetheit
I.Notwendigkeit
II.Dringlichkeit
III.Interessenabwägung
IV.Entscheidung über den einstweiligen Rechtsschutz
C.Zusammenfassung
§ 11Das Rechtsmittelverfahren
A.Vor- und Nachteile
B.Allgemeine Grundsätze der GHEU-Rechtsmittel
C.Rechtsmittel gegen Entscheidungen des EuG
I.Zulässigkeit
II.Anschlussrechtsmittel
III.Begründetheit
IV.Entscheidung des EuGH
D.Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Fachgerichte
E.Überprüfungsverfahren vor dem EuGH
F.Zusammenfassung
§ 12Die Inzidentrüge
A.Anwendbarkeitsvoraussetzungen
I.Anhängigkeit eines Verfahrens am GHEU
II.Rügeberechtigung
III.Rügegegenstand
IV.Entscheidungserheblichkeit
B.Begründetheit und Wirkung der Inzidentrüge
C.Zusammenfassung
§ 13Die Einwirkung des Unionsrechts auf den nationalen Rechtsschutz
A.Unionsrechtlicher Einfluss auf die Bundesverfassungsgerichtsbarkeit
I.Grundrechtsträgerschaft juristischer Personen
II.Deutschen-Grundrechte
III.„Grundrechte“ auf Unionsrechtsbeachtung
1.Recht auf den gesetzlichen Richter
2.Allgemeiner Gleichheitssatz
3.Allgemeine Handlungsfreiheit
B.Unionsrechtlicher Einfluss auf Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess
I.Bestandskraft unionsrechtswidriger Verwaltungsakte
1.Aufhebung begünstigender Verwaltungsakte
2.Aufhebung belastender Verwaltungsakte
II.Sofortvollzug und vorläufiger Rechtsschutz
III.Klagebefugnis und subjektiver Rechtsschutz
C.Unionsrechtlicher Einfluss auf die Zivilgerichtsbarkeit
I.„Grenzüberschreitender Bezug“ als Anwendungsvoraussetzung weitergehenden Unionsrechts
II.Internationale Entscheidungszuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung
1.Internationale Entscheidungszuständigkeit
2.Gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung
III.Europäische Erkenntnisverfahren
1.Europäisches Mahnverfahren
2.Europäisches Bagatellverfahren
IV.Stärkung des kollektiven Rechtsschutzes
1.Anliegen und Inhalt der Kommissionsempfehlung
2.Grenzen der Kommissionsempfehlung
3.Vor- und Nachteile kollektiver Rechtsschutzelemente
D.Unionsrechtlicher Einfluss auf die Strafgerichtsbarkeit
I.Europäischer Haftbefehl
II.Eurojust
III.Europäische Staatsanwaltschaft
E.Zusammenfassung
§ 14Der prozessuale Grundrechtsschutz in Europa
A.Menschenrechtsschutz in der EU
I.Ausgangslage und Rechtsfortbildung durch den EuGH
II.Grundrechtsschutz durch den Vertrag von Maastricht
III.Aktuelle Rechtsquellen
1.Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC)
2.Allgemeine Rechtsgrundsätze
IV.Bedeutung und Funktion der Grundrechte im Unionsrecht
1.Primärrechtlicher Maßstab für unionales Handeln
2.Maßstab für die mitgliedstaatliche Durchführung des Unionsrechts
3.Auswirkungen auf die Ausübung von Grundfreiheiten
V.Gerichtliche Durchsetzung
1.Anforderungen an die gerichtliche Durchsetzbarkeit
2.Verfahren vor dem GHEU
3.Verfahren vor mitgliedstaatlichen Gerichten
B.Das EMRK-System
I.Die EMRK
1.Rechtswirkungen der EMRK
a)Deutsche Rechtsordnung
b)Recht der EU
2.Gewährleistungsumfang
3.Prüfungsstruktur
a)Sachlicher und persönlicher Schutzbereich
b)Eingriff
c)Rechtfertigung
II.Der EGMR
1.Zusammensetzung
2.Arbeitsanfall
3.Auslegungsgrundsätze
III.Die Individualbeschwerde
1.Zulässigkeitsvoraussetzungen
a)Zuständigkeit des Gerichtshofs
b)Beschwerdeführer
c)Keine offensichtliche Unbegründetheit
d)Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs
e)Frist
f)Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen
2.Verfahrensgang
3.Rechtsfolgen und Durchsetzung der Urteile
IV.Weitere Verfahrensarten
1.Die Staatenbeschwerde
2.Das Gutachtenverfahren
C.Der avisierte EMRK-Beitritt der EU
I.Rahmenbedingungen und praktische Bedeutung
II.Unionsrechtskritische Mechanismen des Vertragsentwurfs
1.Ausschließliche Zuständigkeit des GHEU
2.Mitbeschwerdegegnermechanismus
3.Vorabbefassung des EuGH
4.Abstimmung zwischen EMRK und GRC
5.Überprüfbarkeit der GASP
III.Einordnung des EuGH-Gutachtens 2/13
IV.Weiterführende Überlegungen
D.Zusammenfassung
Lernerfolgskontrollfragen
Sachverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
andere Ansicht
ABl.
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften/Union
Abs.
Absatz
a.E.
am Ende
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F.
alte Fassung
Arg. e.
Argument aus
Art.
Artikel
Aufl.
Auflage
Az.
Aktenzeichen
BAG
Bundesarbeitsgericht
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
Bd.
Band
BRD
Bundesrepublik Deutschland
Brüssel Ia-VO
Verordnung über gerichtliche Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
Brüssel IIa-VO
Verordnung über Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung
BSt.
Beamtenstatut
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
CETA
Comprehensive Economic and Trade Agreement
ders.
derselbe(n)
dies.
dieselben
d.h.
das heißt
Ed.
Edition
EG
Europäische Gemeinschaft
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EGMR
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EL
Ergänzungslieferung
EMRK
Europäische Menschenrechtskonvention
EMRK-ÜE
Beitrittsübereinkommen der EU zur EMRK
Energie-VO
Energieeffizienz-Verordnung
ESZB-Satzung
Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EuBagatellVO
Verordnung zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen
EuErbVO
Verordnung über Zuständigkeit, anzuwendendes Rechts, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses
EuG
Gericht der Europäischen Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EuKontPfändVO
Verordnung zur Einführung eines Verfahrens für Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung
EuMahnVO
Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens
EuR
Zeitschrift Europarecht
Euratom
Europäische Atomgemeinschaft
EUStA
Europäische Staatsanwaltschaft
EuUntVO
Verordnung über Zuständigkeit, anwendbares Recht, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen
EUV
Vertrag über die Europäische Union
EuVTVO
Verordnung zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen
EUZBLG
Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWSA
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
EZB
Europäische Zentralbank
f., ff.
folgend(e)
GA
Generalanwalt
GASP
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
gg.
gegen
GG
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggf.
gegebenenfalls
GHEU
Gerichtshof der Europäischen Union
GHEU-Satzung
Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union
GmbH
Gesellschaft mit begrenzter Haftung
GöD
Gericht für den öffentlichen Dienst
GRC
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
h.M.
herrschende Meinung
Hrsg.
Herausgeber
Hs.
Halbsatz
IED
Richtlinie über Industrieemissionen
IntVG
Integrationsverantwortungsgesetz
i.S.d.
im Sinne des/der
ISDS
Investor-state dispute settlement
i.V.m.
in Verbindung mit
KapMuG
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz
lat.
lateinisch
lit.
litera
m.w.H.
mit weiteren Hinweisen
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
No.
Number
Nr.
Nummer
OLG
Oberlandesgericht
OMT
Outright Monetary Transactions
ÖR
Öffentliches Recht
OVG
Oberverwaltungsgericht
PJZS
Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
RB-EUHb
Rahmenbeschluss des Rates über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedsstaaten
RFSR
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
RL
Richtlinie
Rn.
Randnummer(n)
Rs.
Rechtssache
Rspr.
Rechtsprechung
s.
siehe
S.
Satz/Seite(n)
Slg.
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts Erster Instanz
s.o./s.u.
siehe oben/unten
sog.
sogenannte(n)
SpielRL
Spielzeugrichtlinie
st. Rspr.
ständige Rechtsprechung
StPO
Strafprozessordnung
SubProt
Subsidiaritätsprotokoll
tlw.
teilweise
TTIP
Transatlantic Trade and Investment Partnership
TzBfG
Teilzeit- und Befristungsgesetz
u.
und
u.a.
unter anderem/und andere
UA
Unterabsatz
UAbs
Unterabsatz
UKlaG
Unterlassungsklagengesetz
UN
United Nations (Vereinte Nationen)
UVP-Richtlinie
Richtline über Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.
von/vom
Var.
Variante
verb.
verbundene
VerfO-EuG
Verfahrensordnung des Gerichts
VerfO-EuGH
Verfahrensordnung des Gerichtshofs
vgl.
vergleiche
VO
Verordnung
Vol.
Volume
Vorb.
Vorbemerkung(en)
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
wg.
wegen
WRVK
Wiener Vertragsrechtskonvention
z.B.
zum Beispiel
ZP
Zusatzprotokoll zur EMRK
ZPO
Zivilprozessordnung
z.T.
zum Teil
§ 1Einführung
A.Bedeutung des Prozessrechts
B.Thematische Begrenzung
C.Komplementärer und kooperativer Rechtsschutz in Europa
1
„Ubi ius, ibi remedium“.[1] Nach diesem alten lateinischen Rechtsgrundsatz soll ein Recht stets mit der Möglichkeit der Abhilfe bei Verletzungen und mit prozessualen Durchsetzungsmechanismen verbunden sein. Im Einklang damit bestimmte schon § 89 der Einleitung des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 1794: „Wem die Gesetze ein Recht geben, dem bewilligen sie auch die Mittel, ohne welche dasselbe nicht ausgeübt werden kann.“[2] Im Grundsatz verhält es sich mit dem Recht der Europäischen Union (Unionsrecht, Europarecht i.e.S.[3]) nicht anders. Als „Rechtsgemeinschaft“ (dazu § 2) durchdringt die Europäische Union (EU) die heutige Rechtswirklichkeit in mannigfaltiger Weise und gehört daher zu Recht zum Pflichtstoff der juristischen Staatsexamina. Regelmäßig umfasst der dort beschriebene Kanon auch das „Rechtsschutzsystem des Unionsrechts“.[4] Dem entsprechend finden sich in allen Standardlehrbüchern zum Europarecht Kapitel, die sowohl den Gerichtshof der Europäischen Union (GHEU) als Institution als auch das von diesem anzuwendende Verfahrensrecht mehr oder weniger ausführlich erörtern. Das vorliegende Lehrbuch behandelt das Rechtsschutzsystem in der EU eingehend. Es befasst sich neben den Verfahrensarten vor dem GHEU (§§ 3 bis 12) auch mit den Bezügen zwischen dem europäischen Recht und einzelstaatlichem Rechtsschutz (§ 13). Schließlich behandelt es andere zwischenstaatliche Gerichtsverfahren in Europa, insbesondere das Individualbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR, § 14).
§ 1 Einführung › A. Bedeutung des Prozessrechts
A.Bedeutung des Prozessrechts
2
Obgleich zum Wesen des Rechts – wie der Grundsatz ubi ius, ibi remedium andeutet – seine zwangsweise Durchsetzung zählt,[5] kann und ist der dem Recht innewohnende Anspruch, durchgesetzt zu werden, in zweierlei Hinsicht auf das flankierende Prozessrecht angewiesen.
3
Erstens ist denkbar, dass gesetztes Recht zwar verbindlich wirkt und mittels einseitiger Maßnahmen auch durchgesetzt werden könnte, von den Betroffenen aber unterschiedlich ausgelegt wird. Es bedarf dann nach rechtsstaatlichen Grundsätzen der Klärung durch eine zur Streitentscheidung berufene Instanz, z.B. durch ein Gericht. Dieses hat die Möglichkeit und die Aufgabe, den Parteien, insbesondere den strukturell nicht mit Zwangsbefugnissen ausgestatteten Akteuren (natürliche oder juristische Personen), Rechtsschutz zu gewähren. Daraus ergibt sich das Verbot der Selbstjustiz.
4
Zweitens sind die Rechtsbeziehungen der Akteure und der Rechtsunterworfenen in Bezug auf überstaatliches Recht häufig ohne einseitige Durchsetzungs- und Zwangsbefugnisse ausgestaltet, insbesondere wenn es sich um verbandsinterne Regelungen handelt.
Erst durch das Urteil des Gerichtshofs in der Rs. C-303/94[6] wurde klargestellt, dass die Anhörung des Parlaments ein notwendiger Bestandteil des im damaligen Art. 43 II EWG-Vertrag (heute: ordentliches Gesetzgebungsverfahren nach Art. 43 II, Art. 294 AEUV) vorgeschriebenen Konsultationsverfahrens ist und ein Verstoß deswegen zur Nichtigkeit einer ohne Parlamentsbeteiligung erlassenen Richtlinie führt.
§ 1 Einführung › B. Thematische Begrenzung
B.Thematische Begrenzung
5
Der Begriff des Prozessrechts ist zunächst in Abgrenzung zum materiellen Recht zu verstehen. Materiell-rechtliche Regelungen treffen inhaltliche Vorgaben unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, die auf die Vielzahl der Akteure und Lebenssachverhalte im Mehrebenensystem des europäischen Rechtsschutzes (d.h. der nationalen Ebene, der Unionsebene und der internationalen, d.h. zwischenstaatlichen Ebene) angewandt werden. Sie legen fest, wem welche Rechte oder Pflichten unter welchen Voraussetzungen zustehen oder nicht zustehen.
Das unionsrechtliche Loyalitätsgebot begründet eine Pflicht sowohl der Union als auch der Mitgliedstaaten, sich loyal zueinander zu verhalten, woraus verschiedene Informations- und Rücksichtnahmepflichten sowie das Gebot der unionsrechtskonformen Auslegung resultieren. Dies wirkt sich auf verschiedenen Ebenen aus. Art. 4 III EUV modifiziert zum Beispiel nationales Verwaltungsrecht, indem der Ermessenspielraum der Verwaltungsbehörden bei der Rücknahme unionsrechtswidriger Beihilfen auf null reduziert wird.[7] Im Grundrechtsschutz folgt aus Art. 4 III EUV eine möglichst unionsrechtskonforme Auslegung nationalen Rechts, weshalb Art. 19 III GG dahingehend ausgelegt wird, dass sich auch EU-ausländische juristische Personen auf die Grundrechte des Grundgesetzes berufen können.[8]
I.Gerichtliche Rechtsdurchsetzung
6
Derartige Streitigkeiten zwischen Rechtsträgern werden durch Gerichte entschieden, die dem Recht zu seiner Durchsetzung verhelfen. Das Prozessrecht regelt dabei die Mechanismen, wie Gerichte zu ihren Entscheidungen gelangen. Das materielle Recht hingegen regelt, welchen Inhalt die Entscheidung hat – wenngleich auch hier prozessuale Regelungen von Bedeutung sein können. Unter den in diesem Lehrbuch eng verstandenen Begriff des Prozessrechts fallen nur die Verfahren zur Rechtsdurchsetzung vor Gerichten. Andere Verfahrensregelungen bleiben weitgehend außer Betracht. Zu diesen nicht-gerichtlichen Verfahren gehören auf Unionsebene das Petitionsverfahren vor dem Europäischen Parlament (Art. 24 II, Art. 227 AEUV) und die Untersuchungen des Europäischen Bürgerbeauftragten (Art. 228 AEUV). Auf nationaler Ebene steht in Deutschland mit dem behördlichen Ausgangsverfahren (VwVfG und den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder), dem Widerspruchsverfahren (§§ 68 ff. VwGO) und dem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (§ 80 IV VwGO) verwaltungsinterner Rechtsschutz zur Verfügung. Hierauf wird nur insoweit eingegangen, als Unionsrecht auf das verwaltungsgerichtliche Verfahren einwirkt (s. Rn. 606 ff.).
II.Europäisches Prozessrecht
7
Aus dem so verstandenen „Prozessrecht“ behandelt das vorliegende Lehrbuch die Teilmenge des „europäischen“ Prozessrechts. Als institutionelles, d.h. rechtlich verfasstes, „Europa“ (ein ansonsten primär geografisch und historisch belegter Begriff) liegt zunächst die Konzentration auf die Mitgliedstaaten des Europarates, einer bereits 1949 gegründeten internationalen Organisation mit heute 47 Mitgliedstaaten, nahe. Prozessrechtlich ergiebig ist hier die Individual- und Staatenbeschwerdemöglichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zur Wahrung der in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) gewährleisteten Menschenrechte (§ 14). Infolge der deutlich breiteren und zugleich tieferen rechtlichen Verfasstheit meint „Europa“ aber auch und im rechtlichen Sinne vor allem die EU und ihre (noch)[9] 28 Mitgliedstaaten. Nach herrschender Lesart handelt es sich bei der EU um eine supranationale internationale Organisation, für die das Bundesverfassungsgericht den Begriff des „Staatenverbundes“ geprägt hat.[10] Durch das hohe Maß der mitgliedstaatlichen Integration in ein rechtlich und institutionell ausdifferenziertes System ist die EU für die Rechtswirklichkeit in Europa bedeutsam und für die Rechtswissenschaft herausfordernd.
8
Europäisches Prozessrecht ist danach das Verfahrensrecht zur Durchsetzung des materiellen Europarechts, d.h. des Rechts der EU sowie der EMRK. Das hier zugrunde liegende Verständnis von Europäischem Prozessrecht umfasst somit schwerpunktmäßig das Unionsprozessrecht. Dazu zählen die Unionsgerichtsbarkeit (§ 3) und die dort angesiedelten Verfahren (§ 4 bis 12). Darüber hinaus werden die Wechselbeziehungen zwischen Unionsrecht und nationalem Recht im Sinne eines „europäischen Rechtsraums“ (A. v. Bogdandy)[11] und das EMRK-System umfasst (§§ 13 und 14).
III.Europäisierung des nationalen Prozessrechts
9
Zu Europa und damit zum europäischen Prozessrecht könnten auch die europäischen Staaten und ihre nationalen Rechtsschutzsysteme gezählt werden. Ihnen kommt eine wichtige Rolle in Bezug auf das Unionsrecht zu (vgl. Art. 19 I UA 2 EUV), mit denen sich dieses Lehrbuch ebenfalls befasst. Der Bezug kann darin bestehen, dass die nationalen Gerichte europäisches Recht unmittelbar anwenden oder europäische Gerichte anrufen können, oder dass nationales Prozessrecht durch Europarecht beeinflusst bzw. determiniert wird (Europäisierung des Prozessrechts). Mitgliedstaatliche Gerichte werden insoweit regelmäßig auch als „Unionsgerichte im funktionellen Sinne“ bezeichnet[12] – im Gegensatz zum GHEU-System als Unionsgerichtsbarkeit im institutionellen Sinne.
§ 1 Einführung › C. Komplementärer und kooperativer Rechtsschutz in Europa
C.Komplementärer und kooperativer Rechtsschutz in Europa
10
Der aus dem deutschen Verwaltungsrecht bekannte Grundsatz, dass der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz den Handlungsformen der Verwaltung folgt,[13] gilt ebenso für das europäische Prozessrecht. Dabei sind die europäische und die nationalen Gerichtsbarkeiten einander nicht vor- oder nachgeordnet, sondern stehen nebeneinander. Einen Instanzenzug, wie er in nationalen Rechtsordnungen anzutreffen ist, gibt es zwar innerhalb des GHEU, nicht aber zwischen den nationalen und europäischen Gerichten. Auch der EGMR ist kein Teil eines Instanzenzugs, obwohl seine Anrufung die nationale Rechtswegerschöpfung voraussetzt. Das entspricht im deutschen Prozessrecht der Situation der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Der EGMR nimmt die Rolle eines spezialisierten Menschenrechtsgerichts mit Auslegungsautorität über die EMRK ein.
11
Im Ergebnis herrscht also eine durch den jeweiligen Rechtsstreit indizierte und im Hinblick auf die jeweiligen Letztentscheidungszuständigkeiten ausdifferenzierte kooperative Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Das Verhältnis zwischen dem GHEU und dem BVerfG wird von letzterem selbst explizit als „Kooperationsverhältnis“ charakterisiert.[14]
I.Rein nationale Verfahren
12
Rein national gelagerte Sachverhalte betreffende Rechtsstreitigkeiten, auf die nur innerstaatliches Recht Anwendung findet, werden von den zuständigen einzelstaatlichen Gerichten nach Maßgabe der nationalen Gerichtsverfassungen und Prozessordnungen behandelt und entschieden. Daran können sich Verfahren vor dem EGMR anschließen, wenn die Sachverhalte menschenrechtlich relevante Fragen aufwerfen.
13
Allerdings können nationalrechtliche Verweise in das Unionsrecht oder Gleichbehandlungsgebote des nationalen Rechts bewirken, dass auch rein innerstaatliche Sachverhalte, auf die auch kein harmonisiertes Unionssekundärrecht Anwendung findet, unionsrechtliche Fragestellungen begründen.
Dies gilt für die sog. überschießende Richtlinienumsetzung[15] oder die Anwendung der Grundfreiheiten auf innerstaatliche Sachverhalte (wie z.B. in Österreich oder Italien wegen der dort verfassungsrechtlich verbotenen Inländerdiskriminierung[16]). In solchen Fällen sind Vorabentscheidungsersuchen der nationalen Gerichte zur Auslegung des in Bezug genommenen Unionsrechts nach Art. 267 I AEUV regelmäßig zulässig, auch wenn dies von den Mitgliedstaaten ebenso häufig bestritten wird.
II.Rein unionale Verfahren
14
Rechtsstreitigkeiten, die aus der Ausübung von Hoheitsgewalt resultieren, die die Mitgliedstaaten ausdrücklich der EU übertragen haben, werden durch den GHEU selbst oder mittelbar durch Beantwortung von Vorlagefragen (Art. 267 AEUV) entschieden. In diesen Bereichen wurde der Vollzug des Unionsrechts zuvor unmittelbar den Unionsorganen oder anderen EU-Institutionen übertragen (sog. unmittelbarer oder direkter Vollzug des Unionsrechts, z.B. im Wettbewerbsrecht (Art. 101 ff. AEUV) oder im Außenwirtschaftsrecht (Art. 206 ff. AEUV). Gleiches gilt für inter-institutionelle Streitigkeiten der EU oder für aus der EU-Mitgliedschaft erwachsende Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten. Diese können auch als „EU-verfassungsrechtliche“ Streitigkeiten bezeichnet werden. Die so beschriebenen Zuständigkeitsbereiche des GHEU setzen eine mitgliedstaatliche Zuständigkeitsübertragung für ein bestimmtes Verfahren im Einzelnen voraus. Denn auch die Organkompetenz des GHEU wird von der auf dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung basierenden Verbandskompetenz der EU (Art. 4 I, Art. 5 I f. EUV) determiniert.
III.Mischformen in Vollzug und Rechtsschutz
15
Vollziehen mitgliedstaatliche Behörden Unionsrecht, das in die nationalen Rechtsordnungen punktuell einwirkt, ohne einen Sachverhalt gänzlich zu regeln, wird europarechtlich determinierte, aber im Kern nationale Hoheitsgewalt ausgeübt. Den Rechtsschutz gegen solche Maßnahmen gewähren in erster Linie die mitgliedstaatlichen Gerichte als Unionsgerichte im funktionellen Sinne.[17] Da sie dabei als staatliche Stellen die Anwendung und Durchsetzung (auch) des Unionsrechts sicherstellen, kommt ihnen eine wichtige Rolle im europäischen Rechtsschutzsystem zu. Das Unionsrecht nimmt die mitgliedstaatlichen Gerichte in die Pflicht, in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten (Art. 19 I UA 2 EUV). Dafür müssen die Mitgliedstaaten nötigenfalls die erforderlichen Vorkehrungen treffen. Der Prüfungsmaßstab der nationalen Gerichte hängt hingegen davon ab, inwieweit die einzelstaatlichen Hoheitsakte durch Unionsrecht determiniert werden.
16
Den „Brückenschlag“ zwischen den nationalen Gerichten und dem GHEU bildet das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV. Es ist das prozessuale Pendant zu den Rechtsinstituten der unmittelbaren Anwendung und des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts.[18] Durch Vorlagen erhält der GHEU die Möglichkeit, letztverbindlich über die Wirksamkeit und Auslegung des Unionsrechts zu entscheiden, während die mitgliedstaatlichen Gerichte für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits und die Auslegung und Anwendung nationalen Rechts zuständig bleiben. Dieser „Dialog der Gerichte“ führt dazu, dass die komplementären Zuständigkeitsbereiche der Gerichtsbarkeiten nicht unverbunden nebeneinander stehen. So wird den differenzierten Handlungsformen nationaler und unionaler Hoheitsgewalt innerhalb eines Rechtsstreits auch insoweit kooperativ Rechnung getragen, als die nationalen Gerichte innerhalb eines „europäischen Justizverbundes“[19], wie ihn Art. 19 I EUV vorsieht, agieren und entscheiden.
IV.Zentrale Rolle des GHEU
17
Eine wichtige Rolle innerhalb der EU nimmt der GHEU ein, der aus dem Gerichtshof (EuGH) und dem Gericht (EuG) besteht (Art. 19 I UA 1 S. 1 EUV). Der GHEU ist Hüter der Verträge und Garant für die einheitliche Auslegung und Anwendung des Unionsrechts in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Überdies sichert er das institutionelle Gleichgewicht zwischen den europäischen Institutionen und Organen.
18
Für die Erfüllung dieser Funktionen sehen die Verträge verschiedene Rechtsschutzverfahren vor. In ihrer Gesamtheit führen diese Verfahren dazu, dass der GHEU einerseits als Fachgericht über die Auslegung und richtige Anwendung des materiellen Unionsrechts entscheidet. Andererseits kommen ihm durch die Auslegung des primären Unionsrechts und der Entscheidung über die darin vorgesehenen Rechte und Pflichten der Unionsorgane (diese zählt Art. 13 EUV auf) sowie die unionsrechtlich übernommenen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten auch verfassungsgerichtliche Funktionen zu, soweit man das Primärrecht als die Verfassung der Europäischen Union ansieht.
Die Zuständigkeiten für die Nichtigkeitsklage werden zwischen EuGH und EuG in einem differenzierten System zugewiesen. Im Ergebnis werden dabei die eher verwaltungsrechtlichen Fälle dem EuG, die hingegen als verfassungsrechtlich zu charakterisierenden Fälle dem EuGH zugewiesen (s. Rn. 221 ff.).[20]
19
Auch der GHEU ist ein Geschöpf der Verträge, errichtet durch den Willen der Mitgliedstaaten nach den Art. 19 EUV, Art. 251 ff. AEUV und begrenzt durch das geltende Unionsrecht. Doch da der GHEU die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft (so der Gerichtshof selbst in der Rs. 294/83 [Les Verts/Parlament][21]) maßgeblich konkretisiert, nimmt er eine zentrale Funktion im Gesamtkonstrukt der EU ein. Ausschließlich ihm unterliegt die Kontrolle unionaler Rechtsakte sowie die letztverbindliche Auslegung und Anwendung des Unionsrechts (vgl. Art. 19 I UA 2 EUV), ohne dass er dabei selbst über dem Primärrecht steht. Die Schwerfälligkeit des Vertragsänderungsverfahrens (Art. 48 EUV) führt allerdings dazu, dass eine dem Willen der primärrechtssetzenden Mitgliedstaaten nicht entsprechende GHEU-Interpretation jedenfalls der EU-Verträge nur schwerlich korrigiert werden kann.
20
[Bild vergrößern]
von Bogdandy, Was ist Europarecht?, JZ 2017, 589 ff.; Everling, Rechtsschutz in der Europäischen Union nach dem Vertrag von Lissabon, EuR 2009 Beiheft 1, 71; Haratsch, Die kooperative Sicherung der Rechtsstaatlichkeit durch die mitgliedstaatlichen Gerichte und die Gemeinschaftsgerichte aus mitgliedstaatlicher Sicht, EuR 2008, Beiheft 3, 81 ff.; Kraus, Die kooperative Sicherung der Rechtsstaatlichkeit der Europäischen Union durch die mitgliedstaatlichen Gerichte und die Gemeinschaftsgerichte, EuR 2008, Beiheft 3, 109 ff.; Lenaerts, Kooperation und Spannung im Verhältnis von EuGH und nationalen Verfassungsgerichten, EuR 2015, 3 ff.; Pernice, Die Zukunft der Unionsgerichtsbarkeit, EuR 2011, 151 ff.; Schwarze, Die Wahrung des Rechts durch den Gerichtshof der Europäischen Union, DVBl 2014, 537 ff.; Sydow, Europäisierte Verwaltungsverfahren, JuS 2005, 97 ff.; Voßkuhle, Der europäische Verfassungsgerichtsverbund, NVwZ 2010, 1 ff.
Anmerkungen
Abgedruckt in Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 7. Aufl. 2007, S. 236.
Hattenhauer/Bernert (Hrsg.), Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, 3. Aufl. 1996, S. 60.
Zum Begriff des Europarechts s. Streinz, Europarecht, 10. Aufl. 2016, § 1 Rn. 1.
Vgl. z.B. § 18 II Nr. 6 der bayerischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen (JAPO) vom 13.10.2003 in der seit 1.7.2017 geltenden Fassung.
Lesenswert insofern das kurze, sich kritisch gegen das positivistische Rechtsverständnis des Nationalsozialismus wendende Manifest Gustav Radbruchs, Fünf Minuten Rechtsphilosophie, in: Rhein-Neckar-Zeitung vom 12.9.1945, zitiert in ders., Rechtsphilosophie, 8. Aufl. 1973, S. 327 ff.
EuGH, Rs. C-303/94, Europäisches Parlament/Rat, Slg. 1996, I-2943, Rn. 33.
Herrmann, Examensrepetitorium Europarecht, Staatsrecht III, 6. Aufl. 2017, Rn. 125 ff.
Herrmann, Examensrepetitorium Europarecht, Staatsrecht III, 6. Aufl. 2017, Rn. 73.
Nach derzeitigem Stand wird das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland am 29.3.2019 die EU gemäß Art. 50 Abs. 3 S. 1 EUV verlassen (dazu s. Rn. 146 ff.).
BVerfGE 89, 155 (181 ff.).
von Bogdandy, Was ist Europarecht, JZ 2017, S. 589 ff. (597).
Calliess/Ruffert/Wegener, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 267 AEUV Rn. 1.
Maunz/Dürig/Schmidt-Aßmann, Grundgesetz-Kommentar, 81. EL September 2017, Art. 19 Abs. 4 GG Rn. 67.
BVerfGE 89, 155 (175); Voßkuhle, Der europäische Verfassungsgerichtsverbund, NVwZ 2010, S. 1 ff. (1 ff.).
EuGH, Rs. C-297/88, Dzodzi, Slg. 1990, I-3763, Rn. 29-43; Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 62. EL 2017, Art. 288 AEUV Rn. 131.
EuGH, Rs. C-451/03, Servizi ADC, Slg. 2006, I-2941, Rn. 28 f.; EuGH, Rs. C-250/03, Mauri, Slg. 2005, I-1267, Rn. 21.
Calliess/Ruffert/Wegener, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 267 AEUV Rn. 1.
Streinz, Europarecht, 10. Aufl. 2016, § 8 Rn. 717.
Pernice, Die Zukunft der Unionsgerichtsbarkeit, EuR 2011, S. 151 ff. (153 f.).
Im deutschen Recht hingegen schafft § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO mit der Anforderung einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit „nichtverfassungsrechtlicher Art“ im Zusammenspiel mit Art. 93 GG eine vergleichbare Trennung, allerdings zwischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und Bundesverfassungsgerichtsbarkeit (vgl. insb. Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 GG sowie § 50 Abs. 1 Nr. 1 VwGO für den „nichtverfassungsrechtlichen Bund-Länder-Streit“).
EuGH, Rs. 294/83, Parti écologiste „Les verts“/Europäisches Parlament, Slg. 1986, 1339, Rn. 23.
§ 2Die EU als Rechtsgemeinschaft
A.Begriffsgenese und Adaption durch die Rechtsprechung
B.Rechtsstaatlichkeit in der EU
C.Unionaler Rechtsschutz durch Gerichte
D.Recht auf effektiven Rechtsschutz
E.Zusammenfassung
21
Die EU bildet – auch nach ihrem Selbstverständnis und der Rechtsprechung des EuGH – eine Gemeinschaft des Rechts. Art. 2 S. 1 EUV zählt die Rechtsstaatlichkeit zu den grundlegenden Werten der EU. Auch die zentrale Rechtsschutznorm des Art. 19 I EUV und Bestimmungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) bringen dies zum Ausdruck. Gleichzeitig umfasst die Rechtsgemeinschaft neuartige, unionsspezifische Elemente des Rechtsstaates, die gerade im Lichte aktueller politischer Entwicklungen an Relevanz gewonnen haben. Von zentraler Bedeutung ist das im Unionsrecht verbürgte Recht auf effektiven Individualrechtsschutz. Rechtsgemeinschaft, ein vollständiges Rechtsschutzsystem und effektiver Rechtsschutz stellen gleichsam die unionsverfassungsrechtlichen Grundsätze dar, die den einzelnen Verfahrensarten des europäischen Prozessrechts zugrunde liegen.
§ 2 Die EU als Rechtsgemeinschaft › A. Begriffsgenese und Adaption durch die Rechtsprechung
A.Begriffsgenese und Adaption durch die Rechtsprechung
22
Die heutige EU wurde schon früh als Rechtsgemeinschaft bezeichnet. Der erste Kommissionspräsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), Walter Hallstein, führte dazu bereits im Jahr 1973 aus, dass die EWG in dreifacher Hinsicht ein Phänomen des Rechts sei: Schöpfung des Rechts, Rechtsquelle, und Rechtsordnung.[1] Diese drei Wesensmerkmale bestehen fort.
23
Anders als die Mitgliedstaaten, deren Existenz auch durch gravierende verfassungsrechtliche (Um)Brüche nicht in Frage gestellt wird, existiert die EU überhaupt nur Kraft ihrer Gründungsverträge. Sie ist infolge ihres vertragsrechtlichen Charakters – vergleichbar juristischen Personen des innerstaatlichen Rechts – eine Schöpfung des Rechts. Die Gründungsverträge beschränken sich dabei nicht auf Regelungen der jeweils bi- oder multilateralen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten, sondern haben eine eigenständige Rechtsperson geschaffen (Art. 47 EUV), die kraft ihres institutionellen Rahmens handlungsfähig ist (Art. 13 ff. EUV). Rechtssubjekte des Unionsrechts sind neben der EU aber nicht allein die Mitgliedstaaten, sondern vielmehr auch natürliche und juristische Personen, für die das Unionsrecht als eine „neue Rechtsordnung des Völkerrechts“ zum nationalen Recht hinzutritt.[2]
24
Als Rechtsquelle, so Hallstein, müsse die EU für das Erreichen ihrer Ziele ein dynamisches Eigenleben entfalten, indem sie selbst verbindliche Regelungen hervorbringt. Die EU tritt hier durch ihre gesetzgebenden Organe, das Europäische Parlament und den Rat, in Erscheinung. Daneben ist die Europäische Kommission gesetzgebungsinitiativberechtigt und z.T. mit eigenen Normsetzungsbefugnissen betraut. Das so geschaffene abgeleitete Unionsrecht (Sekundär- oder Tertiärrecht) erfährt durch die Möglichkeit, unmittelbar und mit Anwendungsvorrang wirksam zu werden, eine erhebliche Stärkung und Bedeutung im Rechtsverkehr und der Lebenswirklichkeit der Unionsbürger.
25
Als Rechtsordnung schließlich begründet die EU ein geschlossenes System von Rechtssätzen, die durch die Verträge und das abgeleitete Recht geschaffen wurden. Dieses System ist von der Gesetzmäßigkeit jeglichen Organhandelns (Art. 13 II EUV) und dem Rechtsschutz der Normunterworfenen geprägt. Mithin bedarf es nicht nur materiell-rechtlicher Vorgaben, sondern auch formeller Normen verbandsorganisatorischer Natur wie die Normenhierarchie, das interinstitutionelle Gleichgewicht und Durchsetzungsmechanismen für das geltende Recht. Sie konstituieren das Rechtssystem der EU.
26
Der EuGH nahm die Idee der Rechtsgemeinschaft in der Entscheidung Les Verts auf. Er folgerte aus dieser Idee, dass die Handlungen sämtlicher EU-Organe gerichtlich überprüfbar sein müssten:
„Dazu ist zunächst hervorzuheben, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft eine Rechtsgemeinschaft der Art ist, dass weder die Mitgliedstaaten noch die Gemeinschaftsorgane der Kontrolle darüber entzogen sind, ob ihre Handlungen im Einklang mit der Verfassungsurkunde der Gemeinschaft, dem Vertrag, stehen. Mit den Artikeln 173 und 184 EWG-Vertrag auf der einen und Art. 177 EWG-Vertrag auf der anderen Seite ist ein umfassendes Rechtsschutzsystem geschaffen worden, innerhalb dessen dem Gerichtshof die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Handlungen der Organe übertragen ist.“[3]
27
Für die Entscheidung der Rechtssache Les Verts bedeutete dies, dass die Kläger mittels Nichtigkeitsklage gegen das Europäische Parlament vorgehen konnten, obwohl der einschlägige Art. 173 EWG-Vertrag das Parlament nicht als zulässigen Klagegegner aufführte. Unter Hinweis auf den Geist und das System des Vertrags sah es der EuGH als zwingend an, sämtliche Rechtsakte der Union einer gerichtlichen Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit zuführen und dabei insbesondere auf eine bestehende Verbandskompetenz überprüfen zu können.
28
In der Entscheidung Kadi u.a. bestätigte der EuGH dieses Verständnis der EU als Rechtsgemeinschaft. Im zugrunde liegenden Sachverhalt hatten sich die Kläger gerichtlich gegen EU-Gesetzgebung gewehrt, die in Umsetzung von UN-Sicherheitsratsresolutionen im Kampf gegen Terrorismus den Klägern u.a. den Zugriff auf ihre innerhalb der EU verwalteten Geldkonten verwehrte. Doch auch gegenüber dem völkerrechtlich mit Vorrangwirkung ausgestattetem UN-Sanktionsregime (vgl. Art. 103 UN-Charta) bewahrt nach dem dualistischen Verständnis des EuGH[4] die Unionsrechtsordnung ihre Eigenständigkeit:
„Internationale Übereinkünfte können die in den Verträgen festgelegte Zuständigkeitsordnung und damit die Autonomie des Rechtssystems der Gemeinschaft, deren Wahrung der Gerichtshof aufgrund der ausschließlichen Zuständigkeit sichert, die ihm durch Art. 220 EGV übertragen ist, einer Zuständigkeit, die zu den Grundlagen der Gemeinschaft selbst zählt, nicht beeinträchtigen.“[5]
29
EU-Rechtsakte, die bindendes Völkerrecht in den Rechtskreis der EU einführen, müssen daher ebenfalls gerichtlich umfassend auf ihre Vereinbarkeit mit EU-Primärrecht, insbesondere den EU-Grundrechten, überprüft werden können.[6] Nur so löst die EU ihren Anspruch ein, ein vollständiges Rechtsschutzsystem zur Verfügung zu stellen.
§ 2 Die EU als Rechtsgemeinschaft › B. Rechtsstaatlichkeit in der EU
B.Rechtsstaatlichkeit in der EU
30
Auch über die gerichtliche Überprüfbarkeit des Unionshandelns hinaus kommt rechtsstaatlichen Prinzipien in der EU eine hohe Bedeutung zu. Sie werden ohne weitere Konkretisierungen als grundlegender Wert der Union in Art. 2 S. 1 EUV aufgezählt. Zwar ist der Bezugspunkt der Rechtsstaatlichkeit als verfassungsrechtliche Terminologie grundsätzlich der Nationalstaat. Ohne jedoch eine Verfassung im eigentlichen Sinne einer nicht in Frage zu stellenden Grundnorm zu haben, verfügt die Union als supranationale Rechtsgemeinschaft zumindest über von den Mitgliedstaaten übertragene hoheitliche Kompetenzen sowie eigene Organe. Die Unionsorgane üben die übertragene Hoheitsgewalt aus und können den Einzelnen unmittelbar rechtlich verpflichten. So gelten Verordnungen gemäß Art. 288 II AEUV unmittelbar in jedem Mitgliedstaat und greifen aufgrund ihrer Bindungswirkung regelmäßig in die (allgemeine Handlungs-)Freiheit des Einzelnen ein.
I.Rechtsstaatliche Verbürgungen
31
Daneben ergeben sich Konkretisierungen des Rechtsstaatsprinzips aus den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind und die geltendes EU-Primärrecht darstellen (vgl. Art. 6 III EUV).[7] Dazu zählen nach Ansicht der Europäischen Kommission unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des EuGH:[8]
„a)
der Grundsatz der Gesetzlichkeit, der im Wesentlichen ein transparentes, demokratischer Kontrolle unterworfenes und pluralistisches Gesetzgebungsverfahren umfasst;
b)
die Rechtssicherheit, die unter anderem klare und berechenbare Vorschriften voraussetzt, die nicht im Nachhinein geändert werden können;
c)
das Willkürverbot in Bezug auf die Exekutivgewalt. Das Rechtsstaatsprinzip regelt die Ausübung hoheitlicher Befugnisse und stellt sicher, dass sich jede staatliche Handlung auf eine Rechtsgrundlage und entsprechende Gesetze stützt;
d)
unabhängige und effektive richterliche Kontrolle, die auch die Wahrung der Grundrechte sicherstellt. (…) Jeder Bürger hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsschutz;
e)
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Recht auf ein faires Verfahren und der Gewaltenteilung. Nur ein von der Exekutive unabhängiges Gericht kann Bürgern ein faires Verfahren garantieren; (…)
f)
die Gleichheit vor dem Gesetz [als] (…) ein allgemeiner, in den Artikeln 20 und 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerter Grundsatz des EU-Rechts (…).“
II.Adressaten und Durchsetzbarkeit des Rechtsstaatsprinzips
32
Die vorgenannten Anforderungen binden die EU-Institutionen (Art. 13 EUV) selbst und sind von allen Adressaten des Unionsrechts anhand der systematischen Auslegung des Primärrechts oder der primärrechtskonformen Auslegung des übrigen Unionsrechts zu beachten. Die Auswirkungen auf das EU-Rechtsschutzsystem verortet der EuGH normtechnisch in Art. 19 I EUV in Zusammenschau mit den Art. 258 ff. AEUV.
33
Daneben strahlen die Vorgaben des Rechtsstaatsprinzips auch auf die Rechtsordnungen und Rechtsschutzsysteme der EU-Mitgliedstaaten aus. Weil diese unionsrechtlichen Einwirkungen mitunter wesentliche staatsorganisationsrechtliche Entscheidungen der einzelnen Mitgliedstaaten betreffen, können sie politisch umstritten sein. Die betroffenen Mitgliedstaaten verweisen dabei auf ihre Eigenstaatlichkeit bzw. das völkerrechtliche Verbot, in innere Angelegenheiten eines Staates einzugreifen, sowie die (direkt)demokratische Legitimation der mitgliedstaatlichen Regierung.
Auf Betreiben der ungarischen Regierungspartei wurden u.a. die Prüfungsbefugnisse des Verfassungsgerichts eingeschränkt und der Presse weitgehende Meldepflichten auferlegt. Außerdem war zuvor die Herabsetzung des Renteneintrittsalters für hohe Justizbeamte beschlossen worden. Diese erklärte der EuGH allerdings 2012 wegen Altersdiskriminierung für unionsrechtswidrig.[9] Ebenfalls rechtsstaatlich bedenklich war die diskutierte Wiedereinführung der Todesstrafe.[10]
Auch in Polen initiierte die nationalkonservative Regierung Gesetzgebung, die der Regierung die Kontrolle über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sichert und die Rolle des Verfassungsgerichts einschränkt. Dies führte u.a. dazu, dass die Regierung mittlerweile Urteilen des Verfassungsgerichts die Anerkennung verweigern kann. Außerdem kann die polnische Exekutive nun Richter des obersten Gerichtshofs entlassen oder deren Eintritt in den Ruhestand vorziehen.[11]
34
Für EU-Beitrittskandidaten ist die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips aufgrund der sog. Kopenhagener Kriterien[12] relevant. Diese Kriterien konkretisieren die Voraussetzungen, unter denen ein Beitritt zur EU möglich ist, darunter nach Art. 49 I EUV i.V.m. Art. 2 EUV auch die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips. Die Beachtung und Umsetzung der Kopenhagener Kriterien wird von der Kommission in der Einleitungsphase des Beitrittsverfahrens vorläufig, und nach dem Beschluss des Rates zur Eröffnung von Verhandlungen ausführlich geprüft, bevor der Rat mit Zustimmung des Parlamentes über den Beitritt entscheidet. Der Beitritt erfolgt endgültig, wenn der Beitrittskandidat und alle EU-Mitgliedstaaten den ausgehandelten Beitrittsvertrag ratifizieren (Art. 49 II EUV). Der Beitrittsvertrag enthält letztmalig konkrete Forderungen i.S.d. Kopenhagener Kriterien, die der zukünftige Mitgliedstaat vor seinem endgültigen Beitritt erfüllen muss.[13]
III.Kopenhagen-Dilemma und Rechtsstaatsmechanismus
35
Für die beigetretenen EU-Mitgliedstaaten gelten zwar grundsätzlich die gleichen rechtsstaatlichen Anforderungen wie für Beitrittskandidaten. Auch sie müssen die Anforderungen aus Art. 2 EUV erfüllen. Allerdings konnten Verletzungen oder Gefährdungen des Rechtsstaatsprinzips bisher nur unzureichend durchgesetzt werden (sog. Kopenhagen-Dilemma). Denn die Durchsetzungsmechanismen gelten als politisch schwerwiegende Optionen der ultima ratio: Andere Mitgliedstaaten oder die Kommission könnten Vertragsverletzungsverfahren vor dem GHEU wegen Verletzung spezifischer unionsrechtlicher Pflichten einleiten (Art. 258 f. AEUV). Die oben dargestellten Elemente der Rechtsstaatlichkeit selbst erweisen sich dabei jedoch als wenig justitiabel. Sie fallen teilweise gänzlich aus dem Anwendungsbereich des Unionsrechts. Andererseits kann ein politisches Verfahren nach Art. 7 EUV eingeleitet werden. In dessen Verlauf kann der Europäische Rat eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung des Rechtsstaatsprinzips durch den betroffenen Mitgliedstaat feststellen (Art. 7 II EUV), die wiederum vom Rat mit dem Entzug von mitgliedschaftlichen Stimmrechten sanktioniert werden kann (Abs. 3). Dazu ist es aufgrund der Beteiligungserfordernisse anderer EU-Organe, den hohen Quoren (Zustimmung des Europäischen Parlaments, Einstimmigkeit im Europäischen Rat) und der erforderlichen Einstufung des Verstoßes als „schwerwiegend und anhaltend“ allerdings noch nie gekommen.
36
Diesen Missstand nahm die Kommission 2014 zum Anlass, einen niederschwelligen Frühwarnmechanismus zu entwickeln, um die Durchsetzung des Rechtsstaatsprinzips in den Mitgliedstaaten zu stärken.[14] Der sog. Rechtsstaatsmechanismus soll unbeschadet eines Vertragsverletzungsverfahrens und vor dem Verfahren nach Art. 7 EUV greifen. Er ermöglicht einen strukturierten Dialog zwischen der Kommission und dem betroffenen Mitgliedstaat, um möglichen Verletzungen des Rechtsstaatsprinzips frühzeitig vorzubeugen. Das Verfahren setzt eine systemische Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedstaat voraus, die der Kommission vom Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten oder anderen Akteuren angezeigt wird. Daraufhin erstellt die Kommission in der ersten Phase eine Sachstandsanalyse und übermittelt dem betroffenen Mitgliedstaat eine vertrauliche Stellungnahme. Reagiert der Mitgliedstaat darauf nicht zur Zufriedenheit der Kommission, kann diese in der zweiten Phase eine „Rechtsstaatlichkeitsempfehlung“ abgeben, die veröffentlicht wird. Die verfahrensabschließende dritte Phase richtet sich nach dem Verhalten des betroffenen Mitgliedstaats. Setzt der die empfohlenen Maßnahmen fristgerecht um, ist das Verfahren beendet. Tut er dies nicht, kann die Kommission das Präventiv- oder das Sanktionsverfahren nach Art. 7 I bis III EUV einleiten.
37
Als bloßes Dialogverfahren ohne rechtliche Bindungswirkung bedarf der Rechtsstaatsmechanismus keiner expliziten Rechtsgrundlage in den EU-Verträgen.[15] Die Aufgabenzuweisung an die EU könnte daneben aus Art. 2 I i.V.m. Art. 4 III, Art. 3 I und Art. 13 I EUV (Loyalitätsgebot), i.V.m. Art. 19 EUV (wirksamer Rechtsschutz) oder i.V.m. Art. 258 AEUV (Aufsichtsfunktion der Kommission) konstruiert werden.[16] Problematisch erscheint, dass betroffene Staaten nicht verpflichtet sind, im Rahmen des Mechanismus zu kooperieren und ihr rechtsstaatswidriges Verhalten fortsetzen können. Andererseits kann die Kommission durch ihr Tätigwerden öffentlichen Druck ausüben, die Konfliktpunkte aufzeigen und so die Akzeptanz für ein sich möglicherweise anschließendes Verfahren nach Art. 7 EUV und dessen Erfolgsaussichten erhöhen.
Der neue Rechtsstaatsmechanismus wurde bislang erst einmal – und ohne erkennbare Wirkung – aktiviert. Im Januar 2016 leitete die Kommission Untersuchungen hinsichtlich der polnischen Gesetzgebung ein, mit der die Kontrolle von Legislativakten auf Grundrechtsverletzungen durch das Verfassungsgericht faktisch ausgesetzt wurde. Im Mai 2016 übermittelte die Kommission dem Mitgliedstaat die Einschätzung, dass dies mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht vereinbar sei. Im Juni und Dezember 2016 sprach die Kommission Empfehlungen aus und leitete damit die zweite Phase des Rechtsstaatsmechanismus ein. Da Polen weiterhin die Vorwürfe zurückweist und die Legitimation des Verfahrens bestreitet, hat die Kommission im Juli 2017 weitere Empfehlungen ausgesprochen und im Dezember 2017 mit einem begründeten Vorschlag das Verfahren nach Art. 7 I EUV eingeleitet und das Vorverfahren im Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258 AEUV begonnen.[17]
§ 2 Die EU als Rechtsgemeinschaft › C. Unionaler Rechtsschutz durch Gerichte
C.Unionaler Rechtsschutz durch Gerichte
38
In der EU als Rechtsgemeinschaft nimmt der Rechtsschutz eine zentrale Rolle ein. Dogmatischer Ausgangspunkt ist dabei Art. 19 I EUV. Darin heißt es:[18]
Der Gerichtshof der Europäischen Union umfasst den Gerichtshof, das Gericht und Fachgerichte. Er sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge.
Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist.
39
Daraus ergeben sich die wesentlichen Aufgaben sowie die Struktur der Unionsgerichtsbarkeit. Die Norm wird ergänzt durch die Art. 251 bis 281 AEUV, die Satzung des GHEU sowie die Verfahrensordnungen der Unionsgerichte, in denen Einzelheiten zu den Instanzen, den Verfahrensbeteiligten und den verschiedenen Klageverfahren geregelt werden. Gleichzeitig statuiert die Formulierung von der „Wahrung des Rechts“ den Anspruch der EU als einer Rechtsgemeinschaft, in der eine umfassende Primärrechtskontrolle der Handlungen der Mitgliedstaaten und der EU-Organe stattfindet.
40
Der Rechtsbegriff des Art. 19 I EUV, und damit auch die möglichen Gegenstände der Rechtsprechung, erstrecken sich auf das gesamte Unionsrecht. Sie umfassen somit das geschriebene primäre Unionsrecht, das abgeleitete Unionsrecht, das ungeschriebene Unionsrecht (allgemeine Rechtsgrundsätze und Gewohnheitsrecht), völkerrechtliche Verträge, an denen die EU beteiligt ist und solche der Mitgliedstaaten, die mittlerweile in die Zuständigkeit der Union fallen.[19]
I.Rolle des GHEU
41
Konkret wird dem Gerichtshof der Europäischen Union als dritte Gewalt bzw. Judikativorgan der EU in Art. 19 I EUV die Einhaltung des Rechts überantwortet. Obgleich diese Aufgabe umfassend formuliert ist, enthält sie keine zuständigkeitsbegründende Generalklausel zugunsten des GHEU.[20] Nach der begrenzten Verbands- und Organkompetenz im Einzelfall sind dem GHEU einzelne Verfahren enumerativ zugewiesen, z.B. in den Art. 258 ff. AEUV oder Art. 218 XI AEUV. Dennoch erfordert der Zweck des Art. 19 I EUV einen umfassenden und effektiven Rechtsschutz, der in systematischer Hinsicht bei der Auslegung der einschlägigen Vertragsnormen zu berücksichtigen ist, jedoch nicht zwingend durch den GHEU selbst gewährt werden muss.[21] Mit der „Wahrung des Rechts“ obliegt dem GHEU die letztgültige Bestimmung von Inhalt und Tragweite der Normen des Unionsrechts.
1.Wahrung der Kompetenzordnung
42
Zur Wahrung der Kompetenzordnung gehört primär die Einhaltung der Kompetenznormen im positiven Sinne (Erfüllung der im Vertrag festgelegten Pflichten) wie auch im negativen Sinne (Einhaltung der dem Verband der EU und deren Organen gesetzten Kompetenzgrenzen). In dieser Funktion wird der Gerichtshof als Hüter der Verträge tätig.
Nach Ansicht des EuGH stellt die Kompetenz zur Binnenmarktharmonisierung (Art. 114 AEUV) keine allgemeine Kompetenz zur Regelung des Binnenmarktes dar. Eine darauf gestützte Vorschrift muss tatsächlich und nachprüfbar dem Zweck dienen, die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern. Die im Präzedenzfall angegriffene Tabakwerberichtlinie (RL 98/43/EG) hat der EuGH damit für kompetenzwidrig und nichtig erklärt.[22]
43
Aus Sicht der nationalen Verfassungsgerichte ist diese Letztentscheidungsbefugnis des GHEU insofern problematisch, als die EU-Kompetenzen ursprünglich nach Maßgabe der nationalen Verfassungen übertragen wurden, deren Einhaltung wiederum den mitgliedstaatlichen höchsten Gerichten obliegt und nicht dem GHEU.
2.Konkretisierung des Rechts
44
Der abstrakt-generelle Charakter der primären und sekundären Rechtsvorschriften der EU macht es erforderlich, die Normen im Einzelfall zu konkretisieren, damit sie als Richtschnur staatlichen wie privaten Handelns dienen können. Dies erfolgt primär durch die beteiligten Akteure, d.h. durch die das Unionsrecht ausführenden Stellen. Darunter fallen die EU-Organe und die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verfassungsprinzipien der EU. Gerade die allgemeinen Rechtsgrundsätze und Prinzipien des Unionsrechts, etwa der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß Art. 4 III UA 1 EUV, bedürfen häufig der Ausformung und Anwendung auf den Einzelfall. Die Kommission und andere EU-Stellen im direkten Vollzug sowie die nationalen Verwaltungsbehörden im indirekten Vollzug konkretisieren das gesamte, insbesondere das abgeleitete Unionsrecht.
45
Wird der GHEU angerufen – es besteht kein Initiativ- oder Selbsteintrittsrecht des Gerichtshofes –, nimmt er eine eigene autoritative Konkretisierung der einschlägigen EU-Normen vor, an denen er die im Streit stehenden Handlungen der Verfahrensbeteiligten misst und die Rechtssachen entscheidet.
46
Ausnahmen zu diesen nachgeschalteten streitbeendenden Konkretisierungen der EU-Rechtsordnung bilden das Vorabentscheidungsverfahren (in denen das Ausgangsgericht den Rechtsstreit fortführt), die Gutachtenzuständigkeit des Gerichtshofs (Art. 218 XI AEUV) und der einstweilige Rechtsschutz.
3.Fortbildung des Rechts
47
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Europäischen Union und ihres neuartigen Charakters als supranationaler, mit beachtlicher Kompetenzfülle ausgestalteter Staatenverbund, nimmt auch die Rechtsprechung des GHEU bisweilen dynamische, rechtsfortbildend-kreative Züge an. In dieser Funktion lässt sich der Gerichtshof als Motor der Integration bezeichnen.
Die Verträge über die Europäischen Gemeinschaften (EGKS, EAG, EWG) enthielten keine menschenrechtlichen Gewährleistungen. Als Reaktion auf die sich vertiefende gemeinsame Marktintegration wurde dies im Hinblick auf die Auswirkungen, die das Gemeinschaftsrecht und die Handlungen der Kommission auf den Einzelnen haben konnten, aber zunehmend als defizitär angesehen. Mit der rechtsfortbildenden Rechtsprechung zu den Grundrechten als ungeschriebenen allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts (EuGH-Entscheidungen Stauder, Internationale Handelsgesellschaft und Nold)[23] schloss der EuGH diese Lücke.
48
Aus Sicht des GHEU stellen dessen rechtsfortbildenden Entscheidungen jedenfalls immer auch Konkretisierungen des Unionsrechts dar, da und insoweit er neue Rechtsinstitute aus dem bestehenden Primärrecht herleitet und erstmals zur Anwendung bringt.
II.Rolle der nationalen Gerichte
49
Art. 19 I UA 2 EUV verpflichtet zugleich die Mitgliedstaaten, die „erforderlichen“ Rechtsbehelfe zu schaffen, „damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist“. Hiermit wird die zentrale Rolle der nationalen Gerichte beim Vollzug und der Durchsetzung des Unionsrechts unterstrichen. Zum einen müssen die Mitgliedstaaten die notwendigen verfahrensrechtlichen Vorkehrungen treffen, damit die Gerichte ihrem unionsrechtlich vermittelten Rechtsprechungsauftrag auch effektiv nachgehen können. Zum anderen besteht dieser Auftrag an die Gerichte gerade darin, beim dezentralen Vollzug des Unionsrechts als „Unionsgerichte im funktionalen Sinn“ mitzuwirken. Diese Inanspruchnahme der nationalen Gerichte führt dazu, dass bestehender mitgliedstaatlicher Rechtsschutz unionsrechtliche Vorgaben berücksichtigen und das Unionsrecht beachten muss. Die erforderliche prozessuale Verschränkung mit der Unionsgerichtsbarkeit stellt das Vorabentscheidungsverfahren (Art. 267 AEUV) dar.
§ 2 Die EU als Rechtsgemeinschaft › D. Recht auf effektiven Rechtsschutz
D.Recht auf effektiven Rechtsschutz
50
Mit den zuvor behandelten Charakteristika einer „Rechtsgemeinschaft“ eng verknüpft ist das Prinzip des effektiven Rechtsschutzes, da und insoweit es die behandelten Merkmale zum Gewährleistungsinhalt subjektiver Rechte macht. Das Recht auf effektiven Rechtsschutz gewährleistet, dass Individuen
„einen effektiven gerichtlichen Schutz der Rechte in Anspruch nehmen können, die sie aus der Unionsrechtsordnung herleiten.“[24]
51
Individuen besitzen hiernach das einklagbare Recht, die aus der EU als Rechtsgemeinschaft hervorgehenden Verbürgungen geltend zu machen, um ihre Rechte aus dem Unionsrecht durchsetzen zu können. Diese Rechtsschutzgarantie stellt das rechtsstaatlich notwendige Korrelat und Korrektiv zum unmittelbar verpflichtenden und berechtigenden Charakter des Unionsrechts dar.[25]
52
Als geltendes Primärrecht besitzt der Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes normhierarchisch Geltungsvorrang vor dem abgeleiteten Unionsrecht und ist in der systematischen Auslegung des gesamten Unionsrechts zu berücksichtigen. Gegenüber entgegenstehendem nationalem Recht setzt sich der Grundsatz kraft seines unionsrechtlichen Anwendungsvorranges durch, wenn eine Konformauslegung nicht möglich ist.
I.Rechtsgrundlagen
53
Den Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes hat der EuGH frühzeitig als allgemeinen Rechtsgrundsatz des Unionsrechts anerkannt.[26] Der Gerichtshof rekurrierte dabei auf Art. 6 und 13 EMRK. Darin hatten sich die Vertragsstaaten der EMRK, und damit alle EU-Mitgliedstaaten, verpflichtet, den ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf eine wirksame Beschwerde zuzuerkennen. Ebenfalls können diese Verbürgungen aus dem Rechtsstaatsprinzip, einem nach Art. 2 S. 1 EUV grundlegenden Wert der EU, abgeleitet werden. Der Grundsatz effektiven Rechtsschutzes ist mittlerweile in Art. 47 GRC verbürgt, nach dessen erstem Absatz
[j]ede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, (…) das Recht [hat], nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.
54
Weitere Teilgewährleistungen des effektiven Rechtsschutzes finden sich in Art. 41 II GRC. Die Aufnahme in den Menschenrechtskatalog der EU nach dem Vertrag von Lissabon macht deutlich, dass es sich nicht nur um eine objektiv-rechtliche Vorgabe des Unionsrechts handelt, sondern um ein individualberechtigendes EU-Grundrecht.
II.Adressaten und Gewährleistungen
55
Verpflichtungsadressat des Grundsatzes ist zum einen die Union selbst (vgl. Art. 51 I GRC), d.h. die Organe und insbesondere die Gerichte der EU. Daneben werden auch die Mitgliedstaaten, und hier wiederum insbesondere deren Gerichte, zu effektivem Individualrechtsschutz unionsrechtlich eingeräumter Rechtspositionen verpflichtet. Von diesen Rechtspositionen hat der EuGH ein weiteres Verständnis, als es nach deutscher Verwaltungsrechtsdogmatik dem von Art. 19 IV GG geschützten subjektiv-öffentlichen Recht zukommt. Ein (qualifiziertes) Interesse Einzelner ist nach dem Recht der EU bereits ausreichend.[27] Im Hinblick auf nationalrechtliche Verfahrenshindernisse stellt das Recht auf effektiven Rechtsschutz auch eine spezielle Ausprägung des Effektivitätsgrundsatzes aus Art. 4 III UA 2 EUV dar, nach dem der Vollzug von Unionsrecht nicht wesentlich erschwert oder praktisch unmöglich gemacht werden darf.[28]
56
Zwei Einzelgewährleistungen des Grundsatzes verdienen besondere Beachtung: das Recht auf Zugang zu einem Gericht und das Recht auf eine angemessene Verfahrensdauer.
Das Recht auf Zugang zu einem Gericht garantiert einen lückenlosen und umfassenden gerichtlichen Rechtsschutz vor der Unionsgewalt und den Organen der Mitgliedstaaten, soweit diese Unionsrecht vollziehen.[29] Unter den „Handlungen der Organe“ (Art. 47 GRC) sind nicht nur konkret-individuelle Beschlüsse zu verstehen, sondern auch Normativakte. Das Rechtsschutzsystem der EU muss in diesem Sinne vollständig sein und die angefochtene Maßnahme zur Rehabilitation des Klägers oder der Schadenswiedergutmachung vollständig aus der Rechtsordnung entfernen.[30] Ob dieser Anspruch gerade in Bezug auf Rechtsschutz gegenüber Rechtsakten mit Verordnungscharakter (vgl. Art. 263 IV a.E. AEUV) eingelöst wird, ist durchaus umstritten und wird unter Rn. 265 ff. vertieft.
Das Recht auf eine angemessene Verfahrensdauer gewährleistet den Abschluss eines Rechtsstreites innerhalb eines angemessenen Zeitraumes.[31] Die Angemessenheit wird in einer Gesamtbetrachtung der Umstände des Einzelfalls danach bestimmt, welche Interessen auf dem Spiel stehen, wie komplex der Verfahrensgegenstand ist und welchen Einfluss das Verhalten des Klägers und der beteiligten Behörden, einschließlich der Gerichte, auf die Länge des Verfahrens hatte. Dabei ist auch das aufwändige Sprachenregime der EU zu berücksichtigen.
57
Die Art. 47 II f. und Art. 41 II GRC umfassen weitere Teilgewährleistungen wie die Beachtung zentraler Verfahrensnormen, z.B. die Gewähr eines kontradiktorischen Verfahrens, den Anspruch auf rechtliches Gehör, die Waffengleichheit zwischen den Parteien oder den Anspruch auf Prozesskostenhilfe.
§ 2 Die EU als Rechtsgemeinschaft › E. Zusammenfassung
E.Zusammenfassung
58
Die EU verkörpert eine Rechtsgemeinschaft, da sie durch Völkervertragsrecht geschaffen wurde, selbst rechtsetzend tätig wird und als Rechtsordnung konzipiert ist. Wesentliches Charakteristikum dieser Rechtsgemeinschaft ist die vollständige Überprüfbarkeit der Handlungen der EU und ihrer Organe sowie der Handlungen der das Unionsrecht vollziehenden mitgliedstaatlichen Behörden auf ihre Übereinstimmung mit höherrangigem Unionsrecht. Diese Aufgabe ist nach Art. 19 I EUV letztverbindlich dem GHEU, in funktionaler Aufgabenteilung aber gleichfalls den nationalen Gerichten zugewiesen. Die EU-rechtsunterworfenen Personen haben aus dem Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes nach Art. 47 GRC einen grundrechtlichen Anspruch darauf, sie betreffende hoheitliche Handlungen im Anwendungsbereich des Unionsrechts umfassend gerichtlich überprüfen zu lassen. Dazu gehören auch flankierende Gewährleistungen wie rechtliches Gehör und Prozesskostenhilfe.
von Bogdandy, Die EU im polnischen Kampf um demokratische Rechtsstaatlichkeit, EuZW 2016, 441 f.; von Bogdandy/Ioannidis, Das systemische Defizit. Merkmale, Instrumente und Probleme am Beispiel der Rechtsstaatlichkeit und des neuen Rechtsstaatlichkeitsaufsichtsverfahrens, ZaöRV 2014, 283 ff.; Closa/Kochenov/Weiler (Hrsg.), Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, EUI Working Paper RSCAS 2014/25; von Danwitz, Kooperation der Gerichtsbarkeiten in Europa, ZRP 2010, 143 ff.; Haratsch, Effektiver Rechtsschutz auf der Grundlage ungeschriebener Kompetenzen der Europäischen Union, FS für Scheving, 2011, S. 79 ff.; Jarass, Bedeutung der EU-Rechtsschutzgewährleistung für nationale und EU-Gerichte, NJW 2011, 1393 ff.; Kämmerer, Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall „Kadi“: Ein Triumph der Rechtsstaatlichkeit?, EuR 2009, 114 ff.; Kokott/Sobotta, The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – Finding the Balance?, EJIL 2012, S. 1015 ff.; Konstadinides The Rule of Law in the European Union – The Internal Dimension, 2017; Last, Garantie wirksamen Rechtsschutzes gegen Maßnahmen der Europäischen Union, 2008; Mayer, Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft, NJW 2017, 3631 ff.; Müller-Graff/Scheuing (Hrsg.), Gemeinschaftsgerichtsbarkeit und Rechtsstaatlichkeit, EuR 2008 Beiheft 1; Pech, „A Union Founded on the Rule of Law“: Meaning and Reality of the Rule of Law as a Constitutional Principle of EU Law, European Constitutional Law Review 2010, 359 ff.; Pernice, Die Zukunft der Unionsgerichtsbarkeit, EuR 2011, 151 ff.; Rademacher, Rechtsschutzgarantien des Unionsrechts, JuS 2018, S. 337 ff.; Wiater, Effektiver Rechtsschutz im Unionsrecht, JuS 2015, 788 ff.
Anmerkungen
Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, 1973, S. 33 ff.
EuGH, Rs. 26/62, van Gend en Loos, Slg. 1963, 3, 24 ff.
EuGH, Rs. 294/83, Parti écologiste „Les verts“/Europäisches Parlament, Slg. 1986, 1339, Rn. 23; Hervorhebungen durch die Verfasser.
S. dazu Grabitz/Hilf/Nettesheim/Dörr, Das Recht der Europäischen Union, 62. EL 2017, Art. 253 AEUV Rn. 79.
EuGH, verb. Rs. C-402/05 u. C-415/05, Kadi und Al Barakaat, Slg. 2008, I-6351, 4. Leitsatz.
Vertiefend dazu Kokott/Sobotta, The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – Finding the Balance?, EJIL 2012, S. 1015 ff. (1016-1019).
Dazu vertiefend Pech, „A Union Founded on the Rule of Law“: Meaning and Reality of the Rule of Law as a Constitutional Principle of EU Law, European Constitutional Law Review 2010, S. 359 ff.
Europäische Kommission, Pressemitteilung vom 11.3.2014, IP/14/237, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_de.htm (1.5.2018).
EuGH, Rs. C-286/12, Kommission/Ungarn, ECLI:EU:C:2012:687.
Orbán denkt über Todesstrafe nach – Juncker droht Ungarn mit EU-Rauswurf, ntv vom 1.6.2015, http://www.n-tv.de/politik/Juncker-droht-Ungarn-mit-EU-Rauswurf-article15205996.html (1.5.2018).
Europäische Kommission, Pressemitteilung vom 26.7.2017, IP/17/2161, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2161_de.htm (1.5.2018).
Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Kopenhagen 21.-22. Juni 1993, SN 180/1/93, S. 13; Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Madrid 15.-16. Dezember, III A (S. 7).
Vgl. beispielhaft Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom 26.3.2013, Monitoring-Bericht über die Beitrittsvorbereitungen Kroatiens, COM(2013) 171 final.
Europäische Kommission, Pressemitteilung vom 11.3.2014, IP/14/237, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_de.htm (1.5.2018).
von Bogdandy/Ioannidis