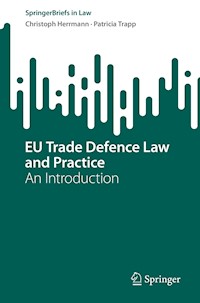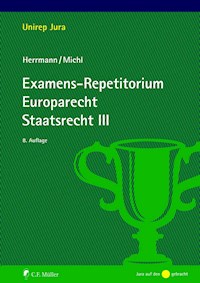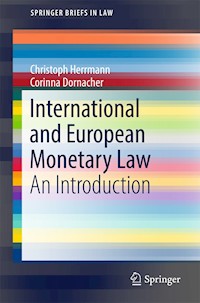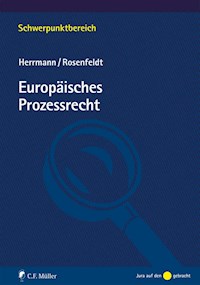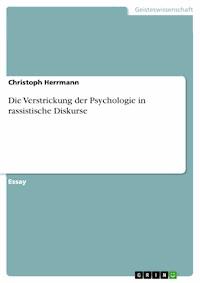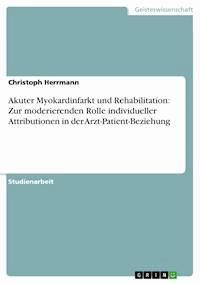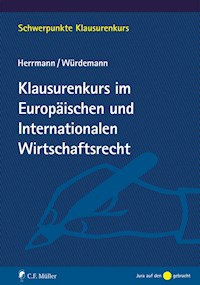
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schwerpunkte Klausurenkurs
- Sprache: Deutsch
Dieser neue Klausurenkurs behandelt das europäische und internationale Wirtschaftsrecht, das nicht nur in der Praxis, sondern auch in der universitären Ausbildung in den Schwerpunktbereichen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die 16 Fälle beruhen auf universitären Schwerpunktbereichsklausuren, die in den vergangenen zehn Jahren im Schwerpunktteilbereich "Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht" an der Juristischen Fakultät der Universität Passau gestellt und geschrieben wurden. Inhalt: Der Klausurenkurs ist in zwei Teile gegliedert, wobei der 1. Teil im Wesentlichen einen Überblick über das Europäische und Internationale Wirtschaftsrecht präsentiert und der 2. Teil 16 Klausurfälle zur Bearbeitung enthält. Der inhaltliche Überblick über das das Europäische und Internationale Wirtschaftsrecht im 1. Teil umfasst die Grundzüge beider Teilbereiche und legt diese in verdichteter Form dar. Eine Durcharbeitung der inhaltlichen Kurseinführung ist vor allem mit Blick auf die spätere Fallbearbeitung lohnenswert. Der 2. Teil beinhaltet eingangs eine Übersicht über die Themenschwerpunkte der einzelnen Klausurfälle, die darüber hinaus Informationen bezüglich des Schwierigkeitsgrades (leicht – mittel – schwierig) der einzelnen Klausurfälle sowie der jeweils vorgegebenen Bearbeitungszeit gibt. Daran schließen sich die 16 Klausurfälle samt Gliederung und ausführlichem Lösungsvorschlag an. Abgerundet wird der Klausurenkurs durch eine Sammlung von insgesamt 100 Lernkontrollfragen, die die Möglichkeit zur Reflexion der zentralen Rechtsfragen der einzelnen Klausurfälle geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klausurenkurs im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht
Mit Bezügen zum Völkerrecht
von
Dr. Christoph Herrmann, LL.M. European Law (London)o. Professor an der Universität Passau
und
Aike WürdemannWissenschaftlicher Mitarbeiter Lehrstuhl Herrmann
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-8448-1
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.de
© 2019 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Das europäische und internationale Wirtschaftsrecht gewinnt nicht nur in der Praxis, sondern auch in der universitären Ausbildung in den Schwerpunktbereichen zunehmend an Bedeutung. In einer globalisierten Weltwirtschaft kann Wirtschaftsrecht kaum noch rein national gedacht werden. Darüber hinaus hat gerade in jüngerer Zeit das allgemeine Publikumsinteresse an Fragen der europäischen und internationalen Wirtschaftsordnung zugenommen. Als Stichwörter seien hier nur die Eurokrise und ihre rechtlich umstrittene Bewältigung, der Streit um die Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) und die Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit (ISDS), der sogenannte Brexit und die damit notwendig werdende zukünftige Form der Wirtschaftsintegration zwischen den verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten (EU27) und dem Vereinigten Königreich, sowie der jüngste „Handelskrieg“ zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Handelspartnern und die Zukunft der Welthandelsorganisation (WTO) genannt.
Während an Lehrbüchern zu den genannten Rechtsgebieten überwiegend kein Mangel besteht, fehlen einschlägige Fallsammlungen bisher völlig. In Klausurenkursen zum Europarecht kommen zwar regelmäßig auch Fälle zu den Grundfreiheiten und (teilweise) zum Wettbewerbs- und Beihilfenrecht vor. Fallsammlungen zum Völkerrecht behandeln hingegen die Themen WTO-Recht und Investitionsschutzrecht allenfalls am Rande. Diese Lücke versucht der vorliegende Band der Schwerpunkte-Reihe zu schließen. Die darin enthaltenen 16 Fälle beruhen auf universitären Schwerpunktbereichsklausuren, die in den vergangenen zehn Jahren im Schwerpunktteilbereich „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht“ an der Juristischen Fakultät der Universität Passau gestellt und geschrieben wurden (dort jeweils als Aufgabenstellung für eine Bearbeitungszeit von 180 Minuten).
Ab dem Wintersemester 2018/19 werden diese Fälle gleichfalls im Rahmen eines interaktiven Kurses der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) bereitgestellt, der wir für die Förderung der Entwicklung des Kursangebots und für die Einwilligung in diese Buchpublikation danken.
Die Entwicklung des vhb-Kurses und dieses Buches wären ohne die Unterstützung zahlreicher Menschen nicht möglich gewesen. Unser Dank gilt dem gesamten Team des Lehrstuhls, insbesondere Herrn Wiss. Mit. Simon Guilliard und Frau Wiss. Mit. Caroline Glöckle für zahlreiche Hinweise zu den Lösungsentwürfen, Herrn Wiss. Mit. Christopher Hook für die Unterstützung bei der Manuskriptgestaltung sowie Herrn stud. jur. Tim Ellemann für die digitale Umsetzung des Projekts und die Hilfe bei der Fahnenkorrektur. Auf Seiten der vhb gilt der Dank Herrn Dr. Holger Kächelein für die unermüdliche Unterstützung und Ermunterung bei der Entwicklung unserer virtuellen Kursangebote sowie auf Seiten des Verlages Frau Alexandra Burrer und Herrn Michael Schmidt für das erneut in uns und das Projekt gesetzte Vertrauen.
Für Kritik und Anregungen sind wir jederzeit dankbar!
Passau/Washington, D.C., im Dezember 2018 Christoph Herrmann Aike Würdemann
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Einführung in die Konzeption des Klausurenkurses
1. TeilEuropäisches und Internationales Wirtschaftsrecht im Überblick
A.Die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union
I.Das wirtschaftsverfassungsrechtliche Leitbild
II.Historische Entwicklung der unionalen Wirtschaftsintegration
B.Teilgebiete des Europäischen Wirtschaftsrechts
I.Die Grundfreiheiten
1.Die Grundfreiheiten als Instrument negativer Integration
2.Die Entwicklung der Grundfreiheitsdogmatik durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs
a)Das Zusammenspiel der Dassonville- und Keck-Formel im Rahmen der Warenverkehrsfreiheit
b)Einführung der sogenannten Dreistufenprüfung durch den Gerichtshof
c)Die Rechtfertigungsdogmatik im Rahmen der Grundfreiheiten
aa)Un-/Geschriebene Rechtfertigungsgründe
bb)Heranziehung von (Unions-)Grundrechten im Rahmen der Rechtfertigung
d)Die dogmatische Besonderheit des Art. 110 AEUV
II.Die Wettbewerbsordnung
III.Das Außenwirtschaftsrecht
1.Die kompetenzielle Reichweite der GHP
2.Die vertragliche Handelspolitik der Union
a)Die unionsrechtliche Bindung gemäß Art. 216 Abs. 2 AEUV
b)Unmittelbare Anwendbarkeit
3.Die autonome Handelspolitik der Union
IV.Die Wirtschafts- und Währungsunion
C.Teilgebiete des Internationalen Wirtschaftsrechts
I.Allgemeines Völkerrecht
II.Das Recht der WTO und regionale Handelsabkommen
1.Der „tariffs only“-/„bound tariffs“-Grundsatz des GATT
2.Das Antidiskriminierungsregime des WTO-Rechts
a)Grundpfeiler des Antidiskriminierungsregimes
b)Die Bestimmung der Gleichartigkeit i.S.v. Art. I:1 GATT bzw. Art. III GATT
aa)Die Kriterien der GATT-Arbeitsgruppe „Working Party on Border Tax Adjustments“
bb)Herstellungs- bzw. Produktionsmethoden als Gleichartigkeitskriterien
3.Die Rechtfertigungsdogmatik des GATT
a)Die allgemeinen Ausnahmen gemäß Art. XX GATT
b)Das Problem der extraterritorialen Wirkung von nationalen Maßnahmen
4.Anforderungen an regionale Handelsabkommen gemäß Art. XXIV GATT
III.Das internationale Investitionsschutzrecht
D.Berührungspunkte von Europäischem und Internationalem Wirtschaftsrecht
Hinweise zu Recherchemöglichkeiten
2. TeilKlausurfälle
Themenschwerpunkte der einzelnen Klausurfälle
Fall 1Integration? Nein, danke!
Regionale (europäische) Wirtschaftsintegration, EU-Zollunion, Binnenmarkt, WTO-Recht, Gemeinsame Handelspolitik, europäische Investitionsschutzpolitik, intra-/extra-EU BITs
Fall 2Wildschweinjagd im Binnenmarkt
Vertragsverletzungsverfahren, Warenverkehrsfreiheit, Keck-Formel/Dreistufenprüfung, Verwendungsmodalitäten, un-/geschriebene Rechtfertigungsgründe
Fall 3Schwerland
Nichtigkeitsklage, Warenverkehrsfreiheit, Verbot steuerlicher Diskriminierung, „objektive Rechtfertigung“, Unionsabkommen als rechtmäßigkeitsmaßstab, Grundsatz der Inländergleichbehandlung, Meistbegünstigungsgrundsatz, Gleichartigkeitsprüfung, PPMs als Gleichartigkeitskriterium, Rechtfertigung nach dem GATT
Fall 4Grenzüberschreitendes Pay-TV
Vorabentscheidungsverfahren, Dienstleistungsfreiheit, Keck-Formel analog, Kartellrecht
Fall 5Talentsicherung durch den Gerichtshof?
Vorabentscheidungsverfahren, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Bindung sozial mächtiger Vereinigungen, Gericht i.S.v. Art. 267 AEUV, unmittelbare Anwendbarkeit völkerrechtlicher Abkommen
Fall 6Sportwetten
Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Rechtfertigungsmöglichkeiten, Kohärenzgebot, Übertragung der Keck-Formel
Fall 7Streiken im Binnenmarkt
Niederlassungsfreiheit, Ausfuhrfreiheit, Groenveld-Formel, unmittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten, Unionsgrundrechte
Fall 8Schwierige Investitionen in Investonia
Abgrenzung Direkt-/Portfolioinvestition, Niederlassungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit, Marktzugangsbeschränkungen ausländischer Investitionen
Fall 9Kampf dem Tabakkonsum
Nichtigkeitsklage, unionsrechtliche Kompetenzordnungsprinzipien, Prinzip der (begrenzten) Einzelermächtigung, Subsidiaritätsgrundsatz, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Harmonisierungskompetenz
Fall 10Gerichtshof vs. Schiedsgericht
Autonomie der Unionsrechtsordnung, BIT-Schiedsgerichte, Beihilfenrecht, Stillhaltegebot
Fall 11Zurückhaltender Wettbewerb oder zurückgehaltener Wett-bewerb?
Verbot wettbewerbsbeschränkender Verhaltensweisen, Missbrauchsverbot, „pay for delay“-Vereinbarung, „essential facilities“-Doktrin, Kartellverfahrensrecht, Untätigkeitsklage, Recht auf eine gute Verwaltung
Fall 1221st Century Trade Agreements
ausschließliche/implizite Vertragsabschlusskompetenzen, unionale Außenhandelskompetenzen
Fall 13Banken in der Krise
Amtshaftungsklage, Nichtigkeitsklage, Eigentumsgrundrecht, Amtshaftungsanspruch, Europäischer Stabilitätsmechanismus, makroökonomische Anpassungsprogramme, Finanz- und Staatsschuldenkrise
Fall 14Flatscreen nicht gleich Flatscreen?
Zollbindung, Zollklassifikation, Harmonisiertes System (HS), Kombinierte Nomenklatur (KN), Informationstechnologieabkommen (ITA), Zollzugeständnislisten, regionale Wirtschaftsintegration
Fall 15Robbenjagd
Nichtigkeitsklage, nicht-privilegierte Kläger, Rechtsangleichung, WTO-Recht, Abgrenzung von Art. XI GATT und Art. III GATT, Rechtfertigung gemäß Art. XX GATT, extraterritoriale Wirkung, PPMs als Gleichartigkeitskriterium
Fall 16Streit um die Erdölförderung
Investitionsschutzrecht, Wiedergutmachung, ILC Draft Articles, Full Protection and Security, Fair and Equitable Treatment, Enteignungsschutz
Lernkontrollfragen
Sachverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
andere Ansicht
Abs.
Absatz
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AG
Aktiengesellschaft
Alt.
Alternative
Art.
Artikel
Aufl.
Auflage
BIT
Bilaterales Investitionsabkommen
bzw.
beziehungsweise
CETA
Comprehensive Economic and Trade Agreement
d.h.
das heißt
DSU
Dispute Settlement Understanding
EEA
Einheitliche Europäische Akte
EFTA
Europäische Freihandelsassoziation
EG
Europäische Gemeinschaft
EG-Vertrag / EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EL
Ergänzungslieferung
EMRK
Europäische Menschenrechtskonvention
EnCV
Energiecharta-Vertrag
ESM
Europäischer Stabilitätsmechanismus
ESZB
Europäisches System der Zentralbanken
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EuG
Gericht der Europäischen Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
Euratom
Europäische Atomgemeinschaft
EUV
Vertrag über die Europäische Union
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWG-Vertrag / EWGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWR
Europäischer Wirtschaftsraum
EZB
Europäische Zentralbank
f., ff.
folgend(e)
FET
Fair and Equitable Treatment
FPS
Full Protection and Security
GA
Generalanwalt
GASP
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
GATS
General Agreement on Trade on Services
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade
GHEU
Gerichtshof der Europäischen Union
GHP
Gemeinsame Handelspolitik
GmbH
Gesellschaft mit begrenzter Haftung
GRCh
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Hrsg.
Herausgeber
Hs.
Halbsatz
HS
Harmonisiertes System
Ibid.
Ebenda
ICSID
International Centre for the Settlement of Investment Disputes
IGH
Internationaler Gerichtshof
i.H.v.
In Höhe von
ILC
International Law Commission
i.R.d.
im Rahmen des/der
i.S.d.
im Sinne des/der
ISDS
Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit
i.V.m.
in Verbindung mit
IWF
Internationaler Währungsfonds
KN
Kombinierte Nomenklatur
lit.
litera (Buchstabe)
LwÜ
Übereinkommen über die Landwirtschaft
MoU
Memorandum of Understanding
m.w.N.
Mit weiteren Nachweisen
No.
Number
NPR-PPM
Non-product-related PPM
Nr.
Nummer
PJZS
Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
PPM
Process and Production Method
PR-PPM
Product-related PPM
RL
Richtlinie
Rn.
Randnummer(n)
Rs.
Rechtssache
s.
siehe
S.
Satz/Seite(n)
s.o. / s.u.
siehe oben/unten
SPS
Sanitary and Phytosanitary Measures
Std.
Stunde
TBT
Technical Barriers to Trade
TTIP
Transatlantic Trade and Investment Partnership
u.a.
unter anderem
UAbs.
Unterabsatz
UN
United Nations (Vereinte Nationen)
UNFCCC
UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen
UNCITRAL
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht
USA
Vereinigte Staaten von Amerika
Var.
Variante
verb.
verbundene
VerfO
Verfahrensordnung
vgl.
vergleiche
vhb
Virtuelle Hochschule Bayern
VO
Verordnung
WHO
Weltgesundheitsorganisation
WTO
Welthandelsorganisation
WVK
Wiener Vertragsrechtskonvention
z.B.
zum Beispiel
Einführung in die Konzeption des Klausurenkurses
1
Der vorliegende Klausurenkurs „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht – mit Bezügen zum Völkerrecht“ fügt sich in die bereits bestehenden Klausurenbände der „Schwerpunkte“-Reihe ein und dient als Ergänzung und Vertiefung zu gängigen Lehrbüchern wie dem Standardwerk „Europarecht“ von Rudolf Streinz, dem „Internationalen Wirtschaftsrecht“ von Burkhard Schöbener, Jochen Herbst und Markus Perkams, dem „Öffentlichen Wirtschaftsrecht“ von Josef Ruthig und Stefan Storr sowie dem „Wirtschaftsvölkerrecht“ von Markus Krajewski. Der Klausurenkurs spricht vor allem Studierende an, die im Rahmen der Juristischen Universitätsprüfung den Schwerpunktbereich Europarecht/Internationales Recht absolvieren. Je nach Ausrichtung dieses Schwerpunktbereichs bzw. den Wahlmöglichkeiten an der jeweiligen Juristischen Fakultät findet sich regelmäßig die gesamte inhaltliche Bandbreite des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts im schwerpunktspezifischen Curriculum wieder, und zwar von den Grundfreiheiten über das unionale Wettbewerbsrecht (vor allem Kartell- und Beihilfenrecht) und die gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union bis hin zum Recht der Welthandelsorganisation (WTO) und dem internationalen Investitionsschutzrecht. Vor diesem Hintergrund bereitet der Klausurenkurs Studierende des entsprechenden Schwerpunktbereichs anwendungsorientiert sowohl auf schriftliche als auch mündliche Schwerpunktprüfungen vor, soweit diese Prüfungsleistungen in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung vorgesehen sind.
Der Klausurenkurs ist in zwei Teile gegliedert, wobei der 1. Teil im Wesentlichen einen Überblick über das Europäische und Internationale Wirtschaftsrecht präsentiert und der 2. Teil 16 Klausurfälle zur Bearbeitung enthält.
2
Der inhaltliche Überblick über das Europäische und Internationale Wirtschaftsrecht im 1. Teil umfasst die Grundzüge beider Teilbereiche und legt diese in verdichteter Form dar. Eine Durcharbeitung der inhaltlichen Kurseinführung ist vor allem mit Blick auf die spätere Fallbearbeitung lohnenswert, da die dargelegten rechtlichen Grundlagen sowie die ausgewählt besprochenen Rechtsprobleme ein grundlegendes Verständnis für das jeweilige Rechtsgebiet schaffen und sich in den verschiedenen Sachverhaltskonstellationen der Klausurfälle wiederfinden. Hinzu kommen didaktische Hinweise zu Recherchemöglichkeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen digitalen Quellen, die auch im rechtswissenschaftlichen Studium immer mehr zur Geltung kommen und das Recherchieren von Rechtsprechung oder anderweitiger (Vertiefungs-)Literatur spürbar vereinfachen.
3
„Herzstück“ des Klausurenkurses sind wesensgemäß die im 2. Teil enthaltenen insgesamt 16 Klausurfälle. Er beinhaltet eingangs eine Übersicht über die Themenschwerpunkte der einzelnen Klausurfälle, die darüber hinaus Informationen bezüglich des Schwierigkeitsgrades (leicht – mittel – schwierig) sowie der jeweils vorgegebenen Bearbeitungszeit gibt. Grundsätzlich bietet es sich an, mit der Bearbeitung von Fall 1 in den Klausurenkurs einzusteigen, wenngleich Studierende nicht daran gehindert sein sollen, gezielt bestimmte Klausurfälle aufgrund deren thematischer Schwerpunktsetzung zu bearbeiten. Bei Fall 1 handelt es sich zwar weniger um eine klassische juristische Fallgestaltung, die im Rahmen eines rechtlichen Gutachtens zu lösen ist, als um rechtliche Fragestellungen, die in Essay-Form beantwortet werden sollen; allerdings deckt der Klausurfall inhaltlich – in Anlehnung an den Brexit – u.a. die historischen Grundlagen der europäischen Wirtschaftsintegration sowie Fragen der wirtschaftlichen Desintegration ab und eignet sich damit in besonderem Maße zur Entwicklung einer anwendungsorientierten Vertrautheit mit Problemstellungen des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts einschließlich etwaiger Bezüge zum allgemeinen Völkerrecht.
Die weiteren 15 Klausurfälle beruhen teils auf Leitentscheidungen bzw. aktueller Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (GHEU) sowie auf Reports von WTO-Panels bzw. des Appellate Body. So behandelt etwa Fall 10 („Gerichtshof vs. Schiedsgericht“) sowohl diejenigen Rechtsfragen, die sich dem Gerichtshof in der Rechtssache Achmea stellten, als auch diejenigen, die sich ihm in der derzeit noch anhängigen Rechtssache Micula stellen. Dagegen sind in Fall 12 („21st Century Agreements“) die Ausführungen des Gerichtshofs im Gutachten 2/15 klausurtechnisch aufbereitet. Insgesamt weisen die Fälle 2 bis 13 einen Schwerpunkt im „Europäischen Wirtschaftsrecht“ auf, während der Fokus der Fälle 14 bis 16 eher auf dem „Internationalen Wirtschaftsrecht“ liegt.
Die einzelnen Sachverhaltskonstellationen sind generell dergestalt konzipiert, dass stets verschiedene Teilgebiete des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts miteinander kombiniert und verzahnt sind, um die Vielschichtigkeit und den möglicherweise nicht auf den ersten Blick ersichtlichen, aber doch zahlreich vorhandenen Berührungspunkten des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts Rechnung zu tragen.
4
Darüber hinaus sehen die 16 Falleinheiten für die Fallbearbeitung jeweils eine dreigliedrige Vorgehensweise vor: (1) Im ersten Schritt sollen Studierende zunächst die Fallangabe bzw. den Sachverhalt lesen und erste Lösungsüberlegungen skizzieren; (2) im Anschluss werden sogenannte Vorüberlegungen einschließlich einer Grobgliederung des Lösungsvorschlags zur Verfügung gestellt, die hinsichtlich der Schwerpunktsetzung und etwaigen Strukturierungsfragen im Zusammenhang mit der Erstellung einer eigenen Lösungsskizze unterstützen; (3) sodann folgt ein ausführlicher Lösungsvorschlag, der allerdings nicht als vollständige Falllösung zu verstehen ist, sondern eine Hilfestellung für die Nachbearbeitung darstellen soll. Der Lösungsvorschlag enthält zudem zum einen im Rahmen von zahlreichen Hinweiskästen zusätzliche inhaltliche Vertiefungs- und Hintergrundinformationen, zum anderen am Ende umfassende Literaturempfehlungen zur Wiederholung und Vertiefung. Die Hinweiskästen versuchen vor allem weiterführende Fragen, die sich Studierenden bei der Nachbearbeitung des Lösungsvorschlags möglicherweise aufdrängen, zu antizipieren und diese entsprechend zu beantworten. Abgerundet wird der 2. Teil des Klausurenkurses durch eine Sammlung von insgesamt 100 Lernkontrollfragen, die die Möglichkeit zur Reflexion der zentralen Rechtsfragen der einzelnen Klausurfälle geben.
5
Der Klausurenkurs ist auf dem Stand von Dezember 2018 und legt der Fallbearbeitung insbesondere die Verträge, d.h. den Vertrag über die Europäische Union (EUV) sowie den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in der Fassung des Vertrags von Lissabon (in Kraft getreten am 1.12.2009) sowie die WTO-Verträge, insbesondere das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) in der Fassung des Marrakesch-Abkommens (unterzeichnet am 15.4.1994) zugrunde. Darüber hinaus ist teilweise die Heranziehung weiterer internationaler Verträge, beispielsweise des Vertrages über die Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), erforderlich, die allerdings in den gängigen Text- und Gesetzessammlungen abgedruckt sind.
1. TeilEuropäisches und Internationales Wirtschaftsrecht im Überblick
A.Die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union
6
Der Rechtsbegriff der Verfassung meint grundsätzlich eine rechtliche Grundordnung eines Gemeinwesens, die aus formaler Sicht Verfahren zur Bewältigung von politischen Konflikten, insbesondere durch einen geregelten Staatsaufbau, vorgibt und darüber hinaus materiell-rechtliche Leitprinzipien grundrechtlicher oder struktureller Art enthält. Damit wohnt einer Verfassung eine sowohl einheits- als auch identitätsstiftende Wirkung für die legitimierte Hoheitsgewalt sowie das Gemeinwesen inne, wodurch die Verfassung als an sich rechtliche Materie (zumindest teilweise) politisiert wird. Als (rechtspolitische) Grundlage des Gemeinwesens ist eine Verfassung grundsätzlich nur unter erschwerten Voraussetzungen abänderbar, weist aufgrund der niedergelegten, naturgemäß abstrakten Prinzipien allerdings eine Offenheit auf, die ihre Bestandskraft maßgeblich erhöht. Wenngleich damit nicht der verfassungsrechtliche Anspruch auf Vollständigkeit einhergeht, deckt die Verfassung wesentliche Bereiche des Gemeinwesens ab, u.a. das Wirtschaftsleben, für dessen Ordnung sie mitunter eine politische Gesamtentscheidung, etwa in Bezug auf das Wirtschaftssystem, trifft und grundlegende Gestaltungselemente einführt. In modernen Verfassungen steht dabei insbesondere die wirtschaftliche Freiheit des Individuums im Spannungsverhältnis zu sozialstaatlichen und sonstigen regulativen Politiken.
7
Historisch bedingt – insbesondere durch das seit dem Ende des 30-jährigen Krieges 1648 vorherrschende Westfälische System – ist der Verfassungsbegriff zwar staatsbezogen, wurde im Rahmen der europäischen Integration vom Gerichtshof allerdings bereits zur Charakterisierung der Unionsverträge (damals EWG-Vertrag) („Verfassungsurkunde“) herangezogen.[1] Jedenfalls spricht man bezüglich der von den Unionsverträgen geschaffenen Rechtsordnung grundsätzlich eher von einer Rechtsordnung sui generis,[2] deren Rechtsqualität sich von der Qualität des völkerrechtlichen Gründungsaktes gelöst hat und die aufgrund ihrer unmittelbaren Wirkung sowie des Vorrangs eine „neue Rechtsordnung des Völkerrechts“[3] darstellt (siehe Fall 1, Rn. 108).[4]
8
Nichtsdestotrotz erfüllt diese „neue Rechtsordnung“ wesentliche Verfassungsfunktionen, etwa die Organisation und Legitimation von Herrschaftsgewalt (vgl. etwa die allgemeinen Kompetenzordnungsprinzipien des Art. 5 EUV oder die Vorschriften zum ordentlichen und besonderen Gesetzgebungsverfahren gemäß Art. 289 ff. AEUV), und enthält zudem grundlegende materiell-rechtliche Verfassungselemente, etwa die Grundfreiheiten (vgl. Art. 28 ff. AEUV, Art. 45 ff. AEUV, Art. 49 ff. AEUV, Art. 56 ff. AEUV sowie Art. 63 ff. AEUV) und die Grundrechte (vgl. die Grundrechtecharta (GRCh), die gemäß Art. 6 Abs. 1 EUV rechtlich gleichrangig zum AEUV und EUV ist).
I.Das wirtschaftsverfassungsrechtliche Leitbild
9
Das wirtschaftsverfassungsrechtliche Leitbild der Unionsverträge, d.h. des EUV sowie des AEUV einschließlich der GRCh, ist gemäß Art. 119 Abs. 1, 2, Art. 120 S. 2 AEUV durch den „Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ bestimmt, die gemäß Art. 3 Abs. 3 S. 2 EUV auch ein soziales Element enthält („wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“). Dieses Bekenntnis zu einer marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung als objektiv-rechtliche Grundentscheidung findet Entfaltung in speziellen subjektiv-rechtlichen Gewährleistungen, die ebenfalls das Wesen der unionalen Rechtsordnung maßgeblich prägen, etwa im Rahmen des Kartellrechts, dem das Idealbild eines Wettbewerbs zugrunde liegt, in dem Unternehmen eigenständig und selbstbestimmt am Markt agieren (siehe Fall 11, Rn. 662).[5]
10
Wirtschaftsintegrationsrechtliche Grundlage der unionalen Rechtsordnung ist die Errichtung einer Zollunion (vgl. Art. 28 ff. AEUV i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. a AEUV), die um binnenmarkt- und wettbewerbsrechtliche Elemente erweitert (vgl. Art. 26 Abs. 2 AEUV und Art. 101 ff. AEUV) und (zumindest in Teilen) zu einer Währungsunion weiterentwickelt worden ist (vgl. Art. 127 ff. AEUV) (siehe Fall 1, Rn. 74 ff.). Die offen marktwirtschaftliche Ausrichtung der Unionsverträge wird allerdings durch die Anerkennung nicht-wirtschaftlicher Allgemeininteressen, etwa die Querschnittsmaterien Umwelt- und Verbraucherschutz (vgl. Art. 11, 12 AEUV) oder die Grundrechte der GRCh, relativiert, die u.a. den Mitgliedstaaten regulative Gestaltungsspielräume verschaffen, die insbesondere in den geschriebenen (vgl. Art. 36 AEUV, Art. 45 Abs. 3 AEUV, Art. 52 AEUV [i.V.m. Art. 62 AEUV] und Art. 65 Abs. 1 lit. b AEUV) und ungeschriebenen (vgl. etwa die zwingenden Erfordernisse i.S.d. Cassis de Dijon[6]) Rechtfertigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Grundfreiheitseingriffen zum Ausdruck kommen (siehe u.a. Fall 2, Rn. 160 f.). Darüber hinaus finden sich im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik oder der Industriepolitik gar ausdrückliche Durchbrechungen des marktwirtschaftlichen Grundsatzes.
II.Historische Entwicklung der unionalen Wirtschaftsintegration
11
Seinen historischen Ursprung findet das Unionsrecht in der Vergemeinschaftung der Kohle- und Stahlindustrie im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahre 1951 durch die westeuropäischen Staaten Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag; seit dem Vertrag von Maastricht EG-Vertrag; seit dem Vertrag von Lissabon AEUV) im Rahmen der Römischen Verträge vom 27.3.1957 wurde dieser Integrationsverbund im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, basierend auf einer Zollunion und unter dem Leitbild des „Gemeinsamen Marktes“, ausgebaut und gestärkt. Mit der Einführung eines gemeinsamen Zolltarifs gegenüber Drittstaaten und der Beseitigung von Binnenzöllen wurde am 1.7.1968 die Integrationsstufe der Zollunion verwirklicht.[7] Nachdem bereits infolge der Dassonville-Rechtsprechung des Gerichtshofs aus dem Jahr 1974 die Marktöffnung im Hinblick auf nicht-tarifäre Handelshemmnisse innerhalb der EWG erhöht werden konnte, die positive Integration durch Rechtsangleichung allerdings (vor allem aufgrund des Einstimmigkeitserfordernisses für derartige Maßnahmen) ins Stocken geraten war, priorisierte die Europäische Kommission die Entwicklung eines vollumfänglichen Binnenmarktkonzepts, was im Jahre 1985 in die Entwicklung des sogenannten Weißbuchs über die Vollendung des Binnenmarktes mündete. Dieses legte die Defizite der Verwirklichung des „Gemeinsamen Marktes“ offen und enthielt eine Reihe von Vorschlägen zur Harmonisierung von wesentlichen Rechtsvorschriften, die dem Funktionieren des Binnenmarktes entgegenstanden. Infolgedessen gab die am 1.7.1987 in Kraft getretene Einheitliche Europäische Akte (EEA) für die Vollendung des Binnenmarktes, d.h. einem Raum ohne Binnengrenzen, einen Zeitplan zur Durchführung der vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen zur Beseitigung von Handelshemmnissen bis zum 31.12.1992 vor (wenngleich der Frist keine rechtliche Wirkung zukam). Die EEA bewirkte im Wesentlichen die Umstellung vom Einstimmigkeits- zum Mehrheitserfordernis für binnenmarktrelevante Rechtssetzung und gab die Schaffung des Binnenmarktes nunmehr verbindlich vor.[8] Die Umsetzung des Binnenmarktkonzepts betraf insbesondere die Beseitigung materieller Schranken im Bereich der Waren- und Personenkontrollen sowie die Beseitigung nicht-tarifärer Hemmnisse technischer Art. Heute ist das Binnenmarktkonzept bzw. das Ziel seiner Verwirklichung verbindlich in Art. 3 Abs. 1 S. 1 EUV sowie in Art. 26 Abs. 2 AEUV niedergelegt, während hauptsächlich die Harmonisierungskompetenz des Art. 114 AEUV die Anforderungen an eine unionale Rechtsangleichung regelt (siehe u.a. Fall 9, Rn. 569 ff.) und gemäß Abs. 1 S. 2 vorgibt, dass Harmonisierungsvorschriften vom Rat und Europäischen Parlament im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens erlassen werden, das gemäß Art. 289, 294 AEUV grundsätzlich die qualifizierte Mehrheit im Rat als Abstimmungserfordernis verlangt (siehe zur historischen Entwicklung der europäischen Wirtschaftsintegration inner- und außerhalb der Union Fall 1, Rn. 77 ff.).
B.Teilgebiete des Europäischen Wirtschaftsrechts
I.Die Grundfreiheiten
1.Die Grundfreiheiten als Instrument negativer Integration
12
Die Grundfreiheiten des AEUV, d.h. die Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 28 ff. AEUV, die Arbeitnehmer- und Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 45 ff. und Art. 49 ff. AEUV, die Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56 ff. AEUV sowie die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 ff. AEUV, stellen die Grundpfeiler des unionalen Binnenmarkts i.S.v. Art. 26 Abs. 2 AEUV dar, dessen Verwirklichung auch über 1992 eine Dauerverpflichtung der Mitgliedstaaten und der Union ist. Als Instrument negativer Integration verbieten sie (sowohl de jure als auch de facto) Diskriminierungen sowie unterschiedslos wirkende Beschränkungen, d.h. Maßnahmen mit protektionistischer oder marktfragmentierender Wirkung, im grenzüberschreitenden innerunionalen (nicht im rein inländischen) Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr, wobei sie lediglich auf die Marktzugangsöffnung, nicht aber auf eine allgemeine Marktliberalisierung abzielen. Im Einklang mit der Außenhandelstheorie der komparativen Kostenvorteile gelingt so mit der Herstellung eines einheitlichen, größeren Marktes eine bessere Ressourcenallokation.
13
Mittelbar können die Grundfreiheiten auch zu positiver Integration führen, wenn eine gegen einschlägige Grundfreiheiten verstoßende, jedoch gerechtfertigte mitgliedstaatliche Maßnahme aufgrund einer drohenden Fragmentierung des Binnenmarktes dessen Funktionieren beeinträchtigt bzw. zu beeinträchtigen droht und damit die unionale Harmonisierungskompetenz gemäß Art. 114 AEUV auslöst.
2.Die Entwicklung der Grundfreiheitsdogmatik durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs
a)Das Zusammenspiel der Dassonville- und Keck-Formel im Rahmen der Warenverkehrsfreiheit
14
Bei der Durch- bzw. Umsetzung des Binnenmarktkonzepts spielt die Rechtsprechung des Gerichtshofs eine maßgebliche Rolle, etwa mit Blick auf die Ausdehnung des warenverkehrsrechtlichen Verbots nicht-fiskalischer Maßnahmen i.S.v. Art. 34 AEUV von einem Diskriminierungs- zu einem Beschränkungsverbot im Rahmen der sogenannten Dassonville-Formel. Auch interne Marktregulierungen wie Verkaufsverbote, die beschränkend auf den Marktzugang wirken (können), sind damit von Art. 34 AEUV erfasst.
15
Mit der Keck-Rechtsprechung hat der Gerichtshof den sehr weiten Anwendungsbereich des Art. 34 AEUV wieder eingeschränkt. Wortlautgemäßer Anknüpfungspunkt der Keck-Formel sind sogenannte „bestimmte Verkaufsmodalitäten“, die nicht geeignet sind, den innerunionalen Handel i.S.d. Dassonville-Formel zu beschränken. Zur Konkretisierung der Begrifflichkeit wird regelmäßig auf die Unterscheidung von vertriebs- und produktbezogenen Regelungen zurückgegriffen, wobei nur erstere unter die Verkaufsmodalitäten fallen. Einen wirklichen dogmatischen Gewinn bringt diese Differenzierung allerdings nicht. Der Kerngedanke der Keck-Formel ist jedenfalls, ob bzw. inwiefern eine interne Marktregulierung starke[9] oder erhebliche[10] Auswirkungen auf den Marktzugang hat.[11] Diese darf den Marktzugang zwar im Rahmen ihrer Eigenschaft als „bestimmte Verkaufsmodalität“ beschränken; eine solche Beschränkung darf aber nicht stärker ausgestaltet sein, als dies für inländische Erzeugnisse der Fall ist.[12]
16
Durch das Zusammenspiel der Dassonville- und Keck-Formel werden damit zum einen aufgrund der Ausnahme der „bestimmten Verkaufsmodalitäten“ nur diejenigen internen Marktregulierungen „herausgefiltert“, die den Marktzugang und folglich den innerunionalen Handel in hinreichend bedeutender Weise beschränken. Zum anderen werden die unterschiedlichen Geltungsbereiche des Beschränkungs- und des Diskriminierungsverbots deutlich. Soweit es sich um eine den innerunionalen Handel beschränkende, d.h. um eine marktzugangsbezogene Maßnahme handelt, gelten sowohl das Beschränkungs- als auch das Diskriminierungsverbot. Betrifft eine mitgliedstaatliche Regulierung dagegen nur interne Sachverhalte im Sinne einer „bestimmten Verkaufsmodalität“, ist diese interne Regulierung nach der Keck-Rechtsprechung keine Beschränkung und ausschließlich am Diskriminierungsverbot zu messen.[13]
b)Einführung der sogenannten Dreistufenprüfung durch den Gerichtshof
17
Mittlerweile hat sich der Gerichtshof von der Prüfung der Keck-Formel teilweise gelöst und führt eine sogenannte Dreistufenprüfung durch. Danach prüft der Gerichtshof das Vorliegen einer Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 34 AEUV anhand von drei Fallgruppen:[14] (1) Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, (2) Missachtung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung (Vorliegen von produktbezogenen, unterschiedslos anwendbaren Vorschriften, nach denen Produkte bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, selbst wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind; produktbezogenes Beschränkungsverbot), (3) sonstiges Marktzugangshindernis. Das Kriterium der Marktzugangsbehinderung ist damit eindeutig zum Leitprinzip der Eingriffsprüfung i.R.d. Art. 34 AEUV geworden. Darüber hinaus scheint die Dreistufenprüfung auch die Dassonville-Formel entbehrlich zu machen.[15] Zudem erscheint auch die Frage der Übertragbarkeit der Keck-Formel auf andere Grundfreiheiten als die Warenverkehrsfreiheit in Anbetracht der „grundfreiheitsneutralen“ Konzeption der Dreistufenprüfung im Grunde obsolet (siehe Fall 2, Rn. 154 ff.).
Bislang ist das Verhältnis zwischen der Dreistufenprüfung und der Keck-Formel allerdings nicht abschließend geklärt und einzelne Kammern des Gerichtshofs verwenden weiterhin die tradierten Formeln.
c)Die Rechtfertigungsdogmatik im Rahmen der Grundfreiheiten
aa)Un-/Geschriebene Rechtfertigungsgründe
18
Darüber hinaus hat der Gerichtshof mit Einführung der zwingenden Erfordernisse des Allgemeinwohls i.S.d. Cassis de Dijon-Formel die Dogmatik der Grundfreiheiten zum einen über die geschriebenen Rechtfertigungsgründe (vgl. Art. 36 AEUV, Art. 45 Abs. 3 AEUV, Art. 52 AEUV (i.V.m. Art. 62 AEUV) und Art. 65 Abs. 1 lit. b AEUV) hinaus erweitert, zum anderen dahingehend geprägt, dass klargestellt wurde, dass Waren, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht wurden, grundsätzlich unionsweit frei zirkulieren dürfen.[16] Aus kollisionsrechtlicher Sicht kommt damit das Herkunftslandprinzip zum Tragen, das zur gegenseitigen Anerkennung „zulasten“ des Rechts des Bestimmungs- oder Aufnahmestaates verpflichtet. Allerdings findet andererseits die Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung ihre Grenzen, soweit eine Maßnahme des Bestimmungs- bzw. Aufnahmestaates notwendig ist, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden.[17] Dabei handelt es sich bei den zwingenden Erfordernissen – wie bereits angedeutet – nicht um tatbestandliche Einschränkungen, sondern um zusätzliche Rechtfertigungsgründe, die das Bestimmungslandprinzip gegenüber dem Herkunftslandprinzip stärken.[18] Für die Einordnung eines Maßnahmenziels als zwingendes Erfordernis des Allgemeinwohls kommt es allgemein darauf an, dass ein Belang in der Unionsrechtsordnung rechtlich Anerkennung gefunden hat, z.B. im Rahmen der Unionsgrundrechte o.ä.
19
Während die Dassonville-Formel i.V.m. der Cassis de Dijon-Formel (ebenso wie die Keck-Formel) speziell für die Warenverkehrsfreiheit konzipiert ist, findet auf die übrigen Grundfreiheiten, nämlich die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sowie die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, die sogenannte Gebhard-Formel Anwendung.
Nach der vollständigen Gebhard-Formel ergibt sich „[a]us der Rechtsprechung des Gerichtshofes (…), dass nationale Maßnahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantierten grundlegenden Freiheiten behindern oder weniger attraktiv machen können, vier Voraussetzungen erfüllen müssen: Sie müssen in nichtdiskriminierender Weise angewandt werden, sie müssen aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, sie müssen geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten, und sie dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist (…).“
Daraus wird ersichtlich, dass die Gebhard-Formel nicht nur den grundfreiheitlichen Beschränkungsbegriff näher bestimmt, sondern darüber hinaus sowohl das den Grundfreiheiten innewohnende Diskriminierungsverbot als auch Rechtfertigungselemente nach dem Vorbild der Cassis de Dijon-Formel enthält.
bb)Heranziehung von (Unions-)Grundrechten im Rahmen der Rechtfertigung
20
Regelmäßig erfolgt die Heranziehung von Grundrechten im Rahmen der Rechtfertigung von Grundfreiheitseingriffen im Zuge einer Abwägung des festgestellten Eingriffs mit den Unionsgrundrechten Dritter. Hintergrund ist, dass die aus den Unionsgrundrechten erwachsende Schutzplicht als eigenständige rechtfertigende Schranke dienen kann, die sodann eine Abwägung der Grundfreiheitausübung auf der einen und der Grundrechtsausübung auf der anderen Seite erfordert (siehe Fall 4, Rn. 310) und beide in einen schonenden Ausgleich zu bringen sind.[19] Zwar gehören die Unionsgrundrechte zu den zwingenden Interessen des Allgemeinwohls, stellen allerdings eine selbstständige Kategorie ungeschriebener Rechtfertigungsgründe dar (siehe Fall 7, Rn. 470 f.).[20]
Darüber hinaus greift der Gerichtshof allerdings auch auf mitgliedstaatliche Grundrechte zurück, um die geschriebenen Rechtfertigungsgründe, etwa denjenigen der öffentlichen Ordnung, zu konkretisieren.[21]
d)Die dogmatische Besonderheit des Art. 110 AEUV
21
Art. 110 AEUV ergänzt das System der Warenverkehrsfreiheit im Bereich der internen fiskalischen Regulierung durch die Mitgliedstaaten. Die Vorschrift verbietet auf der Ebene der internen (steuerlichen) Regulierung als abgabenrechtliche lex specialis zum allgemeinen Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV jede diskriminierende (Abs. 1) oder protektionistische (Abs. 2) Besteuerung ausländischer Waren. Ausländische Waren dürfen folglich nach dem Marktzutritt nicht durch nationale Steuervorschriften gegenüber inländischen Waren diskriminiert werden. Damit verhindert Art. 110 AEUV insbesondere die Umgehung des Zollverbots gemäß Art. 28, 30 AEUV durch steuerliche Belastungen nach dem Marktzutritt einer Ware.[22] Die dogmatische Besonderheit des Art. 110 AEUV, die sich allerdings auch im Rahmen des Verbots von Zöllen und zollgleichen Abgaben gemäß Art. 30 AEUV wiederfindet, ist das Fehlen einer Rechtfertigungsmöglichkeit im Wortlaut der Vorschrift, der lediglich zwei Tatbestandvoraussetzungen enthält, nämlich im Falle des Abs. 1 die Gleichartigkeit der in- und ausländischen Waren sowie deren steuerliche Ungleichbehandlung durch einen Mitgliedsstaat bzw. im Falle des Abs. 2 ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den in- und ausländischen Erzeugnissen sowie der Schutz konkurrierender inländischer Produktionen.
22
Die Rechtsprechungswirklichkeit zeigt allerdings, dass der Gerichtshof die Dogmatik des Art. 110 AEUV stark weiterentwickelt hat und eine sogenannte „objektive Rechtfertigung“ prüft, indem er eine unterschiedliche Besteuerung erlaubt, sofern (1) die vorgenommene Differenzierung anhand objektiver Kriterien erfolgt, (2) die Verfolgung wirtschaftspolitischer Ziele, die mit denen des Unionsrechts korrespondieren, bezweckt ist und (3) keine diskriminierende bzw. protektionistische Wirkung vorliegt.[23] Mit dem Kriterium der legitimen wirtschaftspolitischen Ziele führt der Gerichtshofs faktisch eine immanente Rechtfertigungsmöglichkeit im Rahmen des Art. 110 AEUV ein, wobei er sich der Rechtfertigung jedoch nicht nach der Feststellung eines Eingriffs widmet, sondern vielmehr bereits im objektiven Tatbestand des Art. 110 AEUV mögliche Rechtfertigungsgründe bzw. (legitime) wirtschaftspolitische Ziele einschließlich deren Prüfung anhand des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einfließen lässt. Unter deren Prämisse untersucht der Gerichtshof, ob die mitgliedstaatliche Steuerregelung gleichartige bzw. konkurrierende in- und ausländische Erzeugnisse unterschiedlich bzw. in protektionistischer Weise besteuert. Dabei nutzt er die herausgearbeiteten Ziele als Leitlinie für die Feststellung einer Diskriminierung bzw. einer protektionistischen Schutzwirkung und nutzt diese positiv, soweit die wirtschaftspolitischen Ziele den Erfordernissen des Unionsrechts in verhältnismäßiger Weise entsprechen. Im Ergebnis kommt es tatbestandlich damit nicht zu einer Diskriminierung bzw. protektionistischen Schutzwirkung (siehe Fall 3, Rn. 209 ff.).[24]
II.Die Wettbewerbsordnung
23
Die unionale Wettbewerbsordnung hat die Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs zum Ziel, was im Wesentlichen durch die primärrechtlich verankerten Kartell- und Beihilfevorschriften erreicht werden soll (siehe vor allem das Kartellverbot gemäß Art. 101 AEUV, das Verbot des Missbrauchs marktbeherrschender Stellungen gemäß Art. 102 AEUV und das Beihilfenverbot gemäß Art. 107 AEUV, die durch entsprechende Durchführungsverordnungen, insbesondere die Kartell-VerfO Verordnung (EG) Nr. 1/2003 und die Beihilfen-VerfO Verordnung (EU) Nr. 2015/1589 ergänzt werden). Hinzu kommt die ausschließlich sekundärrechtlich geregelte Fusionskontrolle (siehe insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 139/2004). Im Gegensatz zu den Grundfreiheiten, die grundsätzlich die Mitgliedstaaten adressieren, gelten die Wettbewerbsregeln der Art. 101, 102 AEUV in erster Linie für Unternehmen.
24
In Bezug auf die wettbewerbsrechtlichen Tatbestände von Art. 101 Abs. 1, Art. 102 Abs. 1 und Art. 107 Abs. 1 AEUV sind auch die jeweiligen (nicht abschließenden) Regelbeispielkataloge (vgl. Art. 101 Abs. 1 UAbs. 2 lit. a bis e AEUV und Art. 102 S. 2 lit. a bis d AEUV) bzw. Ausnahme- und Freistellungstatbestände (vgl. Art. 107 Abs. 2 lit. a bis c, Abs. 3 lit. a bis e AEUV) zu beachten, die teils Hilfestellung bei der tatbestandlichen Auslegung leisten können.
25
Wesentliches Element der wettbewerbsrechtlichen Verbotsvorschriften Art. 101, 102 und 107 AEUV ist, dass das jeweilige Verhalten der beteiligten Unternehmen bzw. im Falle des Art. 107 Abs. 1 AEUV die staatliche Begünstigung eine spürbar wettbewerbsverfälschende Wirkung haben sowie den innerunionalen Handel spürbar beeinträchtigen muss. Eine solche Analyse erfordert zunächst die Abgrenzung des relevanten (Produkt-)Marktes, der sachlich durch das Wettbewerbsverhältnis der beteiligten bzw. betroffenen Unternehmen und konkurrierenden Marktteilnehmern, d.h. durch die Austauschbarkeit deren Produkte aus Sicht des Verbrauchers hinsichtlich der Eigenschaften, des Preises und des Verwendungszwecks, zu bestimmen ist. In räumlicher Hinsicht muss der Markt hinsichtlich der Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sein.
26
Auf dem definierten Markt kann eine Wettbewerbsverfälschung zwar infolge der zuvor ebenfalls bereits festgestellten, kartellrechtlich relevanten Koordinierung von Unternehmen i.S.v. Art. 101 Abs. 1 AEUV, Missbrauchshandlung i.S.v. Art. 102 Abs. 1 AEUV bzw. beihilferechtlichen Begünstigung i.S.v. Art. 107 Abs. 1 AEUV regelmäßig indiziert werden, maßgeblich für deren Annahme ist allerdings grundsätzlich jeweils der Vergleich mit den hypothetischen Wettbewerbsverhältnissen, die ohne die in Rede stehende koordinierte Verhaltensweise bzw. ohne die Begünstigung herrschen würde. Nach dem in neuerer Zeit von der Europäischen Kommission verfolgten more economic approach ist vor allem auf den für betroffene Verbraucher nachteiligen Effekt, etwa auf die nachteilige Preisgestaltung infolge einer Verhaltensweise oder Begünstigung abzustellen. Ersichtlich wird, dass der Wettbewerb vor allem als ein die Konsumentenwohlfahrt schaffender Prozess geschützt werden soll und damit kein Selbstzweck ist.[25]
III.Das Außenwirtschaftsrecht
27
Die Außenwirtschaftskontrolle ist grundsätzlich Kernbereich nationaler Souveränitätsrechte, die im Rahmen der unionalen Wirtschaftsintegration teilweise auf die Union übertragen wurden und im Rahmen von Art. 206, 207 AEUV als gemeinsame Handelspolitik (GHP) gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. e AEUV ausschließlich supranational durchgeführt wird. In Anbetracht der Zollunion als wesentlicher Grundbaustein des Binnenmarktes stellt das unionale Außenhandelsregime mit einem einheitlichen gemeinsamen Zolltarif gegenüber Drittstaaten die Außendimension des Binnenmarktes dar.
1.Die kompetenzielle Reichweite der GHP
28
Im Unionsrecht ist das Außenhandelsrecht regelmäßig mit einer Diskussion über die Reichweite der unionalen Kompetenzen verbunden (gewesen). Während mit dem Vertrag von Amsterdam von 1997 lediglich eine Kompetenzerweiterungsmöglichkeit für den Rat bezüglich internationaler Übereinkünfte über Dienstleistungen und Rechte des geistigen Eigentums eingeführt wurde (Art. 133 Abs. 5 EGV-Amsterdam), von der allerdings nie Gebrauch gemacht wurde, erfolgte mit dem Vertrag von Nizza von 2001 die Durchführung der Kompetenzübertragung, allerdings beschränkt auf die jeweiligen Handelsaspekte, d.h. den Handel mit Dienstleistungen sowie Handelsaspekte des geistigen Eigentums.[26] Mit der Ausweitung auf ausländische Direktinvestitionen im Rahmen des Vertrags von Lissabon ließ sich zumindest bis zum Gutachten 2/15 des Gerichtshofs diskutieren, ob der investitionsschutzrechtliche GHP-Kompetenzbereich der Union auf Portfolioinvestitionen ausdehnbar ist,[27] da sich nach der implied powers-Lehre eine dahingehende ausschließliche Unionskompetenz implizit aus den Regelungen über die Kapitalverkehrsfreiheit herleiten und aufgrund der bisher fortgeschrittenen kapitalverkehrsrechtlichen Integration begründen ließe, die eine entsprechende Außenhandelskompetenz erfordert (siehe Fall 12, Rn. 755 ff.).
29
Die sogenannten implied powers knüpfen an ausdrücklich in den Unionsverträgen vorgesehene Unionskompetenzen an und können als Annexkompetenz, als Kompetenz aus dem Sachzusammenhang oder als Kompetenz aus der Natur der Sache eine Zuständigkeit der Union begründen.[28] Daraus folgt, dass sich grundsätzlich dann eine Unionskompetenz ergibt, sofern eine Materie, für die eine ausdrücklich zugewiesene Kompetenz besteht, verständlicherweise nicht geregelt werden kann, ohne dass gleichzeitig eine andere, nicht ausdrücklich zugewiesene Materie mitgeregelt wird.[29] Für den Bereich des Abschlusses internationaler Abkommen durch die Union bestimmt Art. 3 Abs. 2 AEUV die Anforderungen, nach denen die impliziten Vertragsabschlusskompetenzen gemäß Art. 216 Abs. 1 Var. 2 bis 4 AEUV als ausschließliche Kompetenz der Union zu bewerten sind. Dem dogmatischen Ansatz ausschließlich unionaler implied powers folgte der Gerichtshof im Gutachten 2/15 in Bezug auf die Erfassung von Portfolioinvestitionen gemäß Art. 216 Abs. 1 Var. 4 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 AEUV allerdings nicht und begrenzte die ausschließlich unionale investitionsschutzrechtliche Außenhandelskompetenz – im Einklang mit dem Wortlaut von Art. 207 Abs. 1 AEUV – auf ausländische Direktinvestitionen.
2.Die vertragliche Handelspolitik der Union
30
Mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Handlungsinstrumente im Bereich der GHP kann die Union im Rahmen der gemäß Art. 207 AEUV vorgesehenen Politikfelder, deren Abgrenzung zu anderen Politiken wie dem Umweltbereich teils problematisch ist, gemäß Art. 216 Abs. 1 AEUV die vertragliche Handelspolitik nach eigenem Ermessen gestalten und bi- oder multilaterale völkerrechtliche Verträge, z.B. Freihandelsabkommen oder Abkommen über die Errichtung von Zollunionen mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen abschließen (vgl. Art. 207 Abs. 3 AEUV). Die Durchführung der vertraglichen Handelspolitik der Union betrifft damit u.a. auch deren Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO) als Vertragspartei des WTO-Übereinkommens gemäß dessen Art. XI:1.
31
Der Abschluss von internationalen Abkommen durch die Union zieht die Frage nach sich, ob bzw. inwiefern diese Abkommen in den Rechtmäßigkeitsmaßstab für unionale und mitgliedstaatliche Maßnahmen einbezogen werden können. Dies ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs grundsätzlich nur möglich, soweit die erlassende unionale oder mitgliedstaatliche Stelle an die jeweiligen Bestimmungen des Unionsabkommens gebunden ist. Darüber hinaus verlangt der Gerichtshof die unmittelbare Anwendbarkeit, d.h. dass die intern geltende völkervertragliche Bestimmung zur innerunionalen Rechtsanwendung geeignet ist.[30]
a)Die unionsrechtliche Bindung gemäß Art. 216 Abs. 2 AEUV
32
Aus der umfassenden Bindungswirkung von im Rahmen der vertraglichen Handelspolitik eingegangenen Verpflichtungen gegenüber den Unionsorgangen und den Mitgliedstaaten gemäß Art. 216 Abs. 2 AEUV folgt eine hierarchische Einordnung internationaler Übereinkünfte im Rang zwischen Primär- und Sekundärrecht, sodass der Gerichtshof die von der Union abgeschlossenen Abkommen als „integrierende Bestandteile des Unionsrechts“[31] erachtet.
Dies gilt auch für sogenannte „gemischte Abkommen“, für die der Gerichtshof ohne weiteres die Auslegungszuständigkeit für sich in Anspruch nimmt, ohne die Frage aufzuwerfen, ob die Regelungen in den Zuständigkeitsbereich der Union fallen.[32]
b)Unmittelbare Anwendbarkeit
33
Hinsichtlich der unmittelbaren Anwendbarkeit einer völkerrechtlichen Norm ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs Vorraussetzung, dass diese unter Berücksichtigung ihres Wortlauts und im Hinblick auf den Zweck und die Natur des Abkommens eine klare und präzise Verpflichtung enthält, deren Erfüllung und deren Wirkung nicht vom Erlass eines weiteren Aktes abhängen,[33] d.h. dass die Verpflichtung sowohl inhaltlich unbedingt als auch hinreichend bestimmt bzw. präzise ist („self-executing“-Charakter) (siehe Fall 3, Rn. 201; Fall 5, Rn. 354 und Fall 15, Rn. 899).[34]
34
So hält der Gerichtshof etwa die Vorschriften des GATT nicht für unmittelbar anwendbar, da das GATT nach seiner Präambel auf Grundlage der Gegenseitigkeit und dem gemeinsamen Nutzen ausgehandelt wurde und die Zugeständnisse im Rahmen des GATT damit durch diplomatische Rücksprache mit den betroffenen Vertragsparteien ausgesetzt bzw. geändert werden können, sodass die GATT-Vorschriften durch eine große „Geschmeidigkeit“ gekennzeichnet sind.[35] Angesicht dieser großen Flexibilität der GATT-Bestimmungen, vor allem bezüglich etwaiger Abweichungen von den allgemeinen Regeln, kann grundsätzlich nicht von einer Unbedingtheit der GATT-Verpflichtungen ausgegangen werden. An dieser Rechtsprechung hat der Gerichtshof auch nach Gründung der WTO festgehalten (siehe Fall 15, Rn. 899).[36]
3.Die autonome Handelspolitik der Union
35
Demgegenüber kann die Union im Rahmen der autonomen Handelspolitik gemäß Art. 207 Abs. 2 AEUV Verordnungen, d.h. interne Unionsrechtsakte, zur Regulierung des Handels mit Drittstaaten erlassen, etwa Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder die Einführung von Schutzmaßnahmen (siehe Fall 8, Rn. 510). Hinzu kommt die Kompetenz für den Erlass des gemeinsamen Zolltarifs gemäß Art. 31 AEUV. Der Inhalt dieser handelsregulierenden Instrumente wird regelmäßig durch die vertragliche Handelspolitik beeinflusst, da sich die Union nicht zuletzt dem WTO-Rechtsregime und damit internationalen Handelsregelungen unterworfen hat.
IV.Die Wirtschafts- und Währungsunion
36
Die Begrifflichkeiten der Wirtschafts- und Währungsunion werden zwar regelmäßig „in einem Atemzug“ genannt, was durchaus eine gewisse Zusammengehörigkeit bzw. Verzahnung beider Bereiche belegt. Die Wirtschaftsunion sowie Währungsunion stellen allerdings zwei kompetenziell klar abzugrenzende und unterschiedlich integrierte Bereiche des Unionsrecht dar. Während das zentrale Element der Währungsunion die einheitliche Währung, der „Euro“, in der sogenannten Eurozone einschließlich des gemäß Art. 127 Abs. 1 AEUV vorrangigen geldpolitischen Mandats der Gewährleistung der Preisstabilität durch die Europäische Zentralbank (EZB) eine ausschließliche Zuständigkeit der Union (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c AEUV) ist, verbleibt der Kompetenzbereich der Wirtschaftspolitik bei den Mitgliedstaaten, zwischen denen gemäß Art. 5 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 AEUV i.V.m. Art. 119 Abs. 1 AEUV lediglich eine enge wirtschaftspolitische Koordinierung stattfindet, die gemäß Art. 119 Abs. 1, 120 S. 2 AEUV dem Grundsatz der offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.[37]
37
Angesichts der lediglich koordinationsbasierten wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ist deren Verpflichtung zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite gemäß Art. 126 Abs. 1 AEUV und damit zur soliden Haushaltspolitik von besonderer Bedeutung. Die Haushaltdisziplin drückt sich gemäß dem Defizitprotokoll i.V.m. Art. 126 Abs. 2 S. 2 AEUV durch die Einhaltung der Referenzwerte von maximal 3% Nettoneuverschuldung und maximal 60% des Bruttoinlandprodukts als Gesamtschuldenstand aus, die vor allem für die Euro-Staaten finanzpolitische Stabilität gewährleisten soll. Zu beachten ist, dass die Pflicht zur Vermeidung öffentlicher Defizite gemäß Art. 139 Abs. 2 S. 1 lit. b AEUV für die Euro-Mitgliedstaaten uneingeschränkt gilt. Wenngleich die Einhaltung der Haushaltsdisziplin gemäß Art. 126 Abs. 10 AEUV nicht im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens durchsetzbar ist, enthält Art. 126 Abs. 2 bis 11 AEUV einen von der Kommission und dem Rat durchgeführten Überwachungsmechanismus einschließlich etwaiger Sanktionierungsmöglichkeiten durch den Rat (siehe eine typische Fallkonstellation der Finanz- und Staatsschuldenkrise in Fall 13, Rn. 771 ff.).[38]
C.Teilgebiete des Internationalen Wirtschaftsrechts
I.Allgemeines Völkerrecht
38
Die Relevanz des allgemeinen Völkerrechts im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht folgt vor allem daraus, dass die internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen in erster Linie völkervertragsrechtlich in Form von bi-, pluri- oder multilateralen Abkommen zwischen den souveränen Staaten ausgestaltet sind. Die völkerrechtlichen Handels- und Wirtschaftsabkommen werden damit im Sinne von Art. 38 Abs. 1 lit. a IGH-Statut zur praktisch bedeutsamsten Quelle des Wirtschaftsvölkerrechts. So beruht beispielsweise sowohl die Gründung der Europäischen Union als auch die Errichtung der WTO auf völkerrechtlichen Verträgen. Dabei ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich die Rechtsnatur der jeweils neu gestalteten Rechtsordnungen von der Qualität des Gründungsaktes löst und sich zumindest im Verhältnis zu den Vertragsparteien bzw. Mitgliedstaaten von traditionellen völkerrechtlichen Verträgen unterscheidet.[39] Im Falle der Unionsverträge als Rechtsordnung sui generis hat dies zur Folge, dass die allgemein völkerrechtlichen Auslegungsregeln nach der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) im unionalen Binnenbereich grundsätzlich keine Anwendung finden (siehe Fall 1, Rn. 104 ff.).
39
Die rechtliche Ausgestaltung der internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen erfolgt grundsätzlich durch die Nationalstaaten selbst als originäre Völkerrechtssubjekte, die aufgrund der ihnen zukommenden Souveränität in Bezug auf das jeweilige Staatsgebiet (Gebietshoheit) und die jeweilige Bevölkerung (Personalhoheit) entsprechende zwischenstaatliche und völkerrechtlich bindende Übereinkünfte u.a. wirtschaftsrechtlicher Art schließen können. Demgegenüber geht die wirtschaftliche Tätigkeit in internationalen Wirtschaftsbeziehungen weit überwiegend von trans- oder multinationalen Unternehmen aus, die mangels Völkerrechtssubjektivität nicht Vertragspartei von völkerrechtlichen Abkommen sein können. Dies bedeutet wiederum nicht, dass Private im Rahmen von völkerrechtlichen Verträgen keine eigenständigen, unmittelbar anwendbaren Rechte erhalten können. So werden private Investoren in bilateralen Investitionsschutzabkommen regelmäßig etwa mit Klagerechten ausgestattet, die diese zur Initiierung von Investor-Staat-Streitbelegungsverfahren berechtigen. Unmittelbare Rechtswirkung der wirtschaftsvölkerrechtlichen Abkommen zugunsten Privater ist allerdings regelmäßig von den Vertragsparteien nicht gewollt, sodass – zumindest in neuerer Zeit – eine unmittelbare Anwendbarkeit von völkerrechtlichen (Handels-)Abkommen explizit ausgeschlossen wird. Ansonsten bedarf es einer Auslegung konkreter Vorschriften hinsichtlich ihrer hinreichenden Bestimmtheit und Unbedingtheit.
40
Maßgebliche Bedeutung erlangt das allgemeine Völkerrecht im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht darüber hinaus regelmäßig im Rahmen von kodifiziertem Völkergewohnheitsrecht, etwa der WVK oder auch den Regeln über die Deliktshaftung der Staaten wegen der Verantwortlichkeit für völkerrechtswidriges Handeln, die in den ILC Draft Articles niedergeschrieben sind. So hat etwa die UN-Völkerrechtskommission (International Law Commission [ILC]) mit den ILC Draft Articles eine Verschriftlichung der Regeln zur deliktischen Staatenverantwortlichkeit erreicht, die mit der Resolution 56/83 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 12.12.2001 angenommen wurde. Eine völkervertragsrechtliche Grundlage i.S.v. Art. 38 Abs. 1 lit. a IGH-Statut für die völkerrechtliche Verantwortlichkeit von Staaten für völkerrechtswidriges Handeln oder Unterlassen existiert damit allerdings nicht. Verbindlichen Charakter erhält die völkerrechtliche Staatenverantwortlichkeit weiterhin vielmehr „lediglich“ als Gewohnheitsrecht i.S.v. Art. 38 Abs. 1 lit. b IGH-Statut (siehe Fall 16, Rn. 932).
II.Das Recht der WTO und regionale Handelsabkommen
41
Die WTO ist eine internationale Organisation mit derzeit 164 Mitgliedern, die auf Grundlage des Übereinkommens zur Errichtung der WTO (WTO-Übereinkommen) zum 1.1.1995 gegründet worden ist. In die rechtliche WTO-Struktur sind gemäß den Anhängen des WTO-Übereinkommens mehrere multi- und plurilaterale Abkommen integriert, etwa das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 1994 (GATT 1994), das Übereinkommen über die Landwirtschaft, das Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (alle Anhang 1A), das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) (Anhang 1B) sowie die Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung (Anhang 2).
42
Das Regulierungsregime der WTO begründet keinen Freihandel, sondern zielt auf die Erhöhung des Liberalisierungsgrades des internationalen Handels und damit auf einen freieren Handel ab. Es beinhaltet ein umfassendes Antidiskriminierungsregime sowie den „tariffs only“- und „bound tariffs“-Grundsatz.
1.Der „tariffs only“-/„bound tariffs“-Grundsatz des GATT
43
Im Zusammenhang mit dem „tariffs only“-Grundsatz ist zunächst festzuhalten, dass die schlichte Erhebung von Zöllen nicht per se gegen WTO-Recht verstößt. Als offensichtliche Maßnahmen aufgrund des Grenzübertritts sind Zölle im WTO-Recht grundsätzlich ein legitimes Instrument zur Lenkung der Warenströme.[40] Normativ ergibt sich der „tariffs only“-Grundsatz aus Art. XI:1 GATT i.V.m. Art. II GATT. Dabei bestimmt Art. XI:1 GATT, dass Kontingente, Ein- bzw. Ausfuhrbewilligungen wie auch andere Maßnahmen, die den Marktzugang bzw. Marktaustritt von Waren in nicht-tarifärer Art und damit regelmäßig wenig transparenter Weise behindern, verboten sind (siehe dazu Fall 15, Rn. 902 ff.).[41] Art. II:1 GATT schreibt darüber hinaus die Zollbindung der WTO-Mitglieder an die gemäß Art. XI:1 WTO-Übereinkommen beizufügenden Listen der Zugeständnisse und Verpflichtungen vor („bound tariffs“). Die WTO-Mitglieder können mittels der Listen untereinander verbindliche Maximalzölle festlegen, dürfen die in den Listen festgelegten Maximalzölle allerdings nicht überschreiten.[42] Die Zolllisten sind gemäß Art. II:7 GATT ein Bestandteil des GATT (siehe Fall 14, Rn. 831 ff.).
2.Das Antidiskriminierungsregime des WTO-Rechts
a)Grundpfeiler des Antidiskriminierungsregimes
44
In materieller Hinsicht basiert das WTO-System darüber hinaus im Wesentlichen auf einem umfassenden Antidiskriminierungsregime, das den Grundsatz der Meistbegünstigung sowie denjenigen der Inländer(gleich)behandlung umfasst. Während nach dem Meistbegünstigungsgrundsatz ein gegenüber einem WTO-Mitglied gewährter Vorteil auf alle anderen WTO-Mitglieder auszuweiten ist (vgl. Art. I:1 GATT; Art. II GATS), verbietet die Inländerbehandlung die Schlechterstellung gleichartiger ausländischer Waren bzw. Dienstleistungen gegenüber inländischen nach deren Markteintritt (vgl. Art. III GATT). Im Bereich des GATS besteht die Besonderheit, dass für den Umfang der Verpflichtungen die in den Listen i.S.v. Art. XI:1 GATS vorgenommenen Zugeständnisse maßgeblich sind (sogenannter positive list approach).
b)Die Bestimmung der Gleichartigkeit i.S.v. Art. I:1 GATT bzw. Art. III GATT
aa)Die Kriterien der GATT-Arbeitsgruppe „Working Party on Border Tax Adjustments“
45
Eine besondere Schwierigkeit im Rahmen des Art. I:1 GATT bzw. des Art. III GATT besteht regelmäßig hinsichtlich der Bestimmung der Gleichartigkeit der in Rede stehenden Produkte. Diesbezüglich ist auf die von der GATT-Arbeitsgruppe „Working Party on Border Tax Adjustments“ bereits 1970 erarbeiteten Kriterien zurückzugreifen, nämlich die physikalischen Eigenschaften der Ware, deren Endverbrauch, die Vorlieben und Gewohnheiten von Verbrauchern sowie die Zolltarifklassifikation.[43] Zu beachten ist, dass diese Kriterien einer auf den Einzelfall bezogenen Bewertung dienen sollen, inwiefern zwischen den in Rede stehenden Erzeugnissen eine Wettbewerbsbeziehung besteht (siehe dazu Fall 3, Rn. 240 und Fall 15, Rn. 910).[44]
bb)Herstellungs- bzw. Produktionsmethoden als Gleichartigkeitskriterien
46
Zur Bildung der relevanten Vergleichsgruppe kann dagegen nicht unmittelbar die „Herstellungs- bzw. Produktionsmethode“ (Process and Production Method [PPM]) einer Ware herangezogen werden.[45] Allenfalls können PPMs insoweit mittelbar bei der Bestimmung der Gleichartigkeit Berücksichtigung finden, dass diese einen Produktbezug haben (product-related PPMs [PR-PPMs]) und sich etwa in den physikalischen Eigenschaften des Erzeugnisses bzw. in dessen Qualität niederschlagen.[46] Sofern PPMs dagegen keinen Einfluss auf die Produktqualität nehmen und damit keinen unmittelbaren Produktbezug aufweisen (non-product-related PPMs [NPR-PPMs]), widerspricht deren Heranziehung der Dogmatik des GATT. Besonders deutlich wird dies im Falle der Gleichartigkeitsprüfung anhand von Verbrauchervorlieben, die in erheblichem Maße von unterschiedlichen Herstellungsmethoden abhängen können. So dürfte nicht nur die Objektivierung der subjektiven Verbrauchererwägungen regelmäßig Schwierigkeiten bereiten, sondern es dürfte aus dogmatischer Sicht vor allem entscheidend sein, dass das GATT die Berücksichtigung derartiger Erwägungsgründe, die sich in der jeweiligen staatlichen Maßnahme manifestieren, vielmehr als Rechtfertigungsgründe im Rahmen der Rechtfertigung gemäß Art. XX GATT vorsieht (siehe dazu Fall 3, Rn. 242 ff.; Fall 15, Rn. 913 ff.).
3.Die Rechtfertigungsdogmatik des GATT
47
Die Rechtfertigungsdogmatik des GATT enthält zum einen die allgemeinen Ausnahmen gemäß Art. XX GATT, zum anderen spezielle Ausnahmen beispielsweise zur Wahrung der Sicherheit gemäß Art. XXI GATT sowie für handelspolitische Schutzinteressen.
a)Die allgemeinen Ausnahmen gemäß Art. XX GATT
48
Der Appellate Body wendet zur Prüfung des Art. XX GATT einen sogenannte „two-tier“-Test an, der aus folgenden Elementen besteht: (1) Prüfung der legitimen Ziele der abschließenden Liste gemäß Art. XX lit. a-j GATT sowie (2) Prüfung des sogenannten „chapeau“. Für die Prüfung der legitimen Ziele ist zu beachten, dass diese in einer bestimmten Beziehung zum Schutzgut stehen müssen. Während die nationale Maßnahme im Falle von Art. XX lit. a, b und d GATT erforderlich sein muss („necessary“), bedarf es im Falle von Art. XX lit. c, g und e GATT lediglich eines Bezuges zum angestrebten Ziel („relating to“).[47] Voraussetzung des „chapeau“, d.h. der Einführungsklausel des Art. XX GATT, ist, dass die Anwendung der nationalen Maßnahme keine willkürliche und ungerechtfertigte Diskriminierung oder verschleierte Handelsbeschränkung darstellt. Die Anforderungen des „chapeau“ bilden ein einheitliches Prinzip, das eine rechtsmissbräuchliche Anwendung der Rechtfertigungsmöglichkeiten gemäß Art. XX GATT verhindern soll (siehe Fall 3, Rn. 243 und Fall 15, Rn. 914).[48]
b)Das Problem der extraterritorialen Wirkung von nationalen Maßnahmen
49
Im Falle von nationalen Vermarktungsverboten, die auf bestimmte allgemeinwohlbezogene Herstellungs- oder Produktionsmethoden abstellen, ergibt sich allerdings die besondere Problematik, dass mittels einer solchen Maßnahme eines WTO-Mitglieds die Hersteller anderer WTO-Mitglieder mittelbar dazu veranlasst werden, die Erzeugnisse unter Wahrung der festgelegten allgemeinwohlbezogenen Herstellungsmethode herzustellen, da anderenfalls eine Vermarktung im Einfuhrstaat ausgeschlossen ist. Nach den Ausführungen des Appellate Body in US–Shrimp ist eine nationale Maßnahme, die aufgrund der Regulierung von Herstellungsmethoden Auswirkungen auf außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets liegende Sachverhalte hat, grundsätzlich zulässig, soweit eine „ausreichende Verbindung“ („sufficient nexus“) zwischen dem regulierenden Staat und dem Regulierungsgegenstand besteht,[49] wenngleich deren Ausgestaltung fraglich bleibt. So könnte einerseits Anforderung an den Nexus eine physisch-territoriale Verbindung zwischen dem regulierenden Staat und dem Regulierungsgegenstand sein,[50] was mit den Ausführungen des Appellate Body in der Sache US–Shrimp übereinstimmen würde, in der das US-Verbot von Shrimps aus Staaten, in denen keine seeschildkrötenfreundlichen Fangnetze verwendet wurden, angesichts der weitläufigen Migrationswege von Seeschildkröten – u.a. in die US-Gewässer – gerechtfertigt werden konnte (gemäß Art. XX lit. g GATT).[51] Damit können insbesondere Maßnahmen, die transnationale Sachverhalte wie etwa den Klimawandel betreffen, durchaus gemäß Art. XX GATT gerechtfertigt werden.
50
Andererseits muss allerdings in Anbetracht der allgemein völkerrechtlichen Erwägung, dass die Souveränität eines Staates nicht nur die Gebiets-, sondern auch die Personalhoheit umfasst,[52] die schlichte innerstaatliche Zielrichtung einer nationalen Maßnahme ausreichen. So erachtete der Appellate Body in der Sache EC–Seals eine Maßnahme zum Schutz der öffentlichen Wertvorstellungen innerhalb der Union als einen ausreichenden Nexus.[53] Hieraus wird deutlich, dass ein wesentlicher Anknüpfungspunkt für die Bewertung der „ausreichenden Verbindung“ die Frage ist, wem der Schutz zugutekommen soll, nämlich regelmäßig vor allem der heimischen Bevölkerung (siehe Fall 15, Rn. 917 ff.).
4.Anforderungen an regionale Handelsabkommen gemäß Art. XXIV GATT
51
Mit Blick auf die regionale Wirtschaftsintegration sind vor allem die einschlägigen Vorschriften betreffend wirtschaftlicher Integrationsabkommen zu beachten, d.h. für den Warenhandel Art. XXIV GATT bzw. für den Dienstleistungshandel Art. V GATS, die sich in ihren materiellen Anforderungen an regionale Handelsabkommen stark ähneln. Gemäß den genannten Vorschriften sind regionale Wirtschaftsintegrationsabkommen zulässig, die aufgrund der durch das jeweilige Abkommen gegenüber einem begrenzten Kreis von WTO-Mitgliedern gewährten Begünstigungen grundsätzlich einen Verstoß gegen den Meistbegünstigungsgrundsatz darstellen würden.
52
Gemäß Art. XXIV:4 GATT erkennen die WTO-Mitglieder an, dass es wünschenswert ist, durch freiwillige Vereinbarungen zur Förderung der wirtschaftlichen Integration der teilnehmenden Länder eine größere Freiheit des Handels herbeizuführen. Dabei regelt Art. XXIV:5, 8 GATT grundsätzlich lediglich die Zulässigkeit von Zollunionen und Freihandelsabkommen, deren Zweck es sein soll, den Handel zwischen den teilnehmenden Staaten zu erleichtern. Art. XXIV GATT erlaubt damit die Errichtung von Freihandelszonen bzw. Zollunionen, soweit die eingeführten Zölle und Handelsvorschriften für den Handel in ihrer Gesamtheit nicht höher oder einschränkender als vor der Bildung der jeweiligen Integrationsgemeinschaft sind (Art. XXIV:5 lit. a, b GATT) sowie das jeweilige Abkommen annähernd den gesamten Handel betrifft (Art. XXIV:8 lit. a, b GATT). Die Auslegung der dargelegten Begrifflichkeiten ist aufgrund ihrer Unbestimmtheit vergleichsweise schwierig. Nach dem Appellate Body in Turkey – Textiles ist „annähernd der gesamte Handel“ nicht das Gleiche wie „der gesamte Handel“, bedeutet aber gleichzeitig deutlich mehr als „some of the trade“.[54] Zudem sind für die Bewertung sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte heranzuziehen (siehe Fall 1, Rn. 97).[55]
53
Für Dienstleistungsabkommen gelten gemäß Art. V GATS grundsätzlich vergleichbare Anforderungen, nämlich die Erstreckung auf einen beträchtlichen sektoralen Geltungsbereich (Art. V:1 lit. a GATS) sowie keine Erhöhung des allgemeinen Niveaus der Hemmnisse für den Dienstleistungshandel in den jeweiligen (Teil-)Sektoren (Art. V:4 GATS). Hinsichtlich des Kriteriums des „beträchtlichen sektoralen Geltungsbereichs“ konkretisiert die Fußnote 1 zu Art. V GATS, dass diese Bedingung die Zahl der Sektoren, das betroffene Handelsvolumen und die Erbringungsformen (modes of supply i.S.v Art. I GATS) betrifft; insbesondere soll keine Erbringungsform in einem Integrationsabkommen ausgeschlossen sein.
54
Darüber hinaus bedarf es einer angemessenen Zeitspanne zur Umsetzung der Zollunion bzw. des Freihandelsabkommens i.S.v. Art. XXIV:5 lit. c GATT sowie der Notwendigkeit der jeweiligen Handelsregelung für die Verwirklichung der Zollunion bzw. des Freihandelsabkommens (vgl. den Wortlaut des Art. XXIV:5 GATT [„zur Bildung“] sowie die Rechtsprechung des Appellate Body in der Rechtssache Turkey – Textiles[56]).
55
Gemäß Art. XXIV:7 GATT bzw. Art. V:7 GATS besteht zudem eine Notifizierungspflicht für regionale Integrationsabkommen. Durch den Transparenzmechanismus für Regionale Handelsabkommen von 2006 wurde diese Notifizierungspflicht im Hinblick auf den maßgeblichen Zeitpunkt präzisiert. Danach sollen die WTO-Mitglieder im Rahmen einer frühzeitigen Bekanntmachung möglichst bereits die Aufnahme von Verhandlungen anzeigen, die auf den Abschluss eines Abkommens gerichtet sind. Die eigentliche Notifizierung soll „so früh wie möglich“, d.h. im Regelfall unmittelbar nach der völkerrechtlichen Ratifizierung und in jedem Fall vor der eigentlichen Anwendung des Abkommens erfolgen.[57] Der Transparenzmechanismus stellt allerdings allein ein zusätzliches verfahrensrechtliches Element dar, durch das die Transparenz der vielfältigen Abkommensbeteiligungen der WTO-Mitglieder und deren jeweiliger Inhalte erhöht werden sollen. Materiell-rechtlich hat der Mechanismus keine Relevanz.
III.Das internationale Investitionsschutzrecht
56
Das internationale Investitionsschutzrecht ist überwiegend durch eine Vielzahl von bilateralen Investitionsschutzabkommen geprägt. Mit dem Bedürfnis nach fortschreitender Wirtschaftsintegration von vergleichbar homogenen Wirtschaftsräumen enthalten allerdings mittlerweile auch moderne plurilaterale „Handels- und Wirtschaftsabkommen des 21. Jahrhunderts“ Investitionsschutzkapitel (beispielsweise das North American Free Trade Agreement [NAFTA] oder das Comprehensive Economic and Trade Agreement [CETA]).
57
Während ein wesentlicher Aspekt der Handelsliberalisierung die Erleichterung des Marktzugangs etwa durch Zollabbau ist, spielt die Marktöffnung im Investitionsschutzrecht eine eher untergeordnete Rolle. Ein Marktzugangsrecht vermittelt allerdings das GATS, soweit sich ein WTO-Mitglied für den Dienstleistungsmodus 3, nämlich der Dienstleistungserbringung durch eine kommerzielle Präsenz, in seinen sektorspezifischen Zugeständnislisten gemäß Art. XVI GATS dazu verpflichtet hat (Positivlisten-Ansatz; anders dagegen im NAFTA mit einem Negativlisten-Ansatz).[58] Dabei erfasst der Modus 3 allerdings nur ausländische Direktinvestitionen, d.h. solche Investitionen, mit denen sich ein Investor dauerhaft oder für eine gewisse Zeit wirtschaftlich im Zielland betätigen will bzw. durch die er zumindest im Rahmen eines Anteilserwerbs an einem im Zielland bereits ansässigen Unternehmens einen bestimmenden Einfluss erhält.[59]
58
Der Anwendungsbereich von Investitionsschutzabkommen bzw. den entsprechenden Kapiteln in Wirtschaftsabkommen ist regelmäßig schlicht durch den gängigen Investitionsbegriff – im deutschen Model-BIT durch den Begriff der Kapitalanlage sowie des Investors – definiert und damit nicht bereits während der sogenannten pre-establishment-Phase einer Investition, sondern erst ab dem Zeitpunkt deren tatsächlicher Etablierung (post establishment-Phase) eröffnet. Erst dann kann sich ein Investor im Streitfall auf die einschlägigen investitionsschutztypischen Standards, etwa Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Securityoder den im jeweiligen Abkommen niedergelegten Eigentumsschutz in Form von Enteignungsregelungen, berufen. Auf den konkreten Sachverhalt sind diese Schutzstandards im Sinne eines angemessenen Ausgleiches zwischen dem Investorenschutz und dem staatlichen right to regulate, d.h. der Regulierungssouveränität eines Staates, anzuwenden.
59
Ein Investor erhält in Investitionsschutzverträgen regelmäßig ebenfalls ein eigenständiges Klagerecht zur Durchsetzung seiner Ansprüche in Investor-Staat-Verfahren vor einem (auf ad hoc-Basis einzurichtenden) Schiedsgericht. Diese schiedsgerichtliche Klagemöglichkeit bezweckt mittlerweile allerdings weniger die Verschaffung von Rechtssicherheit gegenüber dem Investor bzw. die Überwindung von Rechtsunsicherheit vor den staatlichen Gerichten des Aufnahmestaates als die Schließung von Rechtsschutzlücken, die sich regelmäßig aus der unterschiedlichen – wenngleich völkerrechtlich zulässigen – rechtlichen Behandlung von In- und Ausländern in innerstaatlichen Rechtsordnungen ergeben. Die Effektivität des schiedsgerichtlichen Streitbelegungssystems ist – zumindest in Fällen, in denen die Streitparteien der Zuständigkeit des ICSID zugestimmt haben – dadurch gewährleistet, dass ein ICSID-Schiedsspruch gemäß Art. 54 Abs. 1 der ICSID-Konvention in den Vertragsstaaten wie ein Urteilsspruch eines nationalen Gerichts zu behandeln ist und damit ohne weiteres Anerkennungsverfahren vollstreckt werden kann.
D.Berührungspunkte von Europäischem und Internationalem Wirtschaftsrecht
60
Berührungspunkte bzw. Schnittstellen der beiden Rechtsmaterien ergeben sich bereits daraus, dass die Zulässigkeit regionaler Integrationsabkommen und damit auch die Unionsverträge grundsätzlich nach den multilateralen WTO-Abkommen, vor allem anhand von Art. XXIV GATT und Art. V GATS zu beurteilen sind, die die Anforderungen an regionalen Integrationsgemeinschaften – wenn auch nur sehr unbestimmt und schwierig durchsetzbar – festlegen. Zwar stellen die Unionsverträge nach außen wirtschaftsvölkerrechtliche Abkommen i.S.v. Art. XXIV GATT und Art. V GATS dar, dennoch ist der Rückgriff auf allgemein völkerrechtliche Normen etwa zur Auslegung des unionalen Binnenrechts grundsätzlich ausgeschlossen. Nach seinem Selbstverständnis ist das Unionsrecht nicht als Teil des Völkerrechts anzusehen, sondern es nimmt für sich in Anspruch, normhierarchisch über dem Völkerrecht zu stehen, sodass das Völkerrecht nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs als „integrierender Bestandteil“[60] im Rang unterhalb des Primärrechts und oberhalb des Sekundärrechts steht. Die Unionsverträge haben im Unterschied zu gewöhnlichen internationalen Verträgen eine eigene Rechtsordnung geschaffen, die in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aufgenommen worden ist und von ihren Gerichten anzuwenden ist.[61] Dieses Wesen offenbart sich regelmäßig in der Rechtsprechung internationaler Schiedsgerichte, die in Anerkennung dessen das Unionsrecht nicht als Völkerrecht, sondern – entsprechend der Behandlung innerstaatlichen Rechts in internationalrechtlichen Kontexten – als Faktum (bzw. als Recht des beklagten Staates) begreifen.[62]
61
Vor diesem Hintergrund überschneiden sich das Europäische und Internationale Wirtschaftsrecht in erster Linie dort, wo die Union, aber auch die Mitgliedstaaten nach außen handeln bzw. gehandelt haben, insbesondere im Bereich der (Waren-)Handels- und Investitionsschutzpolitik, und diese außenhandelspolitischen Aktivitäten Rückwirkungen in die Unionsrechtsordnung zeigen. Dies manifestiert sich beispielsweise im Rahmen der Mitgliedschaft der Union in der WTO, deren Recht die Union sowie die EU-Mitgliedstaaten gemäß Art. 216 Abs. 2 AEUV bindet und damit Implikationen innerhalb des Unionsrechts schafft; nicht nur allgemein im Hinblick auf die Gewährleistung der mitgliedstaatlichen Einhaltung von WTO-Recht durch die Union, sondern auch konkret hinsichtlich der Einbeziehung von WTO-Recht in den Prüfungsmaßstab des Gerichtshofs.
62
Darüber hinaus folgen dem außenhandelsrechtlichen Kompetenzzuwachs der Union gemäß Art. 207 Abs. 1 AEUV mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1.12.2009 vielfältige rechtliche Problemkonstellationen u.a. in Form der außenhandelsrechtlichen „Relikte“ der Mitgliedstaaten, die in der Zeit ante-Lissabon selbst etwa im Bereich der ausländischen (Direkt-)Investitionen zahlreiche völkerrechtliche Investitionsschutzabkommen (BITs) abgeschlossen haben. Diese erlangen nunmehr dahingehend eine unionsrechtliche Dimension, dass angesichts der Kompetenzverschiebung zugunsten der Union die grundsätzliche unionsrechtliche Zulässigkeit von mitgliedstaatlichen BITs sowohl in intra- als auch extra-EU Konstellationen in Frage gestellt wird. Jedenfalls hat der Gerichtshof mit seiner Achmea-Rechtsprechung die Diskussion über die unionsrechtliche Zulässigkeit der Errichtung von Schiedsgerichten aufgrund von intra-EU BITs aufgrund von Bedenken hinsichtlich Bewahrung der Autonomie der Unionsrechtsordnung beendet, wobei wiederum offen ist, inwiefern diese Rechtsprechung auf intra-EU Streitigkeiten auf Grundlage des Energiecharta-Vertrages übertragbar ist.[63]
Anmerkungen
Gerichtshof, C-294/83, ECLI:EU:C:1986:166, Rn. 23 – Les Verts.
Gerichtshof, C-7/64, ECLI:EU:C:1964:66, S. 1269 – Costa/E.N.E.L.
Gerichtshof, Rs. C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1, Rn. 3 – van Gend & Loos.
Vgl. Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 62. EL Juli 2017, Art. 351 AEUV, Rn. 42.
Streinz, Europarecht, 10. Auflage 2016, Rn. 1063.
Gerichtshof, C-120/78, ECLI:EU:C:1979:42, Rn. 5 – Cassis de Dijon.
Siehe allgemein zu regionaler Wirtschaftsintegration Krajewski, Wirtschaftsvölkerrecht, 4. Auflage 2017, § 7; Schöbener/Herbst/Perkams, Internationales Wirtschaftsrecht, 2010, § 3 I.
Siehe dazu Streinz, Europarecht, 10. Auflage 2016, Rn. 16 ff.
Gerichtshof, C-142/05, ECLI:EU:C:2009:336, Rn. 28 – Mickelsson und Roos.
Siehe u.a. Gerichtshof, C-108/09, ECLI:EU:C:2010:725, Rn. 54 – Ker-Optika.
Gerichtshof, C-108/09, ECLI:EU:C:2010:725, Rn. 54 – Ker-Optika.
Gerichtshof, verb. C-267/091 und C-268/91, ECLI:EU:C:1993:905, Rn. 17 – Keck und Mithouard.
Vgl. auch Würdemann/Glöckle, Die Dogmatik des Art. 110 AEUV in der Rechtsprechung des EuGH, ZEuS 2016, 85 (88 f.).
Siehe dazu u.a. Cremer/Bothe, Die Dreistufenprüfung als neuer Baustein der warenverkehrsrechtlichen Dogmatik, EuZW 2015, 413 (416/417); Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, 11. Auflage 2018, Rn. 907; Streinz, Europarecht, 10. Auflage 2016, Rn. 909 ff.
Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, 11. Auflage 2018, Rn. 908 mit Verweis auf Gerichtshof, C-456/10, ECLI:EU:C:2012:241, Rn. 33 ff. – ANETT.
Gerichtshof, C-120/78, ECLI:EU:C:1979:42, Rn. 5 – Cassis de Dijon.
Gerichtshof, C-120/78, ECLI:EU:C:1979:42, Rn. 8 – Cassis de Dijon.
Vgl. Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Auflage 2016, Art. 36 AEUV, Rn. 48.
Gerichtshof, C-112/00, ECLI:EU:C:2003:333, Rn. 65 ff. – Schmidberger; siehe auch Streinz, Europarecht, 10. Auflage 2016, Rn. 882.
Streinz, Europarecht, 10. Auflage 2016, Rn. 869.
Gerichtshof, C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Rn. 37 f. – Omega.
Schön, Der freie Warenverkehr, die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten und der Systemgedanke im europäischen Steuerrecht – Teil I: Die Grundlagen und das Verbot der Zölle und zollgleichen Abgaben, EuR 2001, S. 220.
Gerichtshof, C-46/80, ECLI :EU:C:1981:4, Rn. 13 – Vinal/Orbat.
Vgl. auch Würdemann/Glöckle, Die Dogmatik des Art. 110 AEUV in der Rechtsprechung des EuGH, ZEuS 2016, 85 (91 ff.).
Vgl. Albers, Der „more economic appraoch“ bei Verdrängungsmissbräuchen – Zum Stand der Überlegungen der Europäischen Kommission, Vortrag beim Hamburger Kartellrechtssymposium 2006, verfügbar unter <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/albers.pdf> zuletzt abgerufen am 16.1.2019.
Weiß, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 63. EL Dezember 2017, Art. 207 AEUV, Rn. 4 ff.; vgl. auch Herrmann, Vom misslungenen Versuch der Neufassung der gemeinsamen Handelspolitik durch den Vertrag von Nizza, EuZW 2001, 269 (271 ff.).
Herrmann, Die Zukunft der mitgliedstaatlichen Investitionspolitik nach dem Vertrag von Lissabon, EuZW 2010, 207 (209).
Siehe Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 63. EL Dezember 2017, Art. 1 AEUV, Rn. 13.
Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 63. EL Dezember 2017, Art. 1 AEUV, Rn. 13.
Vgl. Gerichtshof, C-21/74 bis 24/72, ECLI:EU:C:1972:115, Rn. 7/9 – International Fruit Company.
Gerichtshof, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, Rn. 2/6 – Haegemann/Belgien.
Vgl. auch Gerichtshof, C-265/03, ECLI:EU:C:2005:213 – Simuntenkov; vgl. auch Ehricke, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Auflage 2018, Art. 267 AEUV, Rn. 21 m.w.N.; vgl. Thiele, Europäisches Prozessrecht, 2. Auflage 2014, § 9, Rn. 24.
Vgl. u.a. Gerichtshof, C-265/03, ECLI:EU:C:2005:213, Rn. 21 – Simuntenkov.
Vgl. Gerichtshof, C-104/81, ECLI:EU:C:1982:362, Rn. 20 – Kupferberg.
Gerichtshof, C-21/74 bis 24/72, ECLI:EU:C:1972:115, Rn. 21 – International Fruit Company.