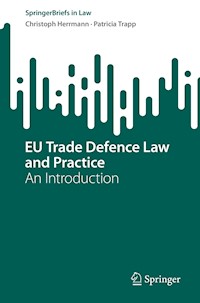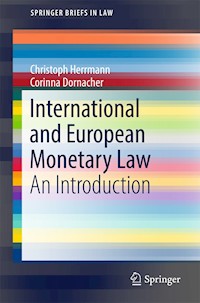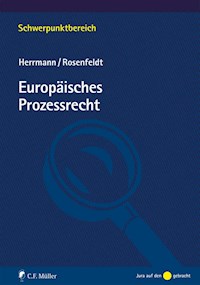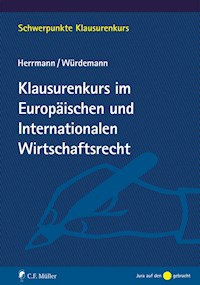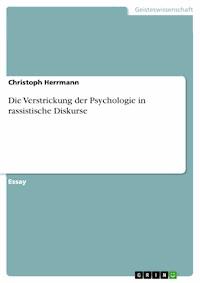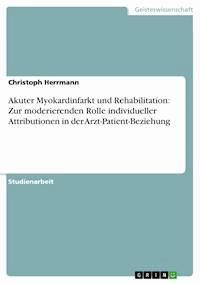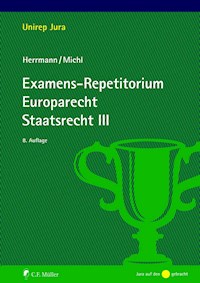
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Inhalt und Konzeption: Das Examens-Repetitorium stellt diejenigen Themenkreise des Europarechts dar, die zum Pflichtfachstoff der Ersten Juristischen Prüfung zählen. Die Grundlagen der völkerrechtlichen Bezüge des Grundgesetzes werden dabei integriert behandelt. Der Band ist konzipiert für eine komprimierte, stark verdichtete Wiederholung vor dem Examen und setzt mithin Grundkenntnisse der behandelten Materien voraus. Die Darstellung folgt dabei nicht dem klassischen Aufbau typischer Lehrbücher, sondern gliedert sich nach der Perspektive der jeweiligen Rechtsanwender, d.h. der deutschen Fachgerichtsbarkeit, des EUGH, des BVerfG und des EGMR. Diese Struktur ist ähnlich als Anspruchsaufbau oder Aufbau nach Klagearten aus anderen Rechtsgebieten hinreichend bekannt. Dies erleichtert den Studierenden gerade bei der examensnahen Wiederholung die Einordnung der Probleme, ohne zugleich die Nachteile des vorrangigen Lernens anhand von Fällen mit sich zu bringen. Dem didaktischen Anliegen der Reihe entsprechend dienen integrierte Beispielsfälle mit Lösungshinweisen der Veranschaulichung. Mehr als 90 Übungsfragen zur eigenständigen Wissenskontrolle des Lesers runden die Darstellung ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Examens-Repetitorium Europarecht. Staatsrecht III
von
Dr. Christoph Herrmann, LL.M. European Law (London), Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth) o. Professor an der Universität Passau
und
Dr. Walther Michl, LL.M. European Law (London), Universitätsprofessor an der Universität der Bundeswehr München
8., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
UNIREP JURA
Herausgegeben von Prof. Dr. Mathias Habersack
Autoren
Christoph Herrmann, Jahrgang 1973, Studium der Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung in Bayreuth und London (LL.M. 2000), Promotion in Bayreuth (2002), Assessorexamen in Bayern (2005), Habilitation in München (2009). Seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, Europarecht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Passau.
Ausgewählte Veröffentlichungen: Richtlinienumsetzung durch die Rechtsprechung, 2003; Welthandelsrecht, 2. Aufl. 2007 (zusammen mit W. Weiß und C. Ohler); Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU, 3. Aufl. 2010 (zusammen mit R. Streinz und C. Ohler); Währungshoheit, Währungsverfassung und subjektive Rechte, 2010; Europäisches Prozessrecht, 2019 (zusammen mit H. Rosenfeldt); Klausurenkurs im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht, 2019 (zusammen mit A. Würdemann).
Walther Michl, Jahrgang 1984, Studium der Rechtswissenschaften an der LMU München (Erste Juristische Prüfung 2008) und am King’s College London (LL.M. in European Law 2010), Promotion (2012) und Assessorexamen (2013) in München, danach als Habilitand bei Prof. Dr. Rudolf Streinz tätig; nach diversen Lehrstuhlvertretungen seit 1.10.2021 Inhaber der Professur für Öffentliches Recht und Europarecht an der Universität der Bundeswehr München.
Ausgewählte Veröffentlichungen: Die Überprüfung des Unionsrechts am Maßstab der EMRK, 2014; Kommentierung der Art. 51-54 GRC in R. Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018; Kommentierung der Art. 17-19 AEUV, 21 GRC in M. Pechstein/C. Nowak/U. Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2017; Die formellen Voraussetzungen für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, NVwZ 2016, S. 1365 ff.; Die Neuausrichtung des Bundesverfassungsgerichts in der digitalisierten Grundrechtelandschaft, JURA 2020, S. 479 ff.
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-5935-9
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2022 C.F. Müller GmbH, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
An Lehrbüchern zum Europarecht herrscht gewiss kein Mangel. Auch zu den völker-rechtlichen Bezügen des Grundgesetzes (Staatsrecht III/Verfassungsrecht III) finden interessierte Studierende immer mehr Lehrbuchliteratur. Gerade in der Zeit der Examensvorbereitung, also der komprimierten und vertieften Wiederholung des im Studium angeeigneten Rechtsstoffs, fehlt aber meist die Zeit zur Lektüre eines „klassischen“ Lehrbuchs. Sowohl im Europarecht als auch im Staatsrecht III wird von vielen Studierenden auch aus diesem Grund oftmals „auf Lücke gesetzt“. Der vorliegende Band der Reihe „Unirep Jura“ will die eingeführten Lehrbücher keinesfalls ersetzen. Dazu sind die Ausführungen viel zu knapp und dicht gehalten; sie setzen Vorkenntnisse der behandelten Materien (an sich) voraus. Vielmehr habe ich versucht, die Darstellung auf diejenigen Problemfelder zu beschränken, die von Examenskandidaten im Pflichtstoff tatsächlich erwartet werden (können). Zugleich habe ich mich darum bemüht, die auch für das Verständnis des Europarechts notwendigen Grundlagen der völkerrechtlichen Bezüge des GG integriert zu behandeln. Die Darstellung folgt dabei nicht dem klassischen Aufbau typischer Lehrbücher, sondern gliedert sich nach der Perspektive der jeweiligen Rechtsanwender, d.h. der deutschen Fachgerichtsbarkeit, des GHEU, des BVerfG und des EGMR. Diese Struktur ist ähnlich als Anspruchsaufbau oder Aufbau nach Klagearten aus anderen Rechtsgebieten hinreichend bekannt. Aus meiner Sicht erleichtert sie den Studierenden gerade bei der examensnahen Wiederholung die Einordnung der Probleme, ohne zugleich die Nachteile des vorrangigen Lernens nur anhand von Fällen mit sich zu bringen.
Mit der achten Auflage tritt Walther Michl als Mitautor in das Werk mit ein. Seit der Europarechtsübung an der Ludwig-Maximilians-Universität München, aus der dieses Werk vor über 15 Jahren hervorgegangen ist, verbindet uns ein langer gemeinsamer Weg – erst im Verhältnis Dozent–Student, dann am gleichen Lehrstuhl als Habilitand und Stud. Hilfskraft, und nun als Freunde und Kollegen. Nach sieben Auflagen in Alleinautorenschaft tut dem Werk ein wenig „frisches Autorenblut“ vielleicht ganz gut. In den nächsten Jahren werden wir die Autorenschaft gemeinsam tragen, bevor Walther Michl dann zu einem späteren Zeitpunkt allein „das Ruder“ übernehmen wird.
Für die achte Auflage haben wir das Buch umfassend aktualisiert. Insbesondere die Rspr. des BVerfG (PSPP, Recht auf Vergessen I und II) machte einige Anpassungen erforderlich. Wesentliche Rechtsänderungen und Gerichtsentscheidungen wurden bis Juli 2022 berücksichtigt.
Für die Unterstützung bei der Überarbeitung danken wir dem gesamten Lehrstuhlteam in Passau, namentlich Wiss. Mitarbeiter Simon Miller, sowie Wiss. Mitarbeiterin Isabel Vicaría Barker in München.
Über Anregungen und Kritik freuen wir uns weiterhin ([email protected]; [email protected]).
Passau/München, im August 2022
Christoph HerrmannWalther Michl
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Europarecht und Staatsrecht III als Gegenstand der juristischen Staatsprüfungen1
Zur Konzeption dieses Buches2 – 5
Entwicklung des Europarechts6 – 8c
Teil 1Völker- und europarechtliche Bezüge in Verfahren vor den deutschen Fachgerichten
§ 1Verhältnis des deutschen Rechts zum Völker- und Europarecht
I.Die Anwendung völker- und europarechtlicher Normen in der deutschen Rechtsordnung11 – 53
1.Bindung des Richters an Recht und Gesetz11
2.Völkerrechtsfreundlichkeit, Integrationsoffenheit und Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes12, 13
3.Rechtsquellen des Völker- und Europarechts14 – 26
a)Begriff und Subjekte des Völkerrechts14 – 17
b)Völkerrechtliche Rechtsquellen (Art. 38 I IGH-Statut)18, 19
c)Begriff des Europarechts20
d)Europarechtliche Rechtsquellen21 – 26
aa)Primärrecht21
bb)Sekundäres Unionsrecht (Art. 288 AEUV)22 – 26
(1)Verordnungen (Art. 288 II AEUV)23
(2)Richtlinien (Art. 288 III AEUV)24
(3)Beschlüsse (Art. 288 IV AEUV)25, 26
4.Geltung und Anwendbarkeit völker- und europarechtlicher Rechtsnormen in der deutschen Rechtsordnung27 – 53
a)Theoretische Grundlagen und Herangehensweise27 – 29
b)Unterscheidung zwischen Geltung, Anwendbarkeit und Wirkung30, 31
c)Völkerrechtliche Verträge (Art. 59 II GG)32 – 34
d)Allgemeine Regeln des Völkerrechts (Art. 25 GG)35 – 38
e)Europäisches Unionsrecht39 – 53
aa)Primärrecht40 – 42
bb)Sekundärrecht43 – 53
(1)Verordnungen43, 44
(2)Richtlinien45 – 52
(3)Beschlüsse53
II.Behandlung von Kollisionsfällen – Vorrang und Konformauslegung54 – 76
1.Rang völkerrechtlicher Normen im deutschen Recht55 – 64
a)Völkerrechtliche Verträge (Art. 59 II GG)55 – 57
b)Sonderfall: Die Europäische Menschenrechtskonvention58 – 62
c)Allgemeine Regeln des Völkerrechts (Art. 25 S. 2 GG)63, 64
2.Vorrang des Europäischen Unionsrechts65 – 70
a)Begründung des Vorrangs durch den EuGH65 – 67
b)Anerkennung des Vorrangs durch das BVerfG68 – 70
3.Vermeidung von Kollisionsfällen durch Konformauslegung71 – 76
a)Der Grundsatz der völkerrechtsfreundlichen Auslegung des deutschen Rechts71
b)Die Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung72 – 76
aa)Allgemeine unionsrechtskonforme Auslegung73, 73a
bb)Richtlinienkonforme Auslegung74 – 76
III.Staatshaftung wegen Verletzung des Europäischen Unionsrechts77 – 93
1.Grundlage und Umfang des unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs81 – 83
2.Unionsrechtliche Voraussetzungen des Staatshaftungsanspruchs84 – 91
a)Individualberechtigende Norm85, 86
b)Hinreichend qualifizierter Verstoß87 – 89
c)Kausalität90, 91
3.Umsetzung im deutschen Staatshaftungsrecht92, 93
IV.Prozessuale Verschränkung von Unionsrecht und nationalem Gerichtsverfahren – Das Vorabentscheidungsverfahren (Art. 267 AEUV)94 – 108
1.Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Vorlage96 – 101
a)Zuständigkeit des EuGH96
b)Vorlageberechtigung des nationalen Gerichts97, 98
c)Zulässige Vorlagefrage99
d)Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage100
e)Formale Anforderungen an die Vorlage101
2.Vorlagepflicht letztinstanzlicher Gerichte102, 103
3.Ungeschriebene Vorlagepflicht bei Annahme der Ungültigkeit einer Unionsrechtsnorm104
4.Inzidentrüge (Art. 277 AEUV)105
5.Wirkung der Entscheidung des EuGH106, 107
6.Durchsetzung der Vorlagepflicht vor dem BVerfG108
§ 2Einfluss des Europäischen Unionsrechts auf VwVfG und VwGO
I.Grundsätze des Verwaltungsvollzugs des Unionsrechts110 – 114
1.Grundsatz des mitgliedstaatlichen Vollzugs des Unionsrechts110, 111
2.Grundsatz der Äquivalenz112, 113
3.Grundsatz der Effektivität114
II.Einzelfragen115 – 142
1.Bestandskraft unionsrechtswidriger Verwaltungsakte116 – 136
a)Rücknahme begünstigender Verwaltungsakte – Beihilfenrückforderung116 – 131
aa)Grundzüge des Beihilfenrechts der Europäischen Union117 – 124
bb)Rückabwicklung unionsrechtswidriger Beihilfen nach deutschem Recht125 – 131
b)Anspruch auf Rücknahme belastender Verwaltungsakte132 – 135
c)Durchbrechung der Rechtskraft von (zivilrechtlichen) Urteilen136
2.Sofortvollzug und vorläufiger Rechtsschutz137 – 141
3.Entstehung subjektiver Rechte und Klagebefugnis (§ 42 II VwGO)142
§ 3Materiell-rechtliche Beschränkungen durch das Europäische Unionsrecht
I.Überblick143
II.Die Grundfreiheiten des Unionsrechts144 – 201
1.Allgemeine Strukturen145 – 161
a)Funktion und Anwendbarkeit der Grundfreiheiten146, 147
b)Struktur der Prüfung der Grundfreiheiten148 – 161
aa)Schutzbereich149 – 153
bb)Eingriffe154 – 156
cc)Rechtfertigung157 – 161
(1)Schranken157 – 160
(2)Schranken-Schranken161
2.Warenverkehrsfreiheit162 – 171
a)Schutzbereich163 – 166
b)Eingriffe167 – 169
c)Rechtfertigung170, 171
3.Arbeitnehmerfreizügigkeit172 – 182
a)Schutzbereich173 – 177
b)Eingriffe178 – 180
c)Rechtfertigung181, 182
4.Niederlassungsfreiheit183 – 187
a)Schutzbereich183 – 185
b)Eingriffe186
c)Rechtfertigung187
5.Dienstleistungsfreiheit188 – 197
a)Schutzbereich189 – 193
b)Eingriffe194, 195
c)Rechtfertigung196, 197
6.Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit198 – 201
III.Unionsbürgerschaft und allgemeines Diskriminierungsverbot202 – 205
Teil 2Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union
§ 4Überblick über das Rechtsschutzsystem der Verträge
§ 5Die Nichtigkeitsklage
I.Zulässigkeitsvoraussetzungen212 – 234
1.Sachliche Zuständigkeit213, 214
2.Parteifähigkeit215 – 217
3.Klagegegenstand218 – 220
4.Richtiger Beklagter221, 222
5.Klagebefugnis223 – 232
6.Geltendmachung eines Klagegrunds233
7.Form und Frist234
II.Begründetheit und Urteilsfolgen235 – 263
1.Verbandskompetenz der EU237 – 244
a)Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung237
b)Vorliegen einer Kompetenznorm238 – 240
c)Grundsatz der Subsidiarität241 – 244
2.Formelle Rechtmäßigkeit von EU-Sekundärrechtsakten245 – 252
a)Organzuständigkeit245 – 248
b)Verfahren249, 250
c)Form251, 252
3.Materielle Rechtmäßigkeit von EU-Sekundärrechtsakten253 – 263
a)Vereinbarkeit mit den Grundfreiheiten254 – 256
b)Vereinbarkeit mit den Unionsgrundrechten257 – 263
§ 6Das Vertragsverletzungsverfahren
I.Zulässigkeitsvoraussetzungen266 – 272
II.Begründetheit und Urteilsfolgen273 – 274a
Teil 3Europa- und völkerrechtliche Bezüge in Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht
§ 7Bundesverfassungsgerichtliche Kontrolle der Europäischen Integration
I.Kontrolle von Rechtsakten der Europäischen Union276 – 284a
1.Ultra-vires-Kontrolle280 – 281a
2.Grundrechtskontrolle282 – 284
3.Identitätskontrolle284a
II.Kontrolle deutscher Vollzugs- und Umsetzungsakte285 – 286
III.Kontrolle von deutschen Mitwirkungsakten an der Europäischen Union287 – 298
1.Überprüfung der Zustimmungsgesetze zur Änderung der primärrechtlichen Grundlagen der EU288 – 292
2.Kontrolle des Abstimmungsverhaltens der Bundesrepublik Deutschland im Rat der EU293 – 298
a)Kontrolle auf Initiative von natürlichen und juristischen Personen295
b)Kontrolle auf Initiative von Bundesländern und Bundesrat296 – 298
§ 8Verfahren mit völkerrechtlichen Bezügen
I.Bund-Länder-Streitigkeiten300 – 303
II.Organstreitverfahren304 – 310
Teil 4Verfahren vor dem EGMR und Grundzüge der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
§ 9Zulässigkeit einer Individualbeschwerde zum EGMR
I.Beschwerdegegenstand313 – 314a
II.Partei- und Prozessfähigkeit des Beschwerdeführers315 – 316a
III.Beschwerdebefugnis/Opfereigenschaft des Beschwerdeführers317, 317a
IV.Rechtswegerschöpfung318, 318a
V.Form und Frist319, 319a
VI.Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen320, 320a
§ 10Begründetheit einer Individualbeschwerde
I.Allgemeine Auslegungsgrundsätze322 – 325
II.Anwendbarkeit der EMRK326 – 327a
III.Schutzbereich der Konventionsrechte328 – 329a
1.Sachlicher Schutzbereich328, 328a
2.Persönlicher Schutzbereich329, 329a
IV.Eingriff330, 330a
V.Rechtfertigung331 – 333a
VI.Urteilsfolgen334, 335
Teil 5Übungsfragen
Teil 6Ausgewählte aktuelle Übungsklausuren
Stichwortverzeichnis
Einführung
Europarecht und Staatsrecht III als Gegenstand der juristischen Staatsprüfungen
1
Das vorliegende Examinatorium behandelt das Europarecht und das Staatsrecht III, soweit diese zum Pflichtstoff in den juristischen Staatsexamina gehören. Zwar bestehen hinsichtlich der Prüfungsgebiete geringfügige Unterschiede zwischen den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der einzelnen Bundesländer; regelmäßig verlangt werden jedoch Kenntnisse der völkerrechtlichen Bezüge des Verfassungsrechts (Staatsrecht III). Im Mittelpunkt steht dabei zumeist die Frage nach der Berücksichtigungsfähigkeit von Rechtsnormen völkerrechtlichen Ursprungs durch deutsche Gerichte. Aus dem Europarecht werden sowohl im Ersten wie im Zweiten Staatsexamen zumeist (Grund-)Kenntnisse der Rechtsquellen des Unionsrechts, des Verhältnisses zwischen Unionsrecht und nationalem Recht, der Organe der Europäischen Union, der Grundfreiheiten sowie des Rechtsschutzsystems erwartet. Vereinzelt nennen die Prüfungsordnungen auch die Grundrechte des Unionsrechts, die Kompetenzen sowie das Rechtssetzungsverfahren als Pflichtstoff[1]. Die Verwendung des Begriffs „Europarecht“ ist dabei uneinheitlich. Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 2009 (VvL) hat sich diese Unterschiedlichkeit jedoch weitgehend erledigt. Während in manchen Bundesländern bisher nur das „Europäische Gemeinschaftsrecht“ gemeint war, erstreckte sich der Prüfungsstoff z.B. in Bayern schon vor 2009 auch auf das „Recht der Europäischen Union“ (zur Unterscheidung, die mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (s. unten Rn. 6 f.) weitgehend hinfällig wurde, vgl. unten Rn. 20). Nunmehr umfasst der Prüfungsstoff das Recht der Europäischen Union. Jedem Examenskandidaten[2] sei insoweit ein Blick in die maßgebliche Prüfungsordnung angeraten, um sich über den genauen Umfang der erwarteten Kenntnisse zu informieren.
Zur Konzeption dieses Buches
2
Hinsichtlich des behandelten Stoffs ist das vorliegende Examinatorium konsequent auf den unter Rn. 1 beschriebenen Pflichtstoff der Ersten und Zweiten Staatsprüfung beschränkt. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit im Sinne der erschöpfenden Behandlung der unter den Begriffen „Europarecht“ und „Staatsrecht III“ sonst noch zu verortenden Teilmaterien, wie sie in universitären Vorlesungen gelehrt werden. Diesbezügliche Kenntnisse werden regelmäßig nur in entsprechenden Schwerpunktbereichen oder Masterstudiengängen mit unterschiedlichem Zuschnitt abverlangt. An einzelnen Stellen mag der Pflichtstoffbereich geringfügig überschritten werden. So wird im Examen (auf absehbare Zeit) kaum eine Klausur eine Individualbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zum Gegenstand haben (vgl. dazu unten Rn. 311 ff.). Es erscheint jedoch nicht abwegig, eine Frage danach zumindest als Zusatzfrage in einer Grundrechteklausur auch im Pflichtstoffbereich zu stellen. Auch die zunehmende Bedeutung der Rechtsprechung des EGMR für die Verwirklichung und Weiterentwicklung des europäischen Grundrechtsschutzes, die durch die Anlehnung der Rechte aus der Europäischen Grundrechtecharta an ihre Pendants aus der EMRK (Art. 52 III GRC) geprägt ist (vgl. Rn. 21), rechtfertigt die Behandlung in einem Examinatorium.
3
Seiner Konzeption nach dient das vorliegende Buch vorrangig der examensnahen Wiederholung von Kernproblemen und Grundstrukturen. Es ersetzt nicht die vorlesungsbegleitende Lektüre einschlägiger Lehrbücher (z.B. aus der Reihe Start ins Rechtsgebiet Fischer/Fetzer, Europarecht, 12. Aufl. 2019 sowie aus der Schwerpunkte-Reihe Streinz, Europarecht, 11. Aufl. 2019, Schweitzer/Dederer, Staatsrecht III, 12. Aufl. 2020 und v. Arnauld, Völkerrecht, 5. Aufl. 2022) während des Studiums, sondern setzt diese vielmehr voraus. Die 20 kurzen Fälle sollen dabei die klausurmäßige Behandlung von völker- und europarechtlich gelagerten Fallkonstellationen[3] knapp veranschaulichen. Während der Examensvorbereitung sollte jeder Kandidat größere Examensfälle eigenständig lösen und überdies so häufig wie irgend möglich Examensklausuren unter Klausurbedingungen schreiben (d.h. vor allem nur mit den erlaubten Hilfsmitteln, ohne Erörterung der Probleme mit anderen Teilnehmern und innerhalb der vorgegebenen Zeit – besser sogar unter Abzug einer halben Stunde)[4]. Neben den universitären und außeruniversitären Klausurenkursen bieten sich für die Arbeit in einer privaten Arbeitsgemeinschaft die zahlreichen Klausur- und Fallsammlungen zum Europarecht an (z.B. Fischer/Fetzer, Fälle zum Europarecht, 9. Aufl. 2019; Musil/Burchard, Klausurenkurs im Europarecht, 6. Aufl. 2022; etwas spezieller auch Herrmann/Würdemann, Klausurenkurs im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht, 2019 (Fälle 2-7 und 9); Ludwigs/Schmidt-Preuß (Hrsg.), Klausurenkurs Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, 2016). Besonders geeignete Übungsklausuren aus Übungszeitschriften werden im Anschluss auf den S. 121 ff. aufgeführt. Ebenfalls für die private Arbeitsgemeinschaft eignet sich die mündliche Aussprache über die auf S. 117 ff. abgedruckten Übungsfragen. Oftmals erkennt man erst in der Auseinandersetzung mit einer konkreten Fragestellung mangelndes eigenes Verständnis und die fehlende Fähigkeit zum gelehrten Gespräch über den Stoff, wie es in der mündlichen Prüfung gepflegt bzw. erwartet wird[5].
4
Eine Besonderheit des Europarechts bildet seine Relevanz in allen drei Kernrechtsgebieten (Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht), wenngleich sich dies aus den Prüfungsordnungen nicht immer eindeutig ergibt und das Europarecht dort häufig als Teil des Öffentlichen Rechts ausgewiesen wird[6]. Im „schlimmsten“ Fall kann es im Staatsexamen also durchaus passieren, dass gleich mehrere Klausuren europarechtliche Fragen aufwerfen. So muss im Zivilrecht z.B. die Wirkung von Richtlinien auch in horizontalen Rechtsverhältnissen sicher beherrscht werden (vgl. dazu unten Rn. 50 ff., 74 ff.). Ähnliches gilt mit Abstrichen im Strafrecht. Auch grundfreiheitliche Bezüge lassen sich im Zivilrecht und im Strafrecht ebenso leicht herstellen wie im Öffentlichen Recht.
Bsp. (BGH, 3 StR 395/04): Die Verurteilung eines Arztes, dessen deutsche Berufszulassung wegen Unzuverlässigkeit ruht, der aber überdies über eine belgische Zulassung verfügt, wegen Körperverletzung nach § 223 StGB für die gelegentliche Durchführung von Behandlungen in Deutschland, verstößt gegen die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 ff. AEUV.
5
Wenngleich in der jüngeren Vergangenheit eine stärkere Ausrichtung der juristischen Ausbildung auf den Anwaltsberuf stattgefunden hat, ändert dies nichts daran, dass im schriftlichen Teil beider Staatsprüfungen regelmäßig Klausuren gestellt werden, die die gutachtliche (bzw. urteils- oder schriftsatzförmige) Lösung von Fällen zum Gegenstand haben. Es handelt sich somit um Rechtsanwendungsklausuren, denen die Vorstellung von einem gedachten Rechtsanwender zugrunde liegt. Jeder Rechtsanwender nähert sich einem Fall aus der Perspektive des jeweils auf den Fall anwendbaren Rechts. In rein nationalrechtlich gelagerten Sachverhalten handelt es sich hierbei um eine schiere Selbstverständlichkeit. Sobald jedoch im Sachverhalt Rechtsnormen völkerrechtlichen oder europarechtlichen Ursprungs auftauchen, kann sich die Frage der Anwendbarkeit dieser Normen zu einem zentralen Problem der Klausur auswachsen (vgl. hierzu eingehend Rn. 10 ff.). Daher ist zunächst zu klären, aus welcher Perspektive die Klausur anzufertigen ist. So macht es einen erheblichen Unterschied, ob ein Gutachten zur Vorbereitung der Entscheidung eines deutschen Fachgerichts, des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) oder des Gerichtshofs der Europäischen Union (GHEU) (bestehend aus dem Gerichtshof [EuGH] und dem Gericht [EuG], vgl. Art. 19 I UAbs. 1 S. 1 EUV – von der darin i.V.m. Art. 257 AEUV vorgesehenen Möglichkeit der Errichtung von Fachgerichten wird seit der Auflösung des Gerichts für den öffentlichen Dienst (GöD) zum 1.9.2016 derzeit kein Gebrauch mehr gemacht[7]) zu erstellen ist. Für deutsche Gerichte ist die Anwendung eines völkerrechtlichen Vertrags (zum Begriff vgl. unten Rn. 18) wie des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) angesichts der Bindung an Recht und Gesetz (Art. 20 III, 97 I GG) keineswegs unproblematisch, wohingegen dem GHEU diese Aufgabe in Art. 19 I UAbs. 1 S. 2 EUV ganz selbstverständlich zugewiesen ist. Das vorliegende Examinatorium zerfällt dementsprechend in vier Hauptteile, die den Stoff aus der Perspektive von nationalen Fachgerichten, BVerfG, GHEU und EGMR behandeln. Jede dieser Perspektiven bringt typische Fragestellungen mit sich, die sich aus den jeweils anderen Perspektiven entweder nicht oder zumindest seltener stellen. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt dabei – entsprechend der höheren Examensbedeutung im Pflichtstoffbereich – auf der Perspektive der nationalen Fachgerichte.
Entwicklung des Europarechts
6
Das Europarecht im engeren Sinne (zu den Begrifflichkeiten s. unten Rn. 20) bildet eine Materie, die in besonderer Weise einem fortschreitenden Wandel durch den Fortgang des europäischen Integrationsprozesses ausgesetzt ist. Die ursprünglichen drei Gemeinschaftsverträge (EGKSV[8], EWGV[9] und EAGV[10] – das sog. „Gemeinschaftsrecht“) wurden seit 1951/1952 bzw. 1957/1958 mehrfach geändert und 1992/1993 mit dem gemeinsamen „Dach“ des Vertrags über die Europäische Union (EUV)[11] versehen, der seitdem selbst wiederum mehrfach durch Änderungsverträge (Vertrag von Amsterdam, 1997/1999[12]; Vertrag von Nizza, 2001/2003[13]) bzw. Beitrittsverträge neuer Mitgliedstaaten geändert wurde. Während der mehr als 60 Jahre europäischer Integration hat sich die Zahl der Mitgliedstaaten zudem von ursprünglich nur sechs (B, D, F, I, LUX, NL) auf zwischenzeitlich 28 erhöht und wegen des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (VK) wieder auf 27 reduziert. Gleichzeitig hat sich der weltpolitische Kontext der europäischen Integration insbesondere durch den Fall des Eisernen Vorhangs 1990 fundamental gewandelt. Seit Mitte der 1990er-Jahre hatten sich die Mitgliedstaaten der EU daher um eine grundlegende Reform insbesondere der Institutionen und Entscheidungsprozesse der EU bemüht, um die Handlungsfähigkeit der EU zu stärken, sie auf die absehbaren Erweiterungen vorzubereiten und ihre Entscheidungen transparenter werden zu lassen[14]. Nachdem der 2004 unterzeichnete Vertrag über eine Verfassung für Europa[15], durch den das Primärrecht neu strukturiert, in vielerlei Hinsicht geändert und zugleich in einem einheitlichen neuen Vertrag konsolidiert werden sollte[16], im Juni 2005 an den ablehnenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden gescheitert war, wurde von den Mitgliedstaaten am 13.12.2007 der Vertrag von Lissabon (VvL)[17] unterzeichnet. Er trat nach erheblichen Schwierigkeiten – zunächst gescheitertes, dann erfolgreich wiederholtes Referendum in Irland; Verfassungsklagen u.a. in Deutschland – am 1.12.2009 in Kraft und bildet seither den maßgeblichen Rechtsstand für die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union.
7
Durch den VvL wurde vor allem die bisherige sog. „Tempelstruktur“ des Unionsrechts beseitigt; die verschiedenen „Säulen“ der Europäischen Union wurden in einen einheitlichen vertraglichen Rahmen integriert. Dieser besteht aus dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV; dabei handelt es sich um die Neubezeichnung des früheren Vertrags zur Gründung der Europäischen [Wirtschafts-]Gemeinschaft [EGV])[18]. Der VvL brachte zudem wichtige Änderungen des institutionellen Gefüges der Europäischen Union mit sich und zahlreiche weitere inhaltliche Änderungen, deren Bedeutung erst langsam zur Gänze deutlich wird[19].
8
Im Rahmen der europäischen Staatsschuldenkrise ist das Unionsrecht zwar im Bereich der Bestimmungen über die Wirtschafts- und Währungsunion grundlegend ergänzt und modifiziert worden. Die meisten dieser Änderungen fanden jedoch auf der Ebene des Unionssekundärrechts statt (zum Begriff s. unten Rn. 22). Lediglich in Art. 136 AEUV wurde ein (klarstellender)[20] neuer Absatz 3 eingefügt, der den ab 1.1.2023 20 Mitgliedstaaten der Eurozone gestattet, einen Stabilitätsmechanismus zu errichten, der Mitgliedstaaten finanziellen Beistand unter wirtschaftspolitischen Auflagen leisten kann[21]. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) selbst wurde hingegen durch einen völkerrechtlichen Vertrag vom 2. Februar 2012 errichtet[22]. Ebenfalls einen völkerrechtlichen Vertrag stellt der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung[23] (sog. Fiskalpakt) vom 2. März 2012 dar. Nähere Kenntnisse dieser Reform der europäischen Währungsverfassung und der Bankenunion (gemeinsame Bankenaufsicht und einheitliche Bankenabwicklung) können im Pflichtstoff nicht verlangt werden[24].
8a
Im Sommer 2015 kam mit der Flüchtlingskrise eine weitere Herausforderung für die Unionsrechtsordnung hinzu, die aber bislang keine Auswirkungen auf der Primärrechtsebene gezeitigt hat, sondern im Wesentlichen Fragen nach der zutreffenden Sekundärrechtsauslegung bzw. Reform im Bereich des Schengenraums (Zulässigkeit von Grenzkontrollen) sowie des sog. Dublin-Systems (Zuständigkeit für Asylverfahren innerhalb der EU)[25] aufwirft. Kenntnisse dieser Teilgebiete des Unionsrechts werden grundsätzlich nicht erwartet. Sofern – ausnahmsweise[26] – doch einmal Fragen aus diesen Gebieten in einer Examensprüfung auftauchen, müssen die maßgeblichen Sekundärrechtsakte jedenfalls im Sachverhalt abgedruckt werden; mehr als eine vertretbare Auslegung der Vorschriften kann dann billigerweise nicht erwartet werden.
8b
Für die europäische Integration noch grundsätzlichere Fragen stellen sich im Hinblick auf den künftigen Kreis der Mitglieder. Der Unterschied zwischen souveränen Staaten und der Europäischen Union liegt in der freiwilligen Natur des Zusammenschlusses. Im Zuge des britischen Austritts aus der EU (Brexit)[27] judizierte der EuGH, dass der austretende Mitgliedstaat die Erklärung innerhalb der in Art. 50 III EUV statuierten Zwei-Jahres-Frist (oder deren gemäß Art. 50 III EUV beschlossener Verlängerung) bzw. bis zum Inkrafttreten des Austrittsabkommens jederzeit zurücknehmen kann. Dies begründete er mit dem Wortlaut des Art. 50 I EUV sowie der Souveränität der Mitgliedstaaten. Weil das souveräne Recht zum einseitigen Austritt bei den Mitgliedstaaten liege, müssten sie auch einseitig wieder hiervon absehen können[28]. Umgekehrt zeigt sich jedoch bei einem Wunsch nach Beitritt zur Europäischen Union – Stichwort: ukrainischer Aufnahmeantrag – die Freiwilligkeit des Zusammenschlusses darin, dass neben den übrigen Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 49 EUV sowohl eine einstimmige Entscheidung im Rat als auch die Ratifizierung des Beitrittsvertrags durch alle Mitgliedstaaten erforderlich ist. Dem geht schon wegen der Vielzahl an Materien, die durch Vorgaben des EU-Rechts berührt werden, ein über viele Jahre dauernder Annäherungsprozess voraus. Ein Ausschluss aus der Europäischen Union, wie er mitunter als Ultima Ratio im Hinblick auf die problematische Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn gefordert wird, ist in den Verträgen jedoch nicht ausdrücklich vorgesehen[29].
8c
Mit der Konferenz zur Zukunft Europas, die von April 2021 bis Mai 2022 stattfand, hat in der EU zumindest ein neues Nachdenken über das Erfordernis einer Weiterentwicklung der Verträge begonnen. Die Konferenz selber stand dabei außerhalb des Vertragsänderungsmechanismus des Art. 48 EUV und diente vor allem einer Einbindung der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. Die Ergebnisse sind in einem Abschlussbericht festgehalten[30]. Dieser wurde vom Europäischen Rat auch begrüßt; zur Einberufung eines Konvents oder einer Regierungskonferenz zur Änderung der Verträge (Art. 48 III, IV EUV) konnte sich der Europäische Rat im Juni 2022 allerdings (noch) nicht entschließen[31]. Die teilweise weitreichenden Vorstellungen z.B. des französischen Staatspräsidenten Macron stoßen in der EU nur teilweise auf Unterstützung. Hinzu kommt, dass der Ukraine-Krieg, die Bekämpfung der energiepolitischen Abhängigkeit von Russland, die Dekarbonisierung der Energie- und Verkehrspolitik („Green Deal“), die nach wie vor ungelöste Rechtsstaatskrise (Polen, Ungarn) sowie die Folgen des Brexit und der Corona-Pandemie derzeit nach wie vor eher kurzfristige Krisenreaktionen als langfristige Integrationsvisionen erfordern, wenngleich gerade die genannten Krisen die Notwendigkeit weiterer Integrationsschritte sowie Änderungen am Governance-Modus der EU offenlegen.
Teil 1Völker- und europarechtliche Bezüge in Verfahren vor den deutschen Fachgerichten
9
In Examensklausuren kommen völker- und europarechtliche Bezüge am häufigsten eingebettet in einen nach nationalem Recht zu begutachtenden Fall vor. Dies entspricht dem Ausbildungsleitbild der „Befähigung zum [deutschen] Richteramt“ (vgl. § 5 I DRiG) und der zu erwartenden Berufspraxis für die große Mehrzahl von Absolventen als Rechtsanwälte in Deutschland. Auch lässt sich auf diese Weise am ehesten die prüfungsrechtliche Beschränkung auf „Grundzüge“ des Europarechts einhalten. Eines der zentralen Probleme in derartigen Fallkonstellationen ist regelmäßig die Frage, welche Bedeutung Bestimmungen des Völker- oder Europarechts für die Entscheidung des Falls zukommt, d.h. in welchem Verhältnis diese zum deutschen Recht stehen.
§ 1Verhältnis des deutschen Rechts zum Völker- und Europarecht
10
Fall 1: F, eine nach US-amerikanischem Recht gegründete Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland, stützt sich in einem Zivilprozess zur Begründung ihrer Parteifähigkeit nach § 50 I ZPO auf Art. XXV des Deutsch-Amerikanischen Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrags, wonach Gesellschaften, die nach den Vorschriften einer der Vertragsparteien gegründet sind, von der anderen anzuerkennen sind. Muss das Gericht diese Vorschrift zugunsten der Gesellschaft beachten?
Fall 2: S reist als geladener Zeuge aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland ein, um in einem Strafprozess auszusagen. Er wird dann aber selbst wegen einer Reihe früherer Straftaten in einem Strafverfahren angeklagt. S macht geltend, ein Verfahren gegen ihn könne nicht geführt werden. Nach Völkergewohnheitsrecht habe er „freies Geleit“ gehabt. Das Verfahren müsse daher nach § 260 III StPO wegen Vorliegens eines dauerhaften Verfahrenshindernisses durch Prozessurteil eingestellt werden. Was muss das Gericht tun?
Fall 3: Eine deutsche Boulevardzeitung veröffentlicht einen ausführlichen Bericht über das „Lotterleben“ des Fußballbundestrainers K in Kalifornien. Der Bericht enthält auch Bilder, die K mit seiner Frau und seinen Kindern am Strand zeigen. K wehrt sich gegen die Veröffentlichungen erfolglos vor den deutschen Zivilgerichten. Nach Ansicht der Gerichte sei er als Bundestrainer eine Person der Zeitgeschichte, so dass ein öffentliches Interesse an freier Medienberichterstattung bestehe. K erhebt Verfassungsbeschwerde mit der Begründung, der Bundesgerichtshof (BGH) habe die Bedeutung des Persönlichkeitsrechtes grundlegend verkannt. Hier sei Art. 8 EMRK zu beachten gewesen, der das Privatleben schütze. Der EGMR habe – was zutrifft – dem Schutz des Privatlebens weitgehenden Vorrang vor der Pressefreiheit eingeräumt. Welche Bedeutung hat diese Rechtsprechung des EGMR für die Verfassungsbeschwerde des K?
Fall 4: A importiert Rotwein aus Frankreich nach Deutschland. Kurz zuvor hatte die Regierungskoalition sich darauf verständigt, die Finanznot des Bundes durch die Erhebung von Einfuhrzöllen auf Luxusgüter i.H.v. 300% zu lindern. Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundesgesetzgeber bereits formal ordnungsgemäß erlassen. A will den Zoll aber nicht bezahlen und wendet ein, dieser würde gegen Art. 28 und 30 AEUV verstoßen. Muss A den Zoll bezahlen?
Fall 5: Eine EU-Verordnung über die gemeinsame Marktorganisation für Getreide sieht vor, dass bei Erteilung von Ausfuhrlizenzen vom Exporteur eine hohe Kaution zu hinterlegen ist, die verfällt, wenn der Exporteur von der erteilten Lizenz bis zu einem Stichtag keinen Gebrauch macht, d.h. kein Getreide in entsprechender Menge exportiert. Als C seine Kaution zurückhaben möchte, obwohl er die Ausfuhrlizenz nicht genutzt hat, verweigert die zuständige Behörde die Rückzahlung unter Berufung auf die EU-Verordnung. C erhebt Klage vor dem Verwaltungsgericht (VG). Er ist der Auffassung, die EU-Verordnung verstoße gegen die Grundrechte des GG, insbesondere Art. 2 I, 12 und 14 GG. Muss das VG die Verordnung dennoch anwenden?
Fall 6: § 14 III (a.F.) des deutschen TzBfG (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse) sieht vor, dass die Befristung von Arbeitsverhältnissen mit Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben, abweichend von der sonstigen Rechtslage keines sachlichen Grundes bedarf. Der 54-jährige W ist Anwalt und hat mit seinem Arbeitgeber einen auf Grundlage dieser Vorschrift auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag geschlossen. Kurz nach Abschluss des Arbeitsvertrages klagt W vor dem zuständigen Arbeitsgericht (ArbG) auf Feststellung des Bestehens eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Die Befristungsregelung diskriminiere ältere Arbeitnehmer. Dies sei aber durch eine auf Art. 19 I AEUV gestützte EU-Richtlinie verboten. Die Befristung sei daher unwirksam. Kann W sich vor dem ArbG auf die Richtlinienwidrigkeit des § 14 III TzBfG berufen?
I.Die Anwendung völker- und europarechtlicher Normen in der deutschen Rechtsordnung
1.Bindung des Richters an Recht und Gesetz
11
Ausgangspunkt in einer gutachtlichen Bearbeitung sollte stets die Frage sein, welche Rechtsnormen dem entscheidenden Gericht als Maßstab für die Entscheidung verbindlich zugewiesen sind. Im deutschen Recht ergibt sich die Antwort auf diese Frage aus Art. 1 III, Art. 20 III und Art. 97 I GG. Danach sind die Gerichte an die Grundrechte und an „Recht und Gesetz“ gebunden und „nur dem Gesetze unterworfen“. Berücksichtigt werden können völker- und europarechtliche Normen von deutschen Gerichten also nur dann, wenn sie „Recht und Gesetz“ i.S.v. Art. 20 III GG darstellen. Das ist bei Rechtsnormen, die wie das Völker- und Europarecht aus einer anderen Rechtsquelle fließen, weil sie nicht nach den Normen des GG vom deutschen Gesetzgeber erzeugt worden sind, nicht selbstverständlich und bedarf daher der Begründung.
2.Völkerrechtsfreundlichkeit, Integrationsoffenheit und Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes
12
Das GG beinhaltet eine Reihe von Vorschriften, die auf das Völkerrecht Bezug nehmen oder auf die Einbindung in die Europäische Union verweisen. Aus der Gesamtschau dieser Normen wird die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes bzw. die offene Staatlichkeit der Bundesrepublik abgeleitet[1]. Mit der Präambel des GG sowie vor allem den Art. 1 II, 23, 24, 25, 26 und Art. 59 GG zielt das GG nach Ansicht des BVerfG darauf ab,
„die Bundesrepublik Deutschland als friedliches und gleichberechtigtes Glied in eine dem Frieden dienende Völkerrechtsordnung der Staatengemeinschaft einzufügen.“[2]
13
Die europäische Integration stellt ausweislich der Präambel und des Art. 23 I GG, der seit seiner Einfügung 1992 den Art. 24 GG als Grundlage der Integration abgelöst hat, ebenfalls ein Staatsziel der Bundesrepublik Deutschland dar[3]. Zu diesem Zweck erlaubt das GG auch die Übertragung von Hoheitsrechten des Bundes und der Länder, d.h. die Übertragung der Ausübung von Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung mit unmittelbarer Wirkung in der deutschen Rechtsordnung auf Organe der Europäischen Union (Art. 23 I 2 GG; zuvor gestützt auf Art. 24 I GG). Die von den Organen der Union in Ausübung dieser Hoheitsgewalt gesetzten Rechtsakte sind von den Behörden der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich anzuerkennen[4]. Dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit hat das BVerfG in seiner Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Zustimmungsgesetzes zum VvL 2009 den Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit zur Seite gestellt[5]. In Entscheidungen über die verfassungsgerichtliche Kontrolle von möglicherweise kompetenzüberschreitenden Hoheitsakten der Organe der Union hat das BVerfG diesen Grundsatz wiederholt zur Anwendung gebracht[6] (s. dazu unten Rn. 280 f.).