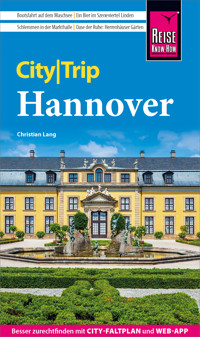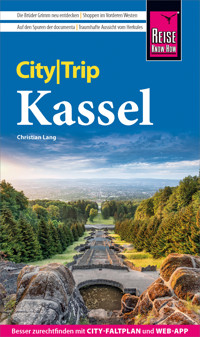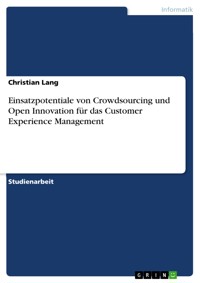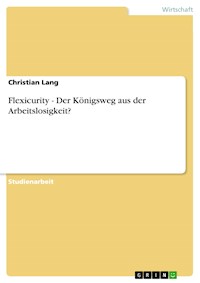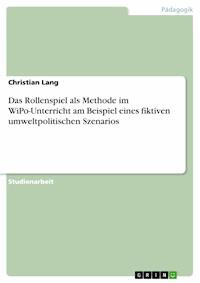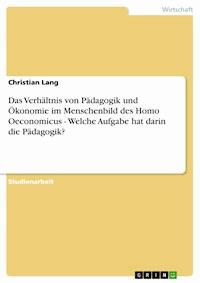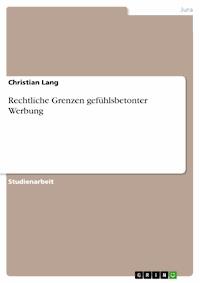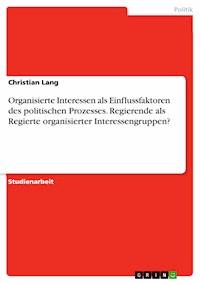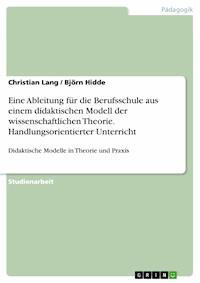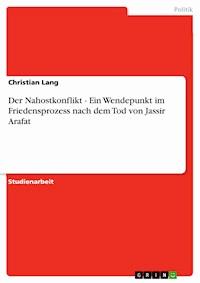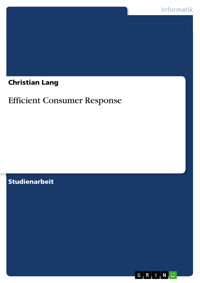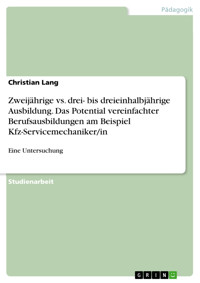Evaluation der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen E-Book
Christian Lang
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pädagogik - Berufsbildung, Weiterbildung, Note: 1,3, Europa-Universität Flensburg (ehem. Universität Flensburg) (Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik (BIAT)), Sprache: Deutsch, Abstract: Die bildungspolitische Bedeutung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen gewinnt vor dem Hintergrund der Forderungen nach lebenslangem Lernen, Flexibilisierung und Öffnung der europäischen Bildungslandschaften eine immer größere Bedeutung. Die Normalität sind nicht mehr unbefristete auf Langfristigkeit ausgerichtete Arbeitsplätze sondern befristete und projektorientierte Jobs mit wechselnden Aufgaben bei verschiedenen Arbeitgebern. Arbeitnehmer die ohne eine Unterbrechung ihrer beruflichen Tätigkeit oder Umschulungs- und Orientierungsphasen das Rentenalter erreichen, werden seltener. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Es wird somit deutlich, dass die Notwendigkeiten einer umfassenderen Evaluation von Kompetenzen bestehen. In dieser Ausarbeitung werden Versuche in Deutschland zur Anerkennung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen aufgezeigt. Die Evaluationsmethodik auf Seiten der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsgemeinschaften und ihrer Träger wird dabei untersucht und im Vergleich dargestellt. Eine qualitative Untersuchung ergänzt die Evaluation ausgesuchter Ansätze und zeigt deren Charakteristiken in einem direkten Vergleich. Das zugrunde liegende Material für diesen Text sind Veröffentlichungen, Fachzeitschriften, Publikationen im Internet und eine qualitative Untersuchung. Die qualitative Untersuchung wurde in der Experten-, Praktiker- und Teilnehmerebene durchgeführt. Gleichwohl die Anzahl der befragten Personen, mit Blick auf den realistischen Umfang einer vergleichbaren Ausarbeitung, gering ist, wurde versucht die Interviewpartner repräsentativ zu wählen, um zu einer validen Aussage gelangen zu können. Diese Arbeit gibt einen ersten Einblick in die Vielzahl der bestehenden Evaluationsansätze für nicht-formal und informell erworbene Kompetenzen in Deutschland. Die qualitative Untersuchung spiegelt dies repräsentativ, mit einem regionalen Schwerpunkt in Schleswig-Holstein wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Abkürzungen
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Qualifikation und Kompetenz – Eine Spurensuche begrifflicher Grundlagen
2.1 Was ist eine Qualifikation?
2.2 Was sind Kompetenzen?
2.3 Definition der Schlüsselkompetenzen
2.4 Kompetenzentwicklung
3 Das Verhältnis von formalen, nicht-formalen und informellem Lernen
3.1 Lebenslanges Lernen
3.2 Formales Lernen als standardisierter Kompetenzerwerb
3.3 Nicht-formales Lernen
3.4 Informelles Lernen
3.5 Formales, nicht-formales und informelles Lernen
4 Dokumentation nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen
4.1 Deutschland
4.1.1 Weiterbildungspässe
4.1.2 Externenprüfung
4.2 Europäischer Vergleich am Beispiel Großbritannien und Frankreich
4.2.1 Großbritannien
4.2.2 Frankreich
5 Kriterien der Evaluation und methodische Ansätze der Kompetenzermittlung
5.1 Employability vs. Kompetenzevaluation
5.2 Selbstevaluation vs. Fremdevaluation
5.3 Ansätze zur Evaluation nicht-formal erworbener Kompetenzen
5.3.1 Kompetenzbilanz
5.3.2 Kompetenzhandbuch im Jobnavigator
5.3.3 Qualipass
5.3.4 Europass
5.3.5 Landesnachweis NRW
5.3.6 Hamburger Nachweis über bürgerschaftliches Engagement
5.3.7 ProfilPASS
6 Profilanalyse und Kompetenzevaluation durch „Profiling“
6.1 Was ist Profiling?
6.2 Kompetenzevaluation mit Profiling
6.3 Anforderungen an „Profiler“
6.4 Profiling als Methode der BA zur Vermittlung Arbeitssuchender
7 Dokumentenanalyse ausgewählter Kompetenzevaluationen
7.1 Profiling der Bundesagentur für Arbeit
7.2 Kompetenzevaluation bei Trägern der BA am Beispiel der „bequa“
7.3 Profiling und Kompetenzevaluation bei der DAA
7.4 Die Kompetenzbilanz des DJI
7.5 Untersuchung der Employability mit dem Jobnavigator (IG-Metall)
7.6 Überblick der Dokumentenanalyse
8 Qualitative Untersuchung zum Profiling
8.1 Expertenebene
8.1.1 Helmut R. IAB
8.1.2 Frau S BA Nürnberg (PP14)
8.1.3 Frau von der Heide und Frau Hornberger DAA Kiel
8.1.4 Frau Gerzer-Sass DJI
8.2 Praktikerebene
8.2.1 Selbsterfahrung des Autors bei einem Träger
8.2.2 Herr Affeldt „bequa“ Flensburg
8.2.3 Arbeitsagentur Flensburg
8.2.4 Arbeitsgemeinschaft Flensburg
8.3 Teilnehmerebene
8.3.1 Teilnehmer/in A (Klient der „bequa“)
8.3.2 Teilnehmer/in B (Arge Flensburg)
8.3.3 Teilnehmer/in C (Arge Flensburg)
8.3.4 Teilnehmer/in D (DAA Kiel – Ü25)
8.3.5 Teilnehmer/in E (DAA Kiel – U25)
8.3.6 Teilnehmer/in F (DAA Kiel – Ü25)
8.3.7 Teilnehmer/in G (DAA Kiel – Ü25)
9 Auswertung der Dokumentenanalyse und qualitativen Untersuchung
9.1 Profiling bei den Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften
9.2 Profiling und Kompetenzevaluation bei Trägern
9.3 Weitere Ansätze zur Evaluation von Kompetenzen
10 Zusammenfassung
10.1 Lernprozesse unter dem Blickwinkel des Qualifikations- und Kompetenzerwerbs
10.2 Nicht-formales und informelles Lernen als Alternative zum formalen Lernen
10.3 Evaluationsansätze nicht-formaler und informell erworbener Kompetenzen
10.4 Profiling - Ergebnisse der qualitativen Untersuchung und Reflektion
10.5 Anerkennung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen
11 Ausblick
11.1 Der Blick über den Tellerrand – ein europäischer Vergleich
11.2 Weitergehende Untersuchungen
11.2.1 Kompetenzevaluierung
11.2.2 Profiling
11.2.3 Formale Anerkennung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen
11.3 Kritische Betrachtung der Ausarbeitung
Quellenverzeichnis
Literatur
Onlinequellen
Abbildungen
Anhang
1 Einleitung
In „Lernen sichtbar machen“ stellte Bjørnåvold Ende der 1990er Jahre einen europäischen Vergleich zur Anerkennung nicht-formal erworbener Kompetenzen dar. Treffend beschreibt er, dass diesbezügliche Ansätze insbesondere in Deutschland und Österreich, aufgrund der starken formalen Ausprägung des Berufsbildungssystems, nahezu nicht vorhanden waren.
Die bildungspolitische Bedeutung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen gewinnt vor dem Hintergrund der Forderungen nach lebenslangem Lernen, Flexibilisierung und Öffnung der europäischen Bildungslandschaften eine immer größere Bedeutung. Die Normalität sind nicht mehr unbefristete auf Langfristigkeit ausgerichtete Arbeitsplätze sondern befristete und projektorientierte Jobs mit wechselnden Aufgaben bei verschiedenen Arbeitgebern. Arbeitnehmer die ohne eine Unterbrechung ihrer beruflichen Tätigkeit oder Umschulungs- und Orientierungsphasen das Rentenalter erreichen, werden seltener. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Es wird somit deutlich, dass die Notwendigkeiten einer umfassenderen Evaluation von Kompetenzen bestehen. In dieser Ausarbeitung werden Versuche in Deutschland zur Anerkennung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen aufgezeigt. Die Evaluationsmethodik auf Seiten der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsgemeinschaften und ihrer Träger wird dabei untersucht und im Vergleich dargestellt. Eine qualitative Untersuchung ergänzt die Evaluation ausgesuchter Ansätze und zeigt deren Charakteristiken in einem direkten Vergleich.
Ein Ergebnis meiner Literaturrecherche im Rahmen dieser Examensarbeit hat gezeigt, dass eine Vielzahl von Veröffentlichungen über nicht-formales und informelles Lernen, insbesondere im europäischem Kontext und durch Ministerien, erschienen sind. Zum Thema Profiling ist in der wissenschaftlichen Diskussion jedoch wenig Material vorhanden. Einerseits ist dies damit zu begründen, dass Profiling ein neuer Ansatz ist und es zum anderen einen Diskurs darüber gibt was darunter zu verstehen ist.
Der Schwerpunkt dieser Ausarbeitung liegt aus diesem Grund darin die verschiedenen Ansätze zur Kompetenzevaluation aufzuzeigen und aktuelle Profilingmethoden, vor dem Hintergrund nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen zu untersuchen.
Einleitend werden die Begriffe Qualifikation und Kompetenz erläutert, um die Unterschiede zwischen formalem, nicht-formellem und formalem Lernen gegeneinander abzugrenzen und einen ersten Ausblick über die bisherigen Ansätze zur Dokumentation von Kompetenzen, außerhalb des formalen Bildungssystems in Deutschland im Vergleich mit Strukturen in Frankreich und Großbritannien, zu geben. Aus dieser Darstellung folgen ausgewählte Beispiele die auf ihre Vor- und Nachteile untersucht werden. Nach einem einführendem Kapitel zum Profiling werden daraufhin Profilingmethoden bei der Bundesagentur für Arbeit, regionaler Arbeitsagenturen und ihrer Träger gesichtet, um diese dann mit der qualitativen Untersuchung abgleichen zu können.
Das zugrunde liegende Material für diesen Text sind Veröffentlichungen, Fachzeitschriften, Publikationen im Internet und eine qualitative Untersuchung. Die qualitative Untersuchung wurde in der Experten-, Praktiker- und Teilnehmerebene durchgeführt. Gleichwohl die Anzahl der befragten Personen, mit Blick auf den realistischen Umfang einer vergleichbaren Ausarbeitung, gering ist, wurde versucht die Interviewpartner repräsentativ zu wählen, um zu einer validen Aussage gelangen zu können.
Diese Arbeit gibt einen ersten Einblick in die Vielzahl der bestehenden Evaluationsansätze für nicht-formal und informell erworbene Kompetenzen in Deutschland. Die qualitative Untersuchung spiegelt dies repräsentativ, mit einem regionalen Schwerpunkt in Schleswig-Holstein wieder.
2 Qualifikation und Kompetenz – Eine Spurensuche begrifflicher Grundlagen
Die Qualifizierung und der Kompetenzerwerb als Sozialisationsprozess in die gesellschaftliche Ordnung stehen im Mittelpunkt pädagogischer Anstrengungen. Die Begriffe stehen in Folge gesellschaftlicher Veränderungen und Anforderungen in einem kontinuierlichem Veränderungsprozess.
Für die Betrachtung von formalem, nicht-formalem und informell erworbenen Kompetenzen kann sich zunächst also die berechtigte Frage stellen, was unter Qualifikation und Kompetenz verstanden werden kann. Die Benennung von Schlüssel- bzw. Kernkompetenzen geht noch einen Schritt weiter. Es findet eine begriffliche Trennung und Wertung statt, welche Kompetenzen im Kern, d.h. hier aus arbeitsmarktpolitischer Sichtweise und von besonderem Interesse für die Eignung einer bestimmten und weiteren beruflichen Tätigkeiten, in Bezug auf Employability[1], sind.
2.1 Was ist eine Qualifikation?
Der Begriff Qualifikation[2] ist in seinem bildungsbezogenem Verständnis eine Umschreibung des allgemeinen Bildungsstands und bezieht sich auf die abstrakte Fähigkeit eines Individuums bestimmte berufliche Anforderungen bewältigen zu können.
Der Qualifikationsbegriff steht dabei in einem engen Bezug zu formalen Bildungssystemen, und bezeichnet die in überwiegend fremd organisierten Lernprozessen erworbenen und anerkannten Qualifikationen und erworbenen Fähigkeiten. In einem formalen Bildungsprozess kann einer Qualifikation eine Auswahl bestimmter Aufgaben zugeordnet werden, die mit den erforderlichen Fähigkeiten deckungsgleich sind. Das einer Qualifikation zugehörige Aufgabenspektrum kann auch auf formale arbeits- und tarifrechtlich geregelte Festlegungen basieren, die einer definierten Fähigkeit entsprechen.
Unter dem Begriff werden in erster Linie objektiv unbestreitbare Bildungsniveaus verstanden, die im Sinne eindeutig geschriebener Leistungskriterien überprüfbar und offiziell anerkannt werden (vgl. Frank 2003, 178). Damit stellt der Terminus der Qualifikation die funktionale Entsprechung zwischen Anforderung, z.B. am Arbeitsplatz und dem beschriebenem Ausbildungsziel eindeutig dar (vgl. Clement 2002, 7).
2.2 Was sind Kompetenzen?
Als Kompetenz[3] wird die Fähigkeit einer Person beschrieben gegebene Aufgaben, Arbeiten und Situationen angemessen zu bewältigen und unmittelbare tätigkeitsbezogene Kenntnisse, Fertigkeiten und intellektuelle Kapazitäten einzusetzen. Der Begriff Kompetenz verfolgt damit einen ganzheitlichen Anspruch, bei dem im Mittelpunkt der Betrachtung die umfassende berufliche Handlungsfähigkeit einer Person, die sich zusammensetzt aus einem Bündel einfacher Kompetenzen, Methodenkompetenzen, sozialen Kompetenzen und persönlichen Kompetenzen, steht. Diese werden fortentwickelt aufgrund von Auseinandersetzungen mit Anforderungen und Herausforderungen innerhalb und außerhalb von allgemeiner Erwerbsarbeit.
Kompetenz kann demnach als übergeordneter Begriff zur Beschreibung der Summe aller Wissensbestände und dessen Fähigkeiten einer Person beschrieben werden. Er beschreibt die Potentiale einer Person situationsadäquate Handlungsmöglichkeiten in einer großen Vielzahl von Aufgabenfeldern anwenden zu können (vgl. Clement 2002, 7). Im Umkehrschluss bezeichnet der Volksmund jemanden als völlig „inkompetent“, wenn einer Person jegliche Mittel zur Beherrschung einer bestimmten Aufgabe oder eines Aufgabenbereiches, fehlen. Kompetenzen sind erworbene und erlernte Fähigkeiten, die über die allgemein erwarteten und hinlänglich verbreiteten Grundfähigkeiten hinausgehen. Handlungs- und tätigkeitsbezogene Kompetenzen werden auch als „harte“ Kompetenzen bezeichnet, denen die „weichen“ gegenüberstehen. Damit sind soziale Kompetenzen[4] gemeint die für die Art des zwischenmenschlichen Umgangs bezeichnend und nur schwer erfassbar sind wie z.B. Umgangsformen, Ausdruck und gepflegtes bzw. situationsadäquates Auftreten..
Durch den Versuch aus dem Umfeld der Arbeit Kompetenzen in wichtigere und unwichtigere zu unterteilen, entstand der Begriff der Schlüsselkompetenzen, der für notwendig erachtete Kompetenzen unter der Prämisse erfolgreicher beruflicher Assimilation steht.
2.3 Definition der Schlüsselkompetenzen
Über die Kompetenzen die als Bestandteile der Schlüsselkompetenzen betrachtet werden, gibt es unterschiedliche Auslegungen. Zum einen gibt es Unterschiede in der Perspektive einer qualitativen Beurteilung von Kompetenzen und zum anderen das Problem der Messbarkeit. Aus Unternehmenssicht müssen Arbeitnehmer über andere Schlüsselkompetenzen (auch als Kernkompetenzen bezeichnet) verfügen, wie z.B. aus der Sicht der Kirche heranwachsende Jugendliche in einer Gesellschaft.
An dieser Stelle wird versucht sich dem Begriff der Schlüsselkompetenzen aus der bildungspolitischen Sichtweise anzunähern.
Nach Definition der Bildungskommission NRW (1995) sind Schlüsselqualifikationen: „Die erwerbbaren allgemeinen Fähigkeiten, Einstellungen, Strategien und Wissenselemente, die bei der Lösung von Problemen und beim Erwerb von Kompetenzen in möglichst vielen Inhaltsbereichen von Nutzen sind, so dass eine Handlungsfähigkeit entsteht, die es ermöglicht, sowohl individuellen Bedürfnissen als auch gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden.“ Die Festlegung von Schlüsselkompetenzen ist denkbar schwer. Dabei ist in Betracht zu ziehen, ob diese sich bereits bei der Evaluation auf bestimmtes Tätigkeitsfeld beziehen oder überbegrifflich gesucht werden.
Kaiser begreift Schlüsselkompetenzen als eine Kombination aus den Kompetenzfeldern: Organisation, Kommunikation, Anwendungen, Selbständigkeit/Verantwortung und Belastbarkeit (siehe Abb. 1). Jedem Attribut sind dabei detailliert zugehörige Kompetenzen zugeordnet die eingefordert werden. Es ist fraglich inwieweit eine akribische Auflistung geforderter Schlüsselkompetenzen bei einer allgemeinen Betrachtung Sinn macht. Die Beschäftigung mit formal, nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen macht eine allgemeine und offenere Betrachtung notwendig, da diese zunächst tätigkeits- und arbeitsfeldunabhängig ermittelt werden müssen.
Abb. 1: Schlüsselkompetenzen und deren Unterkategorien[5]
Die Suche nach einem Verständnis für Schlüsselkompetenzen muss also einen allgemeinen Charakter haben. Mit dem Versuch Schlüsselkompetenzen durch eine allgemein gültige Definition zu umgreifen, unterteilt Huck-Schade diese in die drei Unterbereiche Methodenkompetenz, persönliche Kompetenz und soziale Kompetenz. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie dabei den sozialen Kompetenzen[6] und kommt zu dem Schluss, dass sich diese insbesondere in nicht-formalen und informellen Umgebungen entwickeln und ausprägen. Schon im Elternhaus wird das Fundament sozialer Kompetenzen gelegt und oftmals irreversibel geprägt (vgl. Huck-Schade 2003, 14ff). Die Frage nach dem Ort und den Bedingungen der Kompetenzentwicklung ist damit jedoch nur partiell beantwortet.
2.4 Kompetenzentwicklung
Die Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung sind mannigfaltiger Art und in ihrer Quantität unmöglich vollständig darstellbar. Frank unterstreicht die Kompetenzentwicklung in der Arbeit als wichtige Voraussetzung für die Entfaltung persönlicher und Organisation aller Kreativität, die die Existenz entsprechender und lernförderlicher Rahmenbedingungen voraussetzt. Dazu zählt z.B. das Vorhandensein und die Inanspruchnahme von Handlungsspielräumen in der Arbeit durch eine beherrschbare Problemstellung und eine Tätigkeit die weder über Gebühr unter- noch überfordert (vgl. Frank 2003, 179).
Veith unterscheidet die Entwicklung von Kompetenzen in zwei Dimensionen, die für das Verständnis der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zur Kompetenzentwicklung hilfreich sind. Zum einen spricht er von einer subjektiven Dimension der Kompetenzen, bei der es um die Veränderung motorischer und psychischer Vorraussetzungen des Handelns geht. Diese wird im Gesamtzusammenhang der biographischen Entwicklung gesehen.
Zugleich jedoch ist die Kompetenzentwicklung, betrachtet vor dem Hintergrund der Globalisierung, eine Reaktion der gesellschaftlichen Ebene auf komplexe ökonomische, politische, kulturelle und soziale Herausforderungen. Diese werden gesehen als ein auf Dauer kontinuierlicher gesamtgesellschaftlicher Entwicklungs- und Annäherungsprozess zur Etablierung und Durchsetzung neuer Standards auf allen Handlungsebenen beruflichen Wirkens (vgl. Veith 2003, 37). Dabei verändert sich natürlich auch das allgemeine Verständnis von der Art der Schlüsselkompetenzen (vgl. Kap. 2.3), da diese durch gesellschaftliche Veränderungen und Anforderungen variieren können.
Die pädagogische Forschung ist diesen Veränderungen auf der Spur und macht es sich zur Aufgabe diese zu analysieren und in die Didaktik einfließen zu lassen (vgl. Veith 2003, 394). Nach Münk ist anzunehmen, dass auch weiterhin ein Großteil der beruflich erforderlichen Kompetenzen in formalen Einrichtungen des Bildungswesens entwickelt werden wird. Dies lässt sich an dem bis dato ungebrochenem Trend der Schulabgänger ablesen, einen Ausbildungsabschluss[7] zu erlangen (vgl. Münk 2002, 204). Doch vor dem Hintergrund der allgemeinen Wissenszunahme und der damit verbundenen Priorität „Lernen zu Lernen“, d.h. sich Wissen und Kompetenzen selbst aneignen zu müssen, kommt den nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen nicht nur eine bedeutendere Rolle zu, sondern vielmehr kann man es sich nicht mehr leisten diese zu ignorieren und formal nicht Abbildungsfähig zu machen.
Es ist demnach festzuhalten, dass es verschiedene Ebenen der Kompetenzen gibt und den Schlüsselkompetenzen im Umfeld von Beruf und Arbeit eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Generell besteht nicht nur das Problem der Messbarkeit und Analyse, d.h. der Messung von Kompetenzen auf ihre Existenz und Ausprägungsstärke, sondern auch die Frage nach ihrem Ursprung und der Entwicklung. Vertreter formaler Bildungsträger vertreten aus nachvollziehbaren Gründen die Ansicht, dass die Kompetenzentwicklung vorwiegend auf allen Gebieten in formalen Rahmenbedingungen vollzogen wird.
Es zeigt sich jedoch, dass nicht-formale und informelle Kompetenzen in ihrer Bedeutung weitestgehend unterschätzt werden, ihre Kompetenzentwicklung zum größten Teil außerhalb formaler Einrichtungen stattfindet und dringend Methoden gebraucht werden diese zu evaluieren und sichtbar zu machen.
Dort wo die Angebotsbreite nicht-formaler Bildungsmöglichkeiten kleiner ist, z.B. in den Entwicklungsländern, hat dieser Umdenkungsprozess bereits stattgefunden und man ist notgedrungen darauf übergegangen dem Kompetenzerwerb im nicht-formalen und informellen Sektor größte Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Boehm 1997, 23 und Dohmen 2001, 82ff).
Formales, nicht-formales und informelles Lernen beschreibt die Gesamtheit der verschiedenen Lern- und Kompetenzfelder aber unterscheidet sich gravierend in der Art der Herangehensweise und Kompetenzentwicklung. Das Verhältnis dieser Felder untereinander soll im anschließenden Kapitel näher erörtert und die verschiedenen damit einhergehenden Aspekte aufgeführt werden.
3Das Verhältnis von formalen, nicht-formalen und informellem Lernen
Mit dem Bedeutungszuwachs des lebenslangen (lebensbegleitenden) Lernens und der damit einhergehenden implizierten Anforderung an jeden Einzelnen, individuell einen Beitrag zur Bewältigung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels zu leisten kommt dem nicht-formalen und informellen Lernen eine Schlüsselrolle zu. Diese Bereiche des Kompetenzerwerbs werden als unabdingbare Lernfelder der Kompetenzentwicklung im Prozess des lebenslangem Lernens betrachtet.
Aus pädagogischer Sicht empfiehlt sich daher den Blick von den explizit formalen Kompetenzen auf implizite „verborgene bzw. verdeckte“ Kompetenzen zu richten. Von fachspezifischen Kenntnisse auf ganzheitliche Schlüsselkompetenzen, von der linearen Qualifikationsorientierung auf persönliche Fähigkeiten und vom formalem auf das nicht-formelle Lernen (vgl. Heidegger 2000, 101).
3.1 Lebenslanges Lernen
Infolge des sich in den letzten zwanzig Jahren veränderten Selbstverständnisses der Weiterbildung wurde zunehmend die Bedeutung des lebenslangen Lernens[8] artikuliert. Einhergehend mit der Annahme, dass sich die heutige Gesellschaft zu einer Wissensgesellschaft[9] entwickelt, kommt der Bildung bzw. dem Lernen eine hohe Bedeutung zu, die in weiten Bereichen des Lebenslaufes eine wichtige Rolle einnimmt und diesen bestimmt. Für den Lernenden bedeutet dies die Selbststeuerung der Lernprozesse zu übernehmen und in eigener Verantwortlichkeit zu gestalten. Die Selbststeuerung übernimmt vormals fremdorganisierte Bildungsprozesse und zielt darauf ab, die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten individuell immer wieder zu aktualisieren, zu erweitern und neue Kompetenzen zu erwerben.
Lebenslanges Lernen ist zu einem selbstverständlichem Bestandteil der Biografie und der gesellschaftlichen Entwicklung geworden, während Weiterbildung früher eher eine punktuelle arbeitsplatzorientierte, geplante, betrieblich koordinierte und gesteuerte Funktion erfüllte (vgl. Schiersmann/Strauß 2003, 147). Die Kontinuisierung der Lernprozesse wird dabei verstanden als die Gesamtheit aller formalen, nicht-formalen und informellen Lernprozesse bezogen auf alle Lebensphasen. Die Förderung lebenslanger Lernmöglichkeiten ist aus politischer Sicht ein notwendiger Garant der Beschäftigungsfähigkeit[10] und fortdauernder Innovationsfähigkeit eines Landes. Allerdings stellen sich Personen, die an einer Weiterbildung interessiert sind, auch vielfältige Hürden in den Weg. Sei es, dass durch eine reguläre Erwerbsarbeit keine Zeit für die Weiterbildung da ist, die Kosten für eine Weiterbildung zu hoch sind oder Familie und Arbeitgeber kein Verständnis für eine Zeit der Weiterbildung haben. Es bedarf demnach umfassender Regelungen und einem Paradigmenwechsel um lebenslange Lernprozesse zunächst ermöglichen zu können (vgl. Rothe 2001, 495).
Lernprozesse können dabei unterschieden werden in arbeitsbegleitendes Lernen, Lernen im privaten und gesellschaftlichem Umfeld, Lernen mit traditionellen Medien und Lernen mit den neuen Medien, d.h. in computergestützten bzw. netzbasierten Lernkontexten.
Eine von Schiersmann und Strauß durchgeführte Studie hat ergeben, dass unter Erwerbspersonen das arbeitsbegleitende Lernen als Lernkontext für die berufliche Entwicklung am wichtigsten angesehen wird. Das formale Lernen im privaten und gesellschaftlichen Umfeld hat besonders für Erwerbspersonen ohne qualifizierten Ausbildungsabschluss einen übergeordneten Stellenwert. Für (Fach)Hochschulabsolventen stehen die traditionellen Lernmedien im Fordergrund (vgl. Schiersmann/Strauß 2003, 150).
Eine der Voraussetzungen für das lebenslange Lernen ist eine hohe Motivation zum Lernen und der expliziten Selbststeuerung von Lernprozessen. Darunter wird verstanden, den Individuen die Verantwortung für das Lernen aufzubürden um somit, ökonomisch ausgedrückt, die Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern.
Lebenslanges Lernen bedarf einer grundlegenden Umgestaltung der Lernwege und Lernzeiten als Möglichkeitsbedingungen für Bildung. Eine gelebte Lernkultur kann nur dann entstehen, wenn Lernen und berufliche Weiterbildung berufliche und persönliche Erfolge und Spaß bringt. Erst dann können Weiterbildungschancen von den Lernenden nicht nur als Anpassungsnotwendigkeit begriffen, sondern als Entfaltungsmöglichkeit genutzt werden (vgl. Faulstich 2001, 6). Dies ist mittlerweile überparteilicher politischer Konsens und fand unter anderem im Koalitionsvertrag der großen Koalition seinen Niederschlag[11].