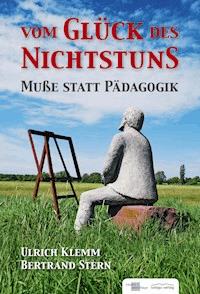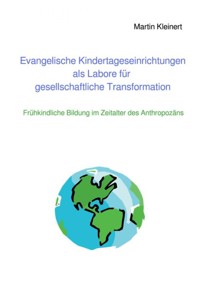
Evangelische Kindertageseinrichtungen als Labore für gesellschaftliche Transformation E-Book
Martin Kleinert
19,99 €
Mehr erfahren.
Der Klimawandel, das Artensterben, die Pandemie, und das Erstarken demokratiefeindlicher Tendenzen stellen frühkindliche Pädagogik in evangelischen Kindertageseinrichtungen vor neue Herausforderungen. Viele Forscher sehen die heutige Zeit als Beginn eines neuen erdgeschichtlichen Zeitalters, des Anthropozäns. Der ungehemmte Einfluss des Menschen auf die Erde wurde möglich durch den stetig zunehmenden Kapitalismus. Damit einhergehend wuchs die Entfremdung des Menschen von der Natur und sich selbst. Mit Hartmut Rosas Soziologie der Weltbeziehung wird ein Kontrapunkt zur Aneignung und Verfügbarmachung gesetzt, welche die Wesensmerkmale des Kapitalismus sind und die Ausbeutung von Menschen und Natur erst ermöglichen. Mit der Agenda 2030 der UNO und den darin formulierten Sustainable Development Goals verpflichten sich die Mitgliedsstaaten zu umfassenden gesellschaftlichen Transformationspro-zessen. Transformation wird zum politischen Handlungszwang. Eine demokratische Regierung steht vor der Herausforderung, wirksame Maßnahmen im Sinn der SDGs einzuführen und gleichzeitig mehrheitsfähig zu bleiben. Mit der Offenen Werkstattpädagogik und dem systemischen Konsensieren werden zwei Konzepte vorgestellt, die für eine kindzentrierte Pädagogik in Kitas und Entscheidungsfindungen ohne Verlierer stehen. In der Tradition der humanistischen Psychologie stehend, fördern beide Konzepte die Stärken und Kompetenzen des Individuums. Es wird gezeigt, dass in Kindertageseinrichtungen bereits viele SDGs im institutionellen und pädagogischen Handeln eine Rolle spielen. Transformation wird erlebbar. Dies wird durch die TeilnehmerInnen einer Gruppendiskussion bestätigt. Die Offene Werkstattpädagogik wird als wirksames Konzept gesehen, Selbstbewusstsein, Resilienz und soziale Kompetenz bei Kindern zu fördern. Diese Eigenschaften werden als wichtig angesehen, damit die Kinder gut die anstehenden gesellschaftlichen Transformationsprozesse mitgestalten können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Evangelische Kindertageseinrichtungen
Dieses Buch entstand als Masterarbeit am Diakoniewissenschaftlichen Institut der Universität Heidelberg im Sommersemester 2023.
Martin Kleinert
Evangelische Kindertageseinrichtungen
als Labore
für gesellschaftliche Transformation
Impressum:
Text Martin KleinertUmschlaggestaltung: Martin Kleinert, Grafik: Pixabay.com
Verlag:Martin KleinertBerner Allee 2822159 [email protected]
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
1.EINLEITUNG
2.NACHHALTIGKEIT ALS ANFORDERUNG FÜR EINE GESELLSCHAFTLICHE TRANSFORMATION
2.1.AKTUELLE SCHLAGZEILENUNDDAS ANTHROPOZÄN
2.2.DER MENSCHUNDSEINE BEZIEHUNGZUR WELTNACH HARTMUT ROSA
2.2.1.VERFÜGBARKEIT, UNVERFÜGBARKEIT, RESONANZ
2.2.2.RELEVANZDES MODELLSDER WELTBEZIEHUNGFÜR EVANGELISCHE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
3.POLITISCHE EBENE
3.1.DIE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSDER UNO
3.2.NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEDER BRD UND HAMBURGS
4.ERFOLGSFAKTOREN FÜR GELINGENDE TRANSFORMATION
4.1.TRANSFORMATIONINDER POLITIKWISSENSCHAFT
4.2.TRANSFORMATIONAUSSYSTEMISCHER PERSPEKTIVE
4.3.ZWISCHENERGEBNIS
5.EVANGELISCHE PROFILBILDUNG IN KITAS DURCH WERKSTATTPÄDAGOGIK UND SYSTEMISCHES KONSENSIEREN
5.1.WERKSTATTPÄDAGOGIKUND SYSTEMISCHES KONSENSIERENALS ELEMENTEFRÜHKINDLICHER PÄDAGOGIK
5.1.1.DAS KONZEPTDER OFFENEN WERKSTATTPÄDAGOGIK
5.1.2.SYSTEMISCHES KONSENSIEREN
5.1.3.DIE SDGSINDER KITA
5.1.4.ZWISCHENERGEBNIS
5.2.PRAXISERKUNDUNG
5.2.1.METHODISCHES VORGEHEN
5.2.2.HANDLUNGSFELD INDIVIDUELLES LERNENUND ERLEBENVON GEMEINSCHAFT – RECHTAUF SELBSTWIRKSAMKEIT
5.2.3.HANDLUNGSFELD BEWEGUNGUND GESUNDHEIT – RECHTAUF WOHLBEFINDEN
5.2.4.HANDLUNGSFELD BILDUNGFÜRNACHHALTIGE ENTWICKLUNG – RECHTAUF ZUKUNFT
5.2.5.HANDLUNGSFELD CHANCENGERECHTIGKEIT, INKLUSIONUND EINGLIEDERUNGSHILFE – RECHTAUF ANERKENNUNG
5.2.6.HANDLUNGSFELDCHRISTLICHE GRUNDLAGENUNDRELIGIONSSENSIBLE BILDUNG – RECHTAUF RELIGION
5.2.7.OFFENE FRAGEN
5.2.8.ZEITREISE
5.2.9.WELTBEZIEHUNGUND KITA
5.3.DISKUSSIONUND BEWERTUNGDER ERGEBNISSE
6.EVANGELISCHE KITAS ALS LABORE FÜR GESELLSCHAFTLICHE TRANSFORMATION. FAZIT UND AUSBLICK
7.LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG
ANHANG 1 SCHLÜSSELINDIKATORENDER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEFÜR DEUTSCHLAND
ANHANG 2 LEITFADENZUM GRUPPENINTERVIEWAM 24.5. VON 15:00 – 18:00 UHR
ANHANG 3 POWERPOINT FOLIENFÜRDAS INTERVIEW
ANHANG 4 INTERVIEW ABSCHRIFT
ANHANG 5 HUNDERT SPRACHENHATDAS KIND
1. Einleitung
„Nach Corona sind die Leute irgendwie anders. Verletzlicher. Empfindsamer. Öfter krank- also wirklich krank.“ Dieses Zitat einer Kitaleiterin drückt die veränderte Wirklichkeit in der Post-Corona Zeit aus. Während der Pandemie sind viele internationale und nationale Krisen in den Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Umso stärker wird nun die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft wahrgenommen. Nicht zuletzt durch den Ausbruch des Ukrainekrieges 2022.
Wie müssen sich Gesellschaften verändern, damit auch in der Zukunft ein gutes Leben für die Menschheit auf der Erde möglich ist? Welche Weichen können heute für Kinder gestellt werden, damit sie als die Erwachsenen von morgen gute Antworten auf diese Fragen finden?
Evangelische Kindertageseinrichtungen haben als Bildungseinrichtungen die Aufgabe, unter Bezugnahme auf ihre christliche Motivation die Kinder gut auf ihr späteres Leben vorzubereiten.
In meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit in leitender Funktion für Kindertageseinrichtungen beschäftige ich mich von Beginn an mit der Frage, wie pädagogische Arbeit gestaltet werden sollte, damit Kinder bestmöglich vom Besuch einer Kita profitieren. Durch den eigenen pädagogischen Hintergrund, der von der humanistischen Psychologie und dem systemischen Denken geprägt ist, sehe ich dafür große Potentiale in der Offenen Arbeit. Die vorliegende Arbeit erhebt daher nicht den Anspruch einer Neutralität, die durch den Vergleich unterschiedlicher pädagogischer Richtungen erreicht werden könnte. Vielmehr soll die Wirksamkeit der Offenen Werkstattpädagogik im Zusammenwirken mit dem pädagogischen Profil eines kirchlichen Großträgers von Kindertageseinrichtungen und den Sustainable Development Goals der UNO auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern untersucht werden. Hierbei wird bewusst auch eine politische und gesellschaftliche Wirkung mitgedacht und als legitim angesehen.
Gerade mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen die Menschheit im Moment steht (Stichworte: Klimawandel und Akzeptanzverlust der Demokratie), ist es keineswegs abwegig, Forschung mit einem politischen Ziel zu verbinden (vgl. Krüger und Meyen 2018). (Meyen, Löblich et al. (2019), S.22)
Neben einer theoretischen Annäherung soll dies durch einen Praxisabgleich geschehen. Hierzu wurde ein Expertengruppeninterview durchgeführt, dessen Teilnehmer in ihrer jeweiligen Funktion stark mit der Offenen Werkstattpädagogik verbunden sind.
In der vorliegenden Arbeit wird daher
„Subjektivität … nicht ausgeklammert – weder auf der Seite der Forschenden noch bei denen, die Teil der Studien werden. Im Gegenteil: Diese Subjektivität offen zu legen und ihre Folgen zu reflektieren (im Forschungsbericht), ist der wichtigste Unterschied zum Positivismus. Auch in Bachelor- und Masterarbeiten sollte folglich darüber nachgedacht werden, was die eigene Person mit der Studie zu tun hat. In aller Regel beginnt das bereits bei der Themenwahl und endet nicht beim Zugang zu Interviewpartnern: Wo komme ich her, welche Interessen habe ich und welche Weltanschauung? Habe ich deshalb andere Dinge gesehen und gehört als Kolleginnen mit einem anderen Hintergrund? Wie könnte sich all das auf die Ergebnisse meiner Untersuchung ausgewirkt haben? Zur Reflexivität gehört die Einsicht, dass Methoden keineswegs neutral sind, sondern den Forschungsprozess beeinflussen.“ (Meyen, Löblich et al. 2019)S.23
Die Unterstützung der „Entwicklung des Kindes zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§22,1 SGB VIII) geschieht bereits in einigen Evangelischen Kitas durch Offene Werkstattpädagogik in die ein christliches Wertesystem und die SDGs als Handlungsziele für den Erhalt der Schöpfung eingebettet sind. Zur Einschulung sollen die Kinder mit dieser Art frühkindlicher Bildung eine möglichst starke und stabile psychische Konstitution und einen ersten ethisch-moralischen Wertekanon erworben haben. Evangelische Kitas wollen daher bewusst Einfluss auf die Konstruktion von Wirklichkeit und Wissen bei den Kindern nehmen, ohne jedoch manipulativ zu sein.
„Karl Mannheim (1931) ging in seiner „Theorie von der Seinsverbundenheit des Wissens“ davon aus, dass die Denkinhalte durch den sozialen Standort der Denkenden beeinflusst werden, durch den Beruf und die Religion, durch das Geschlecht und durch Generationserfahrungen. Wissen reflektiert deshalb nicht einfach den Gegenstand, auf den es bezogen ist, sondern konstruiert ihn erst (vgl. Heintz 1993, S.530).“ (Meyen, Löblich et al. 2019) S.26)
Zur besseren Lesbarkeit erscheinen die Internetlinks von Zitaten nicht im Text, sondern werden als Endnoten im Literaturverzeichnis aufgeführt. Ebenso wird nur der Begriff „Erzieherin“ verwendet (vgl. Sprachregelung im KAT{1}, weil nach wie vor der überwiegende Teil der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen weiblich ist. Der Begriff Erzieherin bezieht sich im Text auch auf andere Berufsgruppen wie Sozialpädagogische Assistentinnen und Heilpädagoginnen und auf alle biologischen und sozialen Geschlechter der Mitglieder dieser Berufsgruppen.
2. Nachhaltigkeit als Anforderung für eine gesellschaftliche Transformation
Warum sollte eine gesellschaftliche Transformation nötig sein und welche Rolle spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit dabei? Nach einer Darstellung eigener Wahrnehmungen und Beobachtungen werden die soziologische und die politische Ebene beleuchtet, um Begründungen für einen transformativen Prozess zu beschreiben. Am Ende dieses Kapitels sollen Erfolgsfaktoren für gelingende Transformationsprozesse geschildert werden.
Unter gesellschaftlicher Transformation verstehe ich die Veränderung von Strukturen in einer Gesellschaft. Die Veränderungen können sich auf politische, institutionelle, soziale und kulturelle Normen als auch auf eine Umgestaltung der Rollen der verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft beziehen. Obwohl es eine Reihe verschiedener Ansätze zur gesellschaftlichen Transformation gibt, kann man sagen, dass das gemeinsame Ziel darin besteht, die Gesellschaft in eine bessere Richtung zu entwickeln und zu stärken. Eine kurze Beschreibung von Transformation liefert die Freie Universität Berlin:
„Veränderungen in den einzelnen Teilsystemen sind interdependent, d.h. Veränderungen in dem einen System beeinflussen Veränderungen in einem anderen System und werden von diesen beeinflusst. Zu einer Transformation kommt es erst, wenn sich verschiedene Veränderungen in Teilbereiche gegenseitig verstärken und der gesellschaftlichen Entwicklung eine Richtung geben (z.B. Nachhaltigkeit). Während des Transformationsprozesses aber existieren 'alt' und 'neu' nebeneinander (z.B. in Form von Technologien, sozialen Normen, wirtschaftlichen und politischen Systemen). Erst im Verlaufe einer Transformation – beim erfolgreichen Verlassen von Pfadabhängigkeiten und Überwinden von Barrieren – stellt sich heraus, welche Richtung die Transformation einer Gesellschaft einschlägt“{2}.
2.1. Aktuelle Schlagzeilen und das Anthropozän
Ein Blick in die aktuelle Medienberichterstattung zeigt die Themenbandbreite der negativen Nachrichten, welche auf die Menschen einwirken. Auch wenn man das Bonmot des Journalismus „bad news are good news” berücksichtigt, bleibt beim Rezipienten angesichts der Fülle der Nachrichten eine bedrückende Schwere, Rat- und Hilflosigkeit. Denn die „bad news“ von heute sind ja nicht „nur“ irgendwelche Mord- und Totschlagsgeschichten, Entführungen, Flugzeugabstürze etc. Viele der schlechten Nachrichten betreffen globale Themen. Einige Beispiele mögen das verdeutlichen:
„Letzte Generation: Italiens Regierung macht Kampfansage an Klimaaktivisten“ (Hamburger Abendblatt, 3.4.2023)
„Antarktis: Meeresströmungen stehen vor dem Kollaps“ (Hamburger Abendblatt, 2.4.2023)
„Rechte Gewalt in Deutschland: Die rechtsextreme Szene in Deutschland hat in den vergangenen Jahren wieder an Zulauf gewonnen.“
{3}
„USA: Wann endet Polizeigewalt gegen Schwarze?“
{4}
„Artensterben durch Erderhitzung: Für Korallen ist es schon zu spät“
{5}
Nach Christian Wirth, Professor für Botanik undBiodiversitätan der Uni Leipzig befinden wir uns in einer Triplekrise. „Klimawandel, Artensterben und die Pandemien, das ist alles eins“{6}. Ich würde diese Aufzählung noch um das Erstarken demokratiefeindlicher Tendenzen sowie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus erweitern.
Die Gemeinsamkeit dieses Themenspektrums liegt meines Erachtens darin, dass die einzelnen Themen schwer zu erfassen und Ausdruck einer langen Entwicklung sind. Die globale Relevanz des Klimawandels ist nur mittelbar und theoretisch für den einzelnen Menschen erlebbar, da menschliche Sinnesorgane nur auf unmittelbare und räumlich nahe Reize reagieren. Menschen erleben (sehen, hören, fühlen, riechen) eine Sturmflut, eine Überschwemmung wie im Ahrtal oder einen Dürresommer. Solche Ereignisse treffen sie unmittelbar. Unsere Sinnesorgane können aber nicht erfassen, dass hinter so einer Katastrophe z.B. ein umgelenkter Jetstream, eine starke Hurricane Saison oder das Schmelzen der Polkappen steckt.
„Die Komplexität der Zusammenhänge zwischen menschlichem Handeln, seinen Auswirkungen auf das Klimasystem und wiederum dessen globalen, aber regional unterschiedlichen und zeitlich versetzten Rückkopplungseffekten auf Gesellschaften (ist) nicht leicht zu vermitteln. … Studien der historischen Katastrophenforschung zeigen, dass der entscheidende Faktor für die Risiko- und Gefahrenwahrnehmung (Hervorhebung vom Autor) die Zeitskala ist, auf der sich eine Krise oder Katastrophe abspielt.“ (Rohland: „Corona, Klima und weiße Suprematie“ in 2020), e-Book)
Der belgische Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Crutzen und der US-amerikanische Biologe Eugene Stoermer haben im Jahr 2000 vorgeschlagen, das aktuelle geologische Zeitalter Anthropozän zu nennen und damit eine neue erdgeschichtliche Episode zu beschreiben {7}. Diese Entscheidung soll im Jahr 2023 von der International Commission on Stratigraphy getroffen werden{8}. Das neue Zeitalter ist dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch durch seine große Bevölkerungszahl und durch seine kollektiven Emissionen den Planeten in bisher unbekanntem Maße verändert, und diese Veränderungen allein durch menschliches Handeln hervorgerufen werden. Beispielhaft sollen hier nur die weitreichenden Abholzungen in den Regenwäldern, Eingriffe in den Wasserhaushalt durch Begradigungen von Flüssen und Trockenlegung von Mooren, Bergbau (i.B. Tagebau) oder irreversible Schäden durch Katastrophen (Exxon Valdez Ölkatastrophe) und den Einsatz von Technik (Fukushima, Tschernobyl, Fracking) genannt werden. Diese Aufzählung könnte noch fortgeführt werden.
„Die menschgemachte Erwärmung des Klimas, die Ausbeutung seltener und nicht erneuerbarer Rohstoffe, landwirtschaftliche Monokulturen, der Einsatz von Pestiziden und die Verschmutzung von Ozeanen mit Mikroplastik sind auch massive Eingriffe in die Habitate anderer Spezies, die zu deren massenhaftem Aussterben beitragen. Dies wiederum bedroht, zusammen mit der Erderwärmung, die Grundlagen der menschlichen Nahrungsmittelproduktion. Dies sind nur einige der sich mit dem Wachstum der Erdbevölkerung verstärkenden Prozesse, die dem Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen, seinen Namen geben.“ (Rohland a.a.O)
Der anthropogene Klimawandel ist mit dem Erscheinen des Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ vom Club of Rome im Jahre 1972 einer breiteren Bevölkerungsgruppe verdeutlicht worden. Nach dem 2. Weltkrieg gab es eine enorme Beschleunigung bei der Freisetzung von Treibhausgasen und dem Gebrauch von Kunstdüngern in riesigen Monokulturen.
„Insbesondere drei Systeme haben die planetaren Grenzen schon deutlich überschritten: Der Verlust an Biodiversität, die Erderwärmung und die Eingriffe in den Stickstoffhaushalt setzen aller Wahrscheinlichkeit nach eine Dynamik frei, die bisher nicht wissenschaftlich vorhersagbar ist. Tipping Points, die nach einer langen Latenzperiode mit einem relativ plötzlichen Umschwung einsetzen, verändern das Erdsystem nun grundlegend (Horn 2020). Die früher vorherrschende Vorstellung, dass menschliche Gesellschaften vor dem Hintergrund einer relativ stabilen Natur ihre Geschichte unabhängig von der Naturgeschichte schreiben, ist völlig obsolet geworden.“ (Adloff, „Zeit, Angst und (k)ein Ende der Hybris“ in (2020), e-book)
Neben den Nachrichten über den Klimawandel kann die Berichterstattung über rassistische Gewalt, Amokläufe (Hamburg 2023) und die sogenannten Reichsbürger Zweifel an der Überzeugung, in einer gut funktionierenden Demokratie und einem Rechtsstaat zu leben, aufkommen lassen. Rassismus ist ein lang existierendes Phänomen und soll hier in Verbindung mit dem Anthropozän gesetzt werden.
Rassistisches Denken kam im großen Stil im 15. und 16. Jahrhundert auf. Der wachsende Bedarf an den Konsumgütern Baumwolle und Zucker führte zur massenhaften Versklavung der afrikanischen Bevölkerung zur Zwangsarbeit in Amerika. Die Bundeszentrale für politische Bildung erläutert zum Rassismus:
„Das Konzept der Rassen stammt ursprünglich aus der Naturwissenschaft, die im 19. Jahrhundert versuchte, das in Europa vorherrschende Klischee einer überlegenen weißen Rasse wissenschaftlich zu untermauern. Die Begründung der Überlegenheit der weißen Rasse war nötig, um die Kolonialisierung Afrikas und Südamerikas zu betreiben. Die Versklavung von Millionen Afrikanern zur Ausbeutung der Rohstoffe der eroberten Gebiete verfestigte bei den europäischen Mächten das Gefühl einer moralischen und zivilisatorischen Überlegenheit der "weißen Rasse". Die Idee einer erblich bedingten Überlegenheit gipfelte nicht zuletzt in der grausamen Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Auch wenn der Rassismus mittlerweile wissenschaftlich widerlegt ist, ist er weiterhin in vielen Köpfen verankert. Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Hautfarbe gehört daher auch heute leider noch zum Alltag vieler Menschen.“{9}
Rohland sieht in der Geschichte der Sklaverei und dem damit verbundenen Rassismus bereits den Beginn des Anthropozäns und verknüpft die Gewinnung von Rohstoffen und die Herstellung von Gütern mit der Verfügbarkeit von kostenloser oder billiger Energie.
„…ab dem frühen 16. Jahrhundert, finden wir die ersten Beispiele für die massive Ausbeutung natürlicher Ressourcen und für die Veränderung und Zerstörung von Ökosystemen durch Europäer, basierend auf der Versklavung indigener und afrikanischer Bevölkerungen. Ohne die Gewalt und Grausamkeit dieser Versklavung aus dem Blick zu verlieren, ist es für die Verbindung zum Anthropozän hilfreich, sie für einen Moment in der scheinbar neutralen Perspektive der Energiegeschichte zu betrachten. Denn die Versklavung indigener Bevölkerungen verhalf den spanischen Konquistadoren zu einem verlässlichen Strom an ›billiger‹ Energie (Muskelkraft), um – unter anderem – die Silberminen Potosís in Peru auszubeuten und so den lukrativen Silberhandel mit China zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Auf der Basis dieser blutigen ›Energie‹ und dieses Handels gelangte das spanische Empire zur Blüte.“ (Rohland, a.a.O.)
Die Verfügbarmachung von billiger Energie in Form von Muskelkraft setze sich im Sklavenhandel durch die Deportation afrikanischer Menschen im britischen Empire und den Südstaaten der USA fort und sicherte den wirtschaftlichen Erfolg.
Auch mit der Erfindung der Dampfmaschine und des Verbrennungsmotors blieb es für den Markt wichtig, Energie in Form von fossilen Brennstoffen möglichst billig zu bekommen, um die Preise für (Konsum-) Güter gering zu halten, ohne für die Folgekosten der Verbrennung wie Landschaftsschäden, Gesundheitsschäden der Arbeiter und Arbeiterinnen und Abgase aufzukommen.
„Bedeutende Teile dessen, was unter dem Begriff der europäischen oder westlichen Moderne gefasst wird, basierten energietechnisch, wirtschaftlich, kulturell und wissenschaftlich auf diesem Ausbeutungsverhältnis. Hier liegen die tiefen historischen Schichten des systemischen Rassismus…Bis heute sind diese »fossilen Freiheiten« und die mit ihnen gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen und Vorteile vor allem ›weiße Freiheiten‹.“ (Rohland, a.a.O.)
Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem Konsum schlechter Nachrichten und physischem Stress herstellen. Beunruhigende Nachrichten und Beobachtungen sorgen evolutionär bedingt für Aktionen, die das Individuum zwischen Flucht oder Kampf entscheiden lassen. Hier wird gerne das Beispiel des Höhlenmenschen aufgezeigt, der vor seiner Höhle Ausschau nach Säbelzahntigern hält.{10} Physische Stressreaktionen, die durch den Konsum o.g. Nachrichtenkomplexe hervorgerufen werden, sind jedoch sinnlos. Man kann, anders als der Höhlenmensch, weder fliehen noch kämpfen. Wobei es durchaus, vielleicht als Kompensation, die Phänomene des Engagements in (radikalen) Gruppierungen oder die Flucht in Nachrichtenenthaltsamkeit gibt. Eine Studie des VOCER Instituts für digitale Resilienz stellt fest:
„Angesichts des permanenten Nachrichtenstroms wenden sich viele Menschen in Deutschland von den digitalen Medien ab, weil sie von ihrer Mediennutzung erschöpft sind, sich ausgebrannt fühlen – besonders Jüngere fühlen sich überfordert, schlapp und leer“.{11}
Nicht zuletzt hat die Corona Pandemie zu einer großen gesellschaftlichen Verunsicherung beigetragen. „Vor Corona“ argumentierten politisch Verantwortliche oftmals mit Sachzwängen, internationalen Abstimmungsbedarfen, der Einhaltung von Verträgen etc., um ihr wenig entschlossenes Handeln zu begründen. Kurz nach Ausbruch der Pandemie durfte die staunende Bevölkerung erleben, wie
„die Grundfeste moderner Gesellschaften erschüttert worden sind. Politikerinnen und Politiker taten das Undenkbare und fuhren zugunsten des Gemeinwohls das öffentliche und wirtschaftliche Leben herunter. Sie verstießen damit gegen Wählerinteressen wie auch gegen wirtschaftliche Interessen – und zwar unter extremer Ungewissheit, ob die Maßnahmen des Lockdowns tatsächlich notwendig waren.“ (Adloff: a.a.O.)
Plötzlich spielten wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungen eine große Relevanz. Eine Kernforderung der Fridays-for-future Demonstrationen ist die Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei politischen Entscheidungen. Wer einmal an so einer Demonstration teilgenommen hat, konnte sich verwundert die Augen reiben, was plötzlich auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse politisch umsetzbar war.
Die Corona Pandemie hat viele (Fehl-) Entwicklungen deutlich gemacht. Die gefeierte Globalisierung der Märkte und die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland haben die Abhängigkeit Deutschlands von den asiatischen Märkten z.B. bei der Medikamentenproduktion oder der Herstellung von FFP2 Masken deutlich aufgezeigt. Unterbrochene Lieferketten sorgten für Preisexplosionen im Baugewerbe und eine allgemeine Inflation.
„Die Pandemie kam zwar innerhalb weniger Wochen über die Welt, wurde aber durch eine über einhundertjährige Geschichte der Globalisierung vorbereitet. Das Virus des Neoliberalismus wiederum kursiert schon seit mehr als 40 Jahren und hat über Privatisierungen und Einsparungen im Gesundheitswesen die Krise befeuert. Dies zeigt, dass die akute Krise einen enormen zeitlichen Vorlauf hat und sich in ihr unterschiedliche Zeitlichkeiten überlagern.“ (Adloff, a.a.O.)
Es könnten sicher noch mehr Verknüpfungen zwischen der aktuellen Krisenwahrnehmung und der Idee des Anthropozäns aufgezeigt werden. Die gezeigten Beispiele des Klimawandels und des Rassismus machen jedoch schon deutlich, dass es für die Lösung der Problematiken keine einfachen und schnellen Antworten gibt, so gerne dies rechtsgerichtete politische Wortführer auch propagieren. Das gegenwärtige (wirtschaftliche) Handeln ist tief im kollektiven Denken der westlichen Gesellschaften verankert. Die Eindämmung der durch den Klimawandel erzeugten Probleme kann aber nur durch globale Veränderungsprozesse erfolgen. Selbst wenn für Deutschland die Folgen des Klimawandels im Vergleich zu einigen Inselstaaten relativ milde wären, würden doch z.B. Flüchtlingsströme gesellschaftliche Anpassungen erfordern. „Die Weltbank schätzt, dass bis zum Jahr 2050 bis zu 143 Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen werden könnten.{12} Es bedarf daher positiver Visionen, um die Bevölkerung für die nötigen Veränderungsprozesse zu gewinnen. Unterschiedliche Staaten müssen dabei je eigene Transformationsprozesse durchlaufen, weil gute und richtige Maßnahmen für die Bundesrepublik Deutschland nicht gleich gut für ein anderes Land und eine andere Gesellschaftsform sein müssen.
2.2. Der Mensch und seine Beziehung zur Welt nach Hartmut Rosa
Im vorigen Kapitel wurde das Anthropozän als erdgeschichtlicher Epochenwechsel vorgestellt. Durch menschliches Handeln sind Eingriffe in die Umwelt geschehen, die die Klimakrise hervorgerufen haben. Die Denkweise in den westlichen Gesellschaften, die Natur und andere Völkergruppen als ausbeutbare Ressourcen zu betrachten, führte zu Sklaverei. Das rassistische Gedankengut ist immer noch in gesellschaftlichen Gruppierungen präsent und dient dabei immer wieder einfachen Schuldzuschreibungen, statt komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge zu analysieren: „Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg“, „Die Muslime befördern den Terrorismus“. Solche Stigmatisierungen und Ressentiments sind meiner Meinung nach Ausdruck eines unterkomplexen Verständnisses über wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge. Es mangelt an einem Verständnis dafür, dass menschliches, nichtmenschliches Leben und die unbelebte Natur EINE gemeinsame planetare Gemeinschaft bilden.
Die Unzufriedenheit und Kritik an der Welt münden für Hartmut Rosa in der Frage:
„Woher kommt all der Frust und der Zorn auf das Leben und die Gesellschaft und die Verzweiflung über eine Welt…, die uns doch in historisch beispiellosem Maße offen und zur Verfügung steht?“ (vgl. Rosa (2019), Schlusswort)
Für ihn sind die Begriffe (Un-) verfügbarkeit und Resonanz Schlüsselwörter zur Beantwortung dieser Frage. Sie bilden den Kern seiner Soziologie der Weltbeziehung. Der Mensch ist in eine schon bestehende Welt hinein geboren. Das Individuum und die Welt existieren nur eine kurze Episode in einer Gleichzeitigkeit, weil es die Welt schon vor der Geburt dieses Menschen gegeben hat und sie auch nach seinem Tod da sein wird. Seine Sicht und Bezogenheit zur Welt ist nicht von vorneherein festgelegt, sondern ist
„abhängig von den sozialen und kulturellen Bedingungen, in die wir hinein sozialisiert werden. Wir erlernen und habitualisieren eine bestimmte Stellungnahme zur Welt, eine praktische Welthaltung, die weit über unser kognitives `Weltbild´, unsere bewussten Annahmen und Überzeugungen über das, was es in der Welt. gibt und worauf es ankommt, hinausgeht.“ (Rosa (2019), S.12)
Für Rosa ist die Beziehung zwischen einem Individuum und der Welt also jeweils selbst gestaltet, wobei diese Beziehungsgestaltung von sozialen Einflüssen beeinflusst wird, nicht jedoch, wie von manchen religiösen Gruppierungen geglaubt, vorherbestimmt ist.
Frust mit und Kritik an der Welt beruhen auf einer unharmonischen, einseitigen Beziehung zur Welt, die strukturelle Ursachen hat. Ähnlich wie Rosa hat bereits Karl Marx die Entfremdung des Menschen zur Welt beschrieben. Entfremdung ist dabei nicht nur im Arbeitsprozess zu beobachten, wo Arbeiter nicht mehr Eigentümer der Produktionsmittel sind und auch nicht bestimmen, was und wieviel mit den Produktionsmitteln hergestellt wird. Die Beziehung der Menschen in den westlichen Industriegesellschaften zur Welt ist strukturell durch die Mechanismen des Kapitalismus und Imperialismus geprägt. Marx beschreibt deren Destruktivität und Aggressionspotential:
„Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingebornen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute, bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. … Diese Methoden (Staatschulden-, Steuer- Protektionssysteme (Einfügung. d. Autors)) beruhn zum Teil auf brutalster Gewalt, z.B. das Kolonialsystem. Alle aber benutzten die Staatsmacht, die konzentrierte und organisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozeß der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäßig zu fördern und die Übergänge abzukürzen. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz“{13}.
Die jahrhundertealte Tradition des Wirtschaftens durch Ausbeutung führt(e) dazu, dass die Menschen die heutige Welt als, so nennt es Rosa, Aggressionspunkt wahrnehmen. Das Subjekt sieht sich nicht als Teil des Ganzen, sondern steht der Welt gegenüber. Die zuvor geschilderten Phänomene werden von den Menschen in einer ES Perspektive wahrgenommen. Sie sind gegeben, vermeintlich unveränderbar und betreffen alle Menschen einer Gesellschaft auf gleiche Art. Der einzelne Mensch steht zur Welt hingegen in der ICH Perspektive. Die strukturellen Gegebenheiten treten in den Hintergrund und die Aggressionspunkte des Subjekts kristallisieren sich an Sätzen wie z.B.: ICH brauche mehr Geld, damit ich mir mehr leisten kann. ICH muss mich verbessern und optimieren, um von den Menschen um mich herum, am Arbeitsplatz, auf dem Partnermarkt anerkannt zu werden. Man kämpft sich an Problemen oder mit der Arbeit ab, Berge müssen bezwungen, Ziele erreicht oder übertroffen werden (vgl. Rosa a.a.O).
Die vielfach wahrgenommenen Selbstoptimierungszwänge beruhen meiner Meinung nach auch auf der Grundannahme des Kapitalismus, dass jedes Produkt einen Mehrwert erzeugen muss, damit daraus Kapital akkumuliert werden kann, welches den Unternehmer konkurrenzfähig bleiben lässt. Dies führt zu einer stetig wachsenden Spirale. Auf die Wirtschaft bezogen bedeutet dies, dass immer mehr oder bessere Produkte produziert werden müssen, die dem Konsumenten einen größeren Nutzen oder mehr Glück versprechen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die jährliche Präsentation eines neuen Apple iPhone, welches oft nur marginale Unterschiede zum Vorjahresmodell hat, aber als „must-have“ vermarktet wird.
Die Selbstoptimierung der Menschen funktioniert in denselben kapitalistisch geprägten Denkmustern. Man muss sich vermarkten, besser sein als die Kollegen, die Mitbewerber, mehr Follower und Klickzahlen erreichen. Mein Wissen oder mein Körper ist mein Kapital, und dieses kann ich durch Lernen, durch Training oder Schönheitsoperationen vermehren. Passend zu der aus einer Sparkassenwerbung stammenden Botschaft „- Mein Haus- Mein Auto - Mein Boot“{14} ist dazu der Sprachgebrauch „Ich habe einen Körper“ (vgl. auch Rosa (2016), S.17). Die Kategorien Haben und Sein hat bereits Ernst Bloch benannt.
„Unsere Gesellschaft (ist) vom Haben und Habenwollen bestimmt– der Mensch ist der Diener des Wirtschaftssystems, und er will immer mehr haben, weil das System es so vorsieht. Der Einzelne, entfremdet von sich selbst, wird dabei krank und unglücklich, und zwischen Gesellschaftsklassen und Völkern entstehen Neid und Krieg. Dem stellt Fromm die Existenzweise des Seins gegenüber: Hier definiert der Mensch sich nicht über seinen Besitz, sondern darüber, was er ist.“{15}
Der Diener des Wirtschaftssystems bei Bloch ist in der Terminologie Rosas das Subjekt, welches sich nicht als Teil der Welt, sondern als ihr Gegenüber sieht und lauter Aggressionspunkte wahrnimmt, die es bezwingen, schaffen, erreichen, erledigen muss.
Allerdings verlieren ideologische Kernbotschaften wie „Leistung lohnt sich“ oder „vom Tellerwäscher zum Millionär“ zunehmend an Attraktivität. Neben dem wachsenden Verständnis von einer Work-Life-Balance wächst in vielen Bevölkerungsgruppen die Angst, dass mehr Leistung nur noch dadurch belohnt wird, nicht abzurutschen.
„Die Steigerungsperspektive verkehrt sich in der kulturellen Wahrnehmung nach und nach von einer Verheißung in eine Bedrohung: Wachstum, Beschleunigung und Innovation erscheinen nicht mehr als Versprechen, das Leben immer besser zu machen, sondern als apokalyptisch-klaustrophobische Drohung: Wenn wir nicht besser, schneller, kreativer, effizienter etc. werden, verlieren wir Arbeitsplätze, kommt es zu Firmenschließungen, sinken unsere Steuereinnahmen, während die -ausgaben steigen, kommt es zur Haushaltskrise, können wir unser Gesundheitssystem, unser Rentenniveau, unsere kulturellen Einrichtungen nicht mehr aufrechterhalten, werden die politischen Spielräume immer enger, sodass am Ende auch das politische System delegitimiert erscheint.“ (Rosa (2019), S.15)