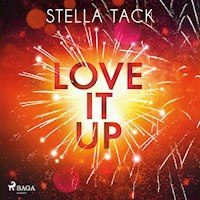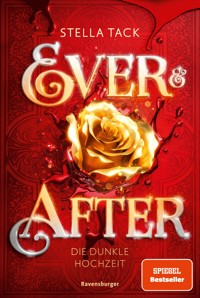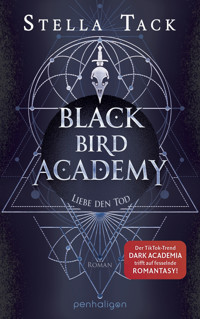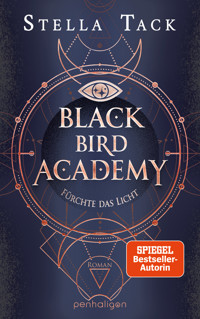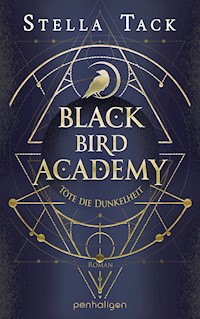15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ever & After
- Sprache: Deutsch
Das große Finale der "Ever & After"-Trilogie Sei vorsichtig, was du dir wünschst! Denn Rains Wunsch, die Welt und ihre Freund*innen zu retten, hat schlimmere Konsequenzen, als sie es sich jemals hätte vorstellen können. Um den Prinzen und seine dunklen Vasallen aufzuhalten, hat sie nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Seele geopfert. Nun muss Rain alles daran setzten, ihren Wunsch rückgängig zu machen. Weitere unvergessliche Romance und spannende Romantasy von SPIEGEL-Bestsellerautorin Stella Tack:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 875
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
TRIGGERWARNUNG
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält Themen, die potenziell emotional belasten oder triggern können. Hier befindet sich ein Hinweis zu den Themen.
ACHTUNG: Dieser enthält Spoiler für die gesamte Handlung.
Als Ravensburger E-Book erschienen 2025 Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg
© 2025 Ravensburger Verlag GmbH Text © 2025 Stella Tack Covergestaltung: Alexander Kopainski unter Verwendung von Fotos von Shutterstock: © VladyslaV Travel photo, Ole moda, kaisorn, Media Guru, Breezy Point, Mischokom, Mr. Rashad, popular.vector, KASUE, Iryna_Shancheva, Gizele, armo.rs, Turan Ramazanli, Croisy, soponyono und DISTROLOGO. Sowie unter Verwendung eines Motivs von Artstation: © Noya Lektorat: Jennifer Benkau
Alle Zitate aus Märchen stammen aus: Brüder Grimm. Kinder- und Hausmärchen. Gesamtausgabe mit allen Zeichnungen von Otto Ubbelohde in zwei Bänden [Erster Band Märchen Nr. 1–93, zweiter Band Märchen Nr. 94–200]. Nach der Großen Ausgabe von 1857. München 2005. Der Märchen- und Eigenname »Sneewittchen« wurde im vorliegenden Werk in »Schneewittchen« umgewandelt.
Alle Rechte vorbehalten.Der Nutzung für Text- und Data-Mining wird ausdrücklich widersprochen.
ISBN 978-3-473-51278-2
ravensburger.com/service
Für Bernd und Sabine Schoder, die behaupten werden, dieses Buch geschrieben zu haben, obwohl sie im Grunde nur vor mir gesessen, ihre Cocktails geschlürft und an den richtigen Stellen genickt haben.
PS: Lasst euch von Bernd auf der Messe bitte kein Autogramm aufschwatzen. Er wird es versuchen.
Für Jennifer Benkau, die sich als Einzige getraut hat, dieses Buch zu lektorieren. Diese Frau ist sehr mutig. ((Anmerkung der Redaktion: Ist sie. Und sie würde es wieder tun.))
Für meine Agentin Christiane,
die mich netterweise nicht aus dem Fenster geschubst hat, als ich ihr sagte, das Buch hätte 900 Seiten statt 450 – allerdings braucht sie jetzt Urlaub … meinetwegen.
Für den Ravensburger Verlag,
der einfach nur noch kraftlos um ein Happy End gebeten hat. Ich glaube, die Leute dort brauchen jetzt auch Urlaub. Auch meinetwegen. Uups.
Für meinen Mann, der die Wäsche gewaschen hat, damit ich nicht ganz so schlimm gestunken habe, wenn ich aus meiner Schreibhöhle gekrochen kam, um röchelnd nach etwas zu essen zu suchen.
Für meine Mama,
weil sie das Buch lesen wird, obwohl es ihr viel zu gruslig ist.
Für meine Katze. Einfach weil sie niedlich ist.
Für meine Kaffeemaschine, weil ohne sie vermutlich nur 3 Wörter in diesem Buch stehen würden.
Für euch alle, weil ihr jetzt 700 Seiten lesen müsst!
Danke.
Sorry.
Kapitel 1
Smugaid
»Weil wir so glücklich dem Tode entronnen sind, so wollen wir uns als gute Gesellen zusammenhalten und, damit uns hier nicht wieder ein neues Unglück ereilt, gemeinschaftlich auswandern und in ein fremdes Land ziehen.«
Aus »Strohhalm, Kohle und Bohne«Gebrüder Grimm
Vor langer, langer Zeit …
Mein Atem schwebte in kleinen Wolken vor meinem Gesicht, als ich durch das zerklüftete Dach des Pferdestalls blickte. Hinter dem Loch im Gebälk konnte ich den Sternenhimmel sehen, wie ein Bruchstück von etwas Magischem. Ein wunderschöner Fleck, der über all dem Dreck und Elend leuchtete, in dem ich mich befand. Jeder Stern dort oben war mir bekannt. Doch heute Abend war etwas anders. Da war ein Stern, der mir fremd war. Er schien direkt über mir, als müsste ich nur eine Hand ausstrecken, um ihn zu berühren.
Wie seltsam. Konnten Sterne einfach so am Himmel auftauchen?
Fröstelnd grub ich meine nackten Füße tiefer ins Stroh, um nach Wärme zu suchen.
Es war eigentlich längst zu kalt, um im Stall zu übernachten. Seit meiner Kindheit arbeitete ich hier, versorgte die Pferde, putzte Stiefel und Zaumzeuge, schleppte Heu und fungierte als Laufbursche für die Soldaten. Im Grunde hatte ich nie mehr besessen als das Stroh unter mir, und dennoch hatte ich mich nie an die Kälte gewöhnt, die in der dunklen Jahreszeit, wenn die Götter übellaunig waren, wie eine eisige Hand nach mir griff und bis tief in meine Knochen drang.
In den nächsten Tagen würde ich mit Schneeflocken in den Haaren und gefrorenen Wimpern aufwachen. Doch solange ich die Nächte überleben konnte, würden die Köche mich nicht neben den Öfen schlafen lassen. Fröstelnd raffte ich die fadenscheinige, raue Decke, die aus einem alten Getreidesack bestand, fester um mich, doch die Kälte blieb. Vielleicht sollte ich mich doch in die Küche stehlen, um zumindest ein paar Stunden neben dem Kohleofen zu schlafen. Doch das letzte Mal hatte eine der Küchenmägde mich bemerkt, das Feuer angefacht und meine Fußsohlen dabei so verbrannt, dass ich noch Tage später eine Spur aus Blut und Asche hinterlassen hatte.
Allein die Erinnerung ließ meine Sohlen wieder schmerzen; ich krümmte die Zehen. Nein. Ich blieb im Stall, solange es möglich war. Hier draußen mochte es eiskalt sein, doch zumindest ließ man mich in Ruhe. Bis auf Ratten und Ungeziefer kam niemand her, der mich störte. Außer vielleicht die Dunkelheit in mir selbst, die an den Stäben meines Verstandes rüttelte, seit ich denken konnte. Wenn ich nachts schreiend aufwachte, den Mund voll Asche, den Kopf voll geflüsterter Worte von Blut und Tod, erregte das im Stall eindeutig weniger Aufmerksamkeit. Die Anfälle waren in den letzten Wochen schlimmer geworden. Die Schwärze in mir reizbarer, sodass es für alle sicherer war, wenn ich mich draußen aufhielt.
Ich seufzte. Wieder stieg Dampf von meinem Mund auf, und ich stellte mir vor, wie er in den Sternenhimmel schwebte und sich dort verfing. Die Menschen mochten Angst vor der Dunkelheit haben. Ich nicht. Vielleicht weil sie längst ein Teil von mir war. Die Dunkelheit war ein Ort, an den ich mich zurückziehen konnte, wie in die Umarmung meiner Mutter, bevor sie verschwunden war und mich allein zurückgelassen hatte. Als Kind hatte ich mir vorgestellt, dass der Kuss der Königin sich anfühlte, als würde Sternenlicht durch meine Adern fließen. Warm und weich. Wie wohltuend es sein musste, geliebt zu werden. Nicht einsam zu sein. Ohne die Angst vor dem Monster in mir selbst zu leben. Oder den anderen Monstern im Palast. Wie es sein mochte, die Augen zu schließen und zu wissen, dass man sie am nächsten Tag wieder ohne Schmerzen öffnen konnte.
Aber ich war nun mal hier, hier unten, fern der Sterne und der Ewigkeit. Und jene Person, die mich hätte lieben können, hatte mich alleingelassen. Mein Blick wanderte meinen Arm hinab. Über die tiefen Schnitte, die die Haut durchkreuzten wie bizarre Adern. Manche stammten von der Arbeit, andere von Menschen und die tiefsten von den Göttern. Für jeden Versuch, meinem Schicksal, diesem Leben oder dem Palast zu entfliehen, hatte ich mit Blut und Schmerz zahlen müssen. Bis meine Haut genauso hässlich und vernarbt geworden war wie mein Innerstes. Die Einschnitte waren so tief, dass ich mir sicher gewesen war, wie Glas zu zerbrechen, nur um festzustellen, dass meine Wut und der Trotz größer waren als Angst und Schmerz. Jedes Mal, wenn ich erfolglos versucht hatte wegzulaufen, hatte ich gedacht, sie würden mich töten, und trotzdem war ich noch hier.
Zwischen meinen halb geschlossenen Augenlidern blitzte etwas auf. Der neue Stern über mir wurde größer und heller. Er schien zu pulsieren, und dann bewegte er sich. Überrascht riss ich die Augen auf und beobachtete, wie der Stern zu fallen begann, als hätte jemand seine Fäden durchgeschnitten.
Eine Sternschnuppe? Sie huschte über den Himmel wie ein schimmerndes Juwel.
Der Anblick brannte sich in meine Augen, und ich erinnerte mich daran, dass ein Küchenmädchen mir einmal erzählt hatte, wenn ein Stern fiele, wäre er bei den Göttern in Ungnade gefallen und dazu verdammt, auf dem Weg zur Welt zu sterben. Doch während er verglühte, könnte er einen letzten Wunsch erfüllen, um seine Schande wiedergutzumachen. Ich hatte schon lange aufgehört, an Wunder oder Wünsche zu glauben. Und dennoch ertappte ich mich dabei, wie ich die Augen zusammenkniff und genau das tat.
Ich wünschte mir ein Ende.
Oder vielleicht doch einen Anfang?
Ich wünschte mir den Anfang vom Ende und das Ende des Anfangs.
Alles, um meinem Leben endlich zu entkommen.
Der Wunsch kam von meinen Lippen wie ein Gebet. Nicht an die Götter, die im Palast saßen und sich an den Leben der Menschen vollfraßen wie Gewürm an Aas. Ich betete voller Inbrunst zu dem Stern, der, wie ich, in Ungnade gefallen war. Ich zitterte vor Kälte und spürte … nichts. Aber was hatte ich auch erwartet? Im Endeffekt waren nur meine Zehen noch kälter als zuvor.
Seufzend öffnete ich die Augen wieder und stutzte. Er war noch immer da. Der Himmelskörper fiel und sah dabei aus, als würde er näher kommen. Verblüfft setzte ich mich auf. Stroh rieselte aus meinen Haaren, als ich zu dem Loch krabbelte, das in der Wand klaffte wie ein Fenster. Heuballen waren darunter aufgestapelt, und ich kletterte an ihnen hoch, der kalten Nacht entgegen. Splitter bohrten sich in meine Finger, als ich mich an dem Bruch abstützte und nach draußen blickte.
Er fiel immer weiter. Ein Ball aus gleißendem Licht, der Schweif war so hell, dass ich mir einbildete, seine Hitze auf der Haut zu spüren, obwohl das unmöglich war. Der Stern verglühte nicht, sondern füllte mein gesamtes Blickfeld aus. Stürzte er gerade auf uns alle nieder? Mein Puls schnellte nach oben, aber nicht zwingend aus Angst. Es war ein unheimlich befriedigender Gedanke, im Licht eines Sternes zerschmettert zu werden, und wenn ich dazu die Götter schreien hörte, würde ich mit einem Lächeln auf den Lippen sterben. Die Dunkelheit in mir regte sich wie ein Biest, das witternd den Kopf hob. Ein heftiger Schauer überkam mich. Die kleinen Härchen in meinem Nacken stellten sich auf. Im nächsten Augenblick war ein Grollen zu hören, als käme die Erde in Bewegung. Ein heftiger Wind schlug mir entgegen. Ich riss den Kopf hoch und sah den Stern über die goldenen Spitzen der Dächer des Palastes fallen. Bei den Göttern, was ging hier vor sich?
Mein Herzschlag beschleunigte sich, er durchdrang mich, bis das Pochen meine Ohren erfüllte. Winzige Flammen huschten über meine Haut. Mein ganzer Körper fühlte sich an wie vom Blitz getroffen.
Der Stern war unerträglich hell. Sein Schein fraß sich in meine Augen, bis ich sie vor Schmerzen schließen musste.
Ein ohrenbetäubender Knall zerriss mir fast das Gehör. Ein heißer Windzug pustete mir die Haare aus dem Gesicht. Die Dunkelheit in mir knurrte. Beinahe schon aufgeregt, und ich spürte das Pulsieren unter der Haut, als dunkle Nebelfetzen hervorzuquellen drohten. Mit Gewalt drängte ich sie zurück und zwang meine Lider auf, um zu sehen, was das Monster in mir in Aufregung versetzte. Das Licht des Sterns war verloschen, nur noch der Mond und die Sterne am Himmel beleuchteten die Nacht. Hinter dem Dorf, tief im dunklen Wald, am Fuß der gläsernen Berge, kräuselte sich eine Rauchfahne empor. Ein Schwarm Vögel stieg wie dunkler Qualm von den Baumkronen des Waldes auf und flog aufgebracht in den Himmel. Die Welt war eindeutig nicht in Flammen aufgegangen, aber dennoch war etwas passiert. Als würde die Erde einen Seufzer ausstoßen, der in mir nachhallte wie ein Echo. Oder ein Ruf. Die Dunkelheit in mir brüllte zurück.
Gänsehaut fuhr über meinen gesamten Körper, und diesmal hatte sie nichts mit der Kälte zu tun.
Aus den Gebäuden erhoben sich aufgeregte Stimmen. Auf dem Schlosshof flammte das Licht von Fackeln auf, als Bedienstete und Soldaten nach draußen stürmten und über die vergoldeten Burgzinnen hinab in den Wald starrten, aus dem die Rauchfahne immer höher aufstieg. Mit klopfendem Herzen sprang ich auf. Stroh flog in alle Richtungen, während die fadenscheinige Decke ein reißendes Geräusch von sich gab. Fluchend schüttelte ich sie ab und kletterte die hölzerne Sprossenleiter nach unten in den Stall, in dem die Pferde unruhig schnaubten. Sie wirkten allesamt, als wollten sie Reißaus nehmen, wie sie mit den Hufen scharrten und gegen die Stalltüren traten.
Der große Rappe des Königs blähte die Nüstern und stieß ein Wiehern wie eine Warnung aus, als ich an ihm vorbeilief. Ihn zu beschützen, war meine wichtigste Aufgabe, aber zuerst musste ich wissen, was vor sich ging.
Die Stalltür stand weit offen. Als ich hinauslief, wurde ich prompt von ein paar Soldaten angerempelt und gegen den Pferdetrog gestoßen, sodass das eiskalte Wasser über meine ohnehin schon ausgekühlten Füße lief.
»Steh nicht im Weg, Smugaid«, blaffte mich einer von ihnen an und lief zu meinem Ärger nicht weiter, sondern verharrte.
Blaue Augen starrten abfällig auf mich herab, während blonde Haare auf breite, gut trainierte Schultern fielen. Hauptmann Lance. Der Anführer der Palastwache, von dem jeder wusste, dass er mehr wegen seines hübschen Gesichtes und weniger wegen seines Könnens befördert worden war. Seine Arbeit bestand im Grunde darin, mittags ohne Hemd auf dem Trainingsplatz zu stehen und Holzpuppen zu Kleinholz zu schlagen, während die Damen des Hofes ihn anstarrten und sich kichernd Schaumwein einflößten.
Im Grunde machte Lance mir keine Angst. Ich überragte ihn um einen knappen Kopf, und auch wenn meine dürre Statur optisch kaum mit den aufgepumpten und eingeölten Muskeln mithalten konnte, war ich um einiges wendiger als er und geübter mit Gegnern, die ein Eigenleben hatten. Doch es war dennoch keine gute Idee, es sich mit dem Hauptmann zu verscherzen. Er mochte nur eine Gefahr für Vogelscheuchen sein, doch er konnte einem das Leben im Palast zur absoluten Hölle machen, und eine persönliche Fehde mit dem Possenschönling des Hofes war das Letzte, was ich gebrauchen konnte.
»Entschuldigung«, presste ich heiser hervor und senkte den Kopf. Dennoch packte Lance mich am Arm und stieß mich nach hinten.
Mir blieb die Wahl, mich zu wehren oder in den Trog zu kippen. Meine Knie gaben nach. Innerlich wappnete ich mich, und dennoch schockte mich die Kälte, als das Wasser meinen Hosenboden durchweichte.
Lance packte meine Haare und starrte mit offensichtlicher Abscheu auf mich herab. »Das heißt Entschuldigung, Kommandant, und dann darfst du dich bei mir für das Bad bedanken. Bei den Göttern, du bist so dreckig, dass du das Wasser schwarz färbst und die Pferde es nicht mehr saufen können.«
Ich presste die Zähne zusammen. Wir wussten beide, warum ich so dreckig war. Weil ich die letzten Tage bei den Schweinen eingepfercht worden war. Von ihm persönlich. Als Strafe dafür, dass ich Essen aus der Küche in den Kerker geschmuggelt hatte. Die Soldaten mochten oder wollten es nicht hören, doch mich hatte das Schreien der Hungernden dort unten halb in den Wahnsinn getrieben. Einige Male war es gutgegangen. Dann hatte man mich erwischt.
In mir zuckte etwas Hässliches auf. Das Monster, das sich wie ein Wurm durch meine Gedärme fraß. Für einen kurzen Augenblick stellte ich mir vor, wie ich aus dem Wasser sprang, meine Finger in den blonden Haarschopf krallte und sein Gesicht so lange in den Trog drückte, bis seine Muskeln zuckten und er sich einpisste. Der Drang danach war so intensiv, dass es beinahe wehtat, einfach sitzen zu bleiben, während mir das Wasser blubbernd in die Hose lief. Er hatte recht. Es wurde schwarz und stank, weil ich stank. Doch keines der Mädchen hätte mich in diesem Zustand in eines der öffentlichen Bäder gelassen, die den Angestellten zur Verfügung standen, und für den See am Ende des Schlossparks war es zu kalt.
»Hast du deine Zunge verschluckt?«, knurrte Lance mich an. »Oder brauchst du noch zwei Tage bei den Schweinen? Sie vermissen dich schon.«
Er riss an meinen Haaren, bis ich gepresst hervorstieß: »Es tut mir leid, dass ich Euch im Weg stand, Kommandant. Es wird nicht wieder vorkommen.«
Lance hob einen Mundwinkel, vielleicht sollte es ein Lächeln sein, doch die Gräuel darin übertünchten alles. »Bedank dich für das Bad, Smugaid.« Seine Augen erinnerten mich an Splitter aus Eis, die sich in mein Innerstes bohrten: kalt, präzise und genau dort, wo es wehtat.
Ich erinnerte mich noch, als er vor drei Jahren an den Hof gekommen war und ich mir dachte, dass ich selten so warme, freundliche Augen gesehen hatte. Doch der Palast brachte in jedem von uns das Schlimmste hervor.
»Danke für das Bad, Sir.«
»Na also, geht doch.« Lance ließ mich so unerwartet los, dass ich noch tiefer in den Wassertrog sank. Die Kälte war inzwischen so durchdringend, dass es schmerzte. Lance wischte sich angewidert die Hände an seiner blauen Uniform ab, ehe er ein paar braune Handschuhe überstreifte. Ich wagte es nicht, aus dem Trog zu klettern, solange er vor mir stand.
»Hast du zufällig gesehen, was vom Himmel gefallen ist?«, erkundigte er sich und blickte über den Hof, in dem sich immer mehr Soldaten einfanden.
»Es sah aus wie …«, begann ich, als ruckartig die großen Türen zum Hauptgebäude des Palastes aufgerissen wurden. Lance’ Augen weiteten sich, während er sich wie alle anderen Soldaten straffte.
Wir alle spürten es, wenn sie kamen. Die Königsfamilie. Die Götter auf Erden.
Als würden sie allein mit ihrer Präsenz sämtliche Luft aus der Umgebung ziehen. Jegliche Aufmerksamkeit richtete sich auf sie. Wenn sie kamen, schien die Sonne heller, die Vögel sangen schöner, und man kämpfte gegen den sofortigen Drang an, vor ihnen auf die Knie zu sinken und ihnen Leib und Leben anzubieten, nur für ein Lächeln.
Die Götter waren Raubtiere, die ihre Opfer mit Schönheit anlockten, und jeder, der ihnen zu nahe kam, starb glücklich. Wenn sie den Leuten die Haut abzogen, sah man das Lächeln selbst auf den zurückgelassenen Schädeln.
Genauso war es auch in diesem Augenblick, als die Schwester des Königs den Hof betrat. Das goldene Haar, das wirkte, als hätte sich Sonnenlicht selbst zu Strähnen verwoben, wehte hinter ihr her. Mitten in der Nacht schien das Mondlicht heller zu scheinen, nur damit sie in der Dunkelheit nicht stolperte. Die schimmernden Röcke ihres ausladenden blauen Kleides wischten über den Boden, während der Schwarm von Vögeln, der sie immer umgab, um sie herumflatterte. Mir war schon aufgefallen, dass die Art je nach Tageszeit variierte. Jetzt, bei Nacht, flogen Nachtigallen um ihr Haar.
»Ihre Königliche Hoheit betritt den Hof, tretet zur Seite!«, bellte Lance, und die Angestellten und Soldaten setzten sich in Bewegung. Sie öffneten eine Schneise, während der Hauptmann endlich von mir abließ und auf die Schwester des Königs zueilte. Zitternd stemmte ich mich aus dem Wassertrog und zog mich so tief in den Schatten der Stalltür zurück, dass ich förmlich verschwand.
Lance’ Muskeln bewegten sich geschmeidig, als er sich tief vor ihr verbeugte, während sie ihn mit funkelnden Augen anblickte.
»Was kann ich für Euch tun, Comtessa? Stimmt etwas nicht?«
»O Lance.« Die Wimpern der Comtessa zitterten vor Aufregung, als sie über den Hof blickte. Die goldenen Zinnen schirmten den Blick nach draußen ab, und dennoch war im Mondschein die Rauchwolke zu sehen, die in den Himmel stieg. »Ich habe es gespürt.«
Lance runzelte die Stirn. »Comtessa?«
»Den Stern«, hauchte sie und legte den Kopf in den Nacken, als würde sie lauschen, was am Nachthimmel vor sich ging. Sie stieß ein leises, seltsames Summen aus und bewegte sich rhythmisch, als würde sie zu einer Melodie tanzen, die nur sie selbst hören konnte. »Ich habe gespürt, wie der Stern gefallen ist. Er war so schön, so funkelnd, so perfekt …«
Sie wirbelte herum und starrte den Hauptmann an.
»Bring ihn mir! Ich wünsche, den Stern zu sehen.«
»Ich …« Lance blinzelte, und man merkte ihm die Überforderung eindeutig an. »Hoheit, ich weiß nicht, ob …«
Sie unterbrach ihn mit dem scharfen Klicken ihrer Zunge. »Du musst nichts wissen, nur handeln. Hol mir den Stern. Wenn er schön ist, werde ich ihn dem König zum Fest des Ersten Schnees schenken.« Sie legte den Kopf schief und murmelte wie zu sich selbst: »Oder wenn er ganz und gar wundervoll ist, behalte ich ihn und schenke meinem Bruder diesen lächerlichen Brieföffner. Wir werden sehen.«
Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Du hast drei Tage Zeit, ihn mir zu bringen, Lance. Ich zähle auf dich persönlich, mein Lieber.«
»Drei Tage?« Der Hauptmann sah sich panisch um und schien zu überlegen, wie er die gesamte Strecke durch den dunklen Wald in so kurzer Zeit schaffen sollte. Selbst Menschen, die wussten, was sie taten, konnten über eine Woche benötigen, nur um ins nächste Dorf am Rand des Waldes zu kommen. Dieser Wald war kein Ort, an dem man sich leicht zurechtfand. Schon gar nicht, wenn man einen ominösen Stern finden musste, der überall und nirgends sein konnte.
»Ich kann doch nicht …«, setzte er an und überlegte es sich sofort anders, denn er lenkte ein. »Ich werde jemanden brauchen, der meine Männer durch den Wald führen kann, Hoheit.«
Sie neigte den Kopf, und auch wenn sie lächelte, wirkte sie gereizt. Die Nachtigallen schwirrten schneller um ihr Haar herum. Instinktiv zog ich mich tiefer in den Schatten zurück, doch sie bemerkte mich. Kein Schatten, in den ich mich hüllte, schien jemals dunkel genug für ihren Blick zu sein.
Ihre Augen leuchteten auf, während sie schnippte. »Smugaid!«
Ich wünschte, sie würde meinen Namen genauso vergessen wie die der anderen Diener. Doch leider wussten sie alle, wer ich war, gleichgültig, wie sehr ich mich zu verstecken versuchte. Ich nahm an, das kam davon, ein königlicher Bastard zu sein.
»Komm her, Smugaid.«
Verflucht. Ich zwang meine Muskeln, sich zu bewegen, trat aus dem Vorsprung und neigte vor der Comtessa den Kopf. Meine Haut brannte bei der Erinnerung an die Verletzungen, nachdem ich einmal etwas nicht zu ihrer Zufriedenheit ausgeführt hatte.
»Hoheit«, murmelte ich und sah aus dem Augenwinkel, wie sie die zierliche Nase rümpfte, als sie die schmutzige Wasserlache entdeckte, die sich unter mir sammelte. Im Prinzip war mir ihre offene Missgunst lieber als die Gewalt hinter den Türen, wenn niemand hinsah. Beide Male blieben Narben zurück, doch die einen heilten deutlich besser als die anderen.
»Warum ist er so nass?«, fragte sie, und ich kam mir wie eine halb ertränkte Katze vor.
»Er wollte ein Bad nehmen«, höhnte Lance.
Ich biss die Zähne zusammen.
»Verstehe, aber vielleicht sollte es etwas gründlicher ausfallen.« Die Comtessa zückte ein Taschentuch und drückte es sich vor die Nase. »Smugaid, es heißt, du würdest den Wald besser kennen als jeder Jäger im Dorf, stimmt das?«
»Ich kenne den Wald«, rang ich mich durch, ihr zuzustimmen, während ich gleichzeitig gegen den Drang ankämpfte, vor ihr auf die Knie zu sinken und ihre Füße zu küssen. Der Drang war so allumfassend, dass ich kaum atmen konnte. Ich hasste es, wenn sie das tat. Die Dunkelheit in mir ebenfalls.
»Sehr gut. Dann nimm den Schmutzburschen mit, Lance. Er weiß, was im Wald zu tun ist. Ihr habt drei Tage. Enttäuscht mich nicht.« Ihre Augen leuchteten begehrlich auf, als sie in Richtung des Waldes blickte. »Ich kann es kaum erwarten, meinen Stern in Händen zu halten.«
Lance verzog das Gesicht, doch er neigte den Kopf. »Ich werde ihn Euch bringen, Comtessa. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.«
Doch der Blick, den er mir dabei zuwarf, machte deutlich, dass es vermutlich das Letzte war, was ich jemals tun würde, wenn wir den Stern nicht fanden.
Kapitel 2
Rain
Als die Jäger das Mädchen anfassten, erwachte es voll Schrecken und rief ihnen zu: »Ich bin ein armes Kind, von Vater und Mutter verlassen, erbarmt euch mein und nehmt mich mit!«
Aus »Allerleirauh«Gebrüder Grimm
»Der Wunsch wurde ausgesprochen. Der Wunsch wurde gewährt. Das Rad des Schicksals dreht sich zurück …«
Und dann?
Dann hörte die Welt für einen Atemzug auf zu existieren.
Von einem Augenblick auf den nächsten war alles einfach weg. Es gab keine anderen Worte, mit denen ich dieses Gefühl beschreiben konnte, diese völlige Abwesenheit von allem.
In der einen Sekunde stand ich vor Rumpelstilzchen, den Spiegel so fest umklammernd, dass sich dessen Kanten schmerzhaft in meine Haut gruben, die reglosen Körper meiner Freunde am Boden wie Marionetten, denen man die Fäden durchschnitten hatte, Rumpelstilzchen vor mir, das Gesicht zu einer wilden Fratze aus Wahnsinn und Wut verzerrt. Erstarrt, als wäre die Zeit eingefroren.
In der nächsten verschwand alles.
Erst Rumpelstilzchen, dann meine Freunde: Holly, Adrien, Avery und Night, das Abbild von mir selbst. Schließlich Black … Und dann auch Cole. Sie wurden schwarz wie Schatten, ehe sie in dunklem Rauch in sich zusammenfielen. Die Decke sowie die Wände schwärzten sich, verschwanden, als wäre Materie nichts weiter als eine Illusion. Der Boden tat sich auf, und ich fiel in ein endloses Nichts hinab.
Ein Schrei blieb mir in der Kehle stecken. Ich versuchte, nach etwas zu greifen, irgendetwas, doch es gab nichts, woran ich mich festhalten konnte. Da war nur das tiefe, dunkle Nichts um mich herum, in das ich fiel wie Alice ins Wunderland.
Jeder Laut schien auf meinen Lippen zu sterben, als ich immer schneller und schneller fiel. Lichter blitzten auf, doch sie waren so flüchtig, dass ich nicht sagen konnte, ob es sich dabei um echte Objekte, Fragmente meiner Erinnerungen oder etwas völlig anderes handelte.
Der Spiegel in meiner Hand vibrierte, wurde hell und glühend heiß. Doch anstatt das verfluchte Ding fallen zu lassen, wie es mir meine Instinkte zuriefen, packte ich ihn fester, obwohl es sich anfühlte, als würde er mir das Fleisch von den Knochen brennen.
Tränen füllten meine Augen, tropften von meinen Wangen wie schimmernde Perlen, die sich im Nichts verloren.
Ich drehte mich um mich selbst. Schneller und immer schneller, während der Spiegel aufleuchtete und meine Haut in einen hellen Schein tauchte.
Ich fiel noch immer, doch plötzlich änderte sich etwas. Ich bemerkte es, als wieder genug Luft in meine Lunge strömte und endlich der Schrei hervorbrach, der sich in meiner Brust aufgestaut hatte.
Der gellende Klang hallte in meinen Ohren nach. Die Schwärze veränderte sich, und das Nichts wich einem dunklen Himmel voller Sterne. Innerhalb eines Wimpernschlages schälte sich eine Landschaft unter mir hervor.
Die zuckenden Lichter ballten sich zu kleinen Punkten zusammen … wie eine Ansammlung von Häusern. Etwas Großes stach hervor. Weitläufig und golden, beinahe wie ein überdimensionaler Vogelkäfig. War das … ein Schloss? Bevor ich es genauer identifizieren konnte, schoss ich daran vorbei. Ich schrie so inbrünstig, dass die kleinen Äderchen in meiner Lunge platzten und der Geschmack von Blut sich auf meine Zunge legte. Ein heftiger Windstoß fegte mir die Haare ins Gesicht, und erst als der nächste Windzug sie wieder zur Seite wehte, konnte ich den Boden sehen.
Ich schoss genau darauf zu. Ich war im Begriff, ungebremst aus dem Himmel zu stürzen, und es gab verflucht noch mal nichts, was ich dagegen tun konnte.
Irgendwie hatte ich mir die Sache mit dem Wunsch anders vorgestellt. Auf dem Boden zu zerplatzen wie eine überreife Frucht, hatte nicht zum Plan gehört.
Vor mir breitete sich ein Meer aus Bäumen aus. Bis an den Horizont erstreckten sich die Wipfel, und ich kniff die Augen zusammen, als ich genau mittendurch krachte. Äste und Zweige zerrten an mir. Meine Schulter knallte so schmerzhaft gegen irgendetwas Hartes, dass ich fürchtete, mir würde der Arm abgeschlagen werden. Ein reißendes Geräusch war zu hören, aber es war nur mein Kleid, das sich verfing. Schreiend wedelte ich mit den Armen, als könnte ich so meinen Sturz abfangen, doch es gab nichts, was ich tun konnte. Ein Fluch entkam mir, und in der nächsten Sekunde knallte ich auf den Boden. Die Wucht war so heftig, dass sie meinen gesamten Körper zerschmetterte. Der Boden gab unter mir nach, Erde spritzte zur Seite, als ich einen regelrechten Krater in den Boden riss. Bäume knickten um und fielen krachend zu Boden. Ein schwarzer Vogel erhob sich mit lautem Krächzen. Mein Kopf fühlte sich an wie in der Mitte gespalten. Ein Stöhnen entkam mir, während meine Haut immer heller leuchtete, als wäre ich ein verdammter Stern, der gerade vom Himmel gefallen war.
Ich spürte den Spiegel in meiner Hand vibrieren. Er war aufgeladen wie ein Kernreaktor, der meine Haare zu Berge stehen ließ. Ein Windzug fuhr durch meine Haare wie Finger, die mich berührten, und eine Stimme flüsterte mir ins Ohr.
»Der Wunsch wurde ausgesprochen. Der Wunsch wurde gewährt. Das Rad des Schicksals hat sich zurückgedreht. Der Anfang hat nun kein Ende und das Ende noch keinen Anfang …«
Super!
Toll!
In diesem Augenblick musste ich mich entscheiden, den Spiegel anzuschreien oder einmal kurz und heftig ohnmächtig zu werden. Damit mir niemand vorwerfen konnte, es nicht zumindest versucht zu haben, wurde ich mitten im Fluchen ohnmächtig.
»Verdammtes Miststü…«
Zack, und weg war ich.
Kapitel 3
Smugaid
»Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich die Treppe hinab.«
Aus »Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen«Gebrüder Grimm
Die Straße aus dem Dorf zog sich wie ein gewundenes Band aus hellem Sandstein durch Wiesen und Felder, die in den Sommertagen überwiegend in einem satten Grün erstrahlten. Die Wildblumen wie Farbspritzer, die eine Künstlerin hinterlassen hatte, während immer wieder Felder von goldglänzendem Weizen die Wiesen unterbrachen, auf denen das Vieh friedlich graste.
In den anbrechenden Winternächten jedoch wirkte es, als würde das Mondlicht jegliche Farbe herauswaschen. Die Wiesen wurden grau, der Weg wirkte wie ein Sumpf aus schwarzem Morast. Die Kälte nahm sich, was der Tag geboren hatte, und raubte das Leben aus den Knochen. Überall lagen kleine erfrorene Tiere am Wegesrand, als hätte sich die Kälte ihr Leben so plötzlich gekrallt, dass sie an Ort und Stelle umgefallen waren. Und es wurde schlimmer, je näher man dem Wald kam. Es war schon vorgekommen, dass die graue Kälte, die die Götter über die Welt brachten, nur wenige Tage oder Wochen anhielt. Doch genauso konnten es Jahre sein, wenn sie schlichtweg vergaßen, es zu verändern. Das Wetter und die Natur waren den Launen der königlichen Familie genauso unterworfen wie die Menschen, die hier lebten.
Als ich stehen blieb, kondensierte mein Atem zu weißen Wolken, und ich starrte auf die Grenze, die die schwarzen Eichen bildeten.
Der Weg lag vor uns wie der Schlund eines Ungeheuers. Die von dichtem Nebel umspülten Stämme der Bäume wirkten wie in ein gräuliches Blau getaucht, knorrige, in sich verzerrte Äste ragten daraus empor.
»Bei den Göttern, man sollte diesen verdammten Forst einfach abbrennen«, fluchte Lance neben mir. Sein Pferd scheute, genau wie die Tiere der anderen. Die Männer hatten Mühe, sie zu kontrollieren und von der Flucht abzuhalten. Ein halbes Dutzend Soldaten, die er mitschleppen musste, obwohl ich ihn mehrfach darauf hingewiesen hatte, dass so viele Männer und Pferde zu laut waren, um in den Wald zu gehen. Die Rauchwolke war noch immer zu sehen und gab uns eine vage Richtung vor. Sie verriet, dass wir sehr viel tiefer in den Wald vordringen mussten, als die meisten jemals gegangen waren. Selbst ich wagte mich nicht oft so weit hinein. Die drei Tage, die die Comtessa uns gegeben hatte, würden kaum ausreichen. Nur wenn wir die Nacht über durchmarschierten, war es womöglich zu schaffen. Doch mit einem Pulk von Soldaten, die lautstark alles niedertrampelten, würde es … schwierig werden.
»Ihr solltet die Pferde zurücklassen«, hörte ich mich selbst sagen, während ich die schwarze Kapuze des Wollmantels nach unten zog. Er roch nach Pferdeschweiß, und ich war mir beinahe sicher, dass er einem toten Soldaten gehört hatte. Trotzdem war meine Kleidung in einem besseren Zustand als alles, was ich im letzten Jahr besessen hatte. »Sie sind zu laut, und die meisten werden durchgehen und dann vom Wald verschlungen werden. Es sind gute Tiere. Wir sollten sie nicht unnötig in Gefahr bringen.«
Lance stieß ein Schnauben aus. »Zu Fuß brauchen wir viel zu lang. Die Pferde tun das, wofür sie da sind. Uns tragen.«
»Um zum Stern zu gelangen, müssen wir den Weg verlassen. Uns durch dichte Dornensträucher zwängen. Die Pferde werden nicht durchkommen. Sie werden dort sterben«, versuchte ich, an Lance zu appellieren, doch er warf mir nur einen Blick zu, der in mir den Drang weckte, sein dummes Gesicht zu brechen. Jeden Knochen einzeln.
»Wenn es so weit ist, können wir die Pferde zurücklassen. Solange werden wir keine weitere Zeit verschwenden.« Er schnalzte mit der Zunge und ritt auf die Waldgrenze zu.
Die Männer folgten ihm, ihre Gespräche und ihr Lachen viel zu laut und ihre vielen Fackeln zu hell. Doch sie hatten beschlossen, all meine Warnungen zu ignorieren, und mir blieb nichts anderes übrig, als es hinzunehmen. Mit einem unruhigen Gefühl im Bauch schlang ich die Proviant- und Ausrüstungsbeutel enger um meine Schultern, überprüfte, ob meine drei Dolche griffbereit am Gürtel hingen, und stülpte mir wieder die Kapuze über den Kopf, ehe ich der Gruppe in schnellem Gang folgte.
Als die Soldaten sich den ersten Bäumen näherten, zogen sich Nebelschwaden wie zischende Schlangen zusammen. Der Schein der Fackeln beleuchtete die verzogene, runzlige Rinde, sodass es beinahe wirkte, als würden uns verknorrte Gesichter anstarren. Hätten wir den Pfad bei Tageslicht genommen, hätte es vielleicht genügt, eine Opfergabe wie eine Goldmünze dazulassen, um die Wesen des Waldes so weit abzulenken, dass wir passieren konnten. Doch nachts sah die Sache anders aus. Und sobald wir den Weg verließen, würde uns kein Opfer der Welt mehr helfen.
Zwei gigantische Wächterbäume, die älter als die Götter selbst sein mussten, standen links und rechts vom Weg und spannten ihre Äste über uns zusammen. Die Zweige waren so stark miteinander verwachsen, dass sie einen Tunnel bildeten. Der Nebel auf dem Weg war nur eine helle Schicht, aus der sich Finger bildeten, die behutsam nach warmem Fleisch tasteten und unter den Stiefeln der Soldaten zerstoben. Doch links und rechts des Weges wurden die Nebel so dicht, dass man schon nach wenigen Schritten darin verschwinden würde. So unauffällig wie möglich schnitt ich mir mit meinem schmalen Dolch in die Handfläche und ließ eine Münze mit ein paar Blutstropfen auf den Wegrand fallen, als ich die Grenze hinter den Soldaten passierte. Ich besaß kaum Geld, doch das wenige, das ich fand oder stahl, versteckte ich genau für solche Augenblicke. Wenn der Boden das Gold nicht wollte, würde ihn das Blutopfer hoffentlich friedlich stimmen.
Die rot verschmierte Münze gab ein leises Geräusch von sich, als sie aufsprang. Sie kullerte einige Meter über den Boden, ehe sie liegen blieb. Wie ein Fleck gefallenen Mondlichts auf dem grauen Pfad.
»Smugaid! Hör auf zu trödeln, du bist hier, um den Weg zu finden und nicht Löcher in die Luft zu starren!«, rief Lance mir zu.
Ich zuckte zusammen und wünschte mir inständig, er würde die Klappe halten. Eilig lief ich nach vorne, während ich gleichzeitig nervös den Blick schweifen ließ, und als ich mich umdrehte, war der Nebel hinter mir zusammengeklappt wie eine Tür, die sich ruckartig schloss. Das Tor, das die beiden Wächterbäume bildeten, war nur noch ein vager Schatten. Die Münze war bereits vom hungrigen Boden verschlungen worden. Ich beschleunigte meine Schritte und holte zum Hauptmann auf. »Seid um Himmels willen still. Wir müssen den Wald nicht jetzt schon gegen uns aufbringen.«
Der Tritt kam hart, aber nicht unerwartet. Die Sohle von Lance’ Stiefel schleuderte mich zu Boden. Der Nebel stob aufgeregt davon, als ich in den Dreck krachte und mir dabei auf die Zunge biss. Blut füllte meinen Mund.
»Sag mir nicht, was zu tun ist, Schmutzfleck. Das hier ist meine Mission. Ich entscheide, was getan werden muss, und du bist hier nichts weiter als der Köter, der den Weg erschnüffelt. Haben wir uns verstanden?«
Ausspuckend blickte ich auf. Zwei Soldaten ragten mit Fackeln neben Lance auf seinem Pferd auf. Ihre Gesichter flackerten wie verzerrte Masken über mir.
»Ja, Sir«, brachte ich hervor.
»Gut.« Lance lehnte sich zurück und zog seinen Harnisch straff. »Geh vor. Wir folgen.«
Meine Schulter pochte. Ein Schwall Blut trat aus der frischen Wunde aus, doch ich hatte Schlimmeres überlebt.
Ich rappelte mich auf und schüttelte den Kopf, als einer der Soldaten mir eine Fackel geben wollte. Noch befanden wir uns auf dem Weg. Wenn wir Glück hatten und uns ab jetzt ruhig verhielten, ließ das Interesse des Waldes nach. Wenn wir noch mehr Glück hatten, war der Stern nur wenige Meter abseits des Weges gefallen, und wir konnten zurück, bevor Schlimmeres passierte.
Die Frage war nur: Wie sah ein Stern aus?
Ich stellte mir einen schimmernden Klumpen vor, ähnlich einem Stein aus Gold, der hier irgendwo lag. Vielleicht war er aber auch längst verglüht? Was würde die Comtessa tun, wenn wir mit nichts als Asche und Staub zurückkämen? Ein kalter Schauer rieselte mir über den Rücken. Ich wollte es mir gar nicht ausmalen. Wir mussten etwas finden, oder es wäre gnädiger, vom Wald niedergestreckt zu werden.
So hätte unser Tod zumindest den Sinn, dass sich die wilden Tiere an uns satt fressen konnten.
Die Unterhaltungen der Soldaten wurden leiser, je länger wir gingen. Ihr Lachen war verstummt, ihre murmelnden Stimmen nur noch unterbrochen vom Schnauben der Pferde und dem Klirren der Schwerter, als wir an der ersten Kreuzung ankamen.
Ein krummes Holzschild wies die näheren Ziele aus. Eine einzelne Laterne stand dort und warf zitterndes blaues Licht auf die Inschrift. Die Buchstaben waren jedoch schon so verwittert und von Efeu überwuchert, dass sie nur schwer zu entziffern waren.
»Was steht da?«, fragte mich Lance, und ich ersparte es mir, ihn zu fragen, ob er es nicht lesen konnte oder wollte. Zumindest wurde klar, dass der Hauptmann nie mehr als wenige Schritte in den Wald gesetzt hatte.
»Der linke Weg führt tiefer in den Wald hinein zum Aschenweiher und den Nachtklaff-Wasserfällen. Der rechte zur alten Windmühle.«
»In welche Richtung müssen wir gehen?«, fragte Lance, als würde ich ihn mit unnötigem Geschwätz aufhalten.
Prüfend blickte ich nach oben. Der Rauch hatte sich unlängst verzogen, doch ich erinnerte mich an die Richtung, in der der Stern gefallen war.
Mir drehte sich fast der Magen um, als ich nach rechts deutete. »Wir müssen in Richtung Mühle. Der Weg wird uns zunächst ein Stück aus dem Wald hinausführen und dann wieder tiefer hinein. Die Mühle liegt im Wald, der Weg endet da. Ab dort müssten wir uns durch das Dickicht schlagen. Das können wir jedoch nicht nachts tun. Ich schlage vor, dort unser Lager aufzuschlagen und tagsüber weiterzugehen.«
Falls wir bis dahin überleben, fügte ich im Stillen hinzu und nahm an, die meisten Soldaten dachten dasselbe. In ihren bangen Gesichtern stand deutlich geschrieben, dass sie diesen nächtlichen Ausflug schon jetzt bereuten.
Nun, bis auf Lance, dieser sah mich an, als wollte er mich wieder treten. »Ich entscheide, was wir tun oder wo wir unser Lager aufschlagen«, schnarrte er, schnalzte mit der Zunge und trieb das Pferd in Richtung der Windmühle.
Der Nebel schlang sich um seine Schultern, die bald aus unserer Sicht verschwanden. Ich folgte ihm, und schon nach wenigen Schritten war das schwache Licht der Kreuzung verschwunden. Das Gemurmel der Männer füllte den geringen Raum zwischen den dicht stehenden Baumstämmen und machte es unmöglich, Geräusche von sich nähernden Wesen zu hören, die uns möglicherweise folgten. Als der Weg vor uns eine Biegung machte, uns aus dem Wald führte und sich ein Weizenfeld und der Nachthimmel vor uns aufspannten, atmete ich erleichtert aus. In der Ferne war eine Ansammlung von Bauernhäusern zu erkennen, deren Fenster von Kerzenlicht erhellt wurden. Es war mutig von den Bauern, so nahe am Wald zu leben. Oder sehr dumm.
Als ich ein Fluchen hörte, verging mein Optimismus genauso schnell, wie er gekommen war.
»Was soll das denn sein?« Lance war stehen geblieben und blickte angeekelt in das Weizenfeld, das nicht abgeerntet war. Sein Pferd schnaubte unruhig, als ich näherkam. Die Pflanzen waren allesamt verschimmelt, die Köpfe hingen eingebrochen und vertrocknet hinab, sodass jeder Windzug Geräusche verursachte wie das Knacken winziger Knochen.
Am Wegesrand waren Silhouetten zu sehen, im ersten Augenblick wirkten sie beinahe wie Menschen, die Wache hielten und zum Wald starrten. Doch als ich zu Lance aufschloss, erkannte ich die Vogelscheuchen. Ein halbes Dutzend von ihnen säumte die Straße. Körper aus knorrigen Ästen, über die man zerschlissene Kleider drapiert hatte. Die Köpfe waren von Tieren. Manche wirkten frisch. Blut tropfte noch hinab, die Schnittstelle am Nacken glatt durchtrennt und auf die Schultern der Vogelscheuchen genagelt. Andere sahen aus, als würden sie schon länger dort hängen. Und rochen auch so. Der süßliche, scharfe Geruch von Verwesung schlug mir entgegen und löste einen Würgereflex aus.
Die Vogelscheuche vor Lance trug den Kopf eines Stieres. Die Hörner des mächtigen Tieres ragten nach oben. Die Nüstern sahen blutverkrustet aus. Ein Geräusch war zu hören, sehr leise, wie ein Klicken oder Kratzen, und als Lance die Fackel anhob, um besser sehen zu können, zeigten sich Hunderte von Maden, die sich in die eingefallenen Augenhöhlen wühlten.
Ein paar der Soldaten stießen würgende Geräusche aus. Die Dunkelheit in mir drängte gegen meine Haut. Aufmerksam. Hungrig. Aufgeregt von dem Opfer vor uns. Ich schüttelte sie ab.
»Was zur Hölle soll das sein?«, schnarrte Lance und starrte mich an, als hätte ich die Vogelscheuchen persönlich zu verantworten.
Beschwichtigend hob ich die Hände. »Keine Sorge. Es sind bloß Wächter.«
»Was für Wächter, Schmutzfleck?«
Ich deutete zu den Häusern. »Ein alter Brauch. Bauern, die nahe am Wald leben, bringen dem Wald ein Opfer dar. Sie schlachten einmal im Monat ein Tier, werfen den Kadaver hinein und hängen die Köpfe hier auf als Beweis, dass sie ihr Opfer erbracht haben. Das Jahr ist bald zu Ende. Es müssten zwölf Wächter hier stehen. Zur Sonnenwende werden die Überreste verbrannt.«
»Das ist ja widerlich.«
»Außerhalb des Palastes und des Dorfes sieht die Welt nicht rosig aus. Die Menschen hier tun nur das, was sie müssen, um möglichst in Frieden zu leben«, erklärte ich und neigte den Kopf. »Ihr kommt ursprünglich von der Meerenge, oder, Hauptmann? Ist es dort anders? Das kann ich mir nur schwer vorstellen.«
Lance ließ sein Pferd schaudernd zurücktreten. »Die Menschen in Meerbrück stehen im Licht und Glanz der Götter«, presste er hervor. »Wir sind Seefahrer, keine Barbaren.« Er nickte einem seiner Männer zu. »Reportiert das Ganze später dem Palast. Die Bauern hier unterschlagen eindeutig Abgaben und beten zu fremden Götzen. Brennt dieses verfluchte Feld nieder.«
»Abbrennen?«, fragte ich ungläubig, doch da neigte der Soldat bereits den Kopf.
»Sehr wohl, Hauptmann.«
In der nächsten Sekunde war ein Zischen zu hören, als die Männer erst das schimmelnde Korn in Brand steckten, danach die Kadaver der Vogelscheuchen. Sie fingen so schnell Feuer, als hätte man sie zuvor mit Petroleum übergossen. Ein stechender Geruch stieg in die Luft.
»Hauptmann, hört auf damit! Es ist mitten in der Nacht. Was, wenn das Feuer die Häuser erreicht? Es werden Frauen dort sein und Kinder. Wir müssen sie …«
»Die Bauern werden die Konsequenzen tragen, wenn sie alte Götzen anbeten«, blaffte Lance mich an, und ich sah mit Grauen zu, wie die Soldaten Fackeln in das Feld warfen. Lance steckte die Vogelscheuche mit dem Kopf des Stieres in Brand, die Kleidung fing sofort Feuer, und die Flammen fraßen sich über das Fleisch. Die Hitze schlug mir ins Gesicht, und der Gestank von verbrennendem Fell überdeckte den der Verwesung.
Die Soldaten wirkten blass, ein paar sahen aus, als wollten sie am liebsten türmen, würde das nicht bedeuten, dass ihre Köpfe als Nächstes auf einem Spieß stecken würden. Das Wiehern der Pferde mischte sich in ihr unruhiges Murmeln. Eine Gänsehaut zog sich über meinen Rücken, als Lance hart befahl, weiterzugehen.
Übelkeit drehte mir fast den Magen um, als mein Blick zum Gehöft in der Ferne schwenkte. Es gab nichts, was ich tun konnte. Sie waren zu weit weg, um sie zu warnen, und Lance würde mir die Hände abschneiden, wenn ich mich von der Gruppe entfernte. Ich hoffte nur, die Bauern würden das Feuer löschen können, bevor es die Häuser erreichte und alles in Schutt und Asche legte.
Die Hitze des brennenden Feldes wurde immer unangenehmer, und der Rauch kratzte in der Lunge, als ich mich zum Weitergehen zwang. Mir war, als würde ich einen Schrei hören, der sich durch das Feld auf uns zubewegte. Ich hoffte inständig, die Bauern kämen mit dem Leben davon. Vor mir konnte ich den breiten Rücken von Lance sehen, der hoch aufgerichtet auf seinem Ross saß und dem Weg folgte, welcher nach einer weiteren Biegung wieder im Wald verschwand, der noch dunkler aussah als zuvor. Der Nebel schlug um uns zusammen und verschluckte jedes weitere Geräusch. Die Soldaten waren uns dichtauf gefolgt. Ich betete inbrünstig, dass sie so schlau waren, nicht vom Weg abzukommen. Männer, die in den umliegenden Dörfern aufgewachsen waren, wussten, was zu tun war, doch zusammen mit Hauptmann Lance war ein ganzes Bataillon von jenseits der Grenze gekommen, und genau diese Soldaten verursachten gerne Probleme. Als würden die Regeln, die hier jedes Kind erlernte, wenn es am Leben bleiben wollte, für sie nicht gelten. Manchmal kam es mir so vor, als müsste die Welt hinter dem Blutsteinpass eine völlig andere sein. Die Götter, so hieß es, waren dort mehr ein obskurer Glaube als Realität, und jeder schien zu denken, die Welt sei ein friedlicher Ort. Ich fragte mich, ob die Menschen in Meerbrück keine Angst hatten, im Wald von schwarzen Wölfen zerrissen zu werden. Zumindest wirkten Lance und seine Männer, als hätten sie nicht einen Funken Selbsterhaltungstrieb in sich. Ich konnte mir das nur damit erklären, dass sie die Angst der Menschen tatsächlich für nicht mehr als ketzerischen Aberglauben gegen die Götter hielten. Vor mir blieb Lance’ Pferd plötzlich stehen. Ich blickte nach links, tiefer in die Schatten, in denen sich der Nebel kräuselte, und hatte das drängende Gefühl, als würde uns etwas beobachten.
Zwei schimmernd gelbe Augen, die uns hungrig fixierten. Ich blinzelte, und die Augen verschwanden, doch meine Gänsehaut breitete sich aus. Wir hatten eindeutig etwas auf uns aufmerksam gemacht.
Lance’ Pferd trat rückwärts, was diesen wütend fluchen ließ. »Hör auf, Mayimus«, brüllte er und gab dem Tier die Sporen, sodass es plötzlich nach vorne preschte, jedoch nicht den Pfad entlang, sondern mitten in den Wald hinein.
»Kommandant!« Unruhige Bewegung kam in die Soldaten. Die Pferde scheuten. Ein Soldat wurde prompt aus dem Sattel gehoben, flog im hohen Bogen durch die Luft und klatschte gegen einen Baum. Ein weiterer wurde abgeworfen, verfing sich jedoch mit dem Fuß im Steigbügel. Das Pferd schleifte ihn panisch über den Waldboden, bis sie beide verschwanden. Ein anderer spannte hektisch einen Pfeil in seine Armbrust, doch als sein Pferd einen Sprung machte, löste sich der Schuss ohne Vorwarnung. Instinktiv wich ich zur Seite aus, doch der Pfeil zischte so haarscharf an mir vorbei, dass ich einen kurzen Schmerz an der Wange fühlte. Der Pfeil blieb in einem Baumstamm stecken, und die Federn zitterten, als wollten sie noch immer flüchten vor dem, was im Nebel lauerte.
Doch es war zu spät. Aus den Schatten schnellte etwas hervor. Es war so flink, dass man nur zwei knochige Hände sah, die mit spitzen, scharfen Nägeln einen am Boden liegenden Soldaten packten und ruckartig in den Nebel zogen. Sein schriller Schrei hallte durch den Wald und wurde jäh von einem nassen Gurgeln und einem schmatzenden Geräusch unterbrochen. In der nächsten Sekunde leuchteten weitere Augenpaare auf. Eins, zwei, drei, ein halbes Dutzend. Und mit einem Schlag wurde der nächste Mann zwischen die Bäume gerissen. Und noch einer.
Auch wenn ich vermutet hatte, dass es zu diesem Massaker kommen würde, so war es noch unheimlicher zu sehen, mit welcher brutalen Effizienz ein Soldat nach dem anderen im Wald verschwand. Mein Mund war staubtrocken, dennoch schluckte ich die Angst hinunter, die sich in mir ausbreiten wollte – aber keinesfalls durfte. Es war nicht mein erstes Mal im Wald, und wenn eines die Wesen hier noch schneller anlockte als der Geruch von Blut, dann war es Furcht.
Mein Herzschlag beschleunigte sich, doch ich zwang meinen Kopf zur Ruhe und bildete mir ein, die Dunkelheit zu fühlen, die sich wie eine Hand auf meine Schulter legte.
»Lauf«, flüsterte sie mir zu, und wenn ich eines gelernt hatte, dann war es, auf die Dunkelheit zu hören.
Ich wirbelte herum und stolperte fast über einen Soldaten, der am Boden lag und Hilfe suchend zu mir aufsah. Seine Fackel erlosch in einer Pfütze, die vermutlich sein Blut war. Eine bleiche Hand hielt seinen Knöchel umklammert und machte Anstalten, ihn vom Weg zu zerren. Mit einem Fluchen zückte ich den Dolch von meinem Gürtel und warf die Klinge. Sie traf die knochige Hand, und das Wesen fuhr mit einem aufgebrachten Zischen zurück.
»Hoch mit dir«, befahl ich dem Soldaten, der sich keuchend die Seite hielt. Blut tropfte aus drei langen, klaffenden Kratzwunden unter seiner zerfetzten Uniform. Ich konnte sie nicht alle retten, aber vielleicht einen. Am Ende hatten auch sie nur Befehle befolgt.
Der Soldat starrte mich fassungslos an, während ich ihm aufhalf. Seine Wangen waren ziemlich blass für die braune Farbe seiner Haut.
»W… was ist das?«, stammelte er.
»Knochenrufer«, sagte ich knapp und zerrte ihn mit mir. Der Soldat stolperte, aber folgte mir. In einer fließenden Bewegung zückte ich einen Dolch, als ein weiterer zitternder Schemen sich neben uns aus dem Nebel zu schälen begann. Der Knochenrufer stieß einen schrillen Schrei aus, der klang, als würden Nägel über eine Schiefertafel kratzen. Gänsehaut überzog meinen Körper. Der Soldat keuchte, doch er hielt trotz seiner Verletzungen mit mir Schritt. Noch.
Ohne die Fackeln schlug die Dunkelheit über uns zusammen, und ich spürte, wie die Verzweiflung in ihm wuchs und überhandzunehmen drohte.
»Wir können nichts sehen«, zischte er mir zu.
Nein. Er konnte nichts sehen. Für mich war die Nacht nie gänzlich dunkel.
»Keine Sorge«, sagte ich grimmig und spürte eine Bewegung vor uns. »Ich weiß, wo wir hinmüssen!« Ruckartig packte ich den Soldaten und drückte ihn gegen einen Baum.
»Was …?«, setzte er an, doch ich hielt ihm den Mund zu und spannte sämtliche Muskeln an.
Ein Knacken war zu hören. Knirschen, als Zähne aneinanderschabten, und Schritte.
Der Knochenrufer war verdammt nahe. Ich konnte seine glühenden Augen kaum drei Schritte von uns entfernt sehen und schob den Soldaten langsam um den Baumstamm herum, um uns vor seinen Blicken zu schützen. Der Knochenrufer ging schleppend, und erst als die Dunkelheit vor meinen Augen so weit zurückgewichen war, dass ich besser sehen konnte, erkannte ich ein abgetrenntes Bein in seiner Klaue, das er hinter sich herschleifte.
Der Soldat keuchte still unter meiner Hand. Sein Herzschlag pochte so heftig, dass ich ihn an meiner Brust fühlen konnte. Seine Angst roch salzig-bitter. Das war nicht gut. Wenn ich es bemerkte, würde es auch der Knochenrufer gleich wittern.
Im nächsten Augenblick blieb dieser auch schon stehen. Sein Kopf schnellte knirschend zu uns herum. Der Winkel hätte jedem Menschen das Genick gebrochen. Der Knochenrufer grollte. Er schien menschlich gewesen zu sein, bevor der Wald ihn zu sich genommen hatte. Alte Fetzen einer Uniform schlackerten um seine Knochen. Er hatte uns eindeutig gesehen.
Mit einem Schmatzen ließ er das Bein fallen und sprang mit einem schrillen Schrei auf uns zu.
»Lauf!«, brüllte ich und schubste den Soldaten zur Seite.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie er sich am Boden abrollte und sofort wieder aufsprang, während der Knochenrufer seine Krallen in die Baumrinde schlug.
Ich zückte meinen letzten Dolch und schleuderte ihn gegen seinen Kopf. Die Klinge blitzte auf und blieb mit einem Knirschen in der linken Augenhöhle stecken. Der Schädel bestand hauptsächlich aus blank gefressenen Knochen und einem fadenscheinigen Büschel aus Haaren. Ein paar graue Sehnen hielten den Körper aufrecht, die wenige übrig gebliebene Haut war vertrocknet und vergilbt, und Schlingpflanzen wanden sich um die Knochen, als würde der Wald noch immer an ihm fressen. Das Monster blieb stehen und schnappte mit seinen Krallen nach dem Griff des Dolches.
»Mist«, stieß ich hervor, bevor es sich auch schon die Waffe aus der Augenhöhle riss, seinen Mund aufsperrte, in dem lange, spitze Zähne sichtbar wurden, und einen gellenden Schrei ausstieß. Stechende Kopfschmerzen jagten durch meinen Schädel. Für einen Augenblick wurde mir schwarz vor Augen, und ich ging fast in die Knie. Eine Sekunde nur, aber es war bereits zu viel. Der Knochenrufer war bei mir und stieß seine Krallen gegen meine Brust. Nur die lederne Brustplatte hielt ihn davon ab, mich aufzureißen wie eine reife Frucht. Ich knallte hart auf den Rücken, den Knochenrufer über mir, und der Gestank von Verwesung stieg mir in die Nase.
Knurrend trat ich aus und versuchte, mich aus dem Klammergriff des Monsters zu befreien, doch dieses sperrte sein Maul auf, drückte meine Arme mit übermenschlicher Kraft zu Boden und machte Anstalten, mir die Kehle durchzubeißen. Den ersten Vorstoß konnte ich mit einer Kopfnuss abwehren. Ein Zahn brach dem Knochenrufer aus dem Oberkiefer, und er schüttelte irritiert den Kopf. Blut und saurer Speichel spritzten auf mich herab.
Für einen winzigen Moment durchzuckte mich der bitterste Gedanke, dass ich bei allen Möglichkeiten zu sterben ausgerechnet wegen Lance’ Torheit draufgehen würde. Als ich bereits den fauligen Atem riechen konnte, flog plötzlich der Knochenkopf von den Schultern. Der Korpus fiel über mir zusammen und begrub mich unter einem müffelnden Haufen Knochen. Ich stieß ein Ächzen aus und blinzelte zu dem Soldaten hoch, der mit gezücktem Schwert über mir stand. Er sah noch blasser aus als zuvor und wirkte leicht verwirrt.
»Du … hast mich gerettet?«, fragte ich überrascht, was dem Soldaten ein leichtes Lächeln entlockte.
»Du mich auch.« Er hielt mir seine Hand entgegen. Sofort griff ich zu und schälte mich aus dem Haufen Knochen. »Warum?«, fragte ich.
»Warum nicht? Es erschien mir nicht schlau, die einzige Person sterben zu lassen, die zu wissen scheint, was hier vor sich geht.«
Müde legte ich den Kopf zur Seite und musterte ihn, von der braunen Haut über das intelligente Leuchten seiner Augen bis zu der Art, wie er sein Schwert hielt. Ein wenig linkisch, als wäre er eine leichtere Waffe gewohnt.
»Du bist noch nicht lange hier, oder?«, erkundigte ich mich.
Der Soldat straffte sich. »Mein Name ist Kealand. Ich wurde vor zwei Wochen aus Shat’Arat für den Dienst eingezogen.« Er kam aus der Wüstenstadt. Das war sehr weit weg, bisher hatte ich nur wenige Arater getroffen.
»Verstehe.« Ich drehte mich um. »Wir müssen weiter, bevor andere Knochenrufer auftauchen«, fügte ich hinzu und setzte mich in Bewegung, doch Kealand hielt mich nach wenigen Schritten zurück.
»Wo willst du hin? Wir müssen den Hauptmann finden.«
Mürrisch hob ich eine Augenbraue. »Wozu? Der Hauptmann würde keine Sekunde zögern, dich zurückzulassen, und wir sind nur seinetwegen in dieser Situation.«
Kealand straffte sich und presste seine blutige Faust über sein Herz. »Als ich in den Dienst eintrat, habe ich einen Schwur geleistet, meinen Kommandanten zu beschützen, und daran halte ich mich.«
Ich seufzte leise, während ich den stoischen Ausdruck in seinem Gesicht unverständlich und faszinierend zugleich fand. So viel Hingabe. So viel Stolz. Da war noch Leben in seinen Augen. Der Hof hatte ihn noch nicht gebrochen, und ich wusste jetzt schon, dass sich das bald ändern und jeglicher Funke aus seinen Augen weichen würde.
»Wir suchen Lance, aber erst, wenn es heller wird. Es bringt dem Hauptmann nichts, wenn wir sofort sterben, und das werden wir, wenn wir hier länger rumstehen.«
Kealand zögerte, als wollte er widersprechen, doch ein knurrendes Geräusch aus der Dunkelheit stimmte ihn um. »Ich folge dir, ähm …«
»Bemüh dich nicht. Ich habe keinen Namen. Du kannst mich nennen, wie du möchtest.« Ich bückte mich und hob meinen Dolch auf, der neben der Leiche am Boden lag. Der Knochenrufer hatte uns nur wenige Schritte abseits des Weges gestellt, und ich war erleichtert, als meine Füße wieder festen Boden statt weicher Erde berührten. Um uns herum war alles still geworden. Weder die Soldaten noch die Pferde waren noch zu hören. Der Nebel schwappte über den Weg und erfüllte alles mit Grau, das um uns herumwogte.
»Wie kannst du keinen Namen haben?«, fragte Kealand leise, als er zu mir aufschloss. Eine Hand an die Wunde an seiner Seite gepresst, die andere hielt weiterhin das Schwert umklammert.
»Man hat mir nie einen gegeben. Die meisten nennen mich Smugaid.«
Kealand runzelte die Stirn und starrte mich an, als würde er mich zum ersten Mal genauer betrachten. »Das ist kein Name, sondern ein Schimpfwort.«
»Etwas anderes habe ich nie bekommen.«
»Wie lange lebst du schon im Palast?«, bohrte er nach.
Mein ganzes verfluchtes Leben lang. Doch stattdessen sagte ich nur: »Eine Weile.«
»Wie kommt es, dass du dich im Wald so gut auskennst? Mir wurde gesagt, nur wenige Dorfbewohner trauen sich hier hinein und das Personal verlässt niemals den Palast.«
»Ich bin etwas anders als die anderen Diener«, sagte ich knapp. »Im Wald zu überleben, war schlichtweg eine Notwendigkeit.«
Kealand stieß ein Schnauben aus. »Du redest nicht gerne über dich, was?«
»Ich bin es nicht gewohnt, dass Leute mit mir reden«, gab ich zu.
»Ich rede mit dir.«
»Ganz offensichtlich. Aber du wirst bald damit aufhören.«
Er sah nur noch verwirrter aus. »Warum sollte ich das tun?«
Ich lächelte. »Das tun sie alle, wenn sie länger im Palast sind.«
Kealand biss die Zähne zusammen, als hätte er Schmerzen, doch er ließ nicht locker, während wir durch den dunklen Wald liefen wie zwei Kaninchen, die vor dem Wolf davonrannten. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir verfolgt wurden. Keine Bewegung war zu sehen, doch der Hauch der Verwesung ließ nicht nach. Ein Schweißtropfen rann mir über den Rücken. Zur Mühle war es nicht mehr weit, bis dahin mussten wir es schaffen. Die Knochenrufer würden uns vermutlich nicht auf die Lichtung folgen, wenn der Sonnenaufgang so nah war.
»Also?«, bohrte Kealand weiter.
Ich seufzte. »Also was?«
»Warum gab es in deinem Leben so viele üble Notwendigkeiten, dass du selbst im Stockdunkeln durch diesen verfluchten Wald gehen kannst? Ich habe ja Geschichten gehört, aber ich hielt sie immer für …« Er stockte.
»Lügen?«, fragte ich amüsiert nach.
Er zuckte die Schultern. »Es ist schon ein seltsamer Wald, das musst du zugeben.«
»Er ist noch viel seltsamer, als du denkst. Vor wenigen Jahren erst hat der Sonnenkönig ihn auf der Jagd komplett niederbrennen lassen.«
Kealand sah an einem Stamm empor, der so hochragte, als würde er den Nachthimmel als Krone tragen. »Kaum zu glauben. Die Bäume sind doch uralt.«
»Sie brannten wie Zunder«, erzählte ich leise und unterdrückte ein Schaudern. »So weit das Auge sah, war nichts als Asche übrig. Doch dann versank die Sonne, die Nacht kam, und als der neue Tag anbrach, war der Wald wieder dicht und finster wie zuvor. Nur noch ein bisschen böser vielleicht.«
Kealand schluckte hörbar. »Was hat der König damals gejagt, dass er dafür einen Wald abbrennen ließ?«
Ich biss mir in die Innenseite der Wange, während ich weiterhin angespannt den Weg nicht aus den Augen ließ.
Menschen.
Doch das sagte ich nicht. Er würde es früher oder später selbst erfahren, daher antwortete ich: »Das Übliche.«
»Und warum kennst ausgerechnet du dich hier so gut aus?«
»Sie haben mich als Kind zur Strafe im Wald ausgesetzt. Irgendwann lernt man das ein oder andere.«
»Du wurdest was? Von wem?«, stieß Kealand hervor, und die Entrüstung in seiner Stimme verwirrte mich mehr, als ich zugeben wollte.
»Meistens von den Göttern.«
»Den Gött… Meinst du damit den König?«
»Ich meine sie alle. Auch den König«, stimmte ich zu.
»Wieso sollte der König einem Kind so etwas Grausames antun?«
Ich rang mir ein Lächeln ab, doch es fühlte sich steif an. Ungelenk. Ich lächelte eindeutig zu wenig.
»Wenn du erst zwei Wochen hier bist, dann hast du den König noch nicht persönlich gesehen, oder?«
»Nein, als ich ankam, war er bereits zur Jagd aufgebrochen. Man sagte mir, er würde zum Fest des Ersten Schnees zurück sein.«
»Er hoffte damals wohl, ich würde nicht zurückkommen, aber leider sterbe ich nicht so schnell, wie er es gern hätte. Am Ende landete ich wieder auf der Türschwelle des Palastes. Beinahe wie ein Fluch«, sagte ich halb scherzend, halb ernst. Es war kein Fluch. Zumindest nicht auf so drastische Weise wie bei anderen Dienern. Ihnen war es ohne Erlaubnis nicht möglich, die Schwelle nach draußen zu übertreten. Ich konnte das durchaus, auch wenn sich dabei alles in mir bei jedem Schritt vor Schmerzen wand, je weiter ich mich vom Palast entfernte. Nachdem der König jedoch bemerkt hatte, dass zu viel Magie in meinen Adern floss und ich nicht so leicht draufging, hatte er mich immer zurückgeholt. Vermutlich aus Angst, was ich tun könnte, wenn ich tatsächlich verschwand. Lieber störte er sich an meinem Anblick, als dass ich jenseits des Waldes eine Revolte anzettelte. Gleichgültig wie oft ich danach versucht hatte zu entkommen. Der König blies zu einer seiner Hetzjagden und fand mich. Bis ich es aufgegeben hatte.
Ich hatte das Gefühl, Kealands Blick würde sich in meinen Hinterkopf bohren, doch ich wandte mich nicht um, und er sagte nichts weiter dazu.
![Kiss me twice [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a0fe1b9f1c7d56660f1a6ac471e68968/w200_u90.jpg)
![Kiss me once [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/58f14f2f022cec4e8263fb50dc264ae2/w200_u90.jpg)
![Kiss Me Now [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2814e535c98fcfda1cfdcb79ccfd3a8/w200_u90.jpg)
![Night of Crowns. Spiel um dein Schicksal [Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f3ef0064b2dcb6a110ec6f7cc33ca401/w200_u90.jpg)
![Ever & After. Der schlafende Prinz [Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1a15fb283a4db3ffe16e7b163009952b/w200_u90.jpg)

![Night of Crowns. Kämpf um dein Herz [Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f13c50da50588357fe7b60b5de49bf54/w200_u90.jpg)
![Ever & After. Die dunkle Hochzeit [Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8868ef4c8bf07024c89e72b8d2c844ea/w200_u90.jpg)
![Ever & After. Die letzte Stunde [Band 3 (ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7d1ffc1b1ca24dc2bdf0ecbbd313392c/w200_u90.jpg)