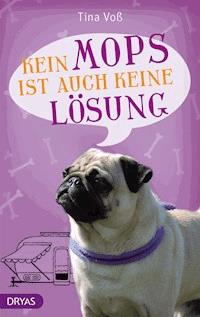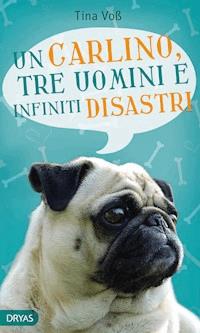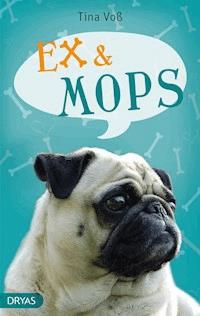
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love and Dogs
- Sprache: Deutsch
Kay, Junior-Personalreferentin, lebt mit Johannes, einem fanatischen Läufer und Veganer, zusammen. Ihre Freundin Klara möchte kurzfristig für ein Jahr ins Ausland gehen und Kay, die in ihrer Beziehung nicht glücklich ist, entschließt sich spontan, die Wohnung samt Bernd, dem Mops, zu hüten. Doch dann gerät alles aus den Fugen. Im Job wird Kay degradiert, ihr Privatleben ist ein Scherbenhaufen und die Erziehung von Bernd eine einzige Katastrophe. Da kommt der Tierarzt Ludger gerade zur rechten Zeit, allerdings kann der verwöhnte Mops ihn einfach nicht ausstehen. Jedes verkaufte Buch spendet an "Tasso e. V.", wo man sich u. a. um die Registrierung und Rückvermittlung entlaufener Tiere kümmert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tina Voß
EX & Mops
To all pugs in the world
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Impressum
Tasso
Der Stoff zum Buch
„Ich will nichts essen, das Alfalfa heißt.“
Das klang kindisch, aber das war mir egal. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und wartete auf Johannes’ immer gleichen Einwand. In wenigen Sekunden würde er sagen, dass die Ausbeute an Vitaminen im Vergleich zur Kalorienzahl der Hammer sei.
„Die Sprossen haben im Gegensatz zu ihrem Brennwert einen bombastischen Vitamingehalt!“
Oha, er ließ den Hammer aus und marschierte, ohne über Los zu gehen, direkt zur Bombe.
„Marzipanschokolade hat im Vergleich zu ihrem Fettgehalt einen bombastischen Geschmack.“
„Schokolade?“, schnaubte er. „Null vegan, absolut null.“
„Alfalfa? Null lecker, absolut null.“
„Aber gut fürs Gewicht“, erwiderte er und kniff mir in die Rolle, die sich partout nicht in die Hüftjeans schieben ließ. Wer diese Hosen erfunden hatte, war ein Frauenhasser. Alles quoll raus. Hosen sollten am besten bis zur mittleren Rippe gehen. Dann war alles gut verstaut. Johannes konnte man nur in die Augäpfel oder in die Hoden kneifen. Vermutlich waren das die einzigen nicht durchtrainierten Teile seines Körpers. Hatten Hoden eigentlich Muskeln? Augen ja, sonst könnte man sie nicht rollen. Aber Hoden? Die hingen da nur unmotiviert in der Gegend rum. Hatte da schon mal jemand geforscht? Das musste ich unbedingt googeln. Ich beugte mich in den Fußraum und angelte nach meiner Tasche.
Mit einem Ruck kam der Wagen zum Stehen. Ich knallte mit dem Kopf ans Handschuhfach und hinterließ dort einen Abdruck meiner Stirn.
„Aua!“
„Wir sind da“, sagte Johannes und stieg aus.
Ich rieb mir die Stirn und pellte mich aus dem Gurt. Draußen lief Johannes um das Auto herum – wie ein –; Hütehund, der aufpasste, dass die Reifen nicht gleich in unterschiedliche Richtungen das Weite suchten. Kaum war ich ausgestiegen, rannte er voraus und umrundete die Plexiglas-Garage der Einkaufswagen.
Neben unserer schwedischen Familienschaukel, ein zu weit vorausschauendes Geschenk von Johannes’ Eltern, hielt ein schwarz glänzender Mercedes Kombi. Kaum stand das Auto, ging automatisch hinten die Klappe auf, ein Yeti sprang raus und landete auf vier Beinen. Mit einem spitzen Schrei wich ich zurück und prallte gegen unseren Volvo. Gingen Yetis nicht aufrecht, und, falls nein, waren die Vier-Fuß-Yetis gefährlicher? Das musste ich auch googeln. Der Yeti spitzte die Ohren und kam auf mich zugetrabt. Oh Gott! Fletschte der die Zähne? Und, falls ja, wo waren die überhaupt? Was tat man, wenn man von so einem Vieh bedroht wurde? Als ich noch hin und wieder mit Johannes gelaufen war, hatte er mir eingeschärft, was man in so einer Situation tun sollte. Dazu hatte er auch etwas in seinem Lauftipp-Blog geschrieben. Aber was war es bloß gewesen? Der Hunde-Yeti pirschte langsam näher. Wo war denn sein Herrchen? Eine weizenblonde, kleine Frau in Jeans stieg telefonierend aus dem Mercedes, schaute kurz zu uns herüber und sprach einfach weiter. Hallo? Ihr Raubtier nahm Maß – und sie plauderte? Vermutlich konnte die zarte Person dieses Vieh sowieso nicht halten und warf daher lieber Fremde dem Tier zum Fraß vor.
Endlich fiel es mir ein! Arme hochreißen, rudern und schreien. Das war’s. Dann würde er den Rückzug antreten.
„AAAHHHH! JIHAIIIII! ANDELE! ANDELE! AAAAAHHHHHHHH!“ Ich schrie und rollte mit den Armen wie eine Windmühle auf Speed.
Der langhaarigen Blondine fiel das Telefon aus der Hand. Sie starrte mich mit offenem Mund an, der Hunde-Yeti senkte seinen Kopf, wuffte und schnellte wieder hoch. Direkt vor mir stoppte er, machte Bocksprünge, rannte zu seinem Frauchen, buckelte jetzt und war mit zwei Sätzen wieder bei mir. Okay, also noch mal!
„JIHAIIIIII! ANDELEEEEE!“ Wieder ruderte ich. Hoffentlich hielten die Arme in ihrer Verankerung.
Der langhaarige Hund warf seinen Kopf in den Nacken und jaulte wie eine Sirene. War das der Angriffsruf? Im Augenwinkel sah ich, dass Johannes den Einkaufswagen stehen ließ und auf uns zu rannte. Die Hundebesitzerin stützte sich an ihrem Autodach ab und ... lachte! Die lachte? Ihr Riesenviech wollte mich fressen, und die kriegte sich gar nicht mehr ein? Johannes stand plötzlich neben mir und stoppte meine Windmühlenarme. Sofort hörte der Hund mit seinem Geheul auf.
„Sag mal, spinnst du jetzt total?“, zischte Johannes.
„Spinnen? Wenn ich nicht so geistesgegenwärtig gewesen wäre, hätte mich das Monster zerrissen!“
Der Hund beobachtete uns mit schief gelegtem Kopf, kam aber nicht näher. Ich schaute über den Parkplatz. Überall standen Menschen in unterschiedlichen Stadien ihrer Tätigkeiten – auf dem Weg in den Supermarkt, beim Autoeinladen oder mit Tüten in der Hand. Sie wirkten wie eingefroren. Als hätte jemand mal kurz die Pause-Taste gedrückt. Alle starrten zu uns herüber. Ein Auto weiter japste jemand. Die Hundefrau bekam vor Lachen keine Luft mehr. Mehrfach nahm sie Anlauf, um etwas zu sagen, kreischte aber stattdessen gleich wieder los.
„Entschuldigung“, murmelte Johannes in Richtung des Mercedes und zog mich am Ellbogen mit sich. Langsam setzten sich die Passanten, immer noch lachend, wieder in Bewegung.
„Was sollte denn der Auftritt?“
„Auftritt? Hast du mir nicht eingeschärft, was man tun soll, wenn man von einem Hund angegriffen wird?“
„Ach. Ich? Was denkst du, was du grad gemacht hast?“
„Laut geschrien, mich groß gemacht und mit den Armen gerudert. Genauso, wie du es in deinem dämlichen Blog empfohlen hast.“
Johannes musterte mich wie etwas, das die Katze mit reingebracht hatte, und schüttelte den Kopf.
„Du hast echt gar keine Ahnung von Hunden, oder?“
„Was soll denn die Frage?“
„Kay, das alles tut man, wenn eine Herde Kühe auf einen zu läuft.“
„Oh.“
Im Supermarkt schien Johannes meine Rinderhirtentätigkeit sofort wieder vergessen zu haben. Wie Pacman flitzte er zwischen den Regalen und dem Wagen hin und her.
„Hast du neue Batterien drin?“, fragte ich. Mir wurde schon beim Zugucken schwindlig. Johannes grinste nur und rannte zur Gemüseabteilung.
„Falls ja, nehme ich sie dir gleich wieder raus“, murmelte ich seinem Windhauch hinterher.
Wir planten keinen Urlaub, ohne dass er einen – seinen! – Marathonlauf inkludierte. Er lief, und ich sollte juchzend mit einem Fotoapparat an der Strecke stehen. Möglichst an mehreren Stellen, damit die Freunde hinterher staunen konnten, wie toll er während des gesamten Laufes ausgesehen hatte. Vorher druckte er mir Stadtpläne aus, markierte den Parcours und notierte die Zeiten, wann ich ihn wo erwarten konnte.
Mit seiner blökenden Herde trabte er Kilometer um Kilometer einen narrensicheren Parcours von zweiundvierzig Komma eins neun fünf Kilometern, während ich zu Fuß, mit dem Rad, einem Taxi, der U-Bahn oder welchem Transportmittel auch immer zu den vorgegebenen Kilometerabschnitten hetzte, nur um ihn strahlend an mir vorbeisausen zu sehen.
Gerade mal eine Millisekunde dauerte das, dann schulterte ich den Rucksack und hastete quer durch die jeweilige Stadt zum nächsten Kontrollpunkt. Am Ende eines Marathons war ich fix und fertig und er der strahlende Langstreckenläufer.
Von jedem Rennen hob er Finisher-Shirt, Startnummer und die Medaille in seiner Siegesvitrine auf. Alle Schuhe, mit denen er jemals einen Marathon gelaufen war, kamen am Ende ihrer Lebenszeit wieder in ihren Originalkarton, auf dem auf die zweite Nachkommastelle genau die Zielzeit notiert wurde. Johannes aß nur so viel, bis er die zuvor errechnete optimale Kalorienmenge erreicht hatte. Jeden Tag wog er sich auf seiner WLAN-Waage, die die Ergebnisse sofort in ein Programm übertrug, das auch die Anzahl seiner Schritte und die Tiefe seines Schlafes überwachte. Morgens schlurfte er schon mal missgestimmt ins Bad und hielt mir sein iPhone unter die Nase. „Ich war dreimal wach, und meine Tiefschlafphasen waren viel zu kurz.“
„Und?“ Ich starrte auf den Bildschirm mit Balkendiagrammen und Kurven, die genauso gut den DAX oder die Urinmenge von Rindern im Jahresverlauf darstellen konnten.
„Du hast den Fernseher wieder nicht ausgemacht.“
„Mein Unterbewusstsein lernt, wenn der Fernseher nachts läuft.“
„Ach. Was denn?“
„Na, was so kommt. Waffensysteme der Zukunft, die tödlichsten Schlangen der Welt oder Tarnkappenbomber im Wandel der Zeit.“ Ich konnte nun mal nur einschlafen, wenn im Hintergrund eine Reportage lief. Während der Sprecher die Vorzüge der XXL-BrückenSüdamerikas erläuterte, schlummerte ich, von seiner Stimme sanft getragen, davon. Die Fernbedienung begrub ich unter mir, damit Johannes nicht mitten in meiner Einschlafphase die Reportage abschalten konnte. Meist hatte ich am nächsten Tag bis mittags Zahlen von null bis neun auf der Wange und einen perfekten Abdruck vom runden Ausschaltknopf.
„Kay, träumst du?“
Ich zuckte zusammen. Johannes stand mit einem Arm voller Ananas vor mir und legte sie in den Einkaufswagen. Bevor ich antworten konnte, war er wieder verschwunden und jagte Wassermelonen, Pomelos oder Physalis. Danach würden wir noch ins Reformhaus fahren und so seltsame Dinge wie Mandelmus, Quinoa (das hatte ich anfangs auch googeln müssen) und Agavendicksaft kaufen. Pfui Deibel! Was sprach gegen Buletten? Diese kleinen, vorgebratenen Dinger aus dem Kühlregal? Lecker!
„Gleich habe ich alles zusammen, und dann kannst du uns einen veganen Zucchini-Auflauf zaubern. Der hat im Vergleich zu einer Lasagne neunzehn Mal weniger Kalorien!“
Kaum war er wieder verschwunden, schaufelte ich Marzipanschokolade, kleine Buletten und Gummibären in den Wagen. Dann drapierte ich die Ananas darüber und machte mich auf den Weg zum Zeitungsstand, um die Klatschzeitschriften mit den fiesesten Enthüllungen über Prominente (Pfeil auf rausgerutschten Oberschenkel mit der Headline: „Schwere Cellulite! Wer hätte das gedacht?“) zu kaufen. Es gab nichts Wohligeres, als zu lesen, dass auch wunderschöne Lichtgestalten nicht makellos durchs Leben stöckelten.
Wo war denn jetzt der Einkaufswagen hin? Den hatte ich doch direkt vor dem Kondomregal geparkt. Der Platz war meist frei. Ich hatte zumindest noch nie jemanden beobachtet, der die Bedienungsanleitungen der Packungen studierte und abwog, ob er Noppen, Geschmack oder doppelte Sicherheit haben wollte. Wer hatte den Wagen geklaut? Das gibt’s doch nicht!, dachte ich. Dann sah ich ihn. Johannes schob den Wagen vors Süßigkeitenregal und packte meine Einkäufe wieder aus. Ich grollte.
„Du zahlst“, sagte ich an der Kasse.
„Aber du bist dran!“
„Wenn wir irgendwas gekauft hätten, was ich freiwillig essen würde, gerne. Aber so?“
Johannes zuckte mit den Schultern und beglich den Betrag. Während ich die Ananasplantage in die Papiertüten zwängte, tippte Johannes etwas auf seinem Smartphone und sah mich fragend an. „Wir haben es ja nicht eilig, gell?“
Bevor ich antworten konnte, klingelte mein Smartphone. Aus Coolnessgründen hatte ich das „Pling!“ eines U-Boot-Sonars als Ton gewählt. „Klara Briese ruft an“, stand im Display.
„Warte hier! Ich brauche noch ein paar Schritte. Liege voll unter dem Tagespensum“, rief Johannes beim Rausgehen, schob mich neben den Parkplatz für Einkaufswagen und rannte los.
Ich nahm den Anruf an. „Hey Klara, was für eineÜberraschung. Alles fein?“
„Kay, Süße! Ich habe die Nachricht des Jahrtausends!“ Klaras Stimme kiekste wie die eines Justin-Bieber-Groupies, das die Nacht mit dem Star verbringen durfte.
„Oha. Was ist passiert?“
„Ich habe eine Zusage! Ein anderer Teilnehmer ist kurzfristig ausgefallen, und nun kann ich mit.“
„Mit? Wohin? Auf den Mars? Nach Hogwarts? Mittelerde? Klara, du sprichst in Rätseln.“
„Simbabwe!“
„Simwas? Simbabwe? Du meinst nicht das Fastfoodrestaurant in der City – du meinst das Land?“
„Exakt.“
Ich schwieg, während mein Gehirn vom Einkaufs-Stand-by auf maximale Kapazität hochfuhr. Klara hatte vor wenigen Wochen ihr Medizinstudium beendet, was wir mit der ganzen Clique ausführlich gefeiert hatten. „Was sagst du? Ist das nicht der Hit?“
Während ich noch mit offenem Mund, nur beobachtet von Tüten voller Ananas, die Einkaufswagen bewachte, rannte Johannes grad zum zweiten Mal vorbei und streckte den Daumen nach oben.
„Aber ... aber, das kommt so plötzlich. Was musst du da machen? Wann geht es los? Wir wollten doch nächste Woche shoppen gehen?“
„Das brauchen wir nur um ein Jahr zu verschieben. Mir gefallen die aktuellen Kollektionen sowieso nicht. Ich kann sofort starten, wenn ich hier alles geregelt habe. Deswegen rufe ich dich auch an.“
Ich schrie auf. Johannes hatte mich von hinten in die Kniekehlen gestupst, so dass ich beinahe umgefallen wäre, und rannte weiter.
„Hey, so zum Schreien ist das nun auch wieder nicht.“
„Das war Johannes. Während wir telefonieren, rennt er um den Supermarkt, damit er sein Trainingspensum an Schritten voll bekommt.“
„Johannes, der Läufer. Ich weiß. Sag mal, hast du eine Idee, wer für ein Jahr meine Wohnung haben möchte? Die Miete wäre kein Problem, ich bräuchte nur die laufenden Nebenkosten.“
Klara lebte in einer wunderschönen Maisonettewohnung mit Blick auf den Stadtwald, während wir im Garten von Johannes’ Eltern in einem von ihnen finanzierten Fertighaus lebten. Seine Eltern hatten gleich zwei Kinderzimmer eingeplant und mehrfach dezent darauf hingewiesen, dass sie auch die weitere Einrichtung und Erstausstattung finanzieren würden, wenn ich ihnen den sehnsüchtig erwarteten Enkel schenken würde. Was hieß hier überhaupt „schenken“? Seitdem nahm ich heimlich die Pille.
„Da kannst du doch richtig Geld für verlangen!“
„Ja, aber es gibt einen Mitbewohner: Bernd. Der Süße kann nicht mit nach Simbabwe, und den muss ich in guten Händen wissen.“
Ich lachte. Klaras Mops war der Hit. Möpse waren auch keine Hunde, sie waren irgendwie besser. Menschlicher. Klara hatte ihn nach dem Züchter benannt, nachdem sie während der Verkaufsphase einmal mit ihm im Bett gewesen war und er beim Sex genauso geschnauft hatte wie seine Hunde. Das hatte sie ihm in einer anderen Nacht wohlig schnurrend gestanden. Danach war der Kontakt abgebrochen. Klara rätselte immer noch warum.
„Wenn ich niemanden finde, der Bernd betreut, kann und will ich nicht mitfahren“, seufzte Klara. „Fällt dir nicht jemand ein, der vertrauenswürdig ist und Hunde mag?“
Johannes war zu kurzen Sprints mit spontanen Richtungswechseln übergegangen und grinste, als er wieder und wieder federnd an mir vorbeilief.
„Ich hab da eine Idee ...“
„Auf dich ist Verlass! Ich wusste es. Wer wird mein Hundesitter?“
„Ich.“
Auf dem Weg nach Hause saß ich, wie in einer Blase von der Welt abgetrennt, neben Johannes im Auto. Was hatte ich getan? Wie sollte ich ihm beibringen, dass er mir so sehr auf die Nerven ging, dass ich bei der ersten Fluchtmöglichkeit davonlief? Und zwar direkt in die Pfoten eines Mopses. Ob es einfacher wäre, wenn ich einen anderen Mann als Grund angeben würde? Eine kugelrunde, vergnügte Couch-Potato! Jemand, der mit mir gemeinsam alberne Fernsehserien schauen würde, statt mich bei jedem Wetter zum Outdoorsport zu treiben. Der mir bei meinen seltenen Joggingrunden nicht hinterherrufen würde, dass das, was ich da veranstaltete, in seinem Laufblog unter der Rubrik „Schnelles Stehen“ abgehandelt würde.
Der Anruf von Klara, der rote Flucht-Teppich – und auf einmal lag alles so deutlich vor mir, als hätte jemand bei einem Beamer die Linse scharf gestellt. Endlich konnte ich die Leinwand genau sehen. Apropos Beamer! Was würde ich mit Bernd machen, wenn ich arbeiten ging? Durfte man Hunde mitbringen? Verdammt! Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich musste Juli anrufen und alles mit ihr besprechen. Sie würde Rat wissen. Verglichen mit ihren Problemen war mein Leben ein Streichelzoo – jetzt bald einer mit Mops.
„Na, überlegst du schon, was du uns kochen magst? Ich habe bei meinen Lieblingsgerichten Knicke in die neuen Kochbücher gemacht.“
Ich fuhr zusammen und war umgehend wieder im Hier und Jetzt. „Haben wir denn Sahne und Gouda gekauft, damit wir das Zeug überbacken können?“
„Sahne? Gouda? Hallo? Wir stellen um auf vegane Ernährung. Da sind Milchprodukte ein absolutes No-Go.“
„Ach. Und wenn wir morgen zu deinen Eltern zum Sonntagsbraten gehen? Kennt deine Mutter das Wort ‚vegan‘ überhaupt?“
„Lass Mama da raus. Das ist etwas anderes.“
„Lass mich da besser ebenfalls raus. Ich möchte auch weiterhin meinen Cappuccino trinken. Mit Milch! Nicht mit Soja-Ersatz-Schlotze. Apropos: Hast du an die Kaffeebohnen gedacht?“
Johannes schüttelte den Kopf, als würde ich fortwährend behaupten, die Erde wäre eine Scheibe.
„Ich habe Matcha gekauft. Zusammen mit der Hafermilch wird daraus ein Matcha-Shake. Der ist beruhigend und gleichzeitig stimulierend.“
„Matscha? Was ist das nun wieder? Und wenn er beruhigend und gleichzeitig stimulierend ist, was bringt das dann? Dann ist es doch genauso, als hätte ich ein Glas Wasser getrunken. Wenn Wasser gleichzeitig den Harndrang treiben und bremsen würde, bliebe alles gleich. Wenn es mich wachsen und schrumpfen ließe, bliebe ich hundertfünfundsechzig Zentimeter hoch. Kapier ich nicht.“
„Du willst es nicht kapieren!“
Beim nächsten Halt erreichte Johannes seine Frustrationsgrenze. Das fühlte ich genau. Leider kam ich grad erst in Fahrt, aber er ignorierte die Zeichen.
„Matcha ist grüner Tee mit einem höheren ORAC-Wert, als normaler grüner Tee aufweist, und war übrigens das Kultgetränk der Samurai.“
„Die danach besonders angriffslustig und friedfertig wurden, die losstürmten und sofort wieder umdrehten?“
„Kay!“
„Ja, ist ja gut. Ich fahre gleich noch mal zu Juli, und wenn sie da ist, klau ich ihr ein paar Kaffeebohnen.“
„Du musst ja wissen, ob du dich noch mit Kaffee aus Kinderhänden vergiften und weiterhin die Muttermilch einer anderen Spezies trinken willst.“
Nun war meine Frustrationsgrenze erreicht, und ich begann in Gedanken zu zählen. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich mich nach solchen Gesprächen schnell wieder beruhigte – meist wenn ich bei einer mittleren vierstelligen Zahl angekommen war.
Für einen beschleunigten Cool Down holte ich mein Smartphone raus und rief Julis und meinen Bandwurm-WhatsApp-Chat auf, der seit Jahren durch mein Smartphone kroch. Irgendwann würde mir Herr WhatsApp wegen Missbrauchs den Speicherplatz kündigen. Juli und ich schrieben uns nämlich am liebsten absurdes Zeug. Sie war die Königin von Absurdistan und ich ihre Zofe.
„Eile sie mir zu Hülfe! Ich werde Mops-Mutter, Maisonette-Wohnungsbesitzerin und Single.“
Nach wenigen Minuten brummte mein Smartphone, und ich öffnete den Chat.
„Sie bringe die Kartons für den Umzug und den Champagner zum Anstoßen.“
„Was schreibst du da schon wieder?“ Johannes versuchte, einen Blick auf mein Smartphone zu erhaschen.
„Nix.“ Ah, seit Kindertagen liebte ich diese Antwort. Ganzes Gesicht voller Schokolade. Was isst du da? Nix. Wühlend in der hintersten Ecke des Elternschrankes? Was machst du da? Nix. Oder mit Mamas Schuhcreme riesige schwarz-braun-graue Elefanten an eine weiße Wand gemalt. Was machst du da? Nix!
„Bist du zu Hause und hast Zeit?“, tippte ich und hielt wie früher in der Schule die Hand vors Smartphone, damit keiner abschreiben konnte.
„Ich lasse die Brücke herunter und erwarte Ihre Ankunft“, ließ mich Juli wissen und setzte das Icon mit der Prinzessin dahinter.
Johannes fuhr das Auto in den Carport und stieg aus. Eigenbau mit Papa am Wochenende – die Frauen, also seine Mutter und ich, hatten derweil Kuchen gebacken. „Für unsere Männer“, wie seine Mutter mir verschwörerisch zugeflüstert hatte.
„Ich denke, dir wird schlecht, wenn du beim Fahren was lesen oder schreiben musst.“
Ich riss die Augen auf, presste die Hand vor den Mund und machte dicke Backen.
„Raus aus dem Wagen! Bevor du das teure Leder vollkotzt!“
Johannes sprang auf meine Seite und riss die Tür auf. Ich eilte nach drinnen, schloss mich im Bad ein und biss mir vor Lachen in die Faust. Übersprunghandlung – eindeutig. Ich war dabei, mein Leben kräftig durchzuschütteln und die handelnden Personen auszutauschen. Vor wichtigen Entscheidungen wurde ich immer albern. Das passierte mir aber auch, wenn ich müde oder betrunken war.
Draußen hörte ich Stimmen. Hoffentlich waren sie wirklich draußen und nicht in meinem Kopf. Wenn sie in mir waren, hatte einer meiner Dämonen die vorwurfsvolle Stimme von Johannes’ Mutter. Oh Himmel! Wenn ich schon schizo bin, dann lasst mich doch bitte die Besetzung frei wählen.
„Warum ist sie denn so schnell reingelaufen?“, fragte Johannes’ Mutter, die vermutlich den ganzen Tag wie ein Trojaner im E-Mail-Programm hinter der Gardine lauerte und, sowie sie ihren Goldjungen sah, aktiviert wurde. Dann drang sie NSA-mäßig umgehend in unsere Privatsphäre ein und setzte sich hartnäckig fest. Sie tarnte diese Überfälle durch Wäschemachen („Kindchen, mit den Schlüpfern und kurzen Hemdchen erkältest du dir aber die Nieren!“) und Staubsaugen („Ihr jungen Leute seid ja nach Feierabend mit ganz anderen Dingen beschäftigt.“ Zwinker, zwinker ...).
„Ihr ist übel“, antworte Johannes.
„Übel? Sie wird doch nicht etwa ...“ Die Stimme kiekste leicht nach oben.
„Mama, Quatsch. Das hat sie manchmal beim Autofahren. Sie ist nicht ...“
Enttäuschtes Gemurmel folgte, als beide außer Hörweite in die Küche gingen. In meinem eigenen Haus – also in Johannes’ eigenem Haus – musste ich die Pille verstecken. Wobei mein Versteck mich jeden Tag aufs Neue erfreute. Schwangere – oder solche, die es werden wollten – sollten regelmäßig Folsäure einnehmen. Also hatte ich mir ein Glas mit Folsäuretabletten besorgt, die Dinger ins Klo gekippt – vermutlich gab es in der Kanalisation jetzt kerngesunden Rattennachwuchs – und meine Einphasenpille aus dem Blister genommen und in das Fläschchen gefüllt. Ich wusste genau, an welchem Tag Johannes’ Mutter beim NSA-Schnüffeln die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hatte. Sie hatte mir abends beim Nachhausekommen über die Wange gestrichen und mir unauffällig – ist klar, genauso unauffällig, wie sich ein Elefant hinter einer Birke verstecken konnte – auf den Bauch geblickt. Hoffentlich häkelte sie jetzt nicht heimlich an der Erstausstattung.
Endlich verstummten die Mutter-Sohn-Stimmen. Ich verließ das Bad und schnappte im Flur meinen Autoschlüssel, um zu Juli in die Stadt zu fahren. Erst seitdem wir in dem Spießer-Vorort wohnten, fuhr ich überhaupt wieder Auto. In der Stadt kam man viel besser ohne klar, zudem ich einparkte wie eine Wurst, sagte Johannes, aber in der Welt der Pendler mit Doppelgarage und zwei Kindern benötigte man den Zweitwagen. Galt das auch für den Zweitmann? War sowas verbreitet? Das musste ich auch mal googeln.
Als ich wurstfrei und exakt am Bordstein ausgerichtet vor Julis Wohnung einparkte, fühlte ich mich wie ein geflohenes Entführungsopfer vor einer geöffneten Polizeiwache. Unendlich erleichtert, verstanden und in Sicherheit. Ich klingelte und musste wie immer beim Blick auf die Klingel lachen. „Juli August“, stand da. Juli musste dringend jemanden heiraten, der – oder in ihrem Fall besser die – mit Nachnamen „September“ hieß. Der folgerichtige Doppelname ergab dann ein Quartal.
Die Tür brummte wie eine Hornisse, und ich schmiss mich mit der Schulter dagegen. Für einen ahnungslosen Beobachter sah das aus, als würde ich das Mietshaus stürmen. Eingeweihte wussten, dass die alte Jugendstiltür keine Wetterumschwünge mochte und sich aus Protest verbog.
Gemächlich machte ich mich an den Aufstieg. Nur Johannes war bei seinen seltenen Besuchen im ehrenwerten Haus, wie Juli manchmal als Adresszusatz schrieb, ab hier meist schon losgerannt. Er nannte das „Bergtraining“. Wenn ich den zweiten Stock erreicht und mich am Geländer hochgezogen hatte, trabte er mir meist schon wieder entgegen, an mir vorbei nach unten und wieder hoch.
Das Haus bestand aus fünf Stockwerken. Altbau – also eigentlich zehn. Manchmal steckte ich mir was zu trinken ein, bevor ich zu Juli hochkletterte. Heute musste es ohne gehen. Mit einem Technobeat-Herzschlag erreichte ich ihr Stockwerk. Wieso wohnten alle meine Freunde unterm Dach? Immer. Ausnahmslos.
„Von allem zu viel ist auch ein Stil“, stand in goldenen Buchstaben auf einer pinken Postkarte, die Juli unter ihr Namensschild geklebt hatte.
Bevor ich mich auf Chillout-Beat runterfahren konnte, ging die Tür auf. Juli hielt sich eine hellblaue Kuckucksuhr vor den Bauch und drückte einen Knopf. Aus dem Türchen über der Uhr sprang mir blökend ein rosa Schaf entgegen.
„Ich habe die Zeit gestoppt. Du warst schneller als sonst.“
„Du ... du ... wenn ... ich ...“ Ich hätte zwar genügend Worte als Antwort parat, aber der Weg war wegen des Sauerstoffmangels blockiert. Die Worte warteten atemlos hinter eine Schranke, bis die endlosen Waggons mit Sauerstoff durchgerattert waren. Ich schnaufte wie im Ziel eines Zehn-Kilometer-Rennens. Oder zumindest nahm ich an, dass Zehn-Kilometer-Renner so schnauften. Oh Himmel, ich dachte schon wieder an Läufer! War das ein Zeichen? Falls ja, wofür? Gehen? Bleiben? Mops oder Mann? Waren Möpse nicht auch gefährlich?
„So kannst du nicht rein. Deine rote Birne beißt sich total mit meinem neuen pinken Sofaüberwurf.“
Juli zwinkerte, und es sah aus, als würde sich ihr dramatischer Lidstrich durchbiegen. Dann hängte sie die Kuckucksuhr wieder an die Wand. „Ich mache uns mal einen Cappuccino.“
Nach der Sporteinheit war mir warm. Ich hängte meinen blauen Kapuzenpulli an ein silbernes Hirschgeweih, das an der blauen Wand hoffentlich als Garderobe diente. Neben der Kuckucksuhr wirkte meine Jacke wie ein farblich abgestimmtes Deko-Element. Wie die Auslagen einer Parfümerie veränderte sich Julis Wohnung von Besuch zu Besuch. Als gelernte Schaufensterdekorateurin musste man vermutlich zwanghaft immer etwas neu arrangieren.
„Mein Italiener ist heiß. Kann losgehen mit Koffein, kann losgehen mit der Geschichte.“
Julis Espressoautomat zischte und ratterte. Unten rotzte er einen dünnen Faden mit zäher schwarzer Brühe raus, die Juli in ein Glas mit aufgeschäumter Milch kippte – der Babynahrung einer anderen Spezies.
„Juli, tut deiner Maschine Kaffeemachen weh? Es sieht aus, als würde sie den Espresso unter großen Schmerzen absondern. So als würde ein Mensch mit einer Blasenentzündung pinkeln.“
„Du Banause hast keine Ahnung. Der Espresso ist perfekt, wenn er sich wie ein kleines Mäuseschwänzchen aus dem Siebträger schlängelt. Euer Schweizer ist dagegen seelenlos.“
„Und wenn schon. Zuverlässig, effizient und ohne Blasenprobleme bereitet der kleine Eidgenosse mit blinkendem Display den schönsten Kaffee.“
Ich fand unseren Vollautomaten super. Draufdrücken – Kaffee fertig. Moment mal ... Unser? Nein, das war Johannes’ Automat. Aber wenn er jetzt vegan lebte, konnte ich den bestimmt mitnehmen. Mitnehmen? Schlagartig fiel mir wieder ein, dass ich nicht nur Kaffeebohnen schnorren wollte, sondern auf eine Katastrophe zusteuerte, die nach einer Juli-Strategie verlangte.
„Na, dann erzähl mal.“
„Wusstest du, dass Klara sich als Entwicklungshelferin oder so in Simbabwe beworben hat?“
Julis geschürzte Lippen blieben kurz vor der Tasse in der Luft hängen, weil ihr Arm auf dem Weg zum Mund einen ungeplanten Zwischenstopp einlegte. Klirrend stellte sie die Tasse auf der Küchenzeile ab. Ihr Mund stand nun offen. Schnell ein Foto! Zu spät. Juli atmete geräuschvoll aus.
„Sie will was machen?“
„Entwicklungshilfe und irgendwas mit Medizin.“
„Sind in Europa alle Stellen für junge Landärztinnen vergeben?“
„Frag Klara.“
„Was hat das mit dir zu tun?“
„Ich hüte ihre Wohnung.“
„Du? Wie kommt sie denn auf die Idee?“
„Gar nicht. Ich hab’s ihr angeboten.“
„Und wie kommst du auf die Idee?“
„Einfach so. Spontan. Ich weiß auch nicht.“
„Kay, Klara hat einen Hund. Was passiert mit dem?“
„Das war leider die Bedingung. Den muss ich auch hüten. Hoffentlich beißt der nicht.“
„Du? Was weißt du denn über Hunde?“
Ich runzelte die Stirn. „Lass mich überlegen: Säugetiere, vier Beine, die Jungs haben einen Penis, die Mädchen dann vermutlich eine Vagina. Sie legen keine Eier, halten keinen Winterschlaf und können nicht fliegen.“
„Bist du dir sicher?“
„Dass sie nicht fliegen können? Na ja, ich kenne nicht alle Rassen. Vielleicht gibt es da ...“
„Kay! Ich will wissen, ob das eine gute Idee ist.“
„Von den Hunden? Das sollten die selber entscheiden.“
Juli beugte sich nach vorne. Zornig zog sie die schmal gezupften Augenbrauen zusammen.
„War nur Spaß! Natürlich weiß ich nicht, ob das eine tolle Idee ist. Aber Johannes nimmt mich doch nur wahr, wenn ich einen Marathon unter drei Stunden laufe und mich anschließend in einen Rettich verwandle. Auch seine Mutter nimmt mich nicht als eigenständige Person wahr, sondern möchte, dass ich eine Kreißsaal-Legende werde und ihr jährlich einen Enkel in die Winkfleisch-Arme lege. Niemand von denen fragt, was ich möchte.“
„Und was möchtest du?“
„Die Muttermilch einer anderen Spezies trinken, die ganze Spezies danach gut durchgebraten aufessen und Buletten kaufen. In der Stadt wohnen. Ohne Doppelgarage und fremde Mutter auf Horchposten.“
„Dafür würdest du sogar einen Hund in Kauf nehmen?“
„Mir ist ein bisschen mulmig dabei. Hoffentlich ist der gut erzogen. Aber anstrengender als Johannes’ Mutter ist er sicher nicht.“
„Kay, das ist ein Mops, kein Rottweiler. Wenn der sich schlecht benimmt, trägst du ihn einfach weg. Ich glaube nicht, dass der Menschen beißt.“
„Und wenn, dann kriegt er halt einen Maulkorb.“
„Mops mit Maulkorb? Wo willst du den anbauen? Du weißt doch, wie er aussieht.“
Wir diskutierten noch eine Weile alle Unwägbarkeiten, die es bei dem Projekt so geben könnte. Speziell das mit dem Hund bereitete mir Unbehagen. Was machte man den ganzen Tag mit so einem Vieh? Setzte man den vor den Kinderkanal, wenn er Langeweile hatte? Je mehr ich aber vor Juli meine Entscheidung verteidigte, desto sicherer war ich mir, dass das genau das war, was ich machen wollte.
„Okay. Es scheint so, als würdest du in den Schoß der Großstadt zurückkehren. Was sagt denn Johannes dazu?“
„Ich frag ihn nachher.“
„Du hast noch gar nicht mit ihm gesprochen? Uff ...“
„Ich wollte erst ein wenig Rückendeckung und Klarheit haben – ohne Vorwürfe. Die Entscheidung ist schließlich auch erst wenige Stunden alt.“
„Viel Spaß. Aber Johannes ist ja wohl endgültig raus. Und wie bringst du das der Schreiber bei?“
Unsere Chefin Kordula Schreiber war eine knallharte Personalfrau, die den Laden von der Pike auf mit aufgebaut hatte. Sie schaute immer noch jeden Tag persönlich im Lager vorbei, um zu prüfen, ob die neuen Arbeitsabläufe beim Einpacken der online bestellten Klamotten endlich griffen. Juli war gelernte Schaufensterdekorateurin und hatte anfangs die Szenen für die Fotoshootings der Artikel dekoriert. Als die Firma den Großauftrag ergatterte, die Kollektionen einer Molligen-Mode-Serie ins Programm zu nehmen, wurde sie als Model entdeckt, arbeitete seitdem meist vor der Kamera und wurde von anderen Menschen dekoriert. Ich durfte die Schreiber als Junior-Referentin unterstützen und hoffentlich irgendwann in ihre Fußstapfen treten. Seit ich „Der Teufel trägt Prada“ gesehen hatte, wusste ich, dass es immer auch noch schlimmer kommen könnte.
„Montag erzähle ich es ihr. Dann begleitet mich Bernd in die Firma, kriegt sein Bett an meinem Schreibtisch und gut.“
Ich tat viel selbstsicherer, als ich mich fühlte. In Gedanken sah ich mich mit einer beigefarbenen Kampfdrohne an der Leine, die wahllos in Hosenbeine biss.
„Kay?“
„Ja?“
„Die Schreiber hasst Hunde wie die Pest.“
Ich fuhr so langsam, dass mich Menschen hupend überholten. Wenn ich zu Hause ankam, war ein Gespräch fällig, das ich nicht führen wollte. Dieser Gedanke lähmte meinen Gasfuß. Vielleicht sollte ich warten, bis Johannes auf eine seiner Laufrunden trabte. Zack! Klamotten in die Koffer und weg. Natürlich würde ich ihm einen Brief hinterlassen und alles erklären – ich war ja kein Unmensch. Der Text könnte lauten: „Liebster, verzeih mir. Ich bin gegangen. Bernd braucht mich. Such nicht nach mir und werde glücklich.“ Am Ende des Briefes wäre die Schrift verwischt – von meinen Tränen. Dazu müsste ich aber mit Füller schreiben. Mist. Hatte ich einen Füller? Nein! Aber Johannes’ Mutter besaß einen. Mit dem schrieb sie Weihnachten die Platzkarten für die Familie. Bei mir setzte sie immer schon Johannes’ Nachnamen hinter den Vornamen: Kay Eske Zwickel. Das fand ich empörend. Selbst wenn ich Johannes wollte, würde ich so nicht heißen wollen. Der Name klang engstirnig.
Meinen zweiten Vornamen verschwieg ich meist und wollte auch ihn auf keinen Fall auf einer Platzkarte lesen. Als meine Eltern damals den Namen Kay beim Standesamt beantragten, mussten sie sich schnell einen weiblichen Zusatznamen wie Gertrud oder Waltraud überlegen, damit deutlich wurde, dass ich wirklich ein Mädchen war. So kamen sie aus unerklärlichen Gründen auf Eske. Gott sei Dank hieß die Cousine des Standesbeamten auch Eske, und er trug ohne Widerworte den zweiten, vermeintlich rein weiblichen Vornamen ein, der aber ebenfalls auch ein Jungenname war. Das war das mit Abstand Illegalste, was meine Eltern jemals getan hatten. Meine Mutter dachte noch Jahre später, wenn es an der Haustür klingelte, dass sie wegen Vortäuschung eines nicht eindeutigen Mädchennamens verhaftet werden würde.
In der Familie Zwickel war alles viel traditioneller und feiner. Da wurde man nicht spontan nach entfernten Verwandten eines unbekannten Beamten benannt. Irgendein Ururgroßvater hatte Johannes geheißen. Nach der Familientradition hieß dann jeder Erstgeborene automatisch Johannes. In Kombination mit dem Nachnamen klang das schrecklich. Ich war froh, wenn der aktuelle Johannes – der soundsovielte – bei der Nennung seines Namens niemanden anspuckte. Ich konnte „Johannes Zwickel“ auch nur spucklos sagen, wenn ich vorher einmal geschluckt hatte.
Gottogott, ich musste diese Gedankenspirale verlassen. Sonst würde ich Johannes anschreien, ohne dass er wüsste, was überhaupt los war. Ich bog in unsere – falsch: bald ex-unsere – Straße ein und rollte am Elternhaus vorbei auf den Zwickelschen Hinterhof, wo unser Fertighaustraum samt Doppelgarage aussah, als wollte er sich vor der Straße verstecken.
Als ich am Elternhaus vorbeifuhr, bewegte sich die Wohnzimmergardine. Im selben Moment wurden auch in unserem Haus die Vorhänge zur Seite geschoben. War NSA-Spitzel-Zwickel-Mutter an zwei Orten gleichzeitig, oder war Hinter-Gardinen-Lauern erblich? Ich stieg aus dem Wagen und lächelte überall hin, wo sich Gardinen bewegten. Noch bevor ich die Haustür aufschließen konnte, wurde sie von innen geöffnet. Showtime!
„Wieso dauert Kaffeebohnenholen so lange?“, begrüßte mich Johannes ungehalten.
„Weil ich sie von meiner Freundin geholt habe und nicht aus einem Discounter. Das mache ich immer so. Wir plaudern miteinander, erzählen uns Neuigkeiten. Klar, dass du sowas nicht kennst, es sei denn, jemand läuft neben dir und redet auf dich ein.“
Erst jetzt fiel mir auf, dass Johannes in kompletter Laufmontur vor mir stand. Da war zum einen die atmungsaktive Jacke mit Netzeinsätzen unterm Arm, abgepolsterten Reißverschlüssen und reflektierenden Nähten. Wenn er in das Scheinwerferlicht eines Autos lief, dachte der arme Fahrer bestimmt, dass vor ihm gerade ein Ufo landete. Die dazu passende Hose hatte sogar unterschiedlich aufgebaute Klimazonen, schließlich kühlte der Körper unterschiedlich aus. Johannes bezeichnete sich als Kopfschwitzer. Als er mir die Hose nach dem Kauf detailliert erklärte hatte (Hallo? Das war eine Hose, kein Raumschiff!), bezeichnete ich ihn als Kniekehlen- und Poschwitzer und er mich als ignorante Kuh.
„Wenn Sprechen eine Disziplin wäre, bei der Qualität die Quantität sticht, dann würdest du mit deiner komischen Freundin auf dem letzten Platz landen.“
Hoppla! War der schon immer so giftig gewesen? Oder sah ich das plötzlich so ungefiltert, weil ich durch Klaras Anruf einen Ausweg aufgezeigt bekommen hatte und somit die Gardine vollständig zur Seite gezogen worden war?
„Ich würde gerne, wenn das geht, ein paar inhaltlich wertvolle Sätze mit dir sprechen.“
„Spinnst du? Ich bin seit zwanzig Minuten überfällig. Heute sind auf meiner Runde Tempoläufe und Intervalle dran. Ich wusste nur nicht, ob du deinen Schlüssel mitgenommen hast und ob andernfalls Mama da wäre.“
Oh! Das war zumindest fürsorglich. In meinen Gedanken tat ich ihm wohl unrecht, und ich schämte mich.
„Wenn du dich ausgesperrt hättest, hätte das mit dem Essen ewig gedauert. Nach so einer Einheit brauche ich Kohlenhydrate. Das Rezept habe ich dir im Buch aufgeschlagen. Wenn du jetzt damit anfängst, bin ich punktgenau zurück. Die Kichererbsen kochen lange.“
Er trabte auf der Stelle, damit seine vorgestretchten Muskeln nicht kalt wurden. Und ich kochte – ganz ohne Kichererbsen – vor mich hin und brauchte keine körperliche Betätigung. Fürsorglich? Pah!
„Johannes, ich möchte mich von dir trennen. Ich ziehe aus. Wir passen nicht zusammen.“
Hatte ich das gesagt? Einfach so? Die Sätze hatten keinen Umweg über mein Gehirn genommen, wo ich sie in ein Mäntelchen aus liebevollen Girlanden wie beispielsweise: „Es ist besser so für uns“, „Lass uns befreundet sein, aber kein Paar“, „Wir haben verschiedene Ziele im Leben“, „Ich möchte keine kleinen Johannes-Zwickel-Namensträger ausbrüten“ oder „Ich will nicht immer sonntags zu deiner Mutter“ hätte einkleiden können. Ich hatte es gesagt. Einfach so. Und das fühlte sich richtig an.
Johannes hörte nicht auf zu traben. Ich suchte nach einer Reaktion in seinem Blick, doch dazu musste ich nicken wie ein Wackel-Dackel auf Speed. Hüpfende Augenhöhe war anstrengend.
„Du hast sie doch nicht alle!“, sagte er, schüttelte den Kopf und lief los.
Hatte er mich nicht verstanden?
Bei seinen Eltern ging die Terrassentür auf, und Mama Zwickel kam raus. Johannes lief zu ihr, sagte etwas, und beide schüttelten den Kopf. Er lief weiter. Sie stemmte kurz die Hände in die Hüften, schaute mich an und marschierte auf mich los. Hilfe!
„Kay Eske, was höre ich da grad von Johannes?“
„Das Evangelium?“
Schon wieder fehlte der Umweg über die Blut-Hirn-Schranke und somit über eine Kontrollinstanz. Mama Zwickel wusste genau, dass ich nicht Eske genannt werden wollte. Das löste in mir einen Widerstands-Tourette aus, der Frechheiten produzierte, die ich nicht steuern konnte. Würde ich jetzt ein Trennungsgespräch mit seiner Mutter führen?
Meine Bemerkung ignorierend, baute sie sich vor mir auf, brachte die Hände wieder in die Ausgangsposition an die Hüften und holte tief Luft. Warum hatte sie die Hände da nicht gelassen, als sie mit großen Schritten zu mir geeilt war? Das hätte dann wie Square-Dance ausgesehen, und wir hätten ein Tänzchen wagen können. Jetzt würde es eine Anklage werden, wo sie Richter, Staatsanwalt und Kronzeugin in einer Person sein konnte.
„Johannes sagte, dass ihr morgen nicht zum Essen kommt, weil du dich von ihm trennen willst?“
Da hatte der Sohn sicherlich recht. Aber mir war nicht klar, was sie so empörend fand: die Absage zum Sonntagsbraten oder die Trennung.
„Das stimmt. Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen, weil er ja weggerannt ist, statt sich mit mir zu unterhalten.“
„Findest du das nicht unverschämt?“
„Dass er weggerannt ist? Absolut.“
„Kay Eske! Du weißt genau, was ich meine.“
„Äh ... nein. Irgendwie nicht.“
„Du wohnst hier nahezu mietfrei, wir füttern dich durch, akzeptieren, dass unser Sohn dich liebt, bereiten euch ein Nest – und jetzt das?“
Heute Morgen hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich mich so schnell zu einer Trennung entschließen würde, und bis eben hätte ich nicht geglaubt, dass ich das dafür notwendige Gespräch mit Johannes’ Mutter statt mit ihm führen würde.
„Ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid und dass das alles sehr plötzlich kommt. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich vorübergehend die Wohnung einer Freundin übernehmen kann. Ich denke, so werden wir ein wenig Abstand kriegen.“
Hatte ich wirklich „wir“ gesagt? Jetzt dachte seine Mutter bestimmt, dass ich damit auch sie und ihren Mann meinte.
„Wenn du denkst, wir nehmen dich nach so einer Nummer wieder mit offenen Armen auf, hast du dich gewaltig getäuscht. Entweder du bleibst und kommst ganz schnell zur Vernunft, oder ich will dich hier nicht mehr sehen.“
Ich kannte ja „Ich heirate eine Familie“, aber auf „Ich trenne mich von seiner Familie“ war noch kein Drehbuchschreiber gekommen. Und ohne das richtige Skript wusste ich nicht, was die weibliche Hauptrolle – also ich – auf die Drohung der Mutter antworten sollte. Ich könnte mal an ihren ondulierten Haaren ziehen oder sie kneifen. Oder einfach auf ihr Angebot eingehen. Hilfe! Ich brauchte eine Werbepause. Bitte blendet ganz schnell eine Frau ein, die sagt, dass sie dank des täglichen Genusses einer weißlichen Zuckerplörre endlich wieder aufs Klo kann. Dieses Gespräch fühlte sich nicht real an. Johannes war weggerannt, seine Mutter drohte mir, und ich stand hier – eingerahmt von Zwickelhäusern – und erwartete die Vertreibung aus dem Paradies. Mir fehlten die Worte, zumindest die angemessenen, und ich beschränkte mich aufs Glotzen.
Doch das fasste Johannes’ Mutter bedauerlicherweise als Zustimmung auf. Schweigen als zustimmende Antwort war sie schließlich auch von ihrem Mann gewohnt.
„Ich sehe, wir haben uns verstanden.“
Ich sah das nicht so. Aber damit war auch das Kernproblem schon genannt. Keiner hier sah etwas so, wie ich es wahrnahm, oder wollte es so sehen.
„Ohne Johannes bist du doch nicht wirklich lebensfähig“, legte sie nach. „Wenn ich nur an das Chaos im Haus denke, das du täglich veranstaltest. Wie gut, dass ich immer nach dem Rechten sehe.“
„Du siehst nach dem Rechten? Du schnüffelst in unseren Sachen herum, tauchst ungefragt zu jeder dir genehmen Zeit auf und hast noch nie gefragt, ob ich das gut finde!“
„Ach, Kindchen, was weißt du schon vom Leben und wie man einen Haushalt führt?“
„Du hast recht. Es wird Zeit, dass ich das mal herausfinde. Alleine. Ohne euch. Ich gehe.“
Johannes’ Mutter zog die Augenbrauen hoch und sah mich an wie etwas, das die Katze mit reingebracht hatte. Jetzt wusste ich endlich, woher ihr Sohn diesen Blick hatte.
„Ich will dich hier nie wieder sehen. Sieh zu, dass du morgen weg bist. Viel zu packen hast du ja nicht.“
Mit hochgerecktem Kinn rauschte sie davon.
Mein Herz trommelte wie irre. Was hatte ich nur getan? Mich von Johannes’ Mutter und dem Fertighaus getrennt? Galt das, was gerade gesagt worden war, auch für Johannes? War das ein Trennungspaket, oder musste ich einige Unterpunkte noch separat verhandeln? Es konnte doch nicht sein, dass ein erwachsener Mann meinen Wunsch nach einem Beziehungsende nicht ernst nahm, seine Mutter schickte und die mir dann auch noch drohte? Doch, konnte es. Ich hatte es gerade erlebt. Eine Mutter, die einen egozentrischen Sohn herangezogen hatte, den sie sich wie eine Kiefer in den Garten pflanzte und regelmäßig verbal zurechtstutzte. Ich war das Unkraut, das sich soeben eigenhändig weggerupft hatte, und nun klopfte sie das Erdreich wieder fest. Ich musste hier weg! Auf dem Absatz drehte ich mich um und lief ins Haus.
Ein Cocktail aus Wut, Erleichterung und Hilflosigkeit jagte durch meine Eingeweide. Mein Telefon piepte und zeigte eine neue Nachricht an:
„Hallo Süße, Montagabend könnte es losgehen! Dann würde ich das komplette Vorbereitungsprogramm noch schaffen. Ist das zu schnell für dich?“