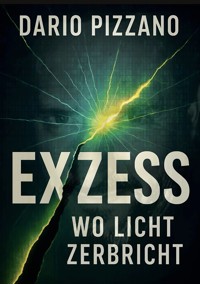
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
EXZESS - WO LICHT ZERBRICHT 14 Jahre nach seinem Longseller Exzess - Meine zwei Leben kehrt Dario Pizzano mit einem neuen Buch zurück - radikaler, tiefer, ehrlicher. Er erzählt von Klinikaufenthalten, Depressionen und dem Ringen mit der eigenen Zerbrechlichkeit - und von Begegnungen, die Hoffnung schenken: mit Nina Hagen, Paddy Kelly, Anselm Grün, Robert Spaemann und Papst Benedikt XVI. Aber auch mit Häftlingen in Hochsicherheitsgefängnissen, mit Jugendlichen, Zweiflern und Menschen am Rand. Ein Buch über den schmalen Grat zwischen Halt und Absturz. Und eine Einladung, im Zerbrechen ein neues Licht zu entdecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Wo das Licht zerbricht
2 Echo aus der Dunkelheit
3 Ein Schritt ins Offene
4 Es wartete
5 Ein Raum, der mich nicht kennt
6 Zwischen zwei Welten
7 Als ich mich zeigte
8 Wenn Geschichten sich kreuzen
9 Ein Bischof, ein Buch und ich
10 Die Brücke über das Dunkel
11 Wo Vertrauen wohnt
12 Alle echten Geschichten sind ewig
13 Gott hat keine Adresse
14 Wo Masken fallen und Menschsein aufblüht
15 Zwischen Kreide und Lebensfragen
16 Wenn Stille zu sprechen beginnt
17 Der Klang der Brüche
18 Holz in Bearbeitung
19 Marzahn: Zwischen den Zeilen
20 Risse im Licht
21 Gräfentonna – Wo Schatten sprechen
22 Das unsterbliche Gerücht
23 Berlin Wannsee, Eine Begegnung mit Robert Spaemann
24 Wo Glaube Raum sucht
25 Roter Berg – Ein Licht am Rand
26 Zurück in Mühlhausen – Zwischen zwei Leben
27 Buchmesse: Zwischen Welten
28 Zwischen den Welten und die Suche nach der Mitte
29 Im Kloster Münsterschwarzach – Eine Reise zu den Wurzeln des Schreibens
30 In Mühlhausen: Was in mir geblieben ist
31 Kleve – Mauern, die atmen
32 Reflexion: Vergebung und zweite Chancen
33 Heiligenkreuz – Im Herzen der Stille
34 Zwischen Heiligenkreuz und der Klinik – Wo gebrochenes Licht in Farben spricht
35 Begegnungen in der Gemeinde
36 Zwischen Welten und Grenzen
37 YOUCAT – Wo der Glaube lebendig wird
38 Türen, die sich öffneten – und was blieb
39 Im Herzen der Klinik
40 Weg zurück
41 Was bleibt, ist der Weg
42 Vieles hat sich verändert – nicht alles. Aber genug
43 Vom Bleiben – Über das Vatersein in einer brüchigen Welt
44 Mona
45 Weltkirche im Eichsfeld
46 Agnès Yoba - Mission beginnt im Herzen
47 Brücken in zwei Welten
48 Steine, die nicht schweigen - ein Abend mit Gunter Demnig
49 Stolpersteine im Innern
50 Nina Hagen, ein Überraschungsei und der Glaube
51 Stille Fragen, leise Antworten
52 Zwischen Brot, Wein und Wahrheit
53 Perlen aus den Wunden
54 Ein Klopfen an der Tür
55 Adrian. Rückblick auf einen Weg
56 Linda. Wenn die Scham spricht
57 Liebe, Masken und ein Papstbesuch
58 Und plötzlich kommt der Papst
59 Das gleiche Blut
60 Hieronymus. Die Begegnung auf der Straße
61 Die Erinnerung an Hieronymus
62 Fluss des Glaubens
63 Wenn Wasser wieder fließt
64 See you in heaven
65 Die Erinnerung an Schwester Leeza
66 Vielleicht beginnt es hier
67 Und dann wurde es still
68 Gott kniet sich nieder
Epilog – Wo Licht zerbricht
Danksagung
Einleitung
(Mühlhausen 2016)
Weihnachten in einer Nervenheilanstalt – ein Gedanke, der mir einst absurd erschien. Und doch bin ich hier. Wieder. Es ist Weihnachten 2016, und ich befinde mich zum zweiten Mal in einer psychiatrischen Klinik. Der Geruch von Kaffee und Desinfektionsmitteln liegt in der Luft, vermischt mit den gedämpften Stimmen der anderen Patienten. Die Einrichtung in Mühlhausen-Pfafferode ist schlicht, beinahe steril – ein Ort, der funktionieren soll, nicht trösten. Ich sitze allein im Aufenthaltsraum, während draußen die Dämmerung den Tag verschluckt. Vereinzelte Lichter im Klinikpark kämpfen gegen die frühe Dunkelheit. Kalte, funktionale Lichtquellen – aber sie sind da. Und manchmal reicht das.
Ich starre hinaus, lasse den Blick zwischen kahlen Bäumen und kleinen Lichtinseln wandern. Sie stehen da, unbeirrt. Warum fühlt sich das so weit entfernt an? Warum habe ich das Gefühl, mein eigenes Licht sei erloschen? Vielleicht war es nie wirklich hell. Vielleicht war ich nie Licht – nur eine Reflexion, ein Spiegel dessen, was andere sehen wollten.
Ich bin hier, weil mich wieder eine Episode schwerer Depression getroffen hat – heftig wie selten. Ich kämpfe seit Jahren. Mal mit mehr, mal mit weniger Kraft. Auch diesmal kam sie wie ein Feind aus dem Nichts. Als hätte sich mein inneres Gleichgewicht aufgelöst. Jeder Tag dehnt die Leere weiter aus.
Der Raum wirkt wie eine Bühne für das Schweigen: schlichter Tisch, metallene Stühle, kahle Bäume hinter der Fensterfront. Ein Mann im Morgenmantel schlurft vorbei – leerer Blick, mechanische Schritte.
Was ist aus mir geworden?
Draußen ist Weihnachten – Familie, Lichter, Wärme. Und ich bin hier. Umgeben von Menschen, die genauso zerbrochen wirken wie ich. Ich versuche, nicht an meine Frau und Kinder zu denken. Ob sie mich vermissen. Ob sie sich schämen.
„Wie fühlen Sie sich heute?“
Die Stimme meiner Therapeutin reißt mich aus den Gedanken. Ruhig, fast sanft, setzt sie sich mir gegenüber. Karierter Rock, schlichte Bluse, Klemmbrett in der Hand. Ihr Blick ist offen, wach – ihre Haltung wie ein kleiner Anker inmitten der inneren See.
Wie ich mich fühle? Schmerz, Scham, Erschöpfung – und Leere. Diese stille, schwere Leere in mir, die alles verschluckt.
„Wie soll ich mich schon fühlen?“ Meine Stimme klingt bitter. „Es ist Weihnachten, und ich bin hier. Nicht gerade der Stoff, aus dem Erfolgsgeschichten gemacht sind.“
Sie nickt, wachsam, wartend. Was würde passieren, wenn ich wirklich ehrlich bin? „Vielleicht sollten wir genau da ansetzen“, sagt sie. „Sie haben viel erlebt. Es könnte helfen, zurückzublicken – nicht nur auf die Schatten, sondern auch auf das, was Sie erreicht haben. Ihre Geschichte hat Kraft, Herr Pizzano.“
Ich lehne mich zurück, spüre die Härte der Stuhllehne. Zurückblicken? Der Gedanke macht mich müde. Schatten habe ich genug. Aber Licht?
Etwas regt sich in mir. Ein leises Flackern. Es begann mit meinem Buch. Exzess – Meine zwei Leben. Damals schien es, als hätte ich einen Weg gefunden, das Chaos in mir zu ordnen. Fremde, Prominente – sie kamen auf mich zu, sagten, wie sehr meine Worte sie berührt hätten. Doch jetzt frage ich mich: Haben sie wirklich verstanden, was ich geschrieben habe? Oder wollten sie nur das Licht sehen, das ich ihnen zeigte?
Ein Bild steigt auf: eine Aula in München, grelles Scheinwerferlicht, mein Herzklopfen während der Lesung. Die Frau in der ersten Reihe wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Am Ende sagt sie: „Ich habe mich in Ihren Worten wiedergefunden.“ Es war ein Licht, das ich geben konnte – auch wenn ich es selbst kaum spürte.
„Herr Pizzano?“ Frau Schuberts Stimme holt mich zurück. „Haben Sie das Gefühl, dass dieser Erfolg auch eine Last war?“
Natürlich war er das. Erwartungen, Verantwortung – sogar hier, wo niemand etwas erwartet, spüre ich sie noch.
„Vielleicht“, flüstere ich. „Es fühlte sich großartig an – eine Zeit lang. Aber irgendwann wusste ich nicht mehr, ob ich die Begegnungen wirklich erlebt habe oder nur… leer war.“ Sie sieht mich lange an, legt das Klemmbrett beiseite.
Ihre Stimme bleibt ruhig: „Haben Sie schon einmal daran gedacht, das wieder aufzuschreiben? So wie damals. Vielleicht hilft es, das alles zu sortieren – nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst.“ Ich nicke kaum merklich. Ihre Worte treffen auf etwas in mir, das längst verschüttet war. Ein leises Erinnern. Ein Aufbruch aus der Erschöpfung. Wenig später verlasse ich den Aufenthaltsraum. Der Flur ist still, die Luft kühl. Meine Schritte hallen auf dem Linoleumboden, als wäre ich allein auf einer Bühne. Ich öffne die Tür zu meinem Zimmer, lasse mich aufs Bett sinken. Ein Moment des Zögerns. Dann ziehe ich den Laptop aus der Tasche, klappe ihn auf. Ein grelles Leuchten auf dem Bildschirm. Der Cursor blinkt. Weiß auf Weiß. Ein stummer Herzschlag. Noch ist alles leer. Aber nicht mehr lange. Ich atme tief ein. Dann schreibe ich. Die ersten vier Wörter: Das Buch war draußen.
Vielleicht ist es Hoffnung. Vielleicht eine Illusion. Aber etwas ist da. Ein Anfang. Ein Funke, der in mir aufglimmt – zart, aber lebendig. Und genau hier, in diesem stillen Moment, lade ich dich ein, lieber Leser, mit mir aufzubrechen. Nicht als fertiger Mensch, nicht mit Antworten – sondern mit offenen Fragen, mit Brüchen, mit dem, was dich ausmacht. Vielleicht findest du in meinen Worten ein Echo deiner eigenen Geschichte. Vielleicht erkennst du dich zwischen den Zeilen. Vielleicht ahnst du: Du bist nicht allein. Denn wir alle tragen dieses Flackern in uns – auch wenn es manchmal kaum zu sehen ist. Und es lohnt sich, danach zu suchen. Denn manchmal bricht Licht genau dort, wo es am dunkelsten ist.
1 Wo das Licht zerbricht
(Eichsfeld 2010)
Das Buch war draußen.
Die erste Auflage frisch gedruckt, und die Nachricht begann sich langsam zu verbreiten. Es fühlte sich an, als hätte ich etwas Großes gewagt – etwas, das mein Leben verändern könnte. Doch was dann kam, überraschte mich mehr, als ich je erwartet hätte.
Ich war in einer Kleinstadt im Eichsfeld aufgewachsen, einer Region voller Tradition und Gemeinschaft – aber auch voller unausgesprochener Regeln. Hier kannte jeder jeden. Und wenn jemand „über das Gras hinauswuchs“, wurde schnell dafür gesorgt, dass er wieder klein gemacht wurde. Das galt auch für mich. Man hatte mich längst in eine Schublade gesteckt: der Sonnyboy, der charmante Draufgänger mit schnellen Autos und einem unbeschwerten Lächeln. Viele glaubten, alles über mich zu wissen. Vielleicht hatte ich sie in diesem Glauben gelassen – es war einfacher so.
Doch plötzlich war da dieses Buch: Exzess – Meine zwei Leben. Ich sprach von Ängsten, Einsamkeit, dunklen Nächten und inneren Kämpfen, die ich so lange verborgen hatte. Es war, als hätte ich mich entblößt. Und genau das stieß in meiner Heimat auf Widerstand. In den Cafés und an den Stehtischen der Bäckerei begann es leise, aber spürbar:
„Hast du gehört? Er schreibt da einfach so über seinen Vater!“, flüsterte jemand, als ich an der Theke stand, um Brot zu kaufen. Ich spürte die Blicke, die schnellen, nervösen Bewegungen, wenn sie sich abwandten. Einmal betrat ich eine Kneipe, um einen alten Freund zu treffen. Die Gespräche verstummten nicht ganz, wurden aber deutlich leiser. An diesem Abend spürte ich den unterschwelligen Widerstand besonders stark.
„Das ist er“, hörte ich eine gedämpfte Männerstimme hinter mir. „Der mit dem Buch. Glaubt wohl, er ist jetzt was Besseres.“ Ein scharfes Lachen folgte. „Hat ja schon immer eine große Klappe gehabt.“
Ich versuchte, die Bemerkungen zu ignorieren – doch sie trafen mich. Jeder Blick, jedes spöttische Wort schien etwas von mir abzutragen. Der Gedanke schoss mir durch den Kopf: Ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterland. Ein Satz, der mir in diesem Moment kaum Trost bot. Ein anderes Gespräch, ein anderer Tag. Ich traf einen alten Schulkameraden auf der Straße. Er musterte mich mit Argwohn. „Na, Pizzano“, begann er, „jetzt bist du also der große Schriftsteller. Glaubst wohl, du bist was Besseres?“
„Ich glaube gar nichts“, antwortete ich ruhig. „Ich habe nur meine Geschichte erzählt.“
Er lachte abfällig. „Deine Geschichte? Was soll das sein? Du hattest doch alles: Frauen, Autos, Partys. Jetzt willst du uns erzählen, wie schwer das war?“
Seine Worte trafen mich, weil sie zeigten, wie wenig er den Menschen hinter dem Bild des Draufgängers gesehen hatte. Wie oft hatte ich mich selbst hinter diesem Bild versteckt? Es schmerzte. Aber ich wusste: Ich hatte das Recht, meine Geschichte zu erzählen – und weiterzugehen. „Vielleicht verstehst du nicht, warum ich das Buch geschrieben habe“, sagte ich schließlich. „Aber ich hab’s nicht für dich geschrieben.“
Ohne seine Antwort abzuwarten, ging ich weiter. Es fühlte sich schwer an – und doch keimte ein leises Flackern von Entschlossenheit in mir: Ich habe meine Wahrheit gesprochen. Die Kritik beschränkte sich nicht auf persönliche Begegnungen. In der Lokalzeitung erschienen spöttische Kommentare, im Internet wurde diskutiert:
„Das Buch ist doch nur eine Abrechnung“, schrieb jemand. „Pizzano versucht, sich wichtig zu machen. Aber das ist Narzissmus.“ Während mich die Stimmen in meiner Heimat zu verschlingen drohten, zeigte das Buch an anderen Orten eine ganz andere Wirkung. Briefe und Nachrichten erreichten mich – aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, sogar darüber hinaus. Sie waren wie ein warmer Strom, der mich über die kalten Wellen der Kritik trug.
Eine Frau aus Hamburg schrieb: „Ihr Buch hat mir geholfen, meine eigene Vergangenheit zu verstehen. Es gibt mir Mut, endlich darüber zu sprechen.“ Ein junger Mann aus Wien: „Ich dachte immer, ich wäre allein mit diesen Gefühlen.“ Und ein Brief aus Bern berührte mich besonders: „Danke für diese Botschaft. Sie zeigt, dass wir alle unsere Geschichte erzählen dürfen.“ Manche schrieben ausführlich, andere nur ein paar Zeilen. Aber alle hatten etwas Gemeinsames: Sie zeigten, dass Worte Brücken bauen können. Eine ältere Dame aus Trier schrieb: „Das Buch hat mich an meinen verstorbenen Sohn erinnert. Ich habe durch Ihre Botschaft Frieden gefunden.“ Ein Student aus Köln: „Danke, dass Sie das Schweigen gebrochen haben. Depressionen sind kein Tabu.“
Diese Stimmen waren wie ein sanftes Licht in einer dunklen Nacht. Klein, aber klar. Nicht fordernd, sondern berührend. Sie machten mir Mut. Zeigten mir: Niemand ist wirklich allein. Doch ich wusste auch: Wo Licht ist, da zerbricht es oft zuerst an den schärfsten Kanten. In meiner Heimat war es an vielen Stellen zersplittert. Wie Glas, das auf Stein trifft. Manche sahen nur die Scherben – andere aber das Licht, das sich in ihnen brach. Ich spürte, dass dieser Weg mich verändern würde. Ich wusste nicht, wohin er führte. Aber ich war bereit, ihn zu gehen. Es war, als würde ein Funke in mir neu aufflammen – ein Licht, das durch die Dunkelheit leuchten wollte. Noch war es schwach. Aber es war da.
Und das genügte.
2 Echo aus der Dunkelheit
(Mühlhausen 2016)
Ich lese die Zeilen, die ich gerade getippt habe, und mein Blick bleibt daran hängen. Sie scheinen ein Eigenleben zu entwickeln, als würden sie mich fragen: Erkennst du dich darin wieder? Oder ist da nur ein Schatten von dem, was einmal war?
Ich lehne mich zurück, die Stuhllehne drückt unangenehm in meinen Rücken, aber ich bewege mich nicht. Das Licht des Bildschirms wirft fahle Schatten auf den Tisch, taucht den Raum in ein kaltes, künstliches Leuchten. Draußen ist es bereits dunkel, der Wind treibt die letzten Blätter des Winters über den Innenhof der Klinik. Ich höre das entfernte Summen der Neonröhren im Flur, das gelegentliche Knacken in den Heizungsrohren.
Ein bitteres Lächeln huscht über mein Gesicht. Es ist seltsam, die eigene Geschichte erneut vor sich zu sehen – schwarz auf weiß. Ich hatte gedacht, ich hätte mit dem Buch alles gesagt, das Kapitel meiner Vergangenheit abgeschlossen. Doch jetzt, Jahre später, holt mich die Frage ein: Wie viel von dieser Ehrlichkeit konnte ich selbst ertragen?
Ich spüre das Gewicht der Erinnerungen, als wären sie mit mir im Raum – lautlos, aber gegenwärtig, wie alte Freunde, die zu lange geschwiegen haben. Die Stimmen von damals kehren zurück – das abfällige Lachen in der Kneipe, der misstrauische Blick meines alten Schulkameraden. Ihre Worte hatten gestochen.
„Er glaubt wohl, er ist was Besseres.“ „Der mit dem Buch.“ „Der denkt, er hat die Wahrheit gepachtet.“ Sie trafen mich auf eine Weise, mit der ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte mich nackt gemacht, alles offengelegt – und doch schien es, als hätte kaum jemand wirklich hingesehen. Nur bewertet, kommentiert, verurteilt. Vielleicht schmerzte das am meisten: nicht die Kritik am Buch, sondern das Festhalten an einem Bild von mir, das längst nicht mehr stimmte. Oder vielleicht nie gestimmt hatte.
Ein Klopfen an der Tür reißt mich aus meinen Gedanken. Christian, ein Mitpatient aus Gräfentonna, steckt den Kopf herein. Müder Blick, ausgehöhlt. „Hast du ’ne Zigarette?“ fragt er leise. „Sorry, ich rauche nicht.“ Er nickt, murmelt etwas Unverständliches und schlurft davon. Seine Schritte hallen durch den Flur – ein müdes Echo gegen die weißen Wände. Ich frage mich, welche Geschichten hinter seinen Worten stecken. Aber hier fragt man nicht zu viel. Man wartet, ob jemand von selbst spricht.
Ich drehe mich zum Bildschirm. Der Cursor blinkt, unermüdlich. Erwartungsvoll. Doch die Worte kommen nicht. Stattdessen denke ich an die Briefe und Nachrichten, die mich damals erreichten. Die Gänsehaut beim ersten Mal, als ich eine dieser E-Mails öffnete. Eine Frau schrieb: „Ihr Buch hat mir geholfen, meine Depression zu verstehen. Es hat Dinge benannt, die ich nie aussprechen konnte.“ Ein junger Mann: „Ich habe erkannt, dass ich mit meinen Kämpfen nicht allein bin.“
Und dann die Nachricht aus Bern: „Danke, dass Sie das Schweigen gebrochen haben.“ Diese Worte fühlten sich an wie ein warmer Hauch auf rauer Haut. Klein, unscheinbar – aber voller Kraft. Wie kleine Lichter in einer Nacht, die sonst nur Schatten kennt. Während in meiner Heimat das Licht an den Bruchstellen zersprang, schien es anderswo hindurch. Ich frage mich: Ist das, was bleibt? Nicht das Urteil derer, die mich festhalten wollten in einem vertrauten Bild – sondern die Stimmen derer, die sich in meinen Worten wiedererkannt haben? Die mir ohne Maske begegnet sind.
Mein Blick wandert zum Fenster. Der Park draußen liegt still unter dem grauen Himmel. Der Wind bewegt sanft die kahlen Äste – wie dunkle Adern in der Luft. Es ist eine unwirkliche Stille, die den Raum füllt. Nicht leer, sondern dicht. Etwas regt sich in mir. Ein Gedanke, ein Funke. Vielleicht war die Geschichte nur ein Anfang. Ich hatte geglaubt, alles gesagt zu haben. Aber jetzt spüre ich: Es gibt noch mehr zu erzählen. Mehr zu verstehen. Mehr zu teilen. Ich erinnere mich an diesen Abend in der kleinen Zweizimmerwohnung. Müde Augen, scrollend durch Stellenanzeigen – bis ich diese Worte sah: „Gesucht: Mitarbeiter in der Bildungsarbeit. Aufgabe: Den Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft gestalten.“ Mein Herz stockte. Irgendetwas in mir regte sich, etwas, das ich längst begraben glaubte. Es war nur eine Zeile – unscheinbar zwischen all den anderen. Aber sie hatte mich berührt. Manchmal erkennt man erst später, wo das Licht zerbricht – und dass genau dort neue Wege entstehen.
Denn was danach kam, veränderte alles. Und ich spürte: Es war nicht das Ende. Es war ein leiser Beginn.
3 Ein Schritt ins Offene
(Eichsfeld 2010)
Es war ein Herbsttag wie gemalt – die Luft kühl und durchdrungen vom Duft feuchter Erde. Goldene und rote Blätter wurden wie flüsternde Erinnerungen vom Wind durch die Straßen getragen, während die Sonne schräg durch die Baumkronen brach, als wolle sie den Tag noch einmal in ein letztes, goldenes Licht tauchen, bevor der Winter alles in Grau hüllte. Irgendwo über den Dächern rief eine Krähe. Ihr Laut schnitt durch die Stille wie ein kurzes Aufwachen. Ich saß am Küchentisch, vor mir der Laptop. Der Geruch von frischem Kaffee stieg auf, die Wärme der Tasse in meinen Händen war vertraut und beruhigend. Doch in mir war keine Ruhe. Die Augen huschten über die Anzeigen, bis eine Überschrift mich festhielt: Mitarbeiter für Bildungsarbeit gesucht – Jugend- und Erwachsenenbildungshaus, Bistum Erfurt. Aufgabe: Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft fördern.
Ich las die Worte ein zweites, ein drittes Mal. Irgendetwas daran ließ mich nicht los. Es fühlte sich fast wie ein Zeichen an. In den letzten Wochen war so viel passiert: Die Veröffentlichung meines Buches hatte meine Heimatstadt aufgewühlt – mit überwältigenden, aber nicht nur positiven Reaktionen. Die Tuscheleien im Café, die missbilligenden Blicke auf der Straße – sie hatten Spuren hinterlassen. Ich fühlte mich wie ein Gefangener in meiner eigenen Stadt, nur noch die Summe ihrer Gerüchte. Und doch begann etwas in mir zu wachsen – eine Ahnung, dass dieses Buch nicht das Ende war.
Vielleicht ein neuer Anfang. Vielleicht ein Schritt hinaus aus der Enge. Der Gedanke an diesen Wechsel war wie ein leiser Windhauch, der durch ein geöffnetes Fenster streicht – noch kein Sturm, aber ein Versprechen. Thüringen war nur zehn Kilometer entfernt – ein anderes Bistum, ein anderer Ort. Aber diese kleine Distanz fühlte sich an wie eine andere Welt. Hier kannte mich niemand. Hier war ich nicht der Autor, über den getuschelt wurde, oder der Mann, über den im Internet spekuliert wurde.
Ich konnte meinem Heimatstädtchen entfliehen, wenn auch nur ein wenig. Und allein dieser Gedanke machte alles ein bisschen leichter. Doch so schnell die Hoffnung aufblitzte, so leise schlich sich auch der Zweifel ein. Wer glaubst du, dass du bist?, flüsterte eine Stimme in mir – zynisch, alt. Sie war wie ein Schatten, der mich begleitete. Du? In so einer Position? Das ist doch lächerlich. Ich spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. „Das ist doch verrückt“, murmelte ich. „Ich? Für diese Aufgabe? Wer sollte mich ernst nehmen?“ Vielleicht reicht es, dass einer an mich glaubt, dachte ich plötzlich. Und dieser eine war Schorse. Er war mein Fels, seit ich ihn das erste Mal getroffen hatte. Der einzige Mensch, der alles mit mir durchgestanden hatte – Kämpfe, Zweifel, Exzesse. Seine Loyalität war eine Liebe, die keine Worte brauchte. Ich griff zum Telefon, wählte seine Nummer fast mechanisch. Als seine Stimme erklang, ruhig und tief, fühlte ich mich sofort etwas sicherer.
„Was ist los, alter Freund?“ fragte er ohne Umschweife. „Ich hab da was gesehen“, begann ich zögernd. „Eine Stellenanzeige.“ „Erzähl.“
Ich schilderte ihm die Aufgabe, doch meine Worte klangen brüchig. „Aber ich hab doch keinen Uniabschluss, Schorse. Was sollen die von mir denken?“
Er schwieg kurz. Dann sagte er ruhig: „Das ist doch genau dein Ding. Du bist durch deine Erfahrungen gewachsen, nicht durch Abschlüsse. Und dein Fernstudium ist doch nicht nichts! Wer, wenn nicht du, kann diesen Dialog führen?“ Seine Worte ließen etwas in mir brechen – eine Mauer aus Angst, die ich lange nicht einmal bemerkt hatte. Es war, als würde jemand einen Stein von meiner Brust nehmen. Ich atmete tief durch, nickte, obwohl er es nicht sehen konnte. „Danke, Schorse.“ „Du weißt, dass ich recht habe“, fügte er mit einem Hauch von Humor hinzu. „Ruf mich an, wenn du die Stelle hast.“
Der Raum, in dem ich kurze Zeit später saß, war schlicht, fast karg, und doch strahlte er eine gewisse Würde aus. Die hohen Fenster ließen das spärliche Herbstlicht hineinfallen, das die alten Holzmöbel und Bücherregale in warmes Braun tauchte. Die Atmosphäre war förmlich und kühl zugleich – ein Ort, der nach altem Papier, Holzpolitur und einem Hauch von Weihrauch roch. Ich saß an einem langen Tisch. Die Hände vor mir gefaltet, die Finger fester ineinander verschränkt, als ich es mir eingestehen wollte. Mir gegenüber saßen drei Männer, die mich mit ruhiger Aufmerksamkeit musterten: ein Domkapitular, ein Diakon und der Leiter des Bildungswerks – Namen und Titel, die für mich bis vor Kurzem noch leer und fern geklungen hatten.
Jetzt saß ich ihnen gegenüber, als hätte ich eine unsichtbare Schwelle in eine neue Welt überschritten. Der Domkapitular, ein älterer Herr mit weich geschnittenen Gesichtszügen und schneeweißem Priesterkragen, eröffnete das Gespräch. Seine Stimme war ruhig, aber bestimmt. „Herr Pizzano, Sie haben Theologie nur nebenberuflich und nicht an einer Universität studiert. Warum glauben Sie, dass Sie für diese Stelle geeignet sind?“ Ich atmete tief durch. „Es stimmt, ich habe Theologie nur berufsbegleitend studiert“, begann ich. „Aber es war mehr als ein theoretisches Studium. Es war eine persönliche Auseinandersetzung mit meinem Glauben, mit meinen Kämpfen und meiner Biografie.“ Ich hob den Blick. „Theologie ist immer Biografie. Letztlich können wir doch nur bezeugen, was wir selbst erfahren haben. Und ich habe sie gelebt.“ Der Diakon nickte nachdenklich. „Ihr Buch hat viele Reaktionen hervorgerufen“, sagte er. „Positive wie negative. Wie gehen Sie damit um?“ Ich zögerte. „Es war nicht leicht. Die Kritik hat mich oft verletzt. Aber sie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns mit unseren Geschichten auseinandersetzen – gerade, wenn sie unbequem sind.“
Der Leiter des Bildungswerks sprach ruhig, aber bestimmt: „Herr Pizzano, hier im Eichsfeld reden die Menschen nicht gerne über ihren Glauben. Wie wollen Sie den Dialog fördern, wenn die Menschen schweigen?“ Ich spürte, wie sich die Spannung im Raum verdichtete. Ein Moment der Stille, dann sprach ich. Meine Stimme war ruhig, aber fest.
„Aber dafür bin ich gekommen.“
Der Satz stand im Raum, klar und offen. Der Domkapitular hob langsam den Kopf, musterte mich. Der Diakon lehnte sich zurück. Der Leiter des Bildungswerks zeigte ein kaum wahrnehmbares Lächeln. Niemand sprach – doch in der Stille lag Zustimmung. Als ich später den Raum verließ, fühlte ich, dass ich etwas Entscheidendes gesagt hatte – nicht nur zu ihnen, sondern auch zu mir selbst. Die kühle Herbstluft schlug mir entgegen, während die letzten Sonnenstrahlen die Dächer der Stadt in warmes Licht tauchten. Mein Herz klopfte schnell – aber nicht mehr vor Angst. Es war Aufregung. Hoffnung. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass auch mein Leben in dieses Licht getaucht werden könnte. Ich griff zum Telefon und wählte Schorses Nummer. „Ich hab’s hinter mir“, sagte ich, bevor er etwas sagen konnte. „Und?“ „Anders“, antwortete ich. „Aber es fühlt sich richtig an.“ „Das habe ich dir doch gesagt. Und, was jetzt?“ Ich ließ den Blick durch den Raum schweifen – auf das Chaos von Büchern und halbleeren Kaffeetassen. „Jetzt warte ich“, sagte ich. Und sah hinaus in den goldenen Abend, der mir zum ersten Mal nicht mehr fremd erschien.
4 Es wartete
(Mühlhausen 2016)
Die Erinnerung kommt nicht sanft. Sie bricht über mich herein. Ein Herbsttag. Ein Gespräch mit Schorse. Eine Entscheidung, die sich wie ein Neubeginn anfühlte. Ich sehe mich noch vor mir – entschlossen, fast trotzig. Weg vom Alten, hinein in etwas Neues. Ein Job, eine Aufgabe, ein Schritt nach vorn. Es war, als hätte jemand ein Fenster geöffnet, nachdem ich monatelang in einem stickigen Raum gefangen war. Das Buch war draußen. Die Reaktionen waren gemischt, aber sie hatten etwas in Bewegung gesetzt. Mit diesem Job schien ich endlich eine Richtung gefunden zu haben. Ich wollte nach vorn schauen. Keine Zeit mehr verschwenden, keine Energie mehr auf das, was gewesen war. Meine Heimat, die Ablehnung, die Zweifel – ich glaubte, sie hinter mir gelassen zu haben. Damals glaubte ich, der neue Job sei ein Befreiungsschlag. Jetzt weiß ich: Es war nur ein Teil der Wahrheit. Jetzt, hier in der Klinik, in der Stille meines Zimmers, frage ich mich: War das wirklich der richtige Weg? Das Zimmer ist klein und karg. Die Wände strahlen dieses leere Weiß aus, das nicht tröstet, sondern kühlt. Der Stuhl, auf dem ich sitze, knarzt leise, als wolle er die Stille kommentieren. Auf dem kleinen Tisch vor mir steht mein Laptop, daneben ein halb gefülltes Glas Wasser. Draußen, hinter dem Fenster, werfen kahle Bäume lange Schatten auf den Boden. Ein einzelnes Blatt schlägt gegen das Fenster, vom Wind getrieben – als wollte es erinnern. Ich starre hinaus, versuche die Gedanken wegzuschieben – aber sie kommen immer wieder. Wie Risse im Eis, die nie ganz heilen. Kann man einfach nach vorn rennen, ohne sich umzudrehen? Vielleicht war es kein Fehler, loszugehen. Aber vielleicht war es einer, den Schmerz nicht wirklich zu verarbeiten. Ich wollte stark wirken. Unverwundbar. Und sah nicht, wie brüchig ich längst war. Die Worte, die Ablehnung, die Blicke aus meiner Heimat – sie sind nicht verschwunden, nur weil ich sie ignoriert habe. Sie waren wie Stimmen unter der Oberfläche – leise, aber da. Wie ein Flüstern, das nie ganz versiegt.
Ein leises Klopfen unterbricht meine Gedanken. Es ist Christian, der oft stundenlang durch die Flure läuft. Sein Kopf erscheint im Türrahmen, sein Blick ist wachsam, als suchte er etwas, das er nicht benennen kann. „Alles okay bei dir?“ fragt er leise. Ich nicke, obwohl ich weiß, dass es nicht ganz stimmt. Er zögert, dann verschwindet er wieder. Seine Präsenz hinterlässt eine seltsame Ruhe – vielleicht, weil ich weiß, dass auch er kämpft. Ich schaue wieder hinaus. Die kahlen Bäume. Die langen Schatten. Als würde die Landschaft mir zuflüstern: Schau hin. Es ist Zeit. Vielleicht muss ich das tun. Die Schatten ansehen. Sie akzeptieren. Sie nicht bekämpfen, sondern ihnen zuhören. Dieses Mal wollte ich nicht weglaufen. Nicht wieder. Ich greife nach meinem Laptop. Das kalte Metall fühlt sich vertraut an. Ich öffne ein neues Dokument. Der Cursor blinkt. Ich beginne zu schreiben. Da war er also, dieser Neuanfang. Ein Job, eine Aufgabe, ein Schritt nach vorn. Aber während ich weiterging, ließ ich etwas zurück. Etwas, das mich einholen sollte. Die Worte fließen langsam, aber sie fließen. Und während ich schreibe, merke ich: Es geht nicht darum, die Vergangenheit abzuschütteln. Es geht darum, sie zu integrieren.
Die Zweifel, die Ablehnung, der Schmerz – sie sind nicht nur Wunden. Sie sind Teil meines Weges. Ich schreibe, weil ich verstehen will. Ich halte inne. Ich weiß, was gemeint ist. Ich kann es spüren, noch bevor ich es in Worte fasse. Der nächste Satz formt sich wie von selbst, klar, unverrückbar: Aber das, was ich hinter mir lassen wollte, war nie wirklich gegangen. Es wartete. Und jetzt klopfte es an. Die Schatten sind längst in den Raum getreten.
Und dieses Mal werde ich nicht wegsehen.
5 Ein Raum, der mich nicht kennt
(Eichsfeld 2010)
Das Büro war klein. Die Wände in mattem Beige wirkten nüchtern, funktional, ohne jede Spur von Persönlichkeit. Der Raum roch nach Papier, alten Ordnern und einem Hauch Bohnerwachs – ein Geruch, der mich an Lehrerzimmer aus meiner Schulzeit erinnerte. Es roch wie damals, wenn ich Strafarbeiten abgeben musste – nach Ordnung, die nicht fragte, wie es mir ging. Der Schreibtisch, die grauen Aktenschränke und der abgenutzte Bürostuhl sahen aus, als hätten sie schon viele Jahre und ebenso viele Geschichten hinter sich.
Auf dem Tisch lag ein Notizblock, daneben ein altmodisches Telefon und eine Bibel, die jemand sorgsam bereitgelegt hatte. Ich blieb in der Tür stehen, ließ den Blick schweifen, nahm das matte Schimmern des Linoleumbodens wahr, der unter meinen Schuhen kaum ein Geräusch machte. Der Raum war still. Zu still für jemanden, der bisher in lebhaften Umgebungen gearbeitet hatte – in Bars, Clubs oder bei Lesungen voller Menschen. Diese neue Stille fühlte sich anfangs fast bedrohlich an. Sie war nicht einfach nur Abwesenheit von Geräuschen. Sie war eine Leere, die mich zwang, mich selbst zu hören. Ich setzte mich langsam auf den Bürostuhl. Das Leder knarrte unter meinem Gewicht – ein trockenes, fast resigniertes Geräusch, als wäre der Stuhl müde von all den Menschen, die hier gesessen hatten. Mein Blick wanderte über die kargen Möbel, blieb an der Bibel hängen, dann am schlichten Kruzifix an der Wand gegenüber. Es war der erste Tag in meinem neuen Leben, aber nichts fühlte sich neu an.
Es war, als hätte ich eine Bühne betreten, deren Kulisse noch auf das alte Stück eingestellt war. „Das bist jetzt du, Dario“, flüsterte ich mir zu. „Hier beginnt etwas, das größer ist als du.“ Doch sofort schlich sich ein anderer Gedanke ein: Was, wenn ich es nicht schaffe? Die Zweifel krochen wie Schatten aus den Ecken des Raums. Ich schüttelte den Kopf, als könnte ich sie dadurch vertreiben. Wie bin ich überhaupt hier gelandet? Ich bin doch kein Theologe, kein typischer Mitarbeiter der Kirche. Wenn man mich fragt, wo ich herkomme, sage ich meist: aus einer Kneipe, nicht aus einem Priesterseminar. Was, wenn sie irgendwann merken, dass ich hier nur provisorisch reinpasse – wie ein Klappstuhl im Chorgestühl? Das Ticken der Wanduhr schnitt in die Stille wie ein Metronom, das meinen Herzschlag begleitete. Es war eine Stille, die ich früher gehasst hatte – weil sie mich zwang, mich selbst anzusehen. Ich fühlte mich wie ein Zuschauer meines eigenen Lebens. Ein Mann, der durch eine Tür getreten war, hinter der er sich nicht sicher war, ob er wirklich willkommen war.
Dann waren da die Schwestern. Die Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel. Bereits in den ersten Stunden hier hatte ich gespürt, dass sie etwas Besonderes ausstrahlten. Sie lebten im Haus, waren Teil dieser eigenartigen Gemeinschaft aus Priesterseelsorgern, Gemeindereferenten und Dozenten – und doch wirkten sie nicht abgehoben, nicht fern, sondern greifbar. Echt. Die Schwestern waren nicht nur ein geistlicher Ankerpunkt, sie waren auch voller Wärme und Lebendigkeit.
In ihrer Gegenwart fühlte ich mich geborgen – als hätten sie von Anfang an einen stillen Bund mit mir geschlossen. Eine von ihnen hatte mir beim Vorübergehen leise zugelächelt – ein Lächeln, das blieb. Eine von ihnen, Schwester Angela, begegnete mir noch an diesem ersten Vormittag. Mit ihrer ruhigen, festen Stimme begrüßte sie mich. Ihre Augen strahlten eine Mischung aus Weisheit und kindlichem Vertrauen. „Es ist schön, dass Sie da sind, Herr Pizzano“, sagte sie. „Wir brauchen Menschen, die zwischen den Welten stehen. Gott hat Sie hierhergeführt.“
Ihre Worte trafen mich tief. Zwischen den Welten stehen – genau so fühlte ich mich. Doch sofort stieg wieder dieser Gedanke in mir auf: Was, wenn sie sich irrt? „Wissen Sie“, fuhr sie fort, „ich habe meinen Weg auch nicht immer verstanden. Als ich ins Kloster ging, dachte ich, ich müsste perfekt sein, um Gott zu dienen. Aber ich habe gelernt: Gott will keine Perfektion. Er will unser Ja. Den Rest überlässt er nicht uns – sondern seiner Gnade.“
Ich schluckte. Es war ein Satz, den ich so noch nie gehört hatte. Aber etwas in mir wollte glauben, dass er wahr war. Vielleicht konnte ich das geben. Dann erklang plötzlich eine Glocke aus der kleinen Kapelle des Hauses. Der Ton war weich, aber bestimmt, und seine Vibration schien durch die stillen Flure zu wandern. Für einen Moment saß ich einfach da und ließ den Klang in mir nachhallen. Katharina klopfte an meine Tür. „Wir beten jetzt den Engel des Herrn. Wenn Sie möchten, können Sie dazukommen.“ Ich zögerte.
Ich war nie der Typ gewesen, der sich in Gebetskreisen wohlfühlte. Aber irgendetwas in mir ließ mich aufstehen. Ich folgte ihr in die Kapelle. Die Kapelle war schlicht, mit weißen Wänden und einfachen Holzbänken, doch die Atmosphäre war tief und still. Die Schwestern, Priester und Mitarbeiter hatten sich versammelt und begannen zu beten. Der Rhythmus der Worte, die klare Struktur des Gebets – es war mir fremd, und doch hatte es etwas Tröstliches. Eine der Schwestern hatte die Augen geschlossen, ein anderer legte die Hände gefaltet auf die Knie, als würde er sich selbst darin bergen. Mein Atem wurde langsamer. Irgendetwas in mir wurde still. Früher hätte ich so etwas nicht ertragen können. Stille war damals mein Feind. Sie zwang mich, mich selbst zu hinterfragen. Doch hier war die Stille anders. Sie war nicht leer, sondern gefüllt mit einer Gegenwart, die ich nicht benennen konnte. Vielleicht ist es genau das, was ich lernen muss – Vertrauen in diese Unterbrechungen. In die kleinen Momente, in denen Gott mir zeigt, dass ich nicht allein bin. Am Ende des Tages saß ich noch einmal allein in meinem Büro. Ich blickte auf die Bibel, fuhr mit den Fingern über den Einband. Der Raum hatte sich nicht verändert, aber irgendetwas in mir schon.
Und dann begriff ich es: Ich bin ein Zeuge. Kein Akademiker, kein Professor – ein Zeuge. Geboren aus einem chaotischen, gelebten Leben. Zum ersten Mal hatte ich nicht das Gefühl, mich beweisen zu müssen. Gott hatte ein Licht in meiner Dunkelheit entzündet. Und nun war es meine Aufgabe, dieses Licht weiterzugeben. Was auch immer die Menschen mich nennen würden – ob Akademiker, Glaubenszeuge oder einfach nur Dario – war letztlich egal.
Ich wusste: Es ging nicht um mich. Sondern um das, was Gott in meiner Seele getan hatte. Danke, Gott. Ich habe Ja gesagt. Hilf mir, es weiter zu sagen.
6 Zwischen zwei Welten
(Mühlhausen 2016)
Ich klappe den Laptop zu. Für einen Moment bleibt der schwache Nachhall des letzten Satzes wie ein Echo im Raum stehen. Mein Blick wandert durch das Zimmer. Die Heizung summt leise, ein fahles Winterlicht schiebt sich durch die Jalousien und zeichnet helle Streifen auf den Boden. Draußen hängt der Himmel grau und schwer über dem Klinikpark, als hätte er das Atmen eingestellt. Die Erinnerung ist plötzlich da – wie ein Duft, den man erkennt, bevor man ihn benennen kann: Der erste Tag im neuen Job. Das Büro. Die Bibel auf dem Schreibtisch. Die leisen Stimmen im Flur. Der Geruch nach Bohnerwachs und Papier. Schwester Angela mit ihrem festen, warmen Blick. Und Schorses Stimme am Telefon, die mir den Rücken gestärkt hatte. Es wirkt, als sei das alles aus einem anderen Leben. Und doch liegt es nur ein paar Jahre zurück. Damals fühlte sich dieser Neuanfang an wie ein Sprung – nicht einfach von einem Ort zum anderen, sondern von einer Welt in eine völlig andere. Ich war jahrelang unterwegs gewesen in der Nacht: zwischen Barhockern, Bassläufen und flackernden Lichtern. Immer auf der Suche nach dem nächsten Moment, der mich vergessen ließ, wer ich wirklich bin. Ich kannte die Sprache der Clubs, die Codes der Events, das schnelle Lächeln, das Türen öffnet – und abends manchmal auch wieder schloss, wenn man nicht rechtzeitig verschwand.
Und dann, fast über Nacht, wurde ich „Herr Pizzano“. Mitarbeiter der katholischen Bildungsarbeit. Zuständig für den Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft. Inklusive E-Mail-Signatur mit Diensttelefonnummer. Es fühlte sich ein bisschen an, als hätte jemand dem DJ ein Messgewand übergeworfen. Manchmal frage ich mich, ob mein Körper damals überhaupt hinterherkam – ob nicht nur mein Name, sondern mein ganzes Inneres wie in einer falschen Kulisse stand. Keine Musik mehr, kein Lärm, keine Flucht. Stattdessen: Stille. Diese Stille. Anfangs war sie ein Fremder. Misstrauisch stand ich ihr gegenüber. Doch mit der Zeit wurde sie ein Raum. Ein Ort, der nichts forderte, sondern einfach nur war. Sie wurde ein Spiegel, in dem ich mich zum ersten Mal wirklich sah. Ich erinnere mich, wie ich anfangs oft das Gefühl hatte, ein Hochstapler zu sein. Als würde jemand plötzlich feststellen, dass ich nicht dazugehöre. Aber da war etwas Tieferes. Ein Flüstern. Ein innerer Ruf, der schon lange in mir lebte, lange bevor ich ihn verstand. Vielleicht war es nie ein Ruf nach oben, sondern ein Rufen nach innen – nach Wahrheit, nach Wurzeln.
Ich blicke aus dem Fenster meines Klinikzimmers. Der Park draußen liegt reglos da, als hielte er den Atem an. Die kahlen Äste der Bäume wirken wie dunkle Adern vor dem bleichen Himmel. Früher hätte mich diese Stille erschreckt – jetzt fühlt sie sich an wie eine Einladung. Ein Bild taucht auf, plötzlich, klar wie ein Fotoblitz: Meine erste Lesung. Der kleine Saal. Das gedämpfte Licht. Stimmen, die vor Beginn noch hallten, dann verstummten.
Mein Herz klopfte bis in die Fingerspitzen, die das Buch hielten wie einen Rettungsring. Ich sehe die Gesichter im Publikum – erwartungsvoll, still. Freunde, Fremde, Menschen, die mir ihre Zeit schenkten. Ich sehe mich selbst, wie ich zum Mikrofon trete. Und das erste Wort spreche.
Es war der Moment, in dem ich lernte, mich zu zeigen.
7 Als ich mich zeigte
(Eichsfeld 2010)
Der Tag der ersten Lesung war gekommen. Draußen fiel der Regen unaufhörlich vom grauen Himmel, prasselte in unregelmäßigen Rhythmen gegen die großen Fensterfronten des Bildungshauses. Jeder Tropfen schien ein Takt meines pochenden Herzens zu sein – unaufhaltsam, fordernd, schonungslos ehrlich. Doch in diesem Rhythmus lag keine Zuversicht, sondern eine aufwühlende, lähmende Unruhe. Es war, als würde der Regen mir ins Gesicht schlagen, mich immer wieder fragen: „Bist du bereit, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist?“ Vielleicht war der Regen nicht mein Feind – sondern der letzte Schleier, der mich vom Jetzt trennte.
Die kühle, klare Architektur des Hauses wirkte wie ein Spiegel meines inneren Zustands: geordnete Strukturen, hinter denen ein wildes Chaos tobte. Ich stand allein im leeren Saal, starrte auf die weißen Wände, die leeren Stuhlreihen – ein Raum voller Möglichkeiten, aber auch voller Bedrohung. Vielleicht war das die Generalprobe für eine andere Art, dazuzugehören. In meiner Hand hielt ich das Buch so fest, dass meine Finger verkrampften, als könnte ich es wie ein Rettungsring umklammern. Es fühlte sich an wie eine fremde Waffe, mit der ich mich gleich gegen mich selbst wenden würde. Ein Zittern durchlief meinen Körper. Ich flüsterte: „Was, wenn sie mich ablehnen? Was, wenn sie hinter die Worte schauen und sehen, wie klein ich wirklich bin?“ Meine Stimme zitterte, brüchig und verloren.
Die Worte hallten in der Leere wider, lösten sich auf wie Nebel – keine Antwort, keine Erleichterung. Meine Angst war wie ein Tier, das sich in meinem Bauch zusammenkrümmte, bereit, jeden Moment zu springen. Ich fragte mich, ob das alles ein Fehler war. Mein ganzes Leben hatte ich gelernt, eine Fassade aufrechtzuerhalten, und nun würde ich sie vor all diesen Menschen einreißen. Es fühlte sich an, als stünde ich nackt auf einer Bühne, bloßgestellt und wehrlos.
„Dario?“ Bernhards Stimme schnitt sanft durch die Stille. Ich zuckte zusammen, drehte mich um und sah sein vertrautes Lächeln. Warm, tröstend, aber auch fordernd – wie ein Freund, der dir Mut zuspricht, während du zögerst, einen Abgrund zu überwinden. Bernhard war nicht nur mein Freund, er war mein Verleger. Der Mann, der an mich geglaubt hatte, als ich selbst noch nicht wusste, wer ich war. Er war eigens aus Augsburg angereist, gemeinsam mit einigen Freunden, die mich ebenfalls auf ihrem ganz eigenen Weg begleitet hatten. Allein ihr Kommen war ein Zeichen. Er legte mir eine Hand auf die Schulter. „Das ist dein Moment. Alles ist bereit.“ Ich versuchte zu lächeln, doch meine Lippen fühlten sich taub an. „Aber bin ich das auch?“ Die Worte klangen hohl, fast wie ein Echo meines eigenen Zweifels.
„Du bist bereit,“ sagte er mit ruhiger Überzeugung. „Die Zweifel, die du fühlst, sind gut. Sie zeigen, dass dir das hier wirklich etwas bedeutet.“ Die Menschen strömten langsam in den Saal. Ihre Gesichter, vertraut und doch bedrohlich, schienen gleichzeitig Trost und Urteil zu verkörpern. Es war nicht nur Stille – es war Erwartung. Und diese Erwartung galt mir.





























