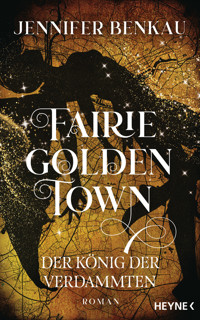
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fairiegolden Town-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nachdem die Proteste in Liverpool brutal niedergeschlagen wurden, steht Samuel Everett, der Anführer der Skysons, vor einer unmöglichen Entscheidung. Entweder er verrät die Fairies und mit ihnen die gesamte Stadt, oder seine große Liebe wird hingerichtet. Doch als Prinzessin der Diebe gibt sich auch Bria erst dann geschlagen, wenn ihr Herz nicht mehr schlägt. Zusammen beschwören die beiden einen Sturm herauf, und die Fairiegolden Town wird zum Zentrum einer nie dagewesene Rebellion zwischen Menschen, Fairies, Meerjungfrauen und Dämonen.
Enthaltene Tropes: Enemies to Lovers
Spice-Level: 3 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 838
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Die Stadt der Fairies schwebt in höchster Gefahr!
Nachdem die Proteste in Liverpool brutal niedergeschlagen wurden, befindet sich Bria in der Gewalt von Lord Mayor Chapman. Er droht sie hinrichten zu lassen, sollte Samuel Everett, der Anführer der Skysons und der heimliche Herrscher Liverpools, nicht auf seine Forderung, die Fairies zu verraten, eingehen. Doch damit würde Samuel auch Bria verraten, die gerade erst ihr magisches Erbe entdeckt hat. Während Samuel sich zwischen der Liebe zu seiner Stadt und der Liebe zu Bria entscheiden muss, setzt diese alles daran, sich aus ihrer Gefangenschaft zu befreien und die Fairiegolden Town, die inzwischen zu ihrem Zuhause geworden ist, vor Chapman und seinen radikalen Anhängern zu retten.
Als dann auch noch die Königin der Fairies in der Stadt auftaucht und ein uralter Dämon Liverpool erreicht, droht die magischste Stadt Englands in einem neuen Krieg zwischen Menschen und Fairies unterzugehen.
Die Autorin
Jennifer Benkau wurde im April 1980 in der Klingenstadt Solingen geboren. Nachdem sie in ihrer Jugend Geschichten in eine alte Schreibmaschine hämmerte, verfiel sie pünktlich zum Erwachsenwerden in einen literarischen Dornröschenschlaf, aus dem sie 2008 von ihrer ersten Romanidee stürmisch wachgeküsst wurde. 2013 erhielt sie den DeLiA-Literaturpreis für die Dystopie Dark Canopy. Sie lebt mit ihrem Mann, vier Kindern, zwei Hunden und einem Pferd zwischen Düsseldorf und Köln. Mit ihrer atemberaubenden Fantasy-Saga Fairiegolden Town hat sie Tausende von Fans begeistert.
JENNIFER BENKAU
FAIRIEGOLDENTOWN
DER KÖNIG DER VERDAMMTEN
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe: 07/2025
Copyright © 2025 by Jennifer Benkau
Published by Wilhelm Heyne Verlag
Copyright © 2025 der Originalausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Marion Meister
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT GbR, München, unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32324-0V002
www.heyne.de
Für uns, die ein Monster in sich tragen. Dann und wann mögen Zeiten kommen, in denen wir womöglich Monster brauchen.
I
Wir haben so viel Wissen und nutzen so wenig davon.
Wir erzählen uns Geschichten, aber lernen nicht aus ihnen.
Wir machen Fehler. Ein zweites Mal. Ein drittes Mal.
Wir reden viel und sagen nichts.
Wir sehen, ohne zu erkennen.
Und glauben, ohne zu hinterfragen.
Wir hören, hören hin und belauschen einander. Und hören doch nie zu.
Was wir lernen könnten, lassen wir unberührt, weil ein neuer Weg uns fremd ist und alles Fremde uns mehr sorgt als die altvertrauten Fehler.
Das. Das ist es, was mir im Kopf umhergeht, wenn es still wird.
Davon handelt meine Geschichte.
Kapitel 1
Samuel
Es ist schwer, einen Menschen zu zerstören.
Selbst aus dem Krieg waren etliche zurückgekommen, wenn auch kaum jemand so, wie er hingegangen war. Vieles an einem Menschen ist verdammt zäh.
Aber das Gute auszulöschen, das, was die Naivlinge als das Menschliche bezeichnen, das war unsagbar leicht.
Der Rest, all das, was übrig blieb, wurde zu etwas wie Samuel Everett.
Er rannte mit wundgescheuerten Füßen. Mit zerschossenen Knien und schweren Beinen, an denen das Blut herabtropfte.
Er würgte, während er lief. Japste nach Luft, aber da war keine, die sich atmen ließ. Nur dichter Rauch aus verbranntem Fleisch, versengtem Haar, kochendem Blut. Die Augen tränten ihm davon.
Die Stimme war ihm auf den Fersen. Schattengleich folgte sie ihm, wohin er auch floh. Das Blut rauschte in seinen Ohren und auf irgendeine Weise hörte er sich selbst schreien, obwohl kein Laut über seine Lippen kam. In ihm schrie es unaufhörlich.
Die Geräusche übertönten die Worte der Stimme, nicht aber den höhnischen Hass, mit der sie sprach. Gelegentlich mit ihm. Vor allem über ihn.
Versager. Jämmerlicher Versager.
Er lief weiter, weil in seinem Kopf nur ein Gedanke Platz hatte. Nur ein Name.
Er musste Bria finden. Sie würde sterben, wenn er diesmal versagte.
Er rannte durch schmale Gassen zwischen Häusern, an denen die Flammen emporleckten. Schemen schwankten in der Feuerhitze hinter den verkohlten Fensterscheiben, schlugen mit den Fäusten dagegen, bis ihre Hände am schmelzenden Glas festbackten. Bollernde Geräusche deuteten auf Türen hin, hinter denen die Menschen verglühten. Er lief an ihnen vorbei.
Er musste Bria finden.
Irgendwann gab die erste Tür nach. Ein Mann stolperte heraus, stürzte auf ihn zu und fiel vor ihm auf die Knie. Mit verbrannten Händen fasste er nach seiner Hose und klammerte sich am Stoff fest.
Er konnte nicht mehr weiter.
Ein zweiter Mensch rannte auf ihn zu, packte ihn und riss ihn zu Boden.
Und dann kamen sie alle. Frauen in blutdurchtränkten Kleidern. Männer in zerrissenen Anzügen. Er sah in Gesichter, in denen Haare und Wimpern zu Klumpen verschmolzen waren, in denen sich Haut vom Fleisch löste und Fleisch von den Knochen. Leere Augenhöhlen starrten ihn an, und er erkannte trotzdem jede Person wieder.
Überall waren diese Hände, Klauen und skelettierte Finger.
Sie hielten ihn fest. Er hatte sie in diese Hölle gebracht. Nun sorgten sie dafür, dass er blieb.
Nun, ein Teil von ihm musste sich eingestehen, dass es fair war. Man zahlte immer einen Preis für das, was man nahm. Und er hatte viel genommen.
So viele Leben für den Traum von einer freien Stadt.
Es war sehr schwer, einen Menschen vollends zu zerstören. Selbst jetzt war noch genug übrig, das ihn zwang, sich aufzurichten und weiterzulaufen.
Für Bria. Es war seine Schuld, dass Chapman sie in seiner Gewalt hatte. Wenn ihr Gesicht zwischen denen der Leichen erschien – dann würde er aufgeben. Keinen Moment vorher.
Er stürzte, kam nicht mehr auf die Beine und konnte nur noch auf den Knien vorwärts rutschen. »Bria!«
Die Schuhe, die vor ihm auftauchten, gehörten nicht zu Bria. Er hob den Blick. Eine elegante Bundfaltenhose, Sakko, ein strahlend weißes Hemd. Darüber ein Lächeln in einem vollkommen unversehrten Gesicht. »Wie schön, dich zu sehen, Samuel.«
»Du bist tot, Pickens. Tot. Ich habe dich erschossen.«
Der Mann kniete sich hin. »Aber nein. Du würdest mir doch nicht wehtun, Sammy. Dein Vater wäre sehr enttäuscht. Und wir sind Freunde, du und ich.«
James Pickens irrte sich. Samuels Waffe lag im Feuer. Er griff danach. Sie glühte und brannte große Blasen in seine Hände, aber er drückte ab.
»Samuel, nicht!«
Er drückte ab!
»Sam!«
Drückte ab.
Drückte … Er stockte. Das Gesicht. Er hatte Pickens das widerliche Grinsen aus der Visage geschossen, aber die blutige Masse aus Knochen und Fleisch war nicht länger James Pickens. Er erkannte die blauen Augen, das mittelblonde lange Haar.
Er hatte nicht Pickens erschossen.
Es war Selina.
»Sam!«
Er richtete sich auf. Kalter Schweiß überzog seine Brust, seinen Nacken und sein Gesicht.
Selina sah ihn besorgt an. Nun seufzte sie. »Na endlich. Ich habe dich kaum wach bekommen. Alles in Ordnung?«
Er blickte sich um. Keine Feuer. Keine Leichen. Keine Waffe und kein James Pickens. Nur das höhnische Murmeln seines Vaters begleitete ihn, aber wann wurde er das schon los?
Er befand sich in einem Schlafzimmer in Darraghs Haus in London. Vor dem offenen Fenster raffte sich die Dunkelheit zusammen und die Uhr an der Wand zeigte im schwachen Licht von Selinas Handlampe drei Uhr morgens.
»Was machst du hier?«
»Du hast so laut im Schlaf geschrien, dass ich drei Zimmer weiter wach geworden bin. Vermutlich ist das halbe Haus jetzt auf den Beinen.«
»Eher nicht.« Darragh hatte noch tiefer ins Glas geschaut als Samuel selbst. Und niemand hier hatte so feine Sinne für die Nöte anderer wie Selina.
»Du musst damit aufhören, Samuel.«
»Aufhören zu schlafen?«
»Aufhören zu trinken, damit du schlafen kannst.«
Er knurrte. Es lief aufs Gleiche hinaus.
»So kann es nicht weitergehen.«
Sie hatte recht. Es geschah wieder und wieder, dass er nach dem Whisky schreiend aus dem Schlaf hochfuhr, weil ihn im Traum die Schuld verbrannte und die Toten verfolgten.
Aber ohne Whisky schlief er nicht, denn dann verfolgten ihn die Lebenden. Eine ganze Stadt voll Lebender, denen er den Rücken zugewandt hatte.
Er hatte sie nicht nur verlassen. Er würde jeden Einzelnen von ihnen verraten.
»Du hast recht. Ich muss etwas tun.«
Selina nickte mitfühlend. Sie hatte allerdings keine Vorstellung, was Samuel meinte. Vermutlich glaubte sie, er wolle weniger trinken und damit wäre es erledigt. Doch die Katastrophe wartete dahinter. Er musste endlich seine Entscheidung akzeptieren. Er hatte eine Wahl getroffen, nicht freiwillig, aber was tat man schon freiwillig? Nun galt es, den Preis zu zahlen, und der Preis war eine Stadt. Seine Stadt. Fairiegolden Town.
Es war schwer, einen Menschen zu zerstören. Das Gute auszulöschen, war dagegen unsagbar leicht. Da konnte es sich noch so trotzig wehren.
Kapitel 2
Kayleigh
Seit Stunden trommelte der Regen auf das Dach des Wohnwagens. Ein endloses Klopfen an die Wände ihrer kleinen Zuflucht. Die Nacht schien mit jedem Tropfen dunkler zu werden, so dunkel, dass die Finsternis mit langen, dünnen Fingern erst durch die Fensterläden und dann durch das schwache Licht der Öllaterne tastete. Als wollte sie nach ihnen greifen. Still und unbemerkt, um die flackernde Hoffnung in ihnen auszulöschen.
Kayleigh legte den Füllfederhalter beiseite und dehnte ihren verspannten Nacken. Jetzt nur nicht die Schwermut siegen lassen. In den Nachtstunden kreisten ihre Gedanken allein um Bria. Sie musste sie finden, sie retten. Doch es gab keine Spur, keinen Hinweis, wo Chapman sie gefangen hielt.
Kayleigh hatte die Meerjungfrau um Hilfe gebeten, nur für den Fall, dass Bria auf ein Schiff gebracht wurde. Aber selbst, wenn sie sie auf einem entdeckte – was sollten sie schon ausrichten? Piraten anheuern, um das Schiff zu kapern? Nun, das war wenigstens eine Idee.
Die unheilvollen Worte des Dämons hallten wie Echos in ihren Gedanken wider. »Du weißt, dass du keine Chance hast, deine Freundin zu retten, Tinkerin. Für mich wäre es ein Leichtes.«
Seine Anwesenheit im Wagen lag wie eine Klaue um ihre Kehle, die jederzeit brachial zudrücken konnte. Aber sie musste sie ertragen, denn nirgendwo sonst konnten sie auf ihn aufpassen. Chapman ließ die Stadt Tag und Nacht durchforsten. Offiziell fahndeten seine Leute nach den Tätern, die für das Chaos am Hafen verantwortlich waren. Doch in Wahrheit war er hinter dem Dämon her. Und mit Gewissheit streiften auch die Skysons nicht auf der Suche nach Pilzen durch Wald und Heide. Wenn Crocell in die falschen Hände geriet und freikam …
Er hatte ihnen unzählige Male in den bildhaftesten Worten geschildert, was dann geschehen würde. Formulierungen wie: »Die Gedärme der Menschen werden wie Weihnachtsschmuck aus den Baumkronen hängen, während ihre ausgeweideten Körper mit euch tanzen, weil ich es ihnen befehle«, gehörten noch zu den harmlosen Drohungen, die aus dem Korb gekommen waren, der so unschuldig auf der Küchenzeile stand.
Vielleicht log er – auch wenn Rory behauptete, er würde niemals lügen, nur nicht immer alles aussprechen. Kayleigh wollte keinesfalls herausfinden, wie viel Macht dieser uralte Dämon besaß, sollte er jemals wieder aus seinem geflochtenen Gefängnis gelangen, in das Rory ihn mit etwas Feenmagie und einem Übermaß an Mut gesperrt hatte.
Ihr schauderte, als sie an ihren ersten und letzten Versuch dachte, seine Emotionen zu erkunden. Ein brutaler Schmerz war ihr durch Kopf, Herz und Seele gefahren. Ein Gefühl, als kochten ihre Gedanken und brächten ihr Hirn zum Platzen wie einen verstopften Kessel. Noch Tage später war ihr Blut aus Nase, Augen und Ohren gelaufen. Aber besser, sie dachte an etwas anderes. Manchmal war ihr, als bemerkte Crocell es, wenn sie über ihn grübelte, und dann begann er von vorn, ihr und Rory das Schlimmste anzudrohen. Seitdem Rory dem Korb allerdings am Tag zuvor einen Tritt verpasst hatte, mit dem sie sich beim Liverpool Football Club hätte bewerben können, war er still – und das sollte besser auch so bleiben.
Rory saß ihr am Tisch gegenüber, auf der Bank, auf der sie jede Nacht schlief, und wo auch Bria geschlafen hatte. Noch immer beugte sie sich über ihr Papier und ihr rotes Lockenmeer nahm Kayleigh den Blick auf ihr Gesicht. Nur das leise Kratzen des Füllfederhalters verriet, dass sie nicht eingedöst war, sondern trotz der späten Stunde nach wie vor verbissen die Zeilen abschrieb, die Kayleigh ihr vorgegeben hatte. Das schummrige Licht spielte in ihren grün schimmernden Flügeln, wenn diese sich regten. Das taten sie ständig. Rory konnte nicht still sitzen, ohne ihre Füße, ihre Hände oder ihre Flügel zu bewegen. Eigentlich bewegte sich alles an ihr ununterbrochen – selbst im Schlaf.
Rory erinnerte sie so sehr an Bria, dass es manchmal wehtat, sie nur anzuschauen.
Bria … immer wieder geisterten Kayleighs Gedanken zu ihr. Von ihr gab es kein Lebenszeichen, seit Lord Mayor Chapman sie festgenommen und seinem Widersacher Samuel Everett demonstriert hatte, dass er nicht davor zurückschreckte, eine Frau foltern zu lassen. Allein die Gedanken daran stießen bohrende Finger in Kayleighs Nacken.
Chapman hatte mit Bria auch Samuel in der Hand, und Kayleigh war nicht sicher, wie weit beide gehen würden. Samuel war der Cormorant – der Anführer der Skysons, und damit vermutlich der mächtigste Mensch in Liverpool. Die Stadt, in der Fairies selbst nach dem Krieg noch so frei leben konnten wie nirgendwo sonst in Europa. In der es keine Checkpoints zwischen den Vierteln gab und wo die Gleichberechtigung fast greifbar schien! Liverpool – Fairiegolden Town – war Samuels Lebenswerk. Er hatte alles dafür gegeben, selbst all seine Ideale und seine eigene Identität. Doch nun war er bereit, die Stadt in die Hand seiner Feinde zu legen, für das Leben der Frau, in die er sich verliebt hatte.
Kayleigh hatte die zerstörerische Kraft, die zwischen Bria und Samuel aufgekeimt war, von Anfang an gespürt. Bereits bei ihrer ersten Begegnung im Drunken Dragonfly, hatte sie ihr vernichtendes Potenzial gefürchtet, nur ihre Schlussfolgerung war die falsche gewesen. Sie hatte angenommen, Samuel sei ein Risiko für Bria. Dass Bria für Samuel die viel größere Gefahr war, damit hatte sie nicht gerechnet.
Ihr Blick ging zum Fenster. Regenfäden rannen an der Scheibe herab und fingen das schwache Licht der Lampe. Es sah aus, als wuschen sie es fort. Wo bist du nur, Bria?
Sicher war nur, dass sie nicht mehr im Liverpool Prison war. Eliah und Selina hatten Kontakte zu Wärtern, und niemand von ihnen hatte sie dort mehr gesehen.
Gerüchten zufolge war sie nach London gebracht worden, doch das roch nach einer falschen Fährte.
»Gibst du mir das Tintenfass, bitte? Meine Füllfeder ist leer.« Zum ersten Mal seit sicher zwei Stunden sah Rory auf. Ihre hellen Augen waren vor Erschöpfung gerötet.
Kayleigh war auch müde, aber erst, wenn sie sich kaum noch wach halten konnte, war ihr das Einschlafen möglich. Und selbst dann brauchte sie Unterstützung von ihren entspannenden Teemischungen.
Es war viel zu viel passiert, um noch ruhig zu schlafen.
Kayleigh hob das Tintenfass an und hielt es an die Lampe, sodass Rory durch das blassblau gefärbte Glas hindurchsehen konnte. »Meine auch. Wir müssen erst neue Tinte besorgen. Ich fürchte, das wird gar nicht so einfach.«
»Wegen der Ausgangssperren?«
»Übermorgen ist Markttag. Die letzten Male habe ich dort nur noch einfache Lebensmittel gesehen.« Und das zu Preisen, die ihr die Sprache verschlagen hatten. »Aber ich höre mich um, ob man irgendwo Tinte ertauschen kann. Und kaufe eine Handvoll Erbsen. Ich kann die Zwiebeln langsam nicht mehr ertragen.«
Rory beugte sich vor, um einen Blick auf den Text zu werfen, den Kayleigh verfasst hatte. »Wie weit bist du denn gekommen?«
»Deine Eltern haben gerade geheiratet«, antwortete Kayleigh mit einem Lächeln. »Aber glaub nicht, ich würde ihre Hochzeitsnacht beschreiben.«
Rory kicherte. »Das würde ich auch nicht lesen wollen.«
Sie hatte Kayleigh gebeten, für sie die Geschichte ihrer Familie aufzuschreiben; aus den Leben von Menschen zu erzählen, die Rory selbst nur noch aus Erinnerungen kannte, die bereits zu verblassen drohten. Von Menschen, die sie geprägt hatten, bevor der Krieg sie ihr genommen hatte. Rory konnte für ein solch umfangreiches Projekt noch nicht gut genug schreiben, aber sie wünschte sich, dass etwas von ihren Eltern blieb. Für sie, für die Welt, vielleicht für irgendjemanden, der eines Tages von ihnen lesen wollte.
»Du lernst doch zu schreiben«, hatte Kayleigh gesagt. »Warum bist du so ungeduldig und wartest nicht, bis du die Geschichten selbst aufschreiben kannst?« Die Frage war rhetorischer Natur. Rory war ungeduldig, weil sie eine Fee war.
Doch die Antwort hatte Kayleigh zuerst überrascht und dann berührt. »Ich habe einen Dämon in meinem Korb. Er ist fast eine Art Freund für mich geworden. Ein sehr seltsamer Freund, der mich töten möchte. Ich habe eine Art Bombe gezündet, als ich Crocell bannte. Ich kann sie ticken hören. Es wäre naiv, zu denken, ich hätte noch genug Zeit, um die Geschichte selbst zu schreiben. Aber womöglich bleibt nach dem Knall noch jemand übrig, der sie lesen sollte, um etwas daraus zu lernen.«
Rory war still geworden und auch Kayleigh hatten die Worte gefehlt. Die Fee schien immer so unbelastet. Als verstünde sie gar nicht, in welch gefährlichen Zeiten sie lebte, in welch heikle politische Phase sie geraten war. Die Situation in Liverpool hatte die Kraft, einen neuen Weltkrieg zwischen Fairies und Menschen auszulösen – und in Rorys Korb lag die schrecklichste und mächtigste aller Waffen.
Nur selten gab Rory zu erkennen, dass sie sich der Bürde, die sie trug, überaus bewusst war.
»Aber Lesen und Schreiben«, hatte sie dann eifrig ergänzt, »das will ich trotzdem lernen! Dumm war ich lang genug!«
Kayleigh lächelte bei der Erinnerung. Rory war so klug und wusste doch so wenig. Ihre Intelligenz hatte nichts mit Bildung zu tun, die man ihr verwehrt hatte, aber das konnte sie ihr hundert Mal sagen – die Fee glaubte es ihr hundertundein Mal nicht.
»Wie weit bist du mit den Sätzen gekommen?«, fragte Kayleigh, während sie das Tintenfass aufschraubte und schräg hielt, in der Hoffnung, dass die letzten Tropfen zusammenliefen und in einen ihrer Füllhalter gezogen werden konnten. »Lies doch mal vor.«
Rory räusperte sich. Das Abschreiben der Worte gelang ihr immer besser, aber das Entziffern fiel ihr schwer. »Mein Name ist Rory Weaver. Ich komme aus einem Ort bei … Boston. Ich be… beha… behau… … Behaue?«
»Behaupte«, half Kayleigh.
»Ich behaupte oft, ich sei nicht be… beso… besonders klug. Aber die Wa… Wahr… Wahrheit ist … dass ich ganz allein einen Dä… Dämon gefangen habe und mit ihm um die ha… halbe Welt gereist bin.« Rory legte das beschriebene Blatt auf den Tisch und sah Kayleigh amüsiert an. »Das war nicht besonders schwer.«
»Lies weiter! Du machst das toll.«
Aus der Küchenzeile drang ein blechernes Lachen. »Oh ja, die kleine Fee wird noch eine Gelehrte«, höhnte Crocell aus seinem Weidenkorb, der neben den Kartoffeln stand. »Hör auf, sie zu verarschen, Tinkerin! Sie hat mich nicht mit Intelligenz gefangen, sondern mit viel zu menschlicher Bosheit. Falsch. Verlogen.«
Rory verdrehte die Augen, doch Kayleigh spürte, dass seine Worte sie trafen, auch wenn sie es nicht zugeben wollte. »Lass ihn reden. Er hat keine Ahnung von Menschlichkeit.«
»Wir waren es«, zischte er, »die die Fairies geschaffen haben. Sie waren ehrlich und gut, bis sie sich auf ordinäre Weise mit den Menschen paarten.«
»Was du nie tun würdest«, sagte Rory und warf mit dem Schatten ihrer Hand ein Maul an die Wand, das sich öffnete und wieder schloss. »Ordinäres Paaren! Bla, bla, bla, Crocell. Ich glaube dir kein Wort.«
»Das ist etwas anderes. Ich war nie einer der Guten. Aber ihr. Unsere Schöpfung …«
»Dann habt ihr wohl bei den Sidhe nicht gut aufgepasst«, fiel Kayleigh ihm ins Wort. »Die galten vor der Vermischung mit der menschlichen Rasse als deutlich kaltherziger. Oder die Meerjungfrauen.«
»Bösartig, oh ja. Aber nie waren sie falsch und verlogen. Würdet ihr den wahren Geschichten lauschen, statt euch unnötige neue auszudenken, so wüsstet ihr das.«
»Und das meine ich«, sagte Kayleigh, den Blick auf Rory gerichtet, »wenn ich dir immer wieder sage, dass jeder Anflug deines schlechten Gewissens darüber, ihn gefangen zu halten, verschwendet ist. Ein Wesen, das an alle anderen einen so unterschiedlichen Maßstab ansetzt, als an sich selbst, sollte niemals frei herumlaufen.«
»Meinst du damit euch Menschen, Tinkerin?« Crocell lachte, es klang wie das Keckern eines Raben.
Das Geräusch überzog Kayleighs Schultern mit einer Gänsehaut. Immer wieder gelang es dem Dämon, durch ihre Schutzmauern zu brechen und zu ihren Schuldgefühlen vorzudringen. Vor wenigen Wochen erst hatte sie ein brandgefährliches Wesen befreit, einzig und allein, weil es ihre Überzeugung war, dass niemand das Recht hatte, eine Seele einzusperren. Es war ihr unsagbar wichtig gewesen, die Meerjungfrau zu befreien.
Und nun unterstützte sie, was sie selbst verachtete.
Er würde uns vernichten, erinnerte sie sich still. Rory musste ihn bannen, sonst hätte er sie getötet. Und nun führt kein Weg zurück.
Doch obschon sie nüchtern betrachtet keines ihrer Argumente anzweifelte, war ihr klar, dass sie sich allesamt auf einem Weg in einen Abgrund aus Schuld befanden, den sie nie wieder würden verlassen können. Vertraute sie dem Glauben der Tinker – und beim großen Giftmischer, das tat sie – musste sie dafür bezahlen, wenn sie eines Tages an die Jenseitspforte klopfte.
»Nicht heute«, murmelte sie zu sich selbst.
»Vielleicht hattest du recht.« Rory sah Kayleigh an, und in ihrem Blick lag eine Mischung aus Hoffnung und Traurigkeit, eine Verwundbarkeit, die sie selten zeigte. »Vielleicht sollte ich den nächsten Teil der Geschichte wirklich selbst schreiben. Den, der von mir handelt, und all den Entscheidungen, die ich getroffen habe.«
Kayleigh nickte. »Das musst du sogar. Nur in deinen eigenen Worten klingt etwas von deiner Seele mit.«
Rory stellte die Ellbogen auf und stützte die Stirn gegen ihre Fäuste. »Wo soll ich bloß anfangen?«
»Vielleicht da«, schnarrte Crocell, »wo du deine Natur verleugnet hast und bösartig geworden bist!«
»Völlig egal«, sagte Kayleigh. Sie war inzwischen geübt darin, die Kommentare des Dämons zu ignorieren. »Es muss nicht sofort ein Buch sein. Fang an mit dem, was du denkst. Mit dem, was du fühlst und was dich beschäftigt.« Sie drückte ihre Füllfeder mit dem letzten Rest Tinte in Rorys Hand. »So kommst du zum Ursprung dessen, was du eigentlich erzählen möchtest. Geschichten sind wie Wasser. Man muss ihre Quelle finden, aber wenn sie erst fließen, finden sie ihren Weg.« Sie nahm ein neues Blatt Papier, ganz weiß und unberührt noch, und legte es vor Rory hin.
Und jeder, der einst mehr über dich erfahren möchte, Rory, wird darin mehr finden als in der chronologischen Abfolge deines Lebens.
Rory schaute auf das Blatt runter, und dann zurück zu Kayleigh. »Ich versuche es. Es kann nicht so schwer sein.«
»Ein Klacks verglichen mit all dem, was du schon geschafft hast. Du bist die mutigste Person, die ich kenne. Nur sehr wenige – ob Menschen oder Fairies, ob Männer, Frauen oder andere – hätten für ihre Freiheit so viel riskiert wie du. Die meisten hätten an deiner Stelle in deinem Heimatdorf einen Mann genommen und sich in ihr trauriges Schicksal gefügt.«
»Und du? Du auch?«
Kayleigh wiegte den Kopf. »Schwer zu sagen. Ich bin nicht aufgewachsen wie du, und vollkommen anders erzogen. Meine Familie hat mich vor anspruchsvolle Bücher gesetzt, damit ich lerne, zu hinterfragen, sie haben meine Courage belohnt und jeden einzelnen meiner Träume unterstützt. Und dennoch … als ich zum ersten Mal allein auf Reisen ging, hatte ich mehr Angst dabei, als ich tragen konnte. Für das, was du gewagt hast, hätte ich nie den Mut gefunden.«
Rory hatte ihr aufmerksam zugehört. Nun schimmerte es hell in ihren blauen Augen. Vielleicht sah sie sich gerade zum ersten Mal in einem besseren Licht.
Die Kälte der Nacht kroch ihnen in die Glieder, brachte die Müdigkeit, und Crocell schnaubte abfällig aus der Ecke, wusste aber vermutlich schon, dass er für heute Nacht verloren hatte. Der Regen trommelte aufs Dach, die Dunkelheit drückte gegen die Wände. Kayleighs Herz jedoch wurde ganz weit und weich und warm. Denn Rory strich so andächtig über das Papier, als könnte sie die Worte fühlen, die noch gar nicht da standen.
Kapitel 3
Bria
Die Zelle war kalt und dunkel, ein Grab aus Stein. Eine Wand war zum Vorraum hin vergittert und es gab ein schmales Fenster auf Höhe der niedrigen Decke. Die Feuchtigkeit kroch durch die Mauersteine direkt in Brias Knochen, und die dünne Pritsche unter ihr war so hart, dass jeder ihrer Muskeln schmerzte. Sie war fast ein wenig dankbar, denn dadurch spürte sie die wunden Striemen, die man ihr zugefügt hatte, etwas weniger. Manchmal, wenn sie sich stark auf etwas anderes konzentrierte – einen Gedanken vielleicht oder eine Erinnerung –, konnte sie sie sogar einen Augenblick vergessen.
Sie lehnte den Rücken gegen die Wand, die Beine angezogen, die Arme vor den Schienbeinen verschränkt und lauschte.
Man hörte selten Stimmen oder Schritte an diesem Ort. Sie war offenbar die einzige Gefangene. Außer ihr gab es nur die Wachen. Nur ein-, zweimal am Tag fuhr draußen ein Automobil vorbei.
Man hatte sie also versteckt. Chapman fürchtete Samuel und die Skysons, auch wenn er noch so großkotzig behauptet hatte, Samuel würde darum betteln, seinen Schwanz lutschen zu dürfen. Ihretwegen. Seit dem Tag, als er sie hatte prügeln, auspeitschen und treten lassen, hatte sie beide nicht mehr gesehen – weder Chapman noch Samuel. Nur noch wechselnde Wachen, die nicht mit ihr sprachen.
Heute war jedoch irgendetwas anders. Die Wachen hatten getuschelt. Es waren doppelt so viele wie sonst anwesend, und vor wenigen Minuten war ein Automobil vorgefahren. Es musste kurz nach Mittag sein, ihre Essensschale war noch nicht abgeholt worden. Der Geruch des zähen Breis aus Kartoffeln, Zwiebeln und Kohl vermischte sich mit dem feuchten Mief der Zelle.
Die Stille wurde durch das Knarren der Tür zum Vorraum gestört. Bria hob den Blick, als Schritte erklangen, rhythmisch, entschlossen. Sie erkannte sie sofort und die Erinnerung drohte sie für einen Moment zu zerreißen.
Farne blieb im Vorraum stehen und aus dem Augenwinkel registrierte Bria, dass sie den Wachmann musterte, der sie eingelassen hatte.
»Die Tür«, sagte Farne mit Nachdruck. »Öffnen Sie diese Tür.«
»Dazu bin ich nicht autorisiert, Madam.«
Natürlich nicht. Seit man sie hier eingesperrt hatte, war das Gitter kein einziges Mal geöffnet worden. Nur durch die seitliche Luke wechselten die Essensschale, der Krug mit Wasser und der widerliche Eimer für ihre Ausscheidungen die Seiten. Es verschaffte Bria eine grimmige Genugtuung, dass Chapman so viel Angst hatte, sie könnte entkommen. Nicht mal Mäuse schafften es in dieses Loch, nur Spinnen und der eine oder andere Käfer.
»Du siehst ja furchtbar aus«, sagte Farne, und ihr Tonfall war nüchtern, fast beiläufig.
Bria rang sich ein Lächeln ab. »Ich habe nicht gedacht, dass sie dich reinlassen. Sonst hätte ich Rouge aufgelegt.«
Farnes Blick traf den Wachmann wie ein perfekt platzierter Schuss. »Sie werden mich wohl einen Moment mit meinem Kind alleinlassen.«
Er nickte und verschwand durch die Tür.
Bria stand auf. Farne sollte die Schussverletzung in ihrem Bein nicht bemerken, aber sie schaffte es nicht zum Gitter, ohne zu hinken.
Sofort nahm Farne ihre Hände in ihre und ließ die gleichgültige Maske fallen. »Liebling! Bist du in Ordnung?«
»Na ja. Weitestgehend.«
»Wie konnte das nur passieren?«
Bria verkniff sich, zu erwidern, dass es jedenfalls keine Hilfe gewesen war, nie etwas über ihr Fairie-Erbe erfahren zu haben. Wenn sie nur eine Chance gehabt hätte, die Magie zu erlernen, die in ihr war … Aber Vorwürfe und das Bedauern früherer Entscheidungen hatten noch nie jemandem geholfen. Und ihre Mutter war hier. Wie mochte sie das angestellt haben?
Sie ließ die Stirn gegen das Metall sinken. »Wenn ich das wüsste«, gestand sie, was mehr Kraft kostete als jedes anklagende Wort. »Ich habe einen Fehler gemacht.«
»Der Ring war ein einziger Fehler.«
Doch das sah Bria nach wie vor anders. »Ich hatte ihn. Er war mein. Ich war schon auf dem Weg nach Stolen Costessy.«
»Aber dann?«
Sie schüttelte den Kopf. Es war müßig, ihrer Mutter zu erklären, dass sie den Siegelring eingetauscht hatte, um Samuel zu retten. Farne O’Toole war die Königin der Diebe. Etwas Wichtigeres als eine solch edle Beute gab es für sie nicht. Sie würde ihre Entscheidung als Schwäche deuten, und wenn es wahr war, was Chapman Bria angekündigt hatte, wollte sie ihrer Mutter nicht als Versagerin in Erinnerung bleiben.
Ein kleiner Teil in ihr hoffte noch, dass Samuel kommen würde – irgendwie. Doch diese Hoffnung nahm von Tag zu Tag ab. Nicht mal Cashingwell, der Anwalt, hatte sich blicken lassen – vermutlich wusste niemand von den Skysons, wo man sie versteckt hatte.
Bis gerade hatte sie auch auf Farne und die Gilde gehofft. Aber ihre Mutter sah trotz ihrer selbstbewussten Haltung nicht gerade aus, als wären dreißig Diebe im Verborgenen bei ihr, um das Gefängnis zu stürmen.
»Weißt du, wo genau wir sind?«, fragte sie.
Farne schüttelte frustriert den Kopf. »Ich musste gefesselt in einen Wagen steigen, mit verbundenen Augen und einem Sack über dem Kopf. Und sie haben mehrmals die Richtung gewechselt und sich vergewissert, dass niemand ihnen folgen konnte.«
»Sehr viel Aufwand für den Besuch bei einer Diebin, die wegen Hochverrats zum Tode verurteilt wurde.« Es fiel ihr ungesund leicht, es auszusprechen, als sei es nur ein Ärgernis. »Du hast Chapman hoffentlich kein Geld dafür bezahlt?«
Farne schwieg.
»Oh. Du hast ihm Geld bezahlt.«
»Und ich würde alles zahlen, Bria, damit er dich hier rauslässt.«
»Ich weiß das zu schätzen, Farne. Aber er wird auf keines deiner Angebote eingehen. Nicht mal, wenn du ihm die Krone vom Kopf Seiner Majestät stiehlst.«
Farne sagte nichts, doch Bria glaubte, etwas in ihrem Gesicht ausmachen zu können. Wie immer behielt ihre Mutter ihre Mimik unter Kontrolle. Sie war eine schöne Frau, jetzt mit bald fünfzig durch die herber gewordenen Züge vielleicht noch schöner als früher. Als Kind hatte Bria sich darauf gefreut, ihr im Alter ähnlicher zu werden. Das würde nicht geschehen. Sie würde vermutlich nicht nennenswert älter werden, und darüber hinaus wusste sie inzwischen, dass sie ja auch nicht verwandt waren – nicht auf körperliche Art jedenfalls.
»Was will er von dir?« Sie hatte es in den Augen ihrer Mutter erkannt. Chapman hatte ihr irgendetwas angeboten. Und es war nichts Gutes. »Was immer es ist – du musst es ablehnen!«
»Was hat es mit den Skysons auf sich, Bria?« Die Worte klangen diesmal nicht wie eine Frage, sondern wie eine Anklage. Bria brauchte einen Moment, um den Zusammenhang zwischen ihrer Frage und der Erwiderung ihrer Mutter zu begreifen. Doch dann kam ihr die Erkenntnis.
»Samuel? Er will, dass du Samuel … Nein! Du kannst ihn nicht töten!« Ihr schwindelte bei der Vorstellung. Es prickelte kalt hinter ihrer Stirn und ihre Beine wurden weich.
»Wenn du in meiner Lage wärst«, sagte Farne schnell und leise, »und dein einziges Kind in tödlicher Gefahr …«
»Auch dann nicht.« Bria drückte Farnes Hände, so fest sie konnte. »Chapman ist kein Mann von Ehre, er würde dich auslachen und mich trotzdem töten lassen. Bitte, Mutter, glaub mir das.«
»Wer ist dieser Everett? Liebst du ihn? Und liebt er dich auch?« Sie ließ ihr keine Zeit zu antworten und stieß ein bitteres Lachen aus. »Wohl kaum. Denn sonst wäre er hier.«
»Er hat keine Möglichkeit, mich …«
»Bitte, Bria. Er befehligt die Skysons.«
Chapman hatte ihr alles erzählt. Vermutlich auch, wo sie Samuel finden konnte.
»Er hat Macht, Bria. Große Macht. Wenn er dich hier rausholen wollen würde, weil du seine erste Priorität wärst – dann würde er es tun.«
Bria spürte ein Zittern in Farnes sonst so sicheren Händen.
Farne O’Toole, die unbezwingbare Königin der Diebe, die Frau, die jedem ihrer Gegner überlegen schien, stand vor ihr und war bereit, alles zu opfern – sogar ihre eigenen Gesetze. Sie hatte es schon einmal getan. Getötet. Ebenfalls für Bria.
»Du kannst Samuel nicht umbringen!« Bria hielt Farnes Hand fest umschlossen, ihre Stimme war drängend, fast flehend. »Du hättest keine Chance gegen ihn, du würdest sterben und Chapman genau das geben, was er will. Glaub mir, er benutzt dich. Entweder stirbst du durch Samuels Hand – oder Samuel durch deine. In jedem Fall wäre mir alles genommen. Absolut alles.«
»Und was bleibt mir, wenn ich es nicht tue?« Farne zog die Hände zurück, trat einen Schritt zur Seite und begann, im engen Raum auf und ab zu gehen. »Ich warte sicher nicht ab, bis es zu spät ist. Ich werde nicht mitansehen, wie mein Kind hingerichtet wird. Ich …«
»Aber ich bin nicht dein Kind!« Die Worte brachen unaufhaltsam aus Bria hervor. Ein Moment der Stille folgte, in dem sich Schmerz tief in die feinen Linien im Gesicht ihrer Mutter grub. Bria biss sich auf die Unterlippe, kämpfte gegen die Tränen, die in ihren Augen brannten. »Ich bin nicht dein Kind«, wiederholte sie leiser. »Und trotzdem seid du und Ophelia meine Familie.«
Farne trat näher, und ihr Blick war weich, aber entschlossen. »Ich habe dich ausgewählt, Bria. Weil ich wusste, dass du das Kind warst, das wir lieben würden. Und das zählt mehr als Blut. Du bist meine Tochter.«
Bria ließ die Worte sinken, fühlte ihre Wärme und den Trost, der in ihnen lag. Doch sie durfte sich nicht ablenken lassen. Sie musste Farne von ihrem Vorhaben abbringen – und gleichzeitig Antworten erhalten. Wer wusste, ob es je eine weitere Gelegenheit geben würde.
»Warum eigentlich ich? Was hast du in mir gesehen? Was hatte ich, das die anderen Kinder nicht hatten?«
Farne hielt inne, ihre Augen schmal. Sie wusste genau, worauf Bria anspielte. »Warum ist das jetzt wichtig?«
»Weil ich Informationen brauche«, sagte Bria. »Ich weiß nichts über meine Herkunft. Nichts über meine leiblichen Eltern. Und nichts über das, was in mir ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der Moment kommen wird, an dem es mir helfen kann.«
Bitte, Mutter! Versteh doch bitte, was ich meine!
Denn wenn sie eine Chance haben wollte – eine geringe Chance, aus diesem Verlies freizukommen, dann musste sie die Magie nutzen, die am Hafen aus ihr hervorgebrochen war. Etwas Derartiges war ihr seitdem nicht mehr gelungen. Ganz am Anfang ihrer Gefangenschaft hatte sie es noch geschafft, eine Handvoll Stroh aus der Matratze zu entzünden. Mittlerweile kam nicht mal mehr ein Funken. Wenn sie nur wüsste, woran es lag und wie sie es ändern konnte!
Aber offen ansprechen konnte sie es hier auf keinen Fall. Sie wurden sicher belauscht.
Farne drehte sich weg, ihre Haltung angespannt. Bria konnte sehen, wie ihre Hände zu Fäusten geballt waren, die Knöchel weiß vor Anspannung.
»Das Waisenhaus …«, begann sie schließlich zögernd. Ihre Stimme war leise, brüchig, ganz anders als die der Frau, die Bria kannte. »Es war in Southampton. Als wir dort waren, hast du geschrien, als ginge es um dein Leben. Es traf mich direkt ins Herz und in die Seele. Man sagte mir, du könntest nicht adoptiert werden, du seist krank.« Farnes Blick machte deutlich, dass mit dem Wort etwas anderes gemeint war. »Ich verstand das nicht, denn an diesem Ort waren doch alle Kinder krank.«
Bria begriff. Diese Kinder waren nicht zwingend Waisen. Es waren Fairie- oder Halbfairie-Kinder, die man den Eltern weggenommen hatte, im Glauben, ihre Magie würde schwach werden und verkümmern, wenn sie niemals lernten, sie zu nutzen.
»Und davon wusstet ihr?« Und ihr habt mitgemacht? Es unterstützt?
»Es war meine einzige Möglichkeit. Auf dem offiziellen Weg hätte ich ohne einen Mann niemals ein Kind bekommen. Und körperlich war ich dazu nie in der Lage.«
Das hatte Bria nicht geahnt. Bisher hatte sie angenommen, dass es für Farne nicht infrage gekommen war, mit einer Schwangerschaft ihre Karriere zu riskieren. Wie lange sie es versucht haben mochte? Mit Männern, die sie nicht anzogen …?
»Keines dieser Kinder konnte zu seinen Eltern zurückkehren. Also habe ich eines mitgenommen. Vielleicht war es eine schlechte Entscheidung, eine egoistische. Es war mir egal. Ich habe es nie bereut.«
Bis jetzt nicht, dachte Bria bedrückt. Nun hat sich allerdings das Wunschkind fangen lassen. Was für eine Schmach für die Königin der Diebe.
»Warum mich?«, flüsterte sie. »Ausgerechnet mich?«
Farne zögerte, dann sah sie Bria direkt an, ihre Augen glänzten von unterdrückten Tränen. »Meine Freundin nahm dich hoch und legte dich in meine Arme. Du warst schwer verletzt und hattest Fieber. Dein gesamter Rücken war eine tiefe, eitrige Wunde. Du brauchtest Hilfe.«
Bria schluckte. Man hatte ihr die Flügel also dort entfernt. Im Waisenhaus. Wenigstens hatten Farne und Ophelia nichts damit zu tun.
»Du hattest diese besonderen Augen, Bria. Als würdest du trotz aller Schmerzen die ganze Welt sehen, doch niemanden in deine hineinlassen. Ich wollte nicht, dass du dort stirbst. Und auch nicht, dass du überlebst, damit die Welt dich zerbricht. Ich wollte, dass du eine echte Chance auf ein Leben hast.«
Bria lehnte sich gegen das Gitter. »Und jetzt habe ich sie verspielt.«
Aber nicht grundlos. Ob sie ihrer Mutter das sagen konnte? Dass auch sie nichts bereute, außer vielleicht, nicht schnell genug über die Reling des Schiffes gesprungen zu sein?
Das, was sie ihr Leben lang gesucht hatte – Anerkennung, Freundschaft, Respekt –, auf ihrer Reise in die Fairiegolden Town hatte sie es endlich gefunden.
Und eine Nacht lang, eine gestohlene Nacht, hatte sie wahrhaftig geliebt. Jemanden, der wusste, wer sie war. Was sie war. Jemanden, der auch sie geliebt hatte, zumindest bis zum Morgengrauen.
»Und du weißt wirklich nichts über meine … anderen Eltern?« Über meine Magie, Farne, wirklich nichts? Es ist so wichtig!
»Tut mir leid«, erwiderte Farne. »Als dein Brief kam, habe ich das Waisenhaus angeschrieben und um Informationen gebeten. Bis heute habe ich keine Antwort erhalten.«
Natürlich nicht. Der Handel mit Fairies war vor dem Krieg nicht offiziell verboten gewesen, aber es galt vermutlich trotzdem als schlechter Stil, Kinder zu entführen, um sie gewinnbringend zu verschachern. Daran erinnerte sich bestimmt niemand gern.
Doch bevor Bria Worte gefunden hatte, trat Farne wieder näher, griff durch die Gitter und schloss ihre Hände um Brias Gesicht. »Lass mich tun, was ich tun muss, Liebling. Chapman hat versprochen, dass er dich begnadigen wird, wenn ich …«
»Das wird er nicht.« Tränen brannten in Brias Augen. Für einen Moment fühlte sie sich wie das kleine Mädchen, das sie einst gewesen war – völlig hilflos, sogar ihrer Mutter gegenüber, die alles tat, um sie zu beschützen. »Es geht ihm nicht darum, ob Samuel lebt oder stirbt. Er hätte ihn selbst töten können. Stattdessen hat er ihn freigelassen.«
»Er ist ausgebrochen!«
»Das lässt Chapman die Leute glauben. Er benutzt alle, wiegelt sie gegeneinander auf, um vor den Menschen, die ihn wählen, als Retter dazustehen. Er schürt Feindschaften unter seinen Gegnern, weil er damit alle schwächt.«
»Du verstehst nicht«, sagte Farne zunehmend ungeduldig, »dass es keine andere Chance gibt. Du denkst immer noch, Samuel Everett würde dich retten. Aber Bria – das wird nicht passieren!«
Als wüsste sie das nicht. Wann immer sie entkräftet in Schlaf fiel, hörte sie seine Stimme in ihr Ohr raunen. »Zähl nicht auf mich. Zähl niemals auf mich.«
»Ich kann mich immer noch selbst retten«, murmelte sie.
Aus irgendeinem Grund schluchzte Farne laut auf. Sie zog ihre Hände zurück und verbarg ihr Gesicht darin.
Bria brauchte einen Moment, um sich klar zu werden, dass ihre Mutter weinte. Angesichts Brias Selbstüberschätzung wäre es angebrachter gewesen, zu lachen. Sie steckte völlig verdreckt in sackartigen, kratzenden Männersachen, war wundgeschlagen und voller Floh- und Bettwanzenbisse und konnte aufgrund ihres Beines nicht mal mehr laufen. Natürlich würde sie sich selbst retten – wie konnte Farne nur daran zweifeln? Lächerlich!
»Mutter?«, flüsterte sie, beschämt von ihren eigenen Worten. »Es tut mir leid. Aber bitte vertrau mir und lass Samuel in Ruhe. Bitte rede mit Kayleigh. Versprichst du mir das? Sie kennt ihn, sie kennt Chapman – und sie kennt mich.«
Sie fehlte ihr so schrecklich. Manchmal, wenn es Nacht war, träumte sie von Kayleighs Umarmung, und wann immer sie dann wach wurde, fühlte sie sich wärmer und als würden ihre Wunden heilen.
»Und bitte überbring ihr eine Nachricht, versprichst du es mir?«
Die Tür öffnete sich, Farne nahm schlagartig eine stolze Haltung an und beherrschte ihre Züge. Ein Mann erschien. »Zeit ist um.«
»Jetzt schon?«, echauffierte sich Farne.
Der Wachmann trat unbeeindruckt näher, die Hand an seiner Waffe. Sein Blick sagte: keine Diskussion.
»Sag Kayleigh, dass Liverpool die beste Entscheidung meines Lebens war.« Jedes Wort gab Bria einen Stich. Sie hätte es Farne erklären müssen, aber dazu war es zu spät, denn sie wurde bereits von der Wache nach draußen geschoben.
»Sag ihr, dass ich – ganz egal was auch passiert – nichts bereue. Sie zu kennen, war alles wert. Macht euch keine Sorgen! Ich liebe dich, Mum, und ich liebe Ophelia. Aber bitte sag auch Kayleigh, dass ich sie lieb habe.«
Kapitel 4
Eliah
Die Treppenstufen knarrten unter Eliahs Stiefeln. Er trat vorsichtiger auf, um sich den Soldaten im dritten Stock nicht anzukündigen.
Durch die halb verhangenen Fenster drang schwaches Licht ins Treppenhaus, wurde fast geschluckt von der Mischung aus Feindseligkeit hinter jeder verschlossenen Tür, sowie dem Geruch von feuchtem Putz und schmutzigen Schuhen.
Aiven bewegte sich hinter ihm mit der lautlosen Präzision eines Schattens, die Waffe fest in seiner verbliebenen Hand. Er war Rechtshänder gewesen, inzwischen schoss er mit der Linken und traf, was er treffen wollte. Noch immer fiel es Eliah schwer, ihn in seinem Rücken zu wissen, und manchmal überwältigte ihn der Gedanke, dass es vielleicht am besten war, wenn der Rachedurst Aiven doch noch überkam, und er ihn aus dem Nichts angriff. Immerhin wusste er dann endlich, woran er bei ihm war. Die Spannung zwischen ihnen kostete ihn Schlaf, Nerven und damit jegliche Kraft, die gute Laune vorzuspielen, die sein Markenzeichen geworden war. Und die er brauchte, um zu verbergen, was er seit dem Krieg in sich trug.
Schieß doch endlich, dachte er so manches Mal. Und dann wandte er sich um und sah, wie ernst Aiven seine Aufgabe nahm, Eliahs Rücken zu schützen. Sie arbeiteten so gut zusammen. Nicht mal Hass auf der einen Seite und Misstrauen auf der anderen kamen dagegen an.
In der dritten Etage verharrte Eliah an der Wohnungstür und rückte zur Seite, sodass auch Aiven Platz fand, sein Ohr ans Holz zu legen. Eliah schloss die Augen, um besser hören zu können.
Er vernahm das Wimmern von Kindern, außerdem schnelle, leichte Schritte. Dann ein lauteres Weinen, gefolgt von einer energischen Frauenstimme.
»Sie machen es den Kindern unnötig schwer, Mrs Raja. Beeilen Sie sich mit dem Packen, sonst nehmen wir die Kinder ohne ihre Sachen mit.«
»Ich geh aber nicht mit!«, widersprach ein Kind. Ein zweites schluchzte auf. Oder war es die Mutter?
Eliah öffnete die Augen und wechselte einen Blick mit Aiven. Die Befürchtungen der Frau, die hinter dieser Tür wohnte, weshalb sie bei den Skysons um Unterstützung gebeten hatte, waren wahr geworden. Die Fürsorge war gekommen, um die Kinder zu holen – Kinder, die zur Hälfte Fairies waren. Und da Eltern ihre Kinder selten freiwillig herausgaben, wurden die Beamtinnen vom Militär begleitet.
Mit den Fingern zählte Eliah erst zwei, dann drei, und schließlich vier und sah Aiven fragend an. Anhand des Automobils vor der Tür konnte er nur grob schätzen, wie viele Soldaten zum Schutz der Beamten mitgekommen waren.
Aiven zuckte mit den Schultern, als wäre die Zahl der Gegner bedeutungslos. Der Mann kannte keine Angst, als hätte er dieses Gefühl mitsamt seiner rechten Hand verloren, und Eliah schwankte zwischen Bewunderung, Sorge und Mitgefühl, wann immer er daran erinnert wurde.
»Ruhe jetzt«, blaffte ein Mann, und das Kinderweinen verstummte abrupt. »Und du beeilst dich besser, sonst helf ich nach.«
Irgendetwas polterte laut über den Fußboden, gefolgt von einem unterdrückten Schmerzlaut.
Eliah zog und entsicherte seine Pistole. Noch ein Blick zu seinem Kameraden, ein stilles »Bereit?«.
Der Anflug eines Lächelns flog über Aivens Lippen. Immer.
Eliah machte einen Schritt zurück und trat gegen die Tür. Das Schloss hielt – aber das Holz gab nach. Aiven griff durch das Loch nach der Klinke und öffnete ihnen die Wohnung.
Der Flur war klein und dunkel, an der Garderobe bäumte sich ein Berg von Jacken auf. Dahinter lag die Wohnstube. Vier Personen wandten sich alarmiert um; zwei Männer in Uniform, ein weiterer Mann und eine Frau in sauber ausgebürsteten grauen Mänteln. Die Mutter kniete in der Mitte des Raumes, die Kinder hinter sich, ihren schmalen, zitternden Körper wie ein Schutzschild um sie gelegt.
»Was soll da…«, fauchte einer der Soldaten. Das Wort erstarb auf seinen Lippen unter Eliahs Schuss. Der Soldat sackte zusammen, wie ein Toter vom Galgen fiel, wenn der Henker das Seil zerschnitt.
Der zweite Schuss peitschte durch den Raum, und der andere Soldat schlug sich beim Versuch, nach seiner Waffe zu greifen, nur hilflos gegen die Seite. Seine Augen weiteten sich, weil er nicht sofort begriff, warum ihm die Finger den Dienst verweigerten. Adrenalin war eine köstliche Droge, die jeden Schmerz auslöschte. Erst das Blut ließ ihn verstehen, was passiert war, und er keuchte auf.
Aiven war ein exzellenter Schütze. Wenn er jemanden erschießen wollte, dann tat er es. Und wenn er mit seiner Kugel ein Handgelenk sprengen wollte, sprengte er ein Handgelenk.
Der Soldat brüllte, die Kinder begannen wieder zu weinen. Der Kerl von der Fürsorge aber kreischte in den höchsten Tönen.
Während Aiven den verletzten Soldaten entwaffnete und in der Zimmerecke ans Heizungsrohr fesselte, scheuchte Eliah die Fürsorgebeamten ins Schlafzimmer der Familie.
»Sie machen einen Fehler.« Die Frau vermied es, ihn anzusehen. Mutig war sie dennoch. Ihr Kollege jammerte nur leise vor sich hin. »Wir machen unsere Arbeit. Diese Mutter ist nicht in der Lage, Kinder großzuziehen. Sie sollte uns dankbar …«
»Halten Sie den Mund.« Eliah war normalerweise gut darin, den brutalen Teil, den der Krieg in ihm hervorgebracht hatte, unter Nonchalance zu verbergen. Aber die letzten paar Wochen hatten die Fassade dünn werden lassen. Rissig.
»Verstehen Sie doch! Kinder brauchen ein sicheres Zuhause, wenn sie …«
Es krachte, als Eliah das Gesicht der Frau nur knapp verfehlte und gegen den Schrank boxte. »Du sollst dein Maul halten! Ihr macht hier keinen Job. Ihr macht Drecksarbeit für Chappy!«
»Hey.« Aiven trat zu ihm. Eine flüchtige Berührung am Arm, ein langer Blick. Und Eliah fasste sich wieder.
Es war beunruhigend, wie es Aiven gelang, seine Nerven aufzureiben, bis sie wund und blutig offen lagen, und sie in anderen Situationen in Sekunden zu beruhigen.
Es glich einer Folter – der Gedanke ließ ihn auflachen.
Eliah verließ das kleine Zimmer. »Schön da drinbleiben, dann macht sich niemand die hübschen Kleider schmutzig.«
Zusammen gingen sie in die Wohnküche zurück. Der Soldat an der Heizung warf ihnen zornerfüllte Blicke zu, war aber vernünftig genug, zu schweigen. Den Toten hatte Aiven mit einem Tischtuch zugedeckt.
Mrs Raja stand an einem Regal und schmiss gehetzt Konserven und in Papier eingeschlagene Lebensmittel in eine Tasche.
»Danke für eure Hilfe«, stieß sie hervor, wobei ihr Tonfall klarmachte, dass sie einen toten sowie einen verwundeten Soldaten in ihrer Wohnung vermutlich nicht als die Art von Hilfe betrachtete, die sie sich erhofft hatte.
»Wir konnten nicht früher kommen«, sagte Aiven. »Und zwei von Chapmans Männer lebend zu überwältigen …«
Es wäre schwer geworden. Gefährlicher. Für alle.
»Tut mir leid«, Aiven wandte sich an die Kinder, »dass ihr das sehen musstet.«
»Kommen wir jetzt auch ins Gefängnis?«, fragte das größere der Kinder, ein schmales Mädchen mit einer Zahnlücke und kurzen Hörnern zwischen den strähnigen Haaren.
Mrs Raja schüttelte müde den Kopf. »Natürlich nicht. Und auch nicht ins Kinderheim.« Sie war nicht mehr jung, aber sicher auch nicht so alt, wie sie aussah. Das Leben schien jede Spur von Unbeschwertheit aus ihrem Gesicht gewischt zu haben. Ihr Blick huschte ruhelos von einem Gegenstand zum anderen, als suchte sie einen, um sich daran festzuhalten.
»Danke, dass ihr gekommen seid«, sagte sie noch einmal, und diesmal schien sie es ernst zu meinen. »Sie haben meine älteste Tochter bei einer der letzten Demonstrationen festgenommen. Mein Mann wollte sie aus dem Gefängnis holen, er hatte sogar die Kaution bei sich – alles Geld, was wir auftreiben konnten. Aber er kam nicht zurück. Wir haben nichts mehr von ihm gehört.«
»Dein Mann ist Fairie?«, fragte Eliah.
Sie nickte knapp. »Und meine Kinder zur Hälfte.«
»Warum sind diese Leute hier?« Eliah deutete zur Tür, hinter der die beiden von der Fürsorge warteten. »Deine Kinder haben doch eine Mutter.« Geschichte wiederholte sich. Das sagte man doch so. Aber war es wirklich schon wieder so weit, dass den Fairies die Kinder geraubt wurden?
Mrs Raja musste sich abwenden und durchatmen, bevor sie antworten konnte. »Vor zwei Jahren hatte ich eine psychische Erkrankung. Ich habe sie überwunden, aber sie steht in meiner Krankenakte. Die Fürsorge behauptet, dass ich aufgrund der Diagnose nicht in der Lage bin, für die Kinder zu sorgen. Aber das ist eine schreckliche Lüge!«
Dass die Fürsorge wusste, dass der Familienvater verschwunden war, bewies, dass man ihn inhaftiert hatte.
»Es sind Chapmans Schikanen«, sagte Aiven.
Eliah nickte. »Familien wie eure stören, beabsichtigt man die Stadt zu teilen und mit Checkpoints voneinander zu trennen.«
»Die Stadt«, flüsterte die Frau, »sowie die Gedanken, die Herzen und unsere Träume. Ich will nicht glauben, dass das alles verloren ist.«
Aiven schüttelte den Kopf, ein Schatten von Zorn verdüsterte sein Gesicht. »Noch sind wir hier. Der Widerstand ist geschwächt, aber ungebrochen.«
Eliah kniete sich nieder und hob etwas vom Boden auf. Es war eine bemalte, zertretene Schachtel, aus der ein Stofftier zur Hälfte heraushing: ein völlig abgeliebter Hase, der vermutlich mal schwarz mit weißen Flecken gewesen war und nun farblich eher an Spülwasser erinnerte. Er hielt es dem kleineren der beiden Kinder hin. »Tut mir leid, ich fürchte, der Stall von deinem Häschen ist kaputtgegangen.«
Das Kind hatte dunkle Augen und halblanges Haar. Eine Weile sah es Eliah kritisch an. Dann sagte es: »Das ist doch kein Stall!«
»Nein? Verzeihung. Was ist es denn?«
Das Kind nahm das Stofftier aus der Schachtel und drückte es an sich. »Ein Flugzeug. Osana Hase will damit wegfliegen. Auf den Mond, weißt du?«
»Hmm«, machte Eliah. »Auf den Mond. Wirklich? So weit?«
»Ja. Weil da keine Hasen gegessen werden, auf dem Mond.«
»Das klingt nachvollziehbar.« Er drehte die Überreste der Schachtel. »Denkst du, das kann man reparieren?«
Das Kind schluckte, schüttelte den Kopf und schluckte ein weiteres Mal, diesmal sehr schwer. »Nein. Aber Osana Hase und ich können ein neues bauen. Das machen wir immer, wenn es kaputtgeht.«
»Viel Erfolg dabei«, sagte Eliah und stemmte sich hoch, um sich der Mutter zuzuwenden. »Ihnen auch. Und Glück.« Er zog ein Bündel aus der Tasche und reichte es der Frau.
Ungläubig starrte sie auf das Geld in ihren zitternden Händen.
»Ihr müsst fliehen«, erklärte Eliah mit leiser Dringlichkeit. »Die Zugtickets sind teuer geworden, aber damit solltet ihr in eine Fairie-Stadt kommen und dort Unterschlupf finden. Du und die Kinder seid in Gefahr, solange ihr hierbleibt. Wir tun alles, damit diese Stadt wieder wird, was sie leuchten ließ. Aber für den Moment ist sie das nicht.«
Die Frau blinzelte, und kurz flackerte Hoffnung in ihrer Miene auf, doch sie wurde schnell überschattet. »Ohne meine Tochter? Und meinen Mann?«
»Unser Anwalt wird sich darum kümmern«, versprach Aiven. »Wir tun, was wir können.«
Eliah bemühte sich um ein regloses Gesicht. Die Wahrheit war eine andere. Eine zähe, bittere, an der er bei Nacht erschöpft und schlaflos herumkaute, während er sie am Tag zu ignorieren versuchte und als Hirngespinst abtat. Die Wahrheit war, dass er nicht mehr wusste, welches Ziel die Skysons wirklich verfolgten. Jeder von ihnen hätte dieselbe Antwort auf die Frage genannt. Nur bei einer Person war Eliah nicht mehr sicher. Und dieser Mann war Samuel Everett, der Cormorant.
Eliah wusste nicht mehr, wer dieser Mann wirklich war, den er so lange, so bedingungslos wie unerwidert geliebt hatte. Dem er sein Leben anvertraut und mehrfach zu verdanken hatte. Aber jetzt …?
»Ihr werdet womöglich erst in ein paar Tagen hier rauskommen«, sagte er zu Mrs Raja. »Die Züge, die noch fahren, sind ausgebucht. Hast du einen Ort, an dem du so lange bleiben kannst?«
Ihr Atem ging schwer, als läge ein Seil um ihren Hals. »Ich weiß nicht, ob ich wirklich …«
Es war hart für sie – natürlich war es das. Aber darauf konnte er keine Rücksicht nehmen. Er blickte zu dem Soldaten in der Ecke. »Wenn du ihm und den beiden in deinem Schlafzimmer das Leben schenken willst, verlass die Wohnung. Anderenfalls …« Er senkte den Blick auf seinen Revolver. »Möchtest du hierbleiben? Mit zwei Kindern und vier Leichen?«
Mrs Raja klappte der Mund auf. So schnell wie still raffte sie ein paar Kleidungsstücke zusammen, die zu Boden gefallen waren, und lächelte ihren Kindern tapfer zu. »Wir fahren mit der Eisenbahn. Was sagt ihr dazu, hm? Wir machen eine richtige Reise!«
»Und Maryam, Mum?«
»Ja! Und Dad? Und Osana Hase?«
»Osana Hase geht mit uns. Maryam und Dad kommen nach, sobald sie können. Wir bereiten alles für sie vor. Was denkt ihr? Ist das ein guter Plan?«
Zwei zusammengepresste kleine Münder verrieten still, dass die Kinder viel mehr durchschauten, als die Mutter wahrhaben wollte. Aber sie verkniffen sich ihre Zweifel, nickten und schulterten ihre Rucksäcke.
Eliah öffnete den dreien die Tür und lauschte ihren schnellen Schritten, als sie die Treppen hinab rannten.
Ein fahler Lichtschein fiel durch das schmutzige Fenster, spiegelte sich im Blut auf den Dielen, in dem die Leiche kalt wurde. Es war weder Schuld noch Reue, die Eliahs Brust enger machten. Es war etwas, womit er noch weniger umgehen konnte als mit Schmerzen oder Todesangst: Hilflosigkeit.
Sie wurden gerufen, wenn den Leuten Schlimmes drohte, kamen und fanden mit Glück eine Lösung. Aber die Hilferufe nahmen zu, der Nachschub an Soldaten, die sich für Chapmans Ziele hergaben, fand kein Ende, und es frustrierte Eliah über alle Maßen, dass keine dieser gewonnen Schlachten einen Einfluss auf das große Ganze hatte.
Aiven trat zu dem verletzten Soldaten und spuckte vor ihm auf den Boden. »Dir ist bewusst, dass diese Lady dein Leben gerettet hat? Erinnere dich daran, wenn du irgendetwas über den heutigen Abend an deine Vorgesetzten weitergibst. Erinnere dich. Und bestell Lord Mayor Chapman einen Gruß der Skysons. Bevor nicht der Himmel auf die Erde stürzt und der Mersey zu Staub und Steinen trocknet, werden wir diese Stadt nicht hergeben.«
Kapitel 5
Samuel
Der Abend strahlte lebendig, fast festlich, als Samuel durch die belebten Straßen nahe des Buckingham Palasts ging.
Menschen in schimmernden Kleidern und feinen Anzügen drängten sich auf den Gehwegen, lachten miteinander, riefen Taxen oder Kutschen herbei und eilten von den glanzvollen Restaurants, deren Fenster in warmem Licht erstrahlten, in die nicht weniger herausgeputzten Bars. Verglichen mit Liverpool umhüllte einen hier der Reichtum, nahm einen in seine Mitte und schuf die Illusion von Zugehörigkeit in einen Kreis, in dem jedermann den Monatslohn eines Arbeiters für ein einziges Essen bezahlte, ohne darüber nachzudenken.
Was fehlte, war die Realität. Niemand hier war arm, krank, versehrt. Und absolut niemand trug nur einen Hauch von Fairie-Kultur nach außen, auch wenn kaum vorstellbar war, dass nicht ein paar der Leute magisches Blut in den Adern hatten.
Die reichen Menschen fühlten sich wohl und sicher in ihrem Teil Londons, und Samuel fragte sich, ob sie nicht wussten, wie die Straßen jenseits der Checkpoints aussahen, oder ob es ihnen egal war.
Doch da war noch etwas anderes, das ihn beunruhigte. Ihm war, als zog er Unheilvolles hinter sich her.
Das Hotel Rubens war nur noch wenige Minuten entfernt. Inmitten des Londoner Nachtlebens war es ein sicherer Hafen für diskrete Verabredungen. Weit sicherer, als Edward Beckenholt in Liverpool zu treffen, wo der Tory auf jeden Schritt beobachtet wurde und Samuel als ein aus dem Gefängnis geflohener Verbrecher galt.
Doch Samuel war nicht nach London gegangen, um Risiken zu vermeiden. Der eigentliche Grund war Bria gewesen. Selina hatte in Erfahrung gebracht, dass man sie hierher überstellt hatte, aber die Information schien eine Finte gewesen zu sein. Es fand sich keine Spur von ihr, so intensiv er auch suchen ließ.
Was machte er sich vor? Die Uhr tickte. Er konnte nicht die Stadt und Bria retten. Nur das mickrige Überbleibsel des naiven Jungen, der sich nach all der Zerstörung durch seinen Vater, durch Chapman und James Pickens noch immer ein Quäntchen lächerlichen Glauben an Wunder bewahrte, der hörte nicht damit auf, es zu versuchen. Samuel wünschte, er könnte diesem kümmerlichen Rest von sich selbst ins bereits blutige Gesicht treten, ihm sämtliche Knochen zertrümmern, bis sie sich in sein Gehirn bohrten. So viele hatten versucht, diesen Jungen auszulöschen, ihn auszutreiben, wann immer er für etwas trotzige Hoffnung den Kopf hob. Hätte Samuel selbst einen Weg gefunden, sein altes, schwaches Ich zu töten – er würde nicht zögern.
Ein Schauder richtete seine Nackenhaare auf. Als er um die nächste Straßenecke trat, bemerkte er eine elegante, in Weiß und Dunkelrot lackierte Bramwith Limousine, die ihm auffällig langsam folgte. Nun war er sich vollends sicher, beschattet zu werden.
Der Verdacht hatte sich langsam aufgebaut, zuerst wie ein Kribbeln im Rücken, dann wie ein Schatten, der sich nicht abschütteln ließ. Er widerstand der Versuchung, sich ein weiteres Mal umzusehen. Stattdessen ließ er seine Umgebung immer wieder in seinen Blick gleiten – eine Spiegelung in einem Schaufenster hier, ein flüchtiges Abbild im Lack eines Automobils dort.
Sie waren zu zweit. Ein Mann, der sich im Gedränge hielt, und eine Frau, die sich viel näher an Samuel heranwagte. Mit ihrem eleganten blauen Mantel, dem hell schimmernden Haar unter einem modischen kleinen Hut sowie ihren tänzerischen Bewegungen fügte sie sich perfekt in die Menge ein. Doch ihr Blick hatte sie verraten. Er fühlte ihn wie einen Druck zwischen seinen Schultern, auch wenn sie tat, als plaudere sie beiläufig mit einem Fremden oder bewundere beim Flanieren ein Schaufenster.
Der Mann war subtiler, unauffällig in einem dunklen Anzug, und mit einem Hut, den er tief in die Stirn gezogen trug. Er war das Netz, während die Frau ihre gemeinsame Beute vor sich hertrieb.
Samuel entschied sich. Keine Gassen, keine Abkürzungen. Stattdessen würde er sie dorthin führen, wo er hinmusste – ins Hotel Rubens. Er floh nicht gern, vor allem nicht vor Menschen. Wenn sie ihn stellen wollten, dann zu seinen Bedingungen.
Er behielt seinen gleichmäßigen Schritt bei, während er sich seinen Weg durch die Menge bahnte. Die beeindruckende Fassade des Hotels im Stil des Klassizismus mit ihren warm leuchtenden Fenstern wirkte wie ein Versprechen: Hier bist du sicher. Wenn du Geld hast. Und Macht. Und das richtige Blut in deinen Adern.
Samuel hatte alles davon und glaubte dem Versprechen dennoch nicht.
Zwei uniformierte Türsteher öffneten ihm die schweren Glastüren, und Samuel trat in die mit Samt und Gold ausgeschmückte Lobby, um sich beim Portier anzumelden. Er wurde erwartet.
Er spürte die Frau mehr, als dass er sie sah, und ließ sich nichts anmerken, auch nicht, als sie sich direkt auf den Fahrstuhl zubewegten.
Die geschwungenen Messingtüren des Lifts standen offen. Ein Liftboy in Uniform neigte höflich den Kopf, als Samuel eintrat. Die gedämpfte Eleganz – der schwere Teppich, die verschnörkelten Spiegel – hätte ihn beinahe entspannt. Beinahe.
Die Türen hatten sich fast vollständig geschlossen, da huschte ein Arm durch die schmale Lücke.
»So warten Sie doch, bitte!« Die Stimme war hell, freundlich, nahezu entschuldigend, und trieb ihm den Schweiß aus den Poren.
Der Liftboy zog den Griff zurück, und die Türen öffneten sich. Die Frau im blauen Mantel trat ein. Aus der Nähe wirkte sie noch auffälliger – ein feines Gesicht, makellos geschminkt. Ihr Parfum füllte den engen Raum aus.
»Vielen Dank«, sagte sie zum Liftboy, dann neigte sie sich zu ihm, hauchte ihm etwas ins Ohr und Geldnoten knisterten zwischen ihren Körpern.
Der junge Mann presste die Lippen zusammen, als müsste er ein Grinsen verbergen. Dann wies er auf die Steuerung. »Kommen Sie denn allein damit zurecht?«
Die Frau legte eine Hand auf den Hebel. Sie trug Handschuhe aus dünnem, weißem Leder, passend zu der Tasche, die über ihrer Schulter hing. »Aber natürlich. Danke.«
Der Liftboy warf Samuel einen vielsagenden Blick zu und trat mit einem Räuspern aus dem Fahrstuhl.
Die Frau schloss die Messinggittertür mit einem kraftvollen Ruck. »Eine schöne Nacht, nicht wahr?«, fragte sie, während sie den Hebel betätigte und der Fahrstuhl sich surrend langsam und mühevoll nach oben arbeitete.
Samuel lehnte sich gegen die Wand des Fahrstuhls, seine Hände in den Manteltaschen vergraben. »Ich nehme an, Sie kennen mich?«
Sie lächelte allein mit dem Mund. »Ich habe viel von Ihnen gehört. Ich hätte Sie gern unter anderen Umständen kennengelernt.«
»Mir gefallen die Umstände ganz gut.«
»Nun denn.« Sie hob die andere Hand, in der eine kleine Pistole lag. »Jeder hat so seine Vorlieben, nicht wahr? Mancher sehnt sich nach der Nacht seines Todes. Es liegen dunkle Jahre hinter uns allen.«
Auf der anderen Seite des Messinggitters schob sich langsam der Flur des ersten Stockwerks vorbei.
»Sie waren im Krieg, Mr Everett, ist es nicht so? Wünschen Sie sich seitdem, zu sterben?«
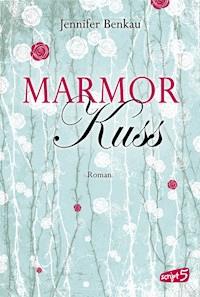










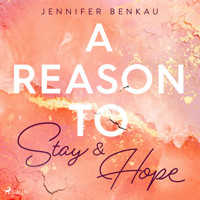
![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Sturmmädchen [Band 3 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5301e0aef492f4b62003660f83fe52a5/w200_u90.jpg)

![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)

![Die Seelenpferde von Ventusia. Himmelskind [Band 4 (ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/087e99c10449973fcfa015c2c26ac9e5/w200_u90.jpg)











