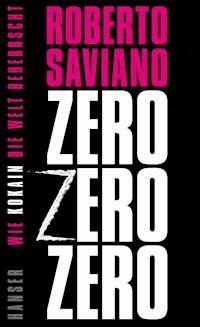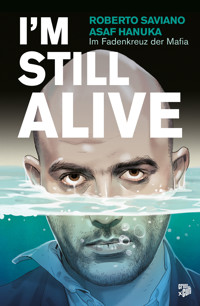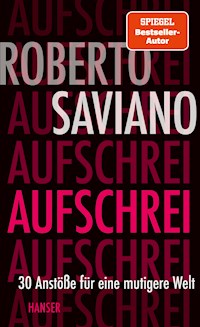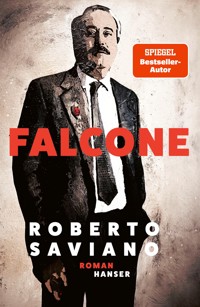
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über den Mut und die Zerbrechlichkeit eines Mannes, der die Welt veränderte. „Saviano macht aus Fakten Literatur.“ Luzia Braun, ZDF Aspekte
Wie lebt man, wenn man weiß, dass die eigenen Tage gezählt sind? Savianos wichtigstes Buch seit „Gomorrah“ erzählt das Leben des größten Mafiajägers der Geschichte. Nicht nur als Richter, sondern auch als Ehemann, als Bruder, als Freund. Mit seinem Geldwäsche-Gesetz forderte Falcone die Mafia heraus. Als er am 25. Mai 1992 mit seiner Frau unterwegs zum Wochenendhaus ist, sprengt die Mafia sie mitsamt einem Stück Autobahn in die Luft. Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte Italiens und Europas. Saviano, der seit Jahren unter Polizeischutz lebt, zeigt anhand von Falcones Geschichte wie demokratische Strukturen ausgehöhlt werden und wie durch Zivilcourage die Welt verändert werden kann. Ein Buch, das uns alle betrifft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wie lebt man, wenn man weiß, dass die eigenen Tage gezählt sind? Savianos wichtigstes Buch seit »Gomorrah« erzählt das Leben des größten Mafiajägers der Geschichte. Nicht nur als Richter, sondern auch als Ehemann, als Bruder, als Freund. Mit seinem Geldwäsche-Gesetz forderte Falcone die Mafia heraus. Als er am 25. Mai 1992 mit seiner Frau unterwegs zum Wochenendhaus ist, sprengt die Mafia sie mitsamt einem Stück Autobahn in die Luft. Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte Italiens und Europas. Saviano, der seit Jahren unter Polizeischutz lebt, zeigt anhand von Falcones Geschichte wie demokratische Strukturen ausgehöhlt werden und wie durch Zivilcourage die Welt verändert werden kann. Ein Buch, das uns alle betrifft.
Roberto Saviano
Falcone
Roman
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Hanser
Für das vergossene Blut, das niemals trocknet.
Dieser Roman erzählt eine wahre Geschichte. Zu manchen Episoden gibt es mehrere Versionen und vielfältige Vermutungen. Von Mal zu Mal habe ich die ausgesucht, die mir am wahrscheinlichsten und überzeugendsten erschien. Diese Arbeit dokumentiere ich in den bibliographischen Angaben zu jedem Kapitel, die die Leser im Internet bei Hanser Plus finden.
Wenn ich mit Hilfe der Vorstellungskraft Fakten verbunden, Lücken gefüllt, Dialoge rekonstruiert, mir kurze Szenen ausgemalt oder Gefühlen und Gedanken Gestalt verliehen habe, dann geschah das nie willkürlich, sondern immer auf der Grundlage historischer Zeugnisse oder konkreter Hinweise. An manchen Stellen habe ich die zeitliche Abfolge der Ereignisse den Erfordernissen der Erzählung angepasst, um ein komplexes, oft verwickeltes Geschehen linearer darzustellen. Diese Seiten sind ein Tableau, entstanden mit Hilfe der Mittel, die die Romanform zur Verfügung stellt. Jede Szene ist ein Ausschnitt des Dramas eines ganzen Landes, wo die Wahrheit so verzerrt ist, dass sie die kühnsten Phantasien übertrifft.
Alle auftretenden Personen hat es wirklich gegeben, jedes Ereignis ist tatsächlich geschehen. All das ist gewesen.
R. S.
1.
FEUER
Corleone, 1943
Ein Donnern erschüttert den Boden. Dann nur Steine. Steine, Fetzen und gebrochene Knochen.
Es schien inzwischen Vergangenheit zu sein, der Teufel schien seine gewaltige Trommel abgelegt, das Pfeifen, das Krachen und die Zerstörungen des Krieges die Straße des Himmels verlassen zu haben. Wenigstens regnete es kein Eisen mehr von oben. Mit dem Sommer hatten auch die Bombardierungen aufgehört. Was war das dann? Warum hängen die Kruzifixe jetzt schief an ihren Nägeln in der Wand?
In der Via Rua del Piano ist die Hölle ausgebrochen. Das Haus von Giovanni und seiner Familie gibt es nicht mehr. Einer steht fassungslos vor den Trümmern und Flammen und blickt über die graue Staubwolke hinweg.
Zwischen den Trümmern nur der junge Salvatore, er lebt noch. Auch Gaetano, sein Bruder, lebt. Er krümmt sich am Boden, blutüberströmt. Die anderen männlichen Mitglieder der Familie sind tot.
Die Hölle schien bis jetzt weit weg von Corleone. Hier wird gearbeitet, man betet und gründet eine Familie.
Der Schlaf dieser ländlichen Gegenden ist so friedlich, dass die Fremden, wenn sie aus irgendeinem Grund hierher geraten, vorsichtig über den Boden gehen, aus Angst, er könnte urplötzlich erwachen, die Erdschollen könnten sich bewegen und in der warmen, blöden Luft über den Feldern könnte ein spöttisches Gelächter aus den Abgründen über ihren Köpfen ertönen: Habt ihr armen Dummköpfe wirklich geglaubt, dass dieser Boden schläft?
Hier erwacht der Boden lange vor der Sonne. Er beginnt zu atmen, wenn es noch dunkel ist. Er dehnt sich, reckt seine Glieder. Er scheint sogar zu gähnen, sein warmer Atem scheint träge über den Obstgärten aufzusteigen.
Mit dem Boden erwachen auch die Menschen.
Heute Morgen hat Giovanni seine drei Söhne auf den Karren geladen, als die Luft noch lauwarm war. Das Maultier setzte sich lustlos auf der Via Rua del Piano in Bewegung, und das Klock, Klock, Klock seiner Hufe ließ die drei Jungen immer wieder einnicken, während Giovanni schon den Tag vor Augen hatte und geradeaus blickte, die Zügel fest in der Hand. Nach und nach ließ der Karren die niedrigen, grauen Häuser hinter sich, und das Land öffnete sich zu beiden Seiten, jenseits der unsichtbaren Barriere, die Corleone umschließt, die der Kirchen: San Michele Arcangelo, San Bernardo, San Nicolò, dann San Leoluca, Madonna delle Grazie, Santa Maria Maddalena, Maria Santissima Annunziata, San Giovanni Evangelista und wieder San Michele Arcangelo. Wollte man sie miteinander verbinden, würden sie eine Umfriedungsmauer ergeben. Von denen im Ortsinneren ganz zu schweigen. Für die Christenmenschen gibt es manchmal keinen Platz in den Betten dieser alten Häuschen, die oft eine ganze Familie beherbergen, dazu die Hunde, die Schweine, die Hühner, aber für die Heiligen gibt es immer genug. Sie hängen an den Bettenden, klammern sich an die Wände, sie spiegeln sich in den Schränken und in den Glasscheiben der Anrichten.
Giovanni besitzt drei Hektar Boden zwischen den Bezirken Marabino, Frattina, San Cristoforo und Mazzadiana. Das ist nicht viel, aber er kommt damit zurecht. Der gesamte Grund in dieser Gegend gehörte einst gewissen schlecht geratenen Baronen, die überall erzählten, sie könnten bis nach Palermo gelangen, ohne ihre Ländereien zu verlassen. Und das stimmte. Kein Wunder, wenn heute, in einer Landschaft aus Schafen, Johannisbrotbäumen, Oliven und ein paar Weinbergen — all das im Besitz eines einzigen Gutsherrn oder eines anderen vor ihm, und so immer weiter zurück in die Vergangenheit — wenn in einem Dorf aus elenden Tagelöhnern und Pächtern, den gabelotti, aus Feldhütern und Hunden, die andere Hunde fressen, um nicht zu verhungern, drei Hektar Landbesitz und eine Mahlzeit am Tag auf dem Tisch als ein Vermögen gelten.
Auf seine Weise ist Giovanni ein vom Glück begünstigter Mann. Zwischen den Falten seines sonnenverbrannten, sechsundvierzig Jahre lang von der Hitze gerösteten Gesichts verstecken sich ein paar Krümel Dankbarkeit. Etwas hat er erreicht, nach einem Leben auf dem Acker, mit gebeugtem Rücken und schmerzenden Armen jeden Abend. Seit er zurückdenken kann, gab es keinen Tag, an dem er sich nicht krummgeschuftet hat, und wenn nicht er selbst buckelte, dann sorgten andere dafür, die Königlichen Carabinieri von Corleone haben ihn in die Verbrecherkartei eingetragen, als »Subjekt, das für Personen und fremden Besitz von Schaden sein kann«.
Was Giovanni und seine drei Söhne Salvatore, Gaetano und Francesco an diesem Morgen zwischen dem Laub suchen gingen, war kein fremder Besitz. Es waren sozusagen Geschenke, vom Himmel gefallen. Amerikanische Bomben. Eisen, Schießpulver, Metall, das man benutzen, verkaufen oder eintauschen konnte. Schwärme von Jagdbombern haben am Himmel Siziliens gebrummt, um eine Brut aus Dracheneiern zwischen den Erdschollen abzulegen. Für den, der sie sehen kann, glitzern sie jetzt halb unter der Erde versteckt im Sonnenlicht.
Nachdem sie die Felder um Corleone kreuz und quer durchforstet hatten, haben sie es gefunden: einen Sprengkörper made in USA und ein Kanonengeschoss.
Salvatore, genannt Totò, ist zwölf Jahre alt. Er ist der Älteste und Stärkste, obwohl er nur einen Meter sechzig groß ist. Seine Kraft wird gebraucht, um die Bombe und das Projektil auf den Karren zu laden.
»Langsam! Laaangsam! Sonst kracht’s hier.«
»Los!«, ruft Totò Gaetano zu, der auf der Pritsche des Karrens kniet. »Zieh …«
Gaetano und Francesco wickeln einen Leinensack um die Bombe und das Projektil, während Giovanni sie beobachtet und an den Fingernägeln kaut.
»Wir fliegen alle in die Luft, pass doch auf … Mit Krachern und Feuer gehen wir hoch …« Das Geschoss ist aus dem Sack gerutscht und rollt bis ans Ende der Pritsche.
»Oh, nein!« Giovanni beißt sich in die Faust. »Nichtsnutz!« Die Jungen sehen ihn ängstlich an. Nicht so sehr wegen des Risikos, in die Luft zu fliegen, als wegen seiner schwieligen, starken Hand, die jederzeit zuschlagen kann.
»Kam hier schon durch, ’s Feuerwerk vom Santo Luca, sehen wir zu, dass wir heil nach Haus kommen, amunì, auf jetzt!«
Und so machten sich, als die Ladung verstaut, das Geschoss und die Bombe auf einen Haufen Stroh gebettet war, damit sie während der Fahrt nicht gerüttelt wurden, alle Männer der Familie am späten Nachmittag auf den Weg nach Hause. Eine Stunde sollte es dauern, wenn das Maultier mitmachte, bevor sie den Klumpen kleiner Bauerhäuser wiedersahen, alle grau, mit brüchigen Ziegeln bedeckt und vollgestopft mit Heiligen, Kruzifixen und nie erhörten Gebeten.
Gaetano betrachtete die Straße und sprach mit seinem Vater über Furchen, die am nächsten Morgen in den Boden bei Mazzadina gezogen werden mussten. Francesco war der einzige, der, mit den beiden Sprengkörpern zwischen den Füßen, auf dem Rückweg schlafen konnte. Totò sprach kein Wort. Er blickte zum Himmel und kaute an den Fingernägeln. Als sie in Corleone ankamen, verpasste er dem Kleinsten eine Ohrfeige.
An der Ecke der Via Rua del Piano und Via Ravenna sprangen sie vom Karren. Giovanni breitete ein Tuch am Boden aus, nahm die Bombe und legte sie darauf. Er wollte sie dort entschärfen, auf der Straße, vor der Tür zu seinem Haus.
Er bückte sich über die Bombe. Zwei alte Frauen, die durch die Via Ravenna gingen, sahen seinen Rücken über eine Art Torpedo gebeugt. Er werkelte, wie so oft, wenn er die Achsen des Karrens richtete, die Schafe melkte, die Bohnen erntete. Jetzt aber spielte er mit siebzig Kilo Sprengstoff vor den Fenstern eines knappen Tausends Christenmenschen, die schon viel Unglück gesehen hatten. Die beiden alten Frauen warfen einen Blick auf die drei armen Kleinen, die auf dem Mäuerchen hockten und zusahen, wie der Vater sich abmühte. Totò antwortete mit einem Grinsen, er war stolz auf seinen Vater, der den Tod verspottete und ihn fachmännisch melkte, ihm ein Stück nach dem anderen abnahm und es zu Geld machte.
Giovanni brauchte nicht lang, um die Bombe zu entschärfen. Vielleicht würde er sie verkaufen. Wem, das war unwichtig. Hauptsache, der kam mit der passenden Summe an, danach war es seine eigene Angelegenheit. Metall, Eisenstücke, Schießpulver — diese Bomben der Amerikaner waren wie Schweine. Nichts wurde weggeworfen. Sie waren besser als Trüffeln und sehr viel leichter zu finden. Aber sie konnten explodieren.
Giovanni hatte eine gewisse Erfahrung mit den Trüffeln aus Stahl. In wenigen Sekunden war er fertig mit dem Zünder vorne und dem hinten. Er wusste nicht mal, wozu sie dienten, aber er wusste, wie er sie abmontieren musste. Jetzt war die Bombe harmlos.
Das Projektil aber nicht. Es war an der Spitze geborsten, und im Inneren war kein Schießpulver. Giovanni und die Jungen drehten es hin und her, drinnen war nichts. Es war leer. Giovanni würde das Eisen wiederverwerten.
Das Projektil war so unschädlich, dass Giovanni den Jungen sagte, sie sollten es ins Haus bringen, in dieses Haus, halb Stall, halb Kirche, mit den Tieren, die niemals still waren.
Die Frauen waren nicht daheim. Maria Concetta war unterwegs, Besorgungen machen mit der älteren Tochter Caterina und der Jüngsten, Arcangela. Sie gingen durch eines der Gässchen des Dorfs, mit langsamen, müden Schritten, denn Maria Concetta war im achten Monat und hatte einen Bauch, dick wie drei Wassermelonen. Sie sahen nicht, wie Giovanni einen Stein nahm, über die Schwelle schritt und der Spitze des Projektils einen harten, entschiedenen Schlag versetzte. Die Jungen aber sahen es. Sie standen hinter dem Vater, als das Projektil mit einem ungeheuren Knall explodierte und die Flammen das Haus umhüllten.
Jetzt erkennt Totò den Körper des Vaters nicht mehr wieder. Eben stand er noch da, brummte etwas, seine starken Arme wirbelten in der Luft, die schwieligen Finger umklammerten einen Stein, und jetzt ist er zerrissen, überall verstreut, auf den Wänden und auf dem Boden dieses zerfetzten Hauses. Auch der kleine Francesco ist so gestorben. Gaetano liegt zusammengekrümmt am Boden. Die Eisensplitter sind in sein rechtes Bein gedrungen, haben ihn am Hals und im Gesicht verletzt.
Nur Totò steht noch auf den Beinen, ohne einen Kratzer, in einer Hölle aus Feuer und Verzweiflung. Jetzt ist er das Familienoberhaupt, der einzige Mann der Familie Riina, der unversehrt blieb.
Um ihn herum tanzen die Flammen, aber sie berühren ihn nicht.
Unter den Menschen, die sich jetzt auf der Straße versammelt haben, wo viele verzweifelt weinen und schreien, sprechen manche von einem Wunder.
2.
DER SPIELVERDERBER
Palermo, 1982
Ist es denn wirklich nötig, dass sich das Heute vom Gestern unterscheidet?
Das denkt der Direktor der Sparkasse, als er die Bar dei Miracoli direkt gegenüber der Bank betritt, wo der Besitzer ihn lächelnd mit einem Kopfnicken begrüßt. Auch der Mann hinter der Theke grüßt.
»Direttore.«
Er nimmt seinen Hut ab, legt ihn auf die Theke und wartet auf seinen üblichen Kaffee mit Croissant, die in Rekordzeit ankommen, begleitet von einem Glas sprudelndem Mineralwasser. Der Direktor senkt den Kopf, betrachtet beides forschend. Wägt es ab.
Der Kaffee ist anständig. Das Croissant ebenfalls. Wäre es nicht soeben aus dem Ofen gekommen, wäre es nichts Besonderes, aber es ist schön warm, also ist die Bilanz auf jeden Fall positiv. Er ist immer dankbar, wenn er vor einer positiven Bilanz steht, sei es die eines seiner Kontoinhaber oder seine eigene.
Also hat der Direktor, während er in das Croissant beißt und die Zuckerkrümel auf seiner Zunge schmelzen, schon die Antwort auf seine Frage. Es ist wirklich nicht nötig, dass sich das Heute vom Gestern unterscheidet.
Der Direktor setzt seinen Hut wieder auf und verlässt die Bar. Er überquert die Piazza mit gesenktem Blick, an seiner rechten Hand baumelt die lederne Aktentasche.
Auf der Westseite der Piazza angekommen, wo die Arkaden der Sicilcassa dem Gebäude aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert etwas Prätentiöses verleihen, spielt der Direktor ein Spiel, das sich jeden Morgen mehr oder weniger gleich wiederholt. Er versucht zu berechnen, wie groß der Unterschied in Zentimetern zwischen seinen Schritten bis zum Eingang heute und den Schritten von gestern ist. Selbst wenn er eines Tages die Perfektion erreichen könnte, indem er genau in seine Spuren vom Tag zuvor tritt, er wird es nie erfahren. Doch Spiele funktionieren, nach allem, was er weiß, so lange, bis keiner wirklich gewinnt.
Dennoch ist heute etwas anders. Er hat die Eingangstür durchschritten und geht mit gesenktem Kopf weiter, als er einige indiskrete Blicke auf sich spürt. Er fühlt sich beobachtet. Ein paar Meter vor seinem Büro sieht er zwei Männer in Uniform, die mit der Sekretärin sprechen. Einer von ihnen stützt sich mit dem Ellenbogen auf den Schreibtisch und lächelt sie an. Doch kaum haben sie ihn gesehen, stehen beide wieder kerzengerade und steif da. Der andere, der sich nicht auf den Schreibtisch gestützt hatte, reicht ihm einen Umschlag, ohne etwas zu sagen.
»Direttore«, mischt sich die Sekretärin ein, »die Beamten sind gekommen, um eine …«
»Eine Anordnung des Gerichts«, unterbricht sie der kleinere der beiden, der jetzt einen anderen Gesichtsausdruck hat.
Der Direktor nimmt den Umschlag an sich. Sein Blick geht von der Sekretärin zu den Männern von der Finanzpolizei. Er versucht ein Lächeln, doch heraus kommt eine seltsame Grimasse.
»Darf ich erfahren, worum es sich handelt?«
»Tja«, sagt die Frau, »das habe ich auch gefragt, aber …«
»Nichts, Direttore. Es ist ein Schreiben aus dem Büro des Ermittlungsrichters.«
»Aha … und worum handelt es sich?«, fragt er wieder. Dabei weiß er ganz genau, worum es sich handelt. Dass es früher oder später so kommen würde, wusste er, und er hatte die schwache — darum aber nicht unbedeutende — Hoffnung gehegt, dass es nicht geschähe. Heute ist diese Hoffnung zunichte.
»Sie müssen es selbst lesen, Direttore. Wir müssen nur zustellen. Unterschreiben Sie bitte hier.«
Der Direktor unterschreibt. Die beiden Finanzpolizisten, die beide ihr Girokonto bei der Sicilcassa haben, schütteln ihm die Hand und deuten ein Heben ihrer Mütze an, dann gehen sie durch den Flur. Das Geräusch ihrer Absätze hallt von einer Wand zur anderen, während der Direktor und die Sekretärin sich unschlüssig ansehen.
In seinem Büro nimmt der Direktor den Hut ab und hängt ihn an den Haken hinter der Tür. Er setzt sich an den Schreibtisch und öffnet den Umschlag mit einem Brieföffner. Betrachtet das zusammengefaltete Papier, dreht und wendet es in den Händen wie ein Pokerspieler. Er streichelt es, versucht, es mit den Fingerspitzen zu liebkosen, im Wissen, dass dieses Blatt die Zukunft der jetzigen Spielrunde und vielleicht auch der folgenden bestimmen wird.
Ein leichtes Zittern bewegt seine Hände.
Endlich ringt er sich durch.
Das Schreiben ist sehr knapp gefasst. Trotzdem braucht er ein paar Minuten, um es zu lesen und abermals zu lesen. In gewisser Weise ist es tröstlich, dass es nun auch ihm passiert. Die Androhung, sagt man, wiegt viel schwerer als ihre Ausführung. Von diesem Moment an gibt es keine Androhung mehr, es gibt nur das Problem.
Im Rahmen einer laufenden Untersuchung ergeht die Anordnung der Ermittlungsabteilung am Gericht von Palermo, dem unterzeichnenden Ermittlungsrichter Giovanni Falcone unverzüglich vollständige Listen sämtlicher Umtauschgeschäfte ausländischer Währungen vorzulegen, die durch das von Ihnen geleitete Kreditinstitut ab Januar 1975 bis zum heutigen Tag getätigt wurden.
Der Direktor legt den Brief auf den massigen Mahagonischreibtisch und dreht sich zum Fenster um. Auch heute erhellt die Morgensonne den großen Raum, der auf die Piazza blickt. Er hebt den Hörer des Telefons zu seiner Rechten — ein weiteres steht auf der linken Seite — und drückt einen Knopf.
»Verbinde mich mit dem Direktor der Banco di Sicilia.«
Er wartet ein paar Minuten, blickt ins Leere und massiert sein Kinn, dann klingelt das Telefon. Die Sekretärin verbindet ihn mit dem Kollegen.
»Bei mir ist er auch angekommen.«
»Willkommen im Club«, sagt der andere.
Wortlos hängt er auf und starrt wieder vor sich hin. So sitzt er über eine Viertelstunde lang da, allein. Niemand betritt das Zimmer, die Angestellten wissen, dass sie ihn am frühen Morgen nicht stören dürfen, außer bei sehr wichtigen Angelegenheiten. Denn um diese Zeit liest er die Tageszeitungen.
Als er gerade meint, die Sache wenigstens ein paar Stunden lang hinter sich lassen zu können, klingelt das Telefon.
»Der Direktor der Raiffeisen- und Handwerksbank fragt …«
»Schon gut, schon gut, gib ihn mir.«
»Ist er auch bei dir angekommen?«, fragt er ihn sofort. Er ist auch bei ihm angekommen. Offenbar hat die palermitanische Staatsanwaltschaft wieder einmal ein Rundschreiben verschickt. Jetzt müsste die Liste der Banken vollständig sein. Die Stimme des Kollegen klingt so angespannt wie seine eigene, ganz anders als die entspannte Stimme am Donnerstagabend, wenn sie sich zum Kartenspiel treffen.
Unglücklicherweise wird sich der heutige Tag wohl vom gestrigen unterscheiden.
Am nächsten Morgen herrscht ein merkwürdiges Kommen und Gehen vor dem Palazzaccio. Ein abschätziger Ausdruck, weit verbreitet im Belpaese, wenn von Gerichtsgebäuden die Rede ist. Umso mehr, wenn das Gericht in Palermo gemeint ist, ein Durcheinander aus Marmor und Zement mit strenger Fassade, wuchtigen Pfeilern und schmucklosem Inneren. Nimmt man hinzu, dass niemand sich freut, vor Gericht zu landen, ist der Spitzname mehr als berechtigt.
Es ist ein merkwürdiges Kommen und Gehen, weniger wegen der Kleidung der Komparsen, im Grunde die gleiche wie immer — dunkler Anzug, Krawatte, Aktenköfferchen — als wegen der Gesichter, denn es sind nicht die üblichen der Anwälte, Richter, Gerichtsdiener und Sekretärinnen.
Vor dem Eingang des Gerichts parken schwere Limousinen. Die Fahrer stehen an die Wagen gelehnt und warten auf die Rückkehr der Geschäftsleute, die sie hergefahren haben.
Ein jähes dumpfes Geräusch, gefolgt von Brummeln, lässt die Passanten aufhorchen. Mehrere Fahrer haben sich um ein Auto mit dunklen Scheiben versammelt und benutzen die Motorhaube als Spieltisch. Gerade hat einer ein Ass daraufgeknallt, zum lautstarken Leidwesen der Kollegen.
Es wird noch dauern, bis ihre Chefs zurückkommen. Die Fahrer wissen nicht, worum es geht und wie lange sie noch warten müssen, doch die Tatsache, dass sie alle zusammengekommen sind, verheißt nichts Gutes. Oder wenigstens nichts Schnelles.
Der größte Teil ihrer Arbeitgeber sind Bankdirektoren, aber es sind auch ein paar mehr oder weniger bekannte Gestalten der Lokalpolitik darunter. Außer den üblichen Besuchern des Gerichtsgebäudes würde niemand sie voneinander unterscheiden können, wenn er sie über die Flure wandern sähe.
Im Inneren herrscht, verglichen mit dem gewohnten alltäglichen Trott, ein Misston, der das Gebäude mit einer gedämpften Hektik belebt. Normalerweise sind es die Jüngeren, die von einem Büro zum anderen hasten, während die Alten eine gewisse Mäßigung an den Tag legen, wenn es darum geht, sich vom eigenen Sessel wegzubewegen. Heute aber sind die Eiligen alle weißhaarig. Und sie sind keine Richter. Auch keine Anwälte.
»Wenn Sie keine Vorladung haben, kann der Dottore sie nicht empfangen«, erklärt eine Sekretärin einem Mann im Zweireiher, der sich bis ins Gebäude von seinem Fahrer oder seinem Taschenträger begleiten ließ. Der steht tatsächlich mit einem Aktenkoffer hinter ihm.
»Natürlich habe ich eine Vorladung. Der Brief von Falcone ist angekommen, wenn das keine Vorladung ist …«
»Es ist keine Vorladung, es ist eine förmliche Anweisung. Wenn Sie mit Dottor Falcone sprechen wollen, müssen Sie einen Antrag auf …«
»Einen Antrag stelle ich nicht. Dann lassen Sie seine Exzellenz Pizzillo, der bis zum Beweis des Gegenteils der oberste Leiter von diesem … von diesem Ort hier ist, bitte wissen, dass ich hier bin und ihn sehen will. Nehmen Sie meinen Ausweis. Antò, die Brieftasche«, sagt er zu dem Mann hinter ihm. Der stellt sich ans Fensterbrett, legt den Aktenkoffer darauf ab, öffnet ihn und wühlt darin.
»Zu Dottor Pizzillo müssen Sie nach oben ins Stockwerk … Entschuldigung, aber haben Sie einen Termin?«
»Einen Termin?«, fragt er. Der Gesichtsausdruck ist angewidert.
»Ja. Sie können nicht einfach so zu ihm, ohne Termin.«
Der Mann im Zweireiher sieht sie ein paar Sekunden lang stumm an. Dann seufzt er.
Er dreht sich zu seinem Taschenträger um. »Gehen wir, komm«, und sie entfernen sich durch den Flur. In diesem Moment fängt das Telefon auf dem Schreibtisch der Sekretärin wieder an zu klingeln, wie kurz vor der Ankunft der beiden, als es ununterbrochen klingelte.
»Büro Ermittlungsrichter. Nein, Dottor Falcone kann nicht … Ja, ich verstehe, aber der Dottore kann keine Anrufe entgegennehmen. Nein, es geht nicht um Ihren, er kann generell keine Anrufe …« Die Sekretärin verdreht die Augen zum Himmel.
Vor der Tür des Generalstaatsanwalts Pizzillo steht ein halbes Dutzend wartender Menschen. Ein Polizist, der hinter einem hölzernen Bänkchen sitzt, fordert sie von Zeit zu Zeit mit einem Pst! auf, leiser zu sprechen, dann liest er weiter Zeitung. Von drinnen kommen die erregten Stimmen zweier Personen. Obwohl sie laut sprechen, versteht man nicht, was sie sagen. Gelegentlich kommen jedoch Satzbruchstücke bei denen an, die draußen warten. Wörter wie »ruinieren«, »Ermittlungen«, »Sizilien« und ein ziemlich häufiges »Scheiße« schaffen Einigkeit unter allen Anwesenden. Jemand nickt, andere wandern nervös im Kreis. Als der Nächste erscheint, gefolgt von seinem Kofferträger, begrüßen ihn alle.
»Aha, sieh mal an«, sagt einer, hager wie ein Skelett, doch nach seinen goldenen Manschettenknöpfen und der Armbanduhr zu urteilen, hat er Hunger nie kennengelernt. »Nur wir fehlten noch. Jetzt kann Falcone feiern, er hat alle Namen auf der Liste angekreuzt. Vielleicht fehlt nur noch …« Doch da kommt schon wieder einer.
»Ein wahrer Prophet bist du!«, sagt ein Kollege und schlägt ihm auf die Schulter. Sie lachen. In diesem Moment öffnet sich die Tür.
»Seine Exzellenz«, sagt einer.
»Giovanni«, grüßt ein anderer.
»Presidente«, der Nächste.
Der Angesprochene blickt sie einen nach dem anderen an, seufzt, zuckt mit den Schultern.
»Kommt rein.«
Im Büro des Generalstaatsanwalts tasten Hände in den Taschen eleganter dunkler Jacketts, dann klicken die Feuerzeuge eins nach dem anderen. Kurze Zeit später ist das Zimmer in dichten Rauch gehüllt.
»Giovanni, Giovanni …«, hebt einer an, sich die Hände reibend. Er trägt einen hellen Anzug und eine hellblaue Krawatte mit kleinen Seepferdchen. Er ist klein und schmächtig, darum wirkt die dicke Zigarre, an der er soeben gezogen hat, noch dicker. »Du weißt, wie lange wir uns kennen. Habe ich mir je erlaubt, dies oder jenes zu sagen? Zu sagen, das hier ist in Ordnung, aber das da ein Scheißdreck? Haben wir uns das je erlaubt?« Er blickt zum gesamten Auditorium hin. Alle schütteln den Kopf.
Einer hebt die Hände. »Und auch jetzt tun wir das nicht.«
»Oh nein, keinesfalls«, pflichtet der im hellen Anzug ihm bei. »Aber eins muss ich dich fragen, und ich frage dich im Namen aller hier anwesenden Herren. Dürfen wir?«
Pizzillo nickt gönnerhaft und fordert ihn mit einer Handbewegung auf, weiterzureden.
»Sehr gut. Ich möchte wissen, wir möchten wissen, ob wir den Beruf wechseln sollen, ob wir uns … was weiß ich, Arbeit bei der Post suchen sollen?«
»Ich bin alt, Signor Presidente«, sagt einer, der an dem kleinen Bücherregal an der Wand lehnt. »Ich kann nur in Pension gehen.« Pizzillo beachtet ihn nicht.
»Wir müssen … ich weiß es nicht, was sollen wir machen? Bei all diesen Papieren, die ihr haben wollt, all diesen Nachforschungen«, gestikulierend bläst der Mann eine Rauchwolke aus, »kommt bei uns alles zum Erliegen. Alles bleibt stecken.«
»Ganze Tage für die Nachforschungen«, sagt der am Bücherregal. »Signor Presidente, wir müssen diese Untersuchungen für Euch machen. Aber dann wird nicht mehr gearbeitet.«
»Alles kommt zum Erliegen«, bekräftigt ein anderer.
Pizzillo massiert sich die Stirn. Er schweigt, während die anderen ihn hinter dem Vorhang aus Rauch anstarren. Nach einer Weile erwacht er aus seiner Meditation. »Was soll ich denn machen? Ich kann die Ermittlungsabteilung doch nicht schließen.«
»Aber nein!« Der Kleinwüchsige mit der Zigarre kommt auf ihn zu und erläutert seinen Gedanken: »Nie und nimmer, Giovanni. Wir würden uns niemals erlauben, von dir zu verlangen, dass du jemandem kündigst. Wie kommst du nur darauf? Entschuldige, falls wir uns missverständlich ausgedrückt haben. Wir wollen nur … atmen«, und mit einer theatralischen Geste lockert er den Knoten seiner Krawatte. »Atmen«, wiederholt er, den Rauch seiner dicken Zigarre ausstoßend. »Atmen.« Er sieht die anderen an, die nicken und, in vollen Zügen Nikotin inhalierend, endlich lächeln. »Nur ein wenig atmen.«
»Nur atmen«, echot sein Kollege am Bücherregal.
Eine Stunde später hat Pizzillo es hinter sich gebracht, verabschiedet seine Besucher und bleibt einen Augenblick mit abwesendem Blick im Türrahmen stehen, während die Stimmen sich entfernen. Als er den letzten am Ende des Flurs um die Ecke biegen sieht, schließt er langsam die Tür und setzt sich wieder. Doch er hat nicht einmal Zeit, sich im Sessel zurückzulehnen, da klopft jemand an die Tür.
»Presidente.« Es ist Rocco Chinnici, Leiter der Ermittlungsabteilung. Chinnici ist teils wegen seiner Körpergröße, teils wegen seiner vielen Berufsjahre und des Amtes, das er bekleidet, im Justizgebäude sehr angesehen. Sein Büro hat die Aufgabe, die Strafverfahren mit Informationen zu versorgen, indem es Beweise sammelt, das Material zusammenstellt und faktisch die Gerichtsakte vorbereitet, die dann im Gerichtssaal zu Lasten der Angeklagten präsentiert wird. Die Arbeit der Ermittlungsabteilung ist sehr heikel. Die formale Korrektheit der Anklagen und die Sammlung des belastenden Beweismaterials sind entscheidend. Vor allem in einer Stadt wie Palermo, wo zahllose Mafiaprozesse aus Mangel an Beweisen mit Freisprüchen endeten. Man kann nicht zweimal für dasselbe Verbrechen angeklagt werden, und ist der Schaden einmal angerichtet, lässt er sich nicht mehr beheben.
Pizzillo nickt und weist auf den Sessel vor seinem Schreibtisch. »Ich wäre zu dir gekommen«, sagt er.
Chinnici tritt ein und schließt die Tür.
»Wegen der Sache mit dem Amtsrichter? La Commare muss ersetzt werden, der Oberste Richterrat hat beschlossen, dass der Gerichtspräsident zuständig ist, wenn wir das nicht …«
»Nein, nein, setz dich. Erst müssen wir über etwas anderes sprechen.«
»Presidente, es ist aber dringend.«
»Erst gibt es etwas Wichtigeres. Willst du dich nun setzen oder nicht?«
»Natürlich.« Chinnici setzt sich. Er streicht mit dem Zeige- und Mittelfinger über seine Krawatte und blickt Pizzillo fragend an.
»Nun, du musst mir erklären, was du und deine … wie nennst du sie? Die Plasmon?«
Chinnici schlägt sich lächelnd mit der Hand auf den Schenkel. »Diesen Namen habe ich ihnen einfach so gegeben, aus Zuneigung. Ich nenne sie die Plasmonianier. Nach der Werbung für die Plasmon-Kekse. Kräftigend und voller Aktivstoffe.« Chinnici errötet ein wenig. »Sie sind jünger als ich, es ist eine Art und Weise …«
»Jaja, schon gut. Nenn sie, wie es dir in den Kram passt.«
Chinnici lässt seine Krawatte jetzt zwischen Daumen und vier Fingern auf und ab gleiten, wie um sie zu bügeln. Das ist ein Tick, den seine Kollegen gut kennen. Wenn er ruhig ist, nimmt er nur zwei Finger, mehrere, wenn er anfängt, sich aufzuregen.
»Das Problem ist nicht, wie ihr euch nennt, sondern wie ihr arbeitet.«
»Wie meinst du das?«
»Ihr richtet ein Chaos an, hier blickt man überhaupt nicht mehr durch. Ich bin über das, was ihr tut, unterrichtet.«
»Das ist Ihr Recht. Ihre Pflicht.«
»Danke, dass du mich daran erinnerst.« Pizzillo erhebt sich und betrachtet das Bild von Sandro Pertini an der Wand, wobei er Chinnici den Rücken zudreht. Der sagt nichts. Auch Pizzillo schweigt eine Weile. Dann dreht er sich plötzlich um und legt die Hände auf den Schreibtisch. »Ich habe euch immer machen lassen, denn es gefällt mir, dass ihr gründlich seid, dass ihr nachforscht, dass ihr die Dinge wieder in Ordnung bringen wollt. Aber so geht das nicht. Vielleicht ist euch nicht klar, dass ihr die Wirtschaft Palermos zugrunde richtet.«
»Wir?«, fragt Chinnici, der dem Obersten Richterrat angehört, erstaunt.
»Ich etwa? Findest du es normal, dass diese Herren jeden Tag erleben müssen, wie die Finanzpolizei in ihren Filialen aufkreuzt? Dass sie ihre Zeit damit verbringen müssen, die Listen mit den Wechselscheinen aufzutreiben? Tage, die damit vergeudet werden, in der Buchhaltung zu wühlen, weil …«, er fuchtelt mit den Händen, »weil Giovanni Falcone sich in den Kopf gesetzt hat, den Sheriff zu spielen?«
Chinnici runzelt die Stirn. »Er macht nur seine Arbeit.«
»Er macht sie schlecht. Und da du sein Chef bist, machst auch du sie schlecht.«
Chinnici lockert seine Krawatte. Pizzillo hebt die Hände, als wollte er etwas sagen, schweigt aber. Er dreht sich wieder zur Wand um und massiert sein Kinn.
»Weißt du, was du tun musst?«
»Nein.«
»Du musst dafür sorgen, dass er wirklich arbeitet.«
»Falcone? Aber ich finde, dass er jetzt schon …«
»Du musst ihn mit Prozessen überhäufen. Aber einfache Prozesse, die alltäglichen.« Pizzillo setzt sich wieder. »Dann wird er das tun, was die Untersuchungsrichter immer getan haben.«
»Nämlich?«
»Nichts!« Er schlägt mit der Faust auf den Schreibtisch.
»Ich will Ihnen damit nicht widersprechen, aber wir sind diejenigen gewesen, die die Kanäle des Drogenhandels zwischen Palermo und den USA entdeckt haben, und wir sind Ermittlungsrichter.«
Pizzillo stützt die Ellenbogen auf den Schreibtisch und starrt Chinnici an. Sein Kiefer ist zusammengepresst. So verharrt er ein paar Sekunden. Nach einer Wartezeit, die endlos scheint, lehnt er sich im Sessel zurück. Er schlägt die Beine übereinander, hustet. Versucht, seinen Zorn zu verbergen, aber es gelingt ihm nicht.
»Was ihr da macht, Rocco, das tut man nicht. Ich werde eure Büros durchsuchen lassen.«
»Dazu sind Sie berechtigt.«
»Wir sind fertig.« Pizzillo hebt eine Hand, um ihm die Tür zu zeigen. Chinnici steht auf, schiebt den Sessel an den Schreibtisch und verlässt den Raum.
Der Aufmarsch der Banker dauert den ganzen Morgen. Kurz nach zwei zieht die Sekretärin sich in ein kleines Zimmer zurück, das auf den Flur hinausgeht, direkt gegenüber der Tür zum Büro des Richters Falcone. Sie stellt gerade den Behälter für das Mittagessen beiseite, da stürmt ein Riese mit breiten Schultern, großem Kopf und finsterem Gesichtsausdruck im Laufschritt auf das Zimmer des Richters zu. Als sie die Spitzen seiner Schuhe sieht, will sie etwas sagen. Dann aber erkennt sie Rocco Chinnici.
Seine große Hand legt sich um die Türklinke, die darunter verschwindet. Er ist schon halb im Zimmer, als ihm einfällt, dass er anklopfen muss.
»Rocco«, sagt der Mann, der in dem schwarzen, gepolsterten Sessel am Schreibtisch sitzt. Außer dem langen Schreibtisch aus Holz steht an der Wand ein Möbelstück mit einer Vitrine, es gibt einen Tresor, einen Haufen überall verteilter Aktenordner und eine Olivetti-Schreibmaschine. Zwei weitere leere Schreibtische, einige Apparaturen und eine Reihe Kalender der Streitkräfte an der Wand. Auf dem Boden stapeln sich viele große Kartons.
»Darf ich hereinkommen?«
»Geht’s noch weiter?«
Chinnici schließt die Tür, nimmt den kleinen Stuhl vor dem Schreibtisch und setzt sich. Der Stuhl knarrt unter seinen schweren Knochen. Er hat sich seine Sporen verdient in den zwölf Jahren in Trapani und Partanna, bevor er nach Palermo zurückkam. Für ihn war das eine Rückkehr nach Hause, oder fast. Das Städtchen, wo er 1925 geboren wurde, Misilmeri, liegt in der Umgebung. Die Straße von dort nach Palermo kennt er sehr gut. Nach den Bombardierungen durch die Alliierten war die Eisenbahn kaputt, und um das humanistische Gymnasium Umberto I. zu beenden, musste er jeden Tag zu Fuß nach Palermo. Über fünfzehn Kilometer, etwa drei Stunden Fußmarsch. Zweimal am Tag.
»Giovanni, du weißt, was gerade passiert, oder?«
»Die Meisterschaft für Juve? Ja, weiß ich, aber wir müssen uns damit abfinden …«
»Komm schon, im Ernst. Diese Geschichte mit den Briefen an die Banken gerät allmählich außer Kontrolle.«
»Und das sagst du mir?« Falcone zeigt auf die großen Kartons. Chinnici stützt die Ellenbogen auf den Schreibtisch.
»Ich komme aus Pizzillos Büro.«
»Seine Exzellenz.«
»Genau.«
»Hat er dich einbestellt?«
»Ich bin zu ihm gegangen.«
»Als guter Katholik wolltest du dich selbst geißeln?«
»Ich wollte ihn daran erinnern, dass wir La Commare ersetzen müssen, nach dem Urteilsspruch des Obersten Richterrats wird ein neuer Amtsrichter gebraucht. Aber er hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Er sagt, dass wir von der Ermittlungsabteilung Palermos Wirtschaft zugrunde richten.«
»Aha, so heißt das jetzt, Wirtschaft?«
»Er sagt, ich soll dich mit unwichtigen Prozessen überhäufen, damit du tust, was ein Ermittlungsrichter tut.«
»Nämlich?«
»Nichts.« Er glättet seine Krawatte mit zwei Fingern, ein Zeichen, dass er sich einigermaßen wohlfühlt.
Falcone runzelt die Stirn, fährt sich mit einer Hand über den dunklen Bart. Er sieht ihm in die Augen. Chinnicis Augen wirken bedrohlich, wenn man ihn nicht kennt, und seine körperliche Präsenz jagt dem Gegenüber meistens Angst ein.
Falcones Ausdruck ist abwartend. Er möchte lächeln, ist aber nicht sicher, ob er sich das erlauben darf. Eine Hierarchie ist immer noch eine Hierarchie, etwas, an das sowohl er als auch Chinnici glauben und das sie beide respektieren.
»Und du, was wirst du tun?«
Rocco atmet tief ein, dann stößt er die Luft aus den Nasenlöchern und schweigt.
»Komm mit.« Er bedeutet Falcone, aufzustehen. Falcone rückt den Sessel vom Schreibtisch ab und folgt Chinnici durch den langen Flur. Der führt ihn vor sein Büro, öffnet die Tür und lässt Falcone als Ersten eintreten.
»So schlimm?«, fragt Falcone. »Sind wir schon so weit?«
Dass es im Gericht Neid und eine ganze Reihe mehr oder weniger stillschweigender Feindseligkeiten gibt, ist allen bekannt, wie auch alle wissen, dass diese Spannungen sich seit Falcones Ankunft verschärft haben. Doch von hier bis zum Verdacht, in den Büros könnten Wanzen installiert sein …
»Nein, was hast du denn gedacht?«
»Keine Ahnung, du sagst nichts, bringst mich in ein anderes Büro, ich dachte, dass …«
»Es ist kein anderes Büro, es ist ein besonderes Büro. Es ist das Büro des Mitglieds im Obersten Richterrat, des Leiters der Ermittlungsabteilung. Und das da, weißt du, was das ist?« Er zeigt auf den Sessel.
»Der Sessel des Mitglieds im Richterrat?«
Der Sessel von Cesare Terranova. Er müsste jetzt hier sitzen. Er war kurz davor.«
3.
DER ZETTEL
Palermo, 1979
Es ist ein eigenartiger Septembermorgen in Palermo. Die Luft ist warm, doch nicht zu sehr. Der Himmel ist grau, doch nicht zu sehr. Jeden Moment könnte es regnen oder die Wolken, die das Blau mit einer feuchten Schicht überziehen, könnten aufreißen und der Sonne Platz machen. Noch ist nichts gesagt.
Giovanna öffnet die Augen. Sie sieht, dass Cesare schon wach ist, er hat die Fensterläden geöffnet und lehnt jetzt mit dem Rücken am Kopfende des Bettes. Sie legt den Kopf auf seine Brust und hört die ruhigen, regelmäßigen Schläge seines Herzens. Sie wundert sich, dass er so ruhig sein kann.
»Machst du dir Sorgen?«, flüstert sie zwischen Schlaf und Wachen.
»Nein«, antwortet er, und Giovanna öffnet endgültig die Augen. Sie ärgert sich.
Warum hat sie Angst und er nicht? Die Mafia hat sich sehr klar ausgedrückt. Der Kronzeuge Giuseppe Di Cristina hat zu Protokoll gegeben, das der Boss Luciano Leggio, genannt Liggio, das Todesurteil für den Richter Terranova ausgesprochen hat, und er, Cesare Terranova, hat einfach weiterhin Druck gemacht, um den Posten eines Ermittlungsrichters in Palermo zu bekommen. Er will die Männer mit den nötigen Beweisen konfrontieren, um diesen Abschaum hinter Gitter zu bringen. Und er macht niemandem etwas vor, wenn er sagt, dass er keine Angst hat, ist er ehrlich. Sein Herzschlag bestätigt das. Vor ein paar Tagen hat er zu Giovanna gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen: »Die Mafia tötet keine Richter. Die Richter machen ihre Arbeit, und die Mafiosi die ihre. So war es schon immer.« Doch heute — es mag die Sonne sein, die nicht herauskommen, oder der Regen, der nicht regnen will — ist Giovanna sich keiner Sache mehr sicher. Dass ihr Mann es ist, beruhigt sie nicht, sondern verdrießt sie ein wenig.
»Ich hatte einen Traum«, sagt Cesare plötzlich. Er starrt vor sich ins Leere. Seine Augen sind die eines Kindes. Er hat sie sich so bewahrt, seit er vor achtundfünfzig Jahren in Petralia Sottana geboren wurde, einem ans Madonie-Gebirge geklammerten Örtchen, wo im Winter Schnee bis zu den Knöcheln liegt und man im Sommer, wenn die Sonne brennt, den Kopf unter die Springbrunnen hält. »Paolo Borsellino war ein kleiner Junge. Ich hatte ihn vor mir bei der Gerichtsverhandlung wegen einer Schlägerei, die er und andere rechte Studenten sich mit den Kommunisten geliefert hatten.«
»Aber das ist wirklich passiert.«
»Ja, klar.« Über diese alte Geschichte haben er und Borsellino oft gelacht. Cesare nimmt seine Brille mit den dicken Gläsern vom Nachttisch und setzt sie auf. Jetzt sieht er nicht mehr aus wie ein Kind. »Aber diesmal hat Paolo mir einen Zettel gereicht.« Er kichert. Giovannas Kopf hüpft auf seiner Brust. »Das heißt, er hat versucht, dieses Papier auf meinen Tisch zu legen, doch die Polizisten haben ihn festgehalten. Er bestand darauf, sagte: »Der Zettel! Der Zettel!« Und sie brachten ihn weg.
»Was war das für ein Zettel?«
»Keine Ahnung.« Cesare hat seine Frau nur sehr wenige Male belogen. Diese Antwort ist eines davon. Die zweite Lüge innerhalb weniger Tage.
Etwas mühsam erhebt er sich aus dem Bett, schlüpft in die Pantoffeln und geht mit kleinen Schritten ins Bad. Er fühlt sich müde. Mit achtundfünfzig hätte er auch das Recht dazu. Er hat im Weltkrieg gekämpft und war in Afrika in Gefangenschaft. Dann, er hatte das Gewehr gerade erst abgelegt, hat er einen anderen Krieg begonnen, diesmal unbewaffnet: Schon 1946 war er am Gericht, Amtsrichter in Messina, dann Richter in Patti und Ermittlungsrichter in Palermo, schließlich Staatsanwalt in Marsala. Er hat alles Mögliche gesehen und gehört. Allein und mit Engelsgeduld hat er wichtige Prozesse im Kampf gegen die palermitanische Mafia eingeleitet und Hunderte von Seiten gegen die Anonima Assassini, die Geheime Mörderbande, geschrieben, vierundsechzig Verbrecher, die unter ihrem Anführer »Lucianeddu« Liggio die Straßen von Corleone in Blut tauchten. Und vor einem Jahr hat Liggio sein Todesurteil unterzeichnet. Nachdem Cesare es erfahren hatte, hat er einem Journalisten erklärt, wie sehr er sich ängstigt: »Oft vergesse ich meinen Revolver zuhause, aber ich habe keine Angst. Ich habe Mafiosi niederknien und weinen sehen, auch Liggio. Ich bin Bridge-Spieler. Ich liebe die Karten und spiele, um zu gewinnen. Luciano Liggio … auch er wird verlieren. Unsere Partie ist noch nicht beendet, aber ich habe keine Angst.«
Er ängstigt sich so sehr, dass er eine Zeichnung in seinem Arbeitszimmer aufgehängt hat, das Geschenk seines Malerfreundes Bruno Caruso. Im Vordergrund ist er selbst zu sehen, der Richter, mit Schlips und Sonnenbrille. Dahinter, wie ein Schatten, der Boss. Jeden Tag, den Gott werden lässt, fragt Giovanna ihn, ob es nicht besser wäre, das Bild abzunehmen. Aber Cesare findet nicht, dass es geschmacklos ist. Im Gegenteil, dieses Porträt des Bosses von Corleone mit halb geschlossenen Augen wie die eines Fischs auf dem Trockenen und dem dümmlichen Ausdruck gefällt ihm.
Und weil er sich so ängstigt, hat er das Foto von Liggio, das die Kollegen ihm geschenkt haben — sogar mit Widmung: In Liebe, dein Freund Lucianeddu — in einen silbernen Rahmen gesteckt. Immer wenn er es vor sich sieht, muss er lachen. Doch jedes Mal hinterlässt dieses Lachen einen Schleier der Müdigkeit, einen dunklen Schleier, der sich auf seine Schultern legt, so dass er Tag für Tag, Schleier für Schleier, das Gewicht stärker spürt. Von Angst würde er nicht sprechen, aber von etwas anderem: Seit dieser Flirt mit dem Tod begann, hat er den Eindruck, der Winter würde früher kommen und der Sommer sich eiliger davonmachen, nur kurz für einen Gruß an der Haustür vorbeikommen, um dann zu verschwinden, und danach wieder Kälte, wieder Dunkelheit.
Es ist also verständlich, dass er jetzt mit den Pantoffeln über den Fußboden schlurft, wie ein älterer Mann es tun würde.
Als er aus dem Badezimmer kommt, gießt Giovanna gerade Kaffee in die Tassen. Die Küche erhellt ein trügerisches Licht, das zwischen Morgenröte und Dämmerung zu schwanken scheint.
»Heute gehst du wieder zum Angriff über?«, fragt sie, Sarkasmus in der Stimme.
Cesare zuckt mit den Schultern. Er weiß, er müsste sich zufriedengeben. Man hat ihn zum Ermittlungsrichter am Berufungsgericht ernannt, eine Möglichkeit, wieder als Richter zu arbeiten, da er die Richterrobe viele Jahre lang abgelegt hatte. Anfangs hat sie ihm nicht sehr gefehlt, um ehrlich zu sein. Das liegt an den Schlappen, die er beim Prozess gegen die Anonima Assassini hinnehmen musste: Auf 64 Angeklagte, darunter Liggio und Riina, kamen 64 Freisprüche. Totò Riina wurde nur für den Diebstahl eines Führerscheins verurteilt. Die Richter schrieben: »Die Gleichung zwischen Mafia und krimineller Vereinigung, auf der die Ermittler so lange bestanden haben und an der sich die dialektischen Fähigkeiten des Untersuchungsrichters abgearbeitet haben, hat auf Prozessebene keine verwertbaren Konsequenzen.« Fehlte nur noch, dass sie ihn offen auslachten. Doch er behauptet beharrlich, es sei keine Niederlage gewesen. »Ich habe sie fotografiert«, hat er zu Giovanna gesagt, als er mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern nach Hause kam. »Sie gehen nicht ins Gefängnis, aber ich habe sie fotografiert. Erst hatten sie kein Gesicht, jetzt gibt es ein Gruppenfoto. Das wird jemand anderes benutzen können.«
Dann hat er sich zurückgezogen und als Abgeordneter der Kommunistischen Partei wählen lassen. Er wurde Mitglied der Antimafia-Kommission und machte sich das Vergnügen, zusammen mit Pio La Torre einen Bericht zu schreiben, in dem mehrere christdemokratische Politiker, darunter die Herren Giovanni Gioia, der ehemalige Bürgermeister von Palermo Vito Ciancimino und der Abgeordnete Salvo Lima, angeklagt wurden, kontinuierliche Beziehungen zur Mafia zu unterhalten.
Doch jetzt fehlt ihm die Richterrobe. Seine Beharrlichkeit klammert sich an etwas, was niemand so recht versteht. Vielleicht nicht einmal er selbst. Er möchte wieder Prozesse einleiten, an vorderster Front.
Er trinkt den Kaffee aus. Während er sich die Schuhe zubindet, geht ihm wieder das Bild des jungen Borsellino mit dem Zettel in der ausgestreckten Hand durch den Kopf.
Er zieht die Jacke über und lauscht auf Geräusche in der Küche. Giovanna hat den Wasserhahn geöffnet, um die Tassen zu spülen. Cesare streift seine Schuhe ab und geht lautlos bis zum Schränkchen im Wohnzimmer. Er nimmt den Schlüssel und öffnet es. Sucht in den Mappen mit seinen Papieren. Da ist er, der Zettel. Der Gegenstand seiner Lüge. Er schließt den Schrank. Giovanna ist jetzt wieder im Schlafzimmer, sie ruht sich eine letzte Viertelstunde lang aus.
»Was ist, findest du deine Schuhe nicht?«
»Ja, nein, ach … hier sind sie.« Er lächelt, gibt ihr einen Kuss auf die Stirn und geht aus dem Zimmer. Er öffnet die große Tür und geht die Treppen hinunter, die vom dritten Stock auf die Straße führen.
Der Polizeioberwachtmeister Lenin Mancuso erwartet ihn rauchend vor dem Haus. Er heißt wirklich so: Lenin. Dieser Polizist mit markanten Zügen, der an Westernschauspieler erinnert und dessen Vater beim Gang an die Wahlurne kaum Zweifel gehabt haben dürfte, ist seine Leibwache. Eigentlich ist er auch sein Fahrer, aber der Richter Terranova fährt lieber selbst.
Cesare begrüßt ihn mit zwei leichten Schlägen auf die Schulter.
Sie gehen die Strecke bis zum blauen Fiat 131 Supermirafiori des Richters und besteigen das Auto. Cesare legt den Rückwärtsgang ein.
»Nun?« Mancuso reibt sich die Hände. »Wie viel fehlt noch, Signor Giudice?« Sie kennen sich seit über zwanzig Jahren, aber Mancuso spricht ihn immer noch mit »Herr Richter« an und siezt ihn. »Machen wir dieser Ermittlungsabteilung jetzt mal ordentlich Dampf?«
»Na ja … Wenn es Gott gefällt.«
»Ich bin bereit.«
»Das weiß ich.« Lenin Mancuso ist nicht nur sein Leibwächter. Der Oberwachtmeister ist auch ein ausgezeichneter Fahnder, sein Spürsinn war im Herbst ’71 entscheidend, als er und Terranova einen Mann jagten, der drei Mädchen entführt und ermordet hatte. Als Cesare ihn seiner Frau Giovanna vorstellte, hat er ihr gesagt, der Mann sei sein Schutzengel. Und so stellt sie sich die beiden jetzt vor, auf dem Bett liegend, den Geschmack des ersten Kaffees noch im Mund und die Augen im letzten Rest Schläfrigkeit halb geschlossen: den Richter und seinen Schutzengel in einem Fiat 131.
»Worauf warten die denn? Hat die Ernennung denn nicht schon stattgefunden?«
»Ja, natürlich«, sagt Terranova, der im Rückwärtsgang inzwischen fast an der Ecke zur Via De Amicis angekommen ist.
»Also was?«
»Tja, also …« Cesare tritt hart auf die Bremse, der Oberwachtmeister klammert sich an den Sitz. Zwei Autos, urplötzlich aufgetaucht, versperren dem Fiat den Weg. Drei Männer mit Pistolen steigen aus, einer hat ein Gewehr. Es gibt nicht viel zu überlegen, es ist nicht mal Zeit, einen Finger zu heben. Mancuso kann seine Dienstpistole aus dem Gürtel ziehen und wirft sich über den Richter. Er versucht, ihn mit seinem Körper zu schützen. Doch die Kugeln erreichen ihr Ziel überall. Cesare spürt den warmen Atem seines Schutzengels im Gesicht, während die Kugeln ihn schütteln. Er nimmt noch wahr, dass der Oberwachtmeister die Wagentür öffnet und ein paar Schüsse abgibt, doch das alles nützt nichts. Gegen ein Gewehr kann man sich nicht mit einer Pistole wehren, vor allem nicht, wenn einem eine Falle gestellt wurde.
Da ist er also, der Tod. Cesare sieht ihn nahen. Er hatte recht, ihn zu verspotten — er ist nicht schrecklich. Er ist nur verflucht dumm. Hat die leeren Augen des Dorftrottels. Wie auf der Zeichnung seines Malerfreundes. Hätte ihm nicht jemand ein Gewehr in die Hand gedrückt, sähe man ihn Tag und Nacht vor der Bar des Dorfes sitzen, den Tod, und sich über die Hitze beklagen oder die Zipperlein des Alters. Aber jemand hat ihm dieses Gewehr gegeben, mit dem er jetzt schießt und immer weiterschießt, ohne genau zu wissen, warum, bis keine Kugeln mehr da sind.
Cesare denkt an die erste Lüge, die er Giovanna erzählt hat, dass die Mafia keine Richter tötet und jeder nur seine Arbeit macht. Doch seit ein paar Jahren gehört auch das zum Beruf des Mafioso, Richter und Polizisten umzubringen. Die zweite Lüge betrifft den Zettel, von dem er heute Nacht geträumt hat. Er weiß genau, worum es sich dabei handelt. Der Zettel liegt verschlossen im Spind der Bibliothek. Darauf steht:
Ich besitze keine Immobilien.
Was die beweglichen Güter betrifft, so wünsche ich, dass sie alle im alleinigen Besitz von Giovanna bleiben. Ich bitte Giovanna, sich um unsere kleine Bibliothek zu kümmern und dafür zu sorgen, dass die zahlreichen literarischen und historischen Werke von gewissem Wert, die wir gemeinsam gesammelt haben, niemals verloren gehen.
Ich möchte auch, dass Giovanna den Organisationen für den Tierschutz und den Erhalt der Natur nach Ihrem Ermessen etwas zukommen lässt.
Insbesondere wünsche ich, dass Giovanna vor allem meiner Mutter — der ich ein langes Leben wünsche — meine Erinnerung weitergibt, meine Erinnerung an eine Mutter, an die ich fortwährend voller Liebe und mit Sehnsucht nach den glücklichen Jahren der Jugend denke.
Daran denkt Cesare, an seine schöne Mutter, die ihn überleben wird, an die glücklichen Jahre der Jugend und an das Örtchen, das sich ans Madonie-Gebirge klammert, wo im Winter Schnee bis zu den Knöcheln liegt und man im Sommer, wenn die Sonne brennt, den Kopf unter die Springbrunnen hält. Jetzt, wo sein Kopf nach vorne gefallen ist und die Brille ihm auf die Nasenspitze rutscht, sind seine Augen wieder die eines Kindes. Ein Kind, das in den Armen seines Schutzengels eingeschlafen ist.
Der Tod, dumm und pedantisch, winkt ihm zum Abschied hinter dem Autofenster, um den letzten Schuss auf ihn abzufeuern, während die Sonne ein für alle Mal hinter den Wolken verschwindet. Das genügt, damit der Regen anfängt zu prasseln.
4.
EIN LANGER STAFFELLAUF
Palermo, 1982
»Um also deine Frage zu beantworten, ob ich es tun werde oder nicht, ob ich dich bitten werde, die Nachforschungen bei den Banken, bei den Spatola, den Gambino, den Corleonesi zu drosseln: Ja, das müsste ich tun. Das verlangt mein Vorgesetzter von mir, der Mensch, dem ich jeden Tag Rechenschaft ablegen muss, bis zum Untergang der Sonne und oft darüber hinaus. Doch der Mensch, dem ich nach dem Sonnenuntergang und oft darüber hinaus Rechenschaft ablegen muss, der sollte an meiner Stelle in diesem Sessel sitzen, er wollte ihn so sehr, diesen Sessel, dass er sich dafür hat umbringen lassen.«
Plötzlich geht die Tür auf. Das schnurrbärtige Gesicht von Paolo Borsellino schaut herein.
»Kommen wir heute nicht zusammen?«
»Natürlich kommen wir zusammen. Einen Moment.«
»Auch die Jungs sind draußen und …«
»Jaja, ich verstehe. Kannst du einen Moment warten?« Er macht ihm ein Zeichen, die Tür zu schließen.
»Jawohl.« Borsellinos Kopf verschwindet im Türrahmen, die Tür schließt sich. Vom Flur kommen die Stimmen der Kollegen, Di Lello und Guarnotta, die auf die Versammlung warten. Eine von Chinnici eingerichtete Institution, diese wöchentliche Zusammenkunft. Bevor er kam, war es üblich, dass jeder bei der Ermittlung blieb, die er leitete, selten, eher nie, gab es zwischen den Richtern einen Informationsaustausch über die verschiedenen Akten. Andererseits war das auch nicht nötig, da die Mafia nach Ansicht der meisten als eine Reihe von kriminellen Phänomenen einzuordnen war, zwischen denen nicht der geringste Zusammenhang bestand. Ihr fehlte die zentralistische Organisation, die Konzentration von Macht an der Spitze, die Chinnici ihr nun schon seit Jahren unbedingt zuschreiben will. Ein paar schießwütige Bauern und eine Handvoll Entführer, die oft rückfällig werden. Jetzt dagegen …
Aus dem Flur kommt Gelächter.
»Heilige Scheiße! Ihr arbeitet immer noch?« Die Stimme von Ayala, dann seine Schritte, die sich auf dem Boden stapfend entfernen. Im Büro stehen Falcone und Chinnici einander gegenüber und blicken sich an. Rocco hat sich auf den Schreibtisch gestützt. An der Wand hinter ihm beobachtet sie das Bild von Sandro Pertini mit der quadratischen Brille.
»Ich erkläre dir das, weil …«, er gestikuliert, streicht sich über die Krawatte. »Ich erkläre dir das aus zwei Gründen. Erstens …«, er hebt den Daumen, »will ich nicht, dass du glaubst, hier drinnen macht jeder, was er will, oder dass ich keinen Respekt vor Hierarchien habe. Ich glaube fest an Hierarchien und an die Ordnung. Verstehst du, was ich meine?« Giovanni nickt, aber in seinem Gesichtsausdruck gibt es eine Spur Zweifel. Er versucht zu verstehen, worauf Rocco hinauswill. »In erster Linie aber bin ich meinem Gewissen verantwortlich, noch vor dem Staat. Pizzillo ist nicht korrupt, er ist nur ein bisschen … träge. Ein bisschen konservativ, ja, ein bisschen zu konservativ.« Giovanni hebt die Augenbrauen. Er ist nicht ganz überzeugt. »Zweitens. Weißt du, warum ich euch im Team arbeiten lasse? Warum wir mindestens einmal die Woche zusammenkommen, Informationen austauschen und uns die Akten weitergeben? Weißt du das?«
»Weil diese Akten alle miteinander in Zusammenhang stehen, es sind immer dieselben Namen, die auftauchen, es ist ein ausgefeiltes System aus …«
»Ja, natürlich.« Rocco macht eine Handbewegung. »Das ist klar. Aber es gibt noch einen Grund, einen geheimeren Grund.« Er zwinkert ihm zu und weist auf den Stuhl. Falcone setzt sich, und auch Rocco setzt sich hinter den Schreibtisch, auf den er die Ellenbogen stützt.
»Die Mafia hat sich verändert, Giovanni. Für die ist es kein Problem mehr, wenn es darum geht … Das wissen wir, oder?« Chinnici umklammert die Armlehnen seines Sessels. Das Bild seiner in die Polsterung gegrabenen Fingerkuppen wird sekundenlang zu einem grauenhaften Anblick. Falcone sieht einen Mann, der lebendig in seinem Sarg eingeschlossen ist. Dieser Sessel ist eine sehr sorgfältig ausgewählte Bahre. Die Farbe, das Holz, die Ausstattung …
Giovanni versucht, das Bild aus seinem Geist zu verscheuchen.
»Ich habe Wochen, viele Wochen gebraucht, um meiner Frau und meinen Kindern zu erklären, dass mir sehr viel an diesem Posten liegt«, er drückt immer noch auf die schwarze Polsterung der Armlehnen, »dass er meine natürliche Bestimmung ist und ich mich nicht zurückziehen kann. Sie wissen genau, was passiert ist … Sie wissen alles. Aber sie dürfen sich keine Sorgen machen, habe ich ihnen gesagt. Du hast jetzt Begleitschutz, ich habe Begleitschutz. Und wir dürfen uns nicht allzu sehr sorgen. Aber wir müssen auch realistisch sein. Nach Cesares Tod habe ich viel darüber nachgedacht. Es ist wichtig, dass, sollte jemand von uns fallen, wenn jemand von uns …«
»Ich habe verstanden«, unterbricht ihn Falcone. Roccos Gesicht ist heute bleicher als sonst, und er hat tiefe Schatten unter den Augen. Dieses Bild, das sich ihm ins Gehirn gebrannt hat, kann Giovanni nicht weiter ertragen.
»Siehst du. In diesem Fall darf das Wissen, das jeder von uns angesammelt hat, nicht verlorengehen. Wenn einer fällt, fällt nicht auch die Ermittlung. Wenn einer fällt, wissen wir, dass er, bevor er fiel, den Staffelstab weitergegeben hat.« Das Licht, das durchs Fenster fällt, spiegelt sich in Roccos Augen, die jetzt einen feuchten Schleier haben. Er lehnt sich zurück, versinkt in der weichen, schwarzen Polsterung, als wäre er niedergestreckt, und streicht wieder über seine Krawatte.
»Darum musst du weiter ermitteln. Und dann musst du auch den anderen, Paolo, Giuseppe, Leonardo, das sagen, was …«
»Ja, Rocco, es ist alles klar.« Giovanni steht abrupt auf. Er bekommt keine Luft mehr. Fast im Laufschritt verlässt er das Büro, während die im Flur versammelten Kollegen ihn rufen. Aber er hört und spürt nichts, außer einem Messer an seiner Kehle. Eine kalte, scharfe Klinge, die auf seinem Kehlkopf liegt.
5.
GEISEL
Favignana, 1976
»Ihr wollt mich reinlegen … Ich bring ihn um! Ich bring ihn um!«
Im Besuchszimmer des Gefängnisses von Favignana ist Giovanni Falcone an einen Stuhl gefesselt, ein Messer an seiner Kehle. Hinter ihm, besessener Blick und ein großes Tattoo, das seinen Hals bedeckt, sich bis zu den Armen erstreckt, Vincenzo Oliva, neunundzwanzig, wegen Mordes zu dreißig Jahren verurteilt.
»Ich bring ihn um!«
Der Gefängnisdirektor steht draußen im Flur dicht neben der Tür. Er zweifelt nicht daran, dass der Häftling Ernst macht — ein alter Bekannter des Gefängnisses, der erst verlegt und dann nach einer Schlägerei mit anderen Gefangenen wieder zurückgebracht wurde. Oliva, der sich als Mitglied der Bewaffneten Proletarischen Zellen bezeichnet, ist in Haft, weil er am 9. Mai ’64 in Sanremo bei einem Raubüberfall, der ihm dreißigtausend Lire einbrachte, den Tankwart Ottavio Perrone ermordet hat. Für ihn ist das der Wert eines Menschenlebens.
Die Sache ist ernst, darum steht neben dem Gefängnisdirektor der Staatsanwalt Giuseppe Lumia, der sofort gekommen ist, als er benachrichtigt wurde, und auch der Gerichtspräsident von Trapani, Cristoforo Genna. Doch Oliva weigert sich, mit beiden zu verhandeln. Er hat alle gewarnt, sie sollen nicht ins Besuchszimmer kommen, sonst legt er den Richter um. Er redet lieber mit zwei Gefangenen, die ihm als Vermittler dienen: der sardische Kriminelle Peppino Pes und Sante Notarnicola aus Apulien, rechter Arm von Pietro Cavallero, dem Boss der Bande von Entführern, die vor neun Jahren das Piemont und die Lombardei mit Feuer und Schwert heimsuchten.
»Wo ist das Fernsehen? Hä? Wollt ihr mich für dumm verkaufen?«, schreit Oliva. Giovanni Falcone kleben die Haare an der Stirn. Er schwitzt, obwohl es Ende Oktober ist, aber er scheint keine Angst zu haben. Angespannt ist er, das ja. Wer wäre das nicht, wenn ihm ein Arm den Hals zudrückt und eine Messerspitze an seinem Kehlkopf sitzt?
»Wo sind die Zeitungen? Das Radio? Wollt ihr mich verarschen?«
»Nein, nein.« Der Gefängnisdirektor versucht, ihn zu beruhigen. »Sie sind auf dem Weg.« Er dreht sich zum Staatsanwalt um, der nickt. »Sie kommen, sind schon auf dem Boot.« Zum Teil stimmt das. Einige Männer sind auf dem Fährboot, das in Kürze auf der Insel Favignana anlegen wird, wo die Carabinieri und die Polizei mehrere Straßensperren eingerichtet haben. Es steht noch nicht fest, ob die Journalisten tatsächlich ins Gefängnis hereinkommen werden, vorerst haben sie sich auf den Weg gemacht. Die Situation verändert sich von Minute zu Minute und könnte außer Kontrolle geraten.
Auch Pes und Notarnicola sind aufgeregt. Aus den Zellen kommen die Stimmen der anderen Häftlinge, die Oliva anfeuern, indem sie auf die Behörden schimpfen. Die Revolte steht vor der Tür.
Der Richter am Überwachungsgericht Giovanni Falcone war für seinen wöchentlichen Besuch gegen Mittag im Gefängnis angekommen. Oliva wartete mit anderen Häftlingen in dem Gang, der zum Besuchszimmer führt. Als Falcone ins Zimmer ging, griff Oliva ihn an, setzte ihm das Messer an die Kehle, fesselte ihn an einen Stuhl und verbarrikadierte sich im Zimmer. Er forderte, zusammen mit seiner Schwester ins Gefängnis von Turin verlegt zu werden, denn, so sagte er, die in Favignana wollten ihn kaltmachen. Und vielleicht hatte er nicht ganz Unrecht, in Anbetracht seiner Vergangenheit als Streithammel. Er verlangte außerdem, im Radio und Fernsehen eine politische Verlautbarung verlesen zu können, die auf jeden Fall mit seiner Forderung nach Verlegung ins Turiner Gefängnis enden sollte.
Plötzlich bringen zwei Polizisten einen keuchenden Mann im dunklen Anzug vor das Besuchszimmer. Es ist der Anwalt Salvatore Ciaravino, bekannt dafür, mit der linksextremen Organisation Rote Hilfe schon einige Terroristen verteidigt zu haben. Sein Blick ist beruhigend. Er steckt den Kopf durch die Tür. Oliva presst den Arm um Falcones Hals. Der hustet.
»Ruhig, ganz ruhig«, sagt der Anwalt. »Ich bin Salvatore Ciaravino, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe schon …«
»Jaja«, brummt Oliva, »ich weiß, wer du bist.«
»Gut. Können wir uns dann ein wenig beruhigen? Es ist alles gut.« Falcone wirft ihm einen erstaunten Blick zu. »Es wird alles gut«, korrigiert sich Ciaravino.
»Wo sind die Fernsehsender?«
Sehr vorsichtig macht Ciaravino einen Schritt in das Zimmer hinein. »Im Moment kommen erst mal die Radiosender an. Mit dem Fernsehen ist das schwieriger, es braucht mehr Zeit.«
»Ihr verarscht mich!«
»Nein, nein … Sehen Sie, um diese Zeit sitzt niemand vor dem Fernseher, aber eine Livesendung im Radio gelangt überallhin, auch zu denen, die gerade Auto fahren.« In der Lüge des Anwalts steckt ein Körnchen Wahrheit. Seit über vier Stunden hat sich Oliva in diesem Zimmer verschanzt. Mittlerweile sind alle erschöpft. Falcone hebt langsam eine Hand und trocknet sich die Stirn.
Unter Hin und Her, Geschrei und Drohungen, der Geisel die Kehle durchzuschneiden, vergeht noch ein Stündchen. Dann kommt Ciaravino ins Besuchszimmer zurück, in der Hand ein Telefon, das mit einem langen Kabel an eine Steckdose im Flur angeschlossen ist.
»Sie können mit einem Redakteur der ANSA sprechen.«
»Was zum Teufel …« Oliva reißt die Augen auf. »Was soll der Scheiß bedeuten? Ich habe Radio und Fernsehen verlangt. Was versucht ihr hier?«
»Die ANSA ist die Presseagentur, die alle Tageszeitungen, die Fernsehsender und die Radiostationen beliefert. Das ist das Beste, was wir tun können.«
»Aber es ist nicht das, was ich gefordert habe!«, brüllt der Gefangene. »Ich will die RAI! Verstanden?«
»Die RAI ist unmöglich«, sagt Ciaravino. »Hören Sie mich an, Oliva. Darf ich?« Er presst den Telefonhörer an seine Brust und nähert sich Oliva mit kleinen Schritten, die andere Hand immer gut sichtbar. »Das ist die beste Abmachung, die wir uns erhoffen können. Eine schon unterzeichnete Anordnung zur Verlegung ins Turiner Gefängnis und das Verlesen Ihrer Mitteilung im Radio.«
Oliva ist nicht überzeugt.
»Und wer sagt mir, dass sie wirklich im Radio gelesen wird?«
»Sie selbst werden die Sendung hören.« Der Gefangene zögert einige Sekunden lang, dann streckt er die Hand aus, um den Hörer zu ergreifen.
»Wer ist am Telefon? Nein, ich habe … Okay, gut. Kann ich anfangen?« Erst jetzt merkt er, dass er seine Verlautbarung unmöglich lesen kann, wenn er einen Arm um Falcones Hals und das Telefon in der anderen Hand hat.
»Mach die Tür zu«, sagt er zum Anwalt. Der tut so, als schlösse er sie hinter sich.
»Raus mit dir!«, schreit Oliva. Ciaravino geht hinaus und schließt die Tür des Besuchszimmers.
Oliva nimmt den Arm von Falcones Hals, hält das Messer aber noch in der Hand. Er klemmt den Hörer zwischen Schulter und Kinn. Mit der Linken holt er einen Zettel aus der Tasche, faltet ihn auseinander und liest.