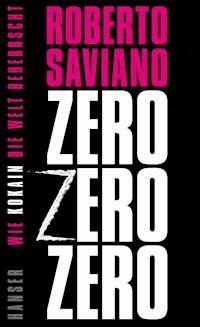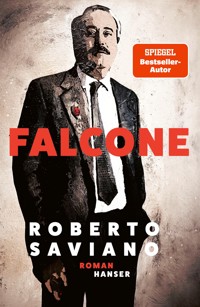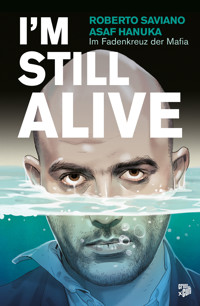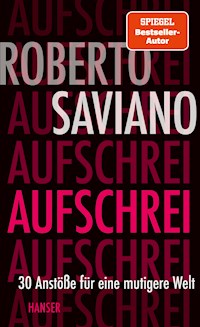Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Das erschütternde, eindrucksvolle Bild einer Generation ohne Zukunft.“ La Repubblica Sie sind gierig, sie sind jung, sie sind skrupellos – und sie haben nichts zu verlieren. Für Maraja, Tucano, Drane und Dragò beginnt der Kampf um die Vorherrschaft in Neapel früh. Maraja ist noch keine achtzehn, als er nach dem Mord an seinem Bruder Blutrache schwört. Doch eigentlich will der Clan vor allem eins: Die nächste Million mit Kokain machen. Als es zu Lieferschwierigkeiten kommt, muss Maraja Allianzen mit den Rivalen schmieden – und unterschätzt die Gefahr aus den eigenen Reihen. Bis eines Nachts an seiner Stelle irrtümlich ein junger Mann ermordet wird. Eine rasante Erzählung über die Kinder der Camorra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Roberto Savianos neuer Roman: Sie sind jung, sie sind skrupellos — die Kinder der Camorra ab 22. August im KinoSie sind gierig, sie sind jung, sie sind skrupellos — und sie haben nichts zu verlieren. Für Maraja, Tucano, Drane und Dragò beginnt der Kampf um die Vorherrschaft in Neapel früh. Maraja ist noch keine achtzehn, als er nach dem Mord an seinem Bruder Blutrache schwört. Doch eigentlich will der Clan vor allem eins: Die nächste Million mit Kokain machen. Als es zu Lieferschwierigkeiten kommt, muss Maraja Allianzen mit den Rivalen schmieden — und unterschätzt die Gefahr aus den eigenen Reihen. Bis eines Nachts an seiner Stelle irrtümlich ein junger Mann ermordet wird. Eine rasante Erzählung über die Kinder der Camorra: »Das erschütternde, eindrucksvolle Bild einer Generation ohne Zukunft.« (La Repubblica).
Roberto Saviano
Die Lebenshungrigen
Roman
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Carl Hanser Verlag
Für G., unschuldig, ermordet mit siebzehn.
Für N., schuldig, Mörder mit fünfzehn.
Für meine Heimat aus Mördern und Ermordeten.
Die Paranza
MARAJA Nicolas Fiorillo
BRIATÒ Fabio Capasso
TUCANO Massimo Rea
DENTINO Giuseppe Izzo
DRAGÒ Luigi Striano
LOLLIPOP Vincenzo Esposito
PESCE MOSCIO Ciro Somma
STAVODICENDO Vincenzo Esposito
DRONE Antonio Starita
BISCOTTINO Eduardo Cirillo
SUSAMIELLO Emanuele Russo
RISVOLTINO Gennaro Scognamiglio
PACHI Diego D’Angelo
Non ti voltare, scappa
Bambini con gli AK gridano »pappa«!
Dreh dich nicht um, such ein Versteck,
Kinder mit Kalaschnikow schreien: »Ich schieß dich weg!«
NTO’, Il ballo dei macellai (Der Tanz der Schlachter)
1. Teil
Küsse
Küsse schicken wir uns im Plural. Viele Küsse. Doch jeder Kuss ist einzigartig, wie Schneekristalle. Wichtig ist nicht nur, wie er gegeben wird, sondern auch, wie er entsteht: die Absicht, die ihn trägt, die Anspannung, die ihn begleitet. Und dann, wie er empfangen oder abgewehrt wird, mit welcher Gefühlsbewegung — Fröhlichkeit, Erregung, Verlegenheit — man ihn aufnimmt. Ein Kuss, in der Stille gegeben oder durch Lärm abgelenkt, tränenfeucht oder von Gelächter begleitet, von der Sonne gekitzelt oder im unsichtbaren Dunkel.
Küsse haben eine präzise Ordnung. Die wie ein Stempel verabreichten Küsse, Lippen auf Lippen gepresst. Leidenschaftlicher Kuss, unerfahrener Kuss. Frühreifes Spiel. Schüchternes Geschenk. Ihre Gegenspieler: Zungenküsse. Die Lippen treffen nur aufeinander, um sich zu öffnen, ein Austausch zwischen Papillen und Geschmacksknospen, von Säften und Liebkosungen des Zungenmuskels in der mit Zähnen bewehrten Mundhöhle. Ihr Gegensatz sind die mütterlichen Küsse. Lippen, auf Wangen gedrückt. Küsse, die ankündigen, was gleich danach kommt: die feste Umarmung, Streicheln, die Hand auf der Stirn, um das Fieber zu fühlen. Väterliche Küsse streifen über Schläfen, es sind bärtige Küsse, stechend, ein flüchtiges Zeichen von Nähe. Dann die Abschiedsküsse, die die Haut kaum berühren, und die Küsse geiler Alter, heimlich geraubt, kleine sabbernde Überfälle, die eine flüchtige Intimität genießen.
Harte Küsse haben keine Ordnung. Sie können Schweigen besiegeln, Versprechungen geben, Urteile fällen oder Absolution erteilen. Es gibt harte Küsse, die nur leicht das Zahnfleisch berühren, andere, die fast bis in den Rachen vorstoßen. Doch immer besetzen die harten Küsse allen verfügbaren Raum, sie benutzen den Mund als Zugang. Der Mund ist nur der Brunnen, in den man eintauchen muss, um herauszufinden, ob es dort eine Seele gibt, ob der Körper wirklich von etwas anderem bewohnt wird oder nicht — der harte Kuss lotet diesen unergründlichen Abgrund aus, oder er trifft auf eine Leere. Die taube, dunkle Leere — das Versteck.
Es gibt eine alte Geschichte, die sich die Novizen der Barbarei erzählen, sie wird unter denen weitergegeben, die heimlich Kampfhunde züchten: armselige Geschöpfe, unfreiwillig einem Schicksal aus Muskeln und Tod unterworfen. Diese Legende ohne jeden wissenschaftlichen Beweis erzählt, dass Kampfhunde schon kurz nach der Geburt ausgewählt werden. Die Abrichter studieren den Wurf eiskalt und unerbittlich. Es geht nicht darum, den auszusuchen, der stark erscheint, den Schmächtigen auszusondern, zu begünstigen, wer die Geschwister von der mütterlichen Zitze vertreibt, oder herauszufinden, wer den gefräßigen Bruder bestraft. Die Prüfung läuft anders: Der Züchter reißt den Welpen von der Zitze, packt ihn im Nacken und bewegt seine kleine Schnauze vor seinem Gesicht hin und her. Die meisten Welpen lecken die Wange. Einer aber — noch halb blind, zahnlos, das Zahnfleisch nur an die weiche Mutterbrust gewöhnt — versucht zu beißen. Er will die Welt kennenlernen, will sie zwischen den Zähnen haben. Das ist der harte Kuss. Dieser Hund, egal ob Weibchen oder Männchen, wird zum Kämpfer abgerichtet.
Küsse und harte Küsse. Die einen machen vor dem Körper Halt, die anderen kennen keine Grenzen. Sie wollen sein, was sie küssen.
Die harten Küsse sind weder gut noch schlecht. Sie existieren, wie Bündnisse. Und hinterlassen immer einen Geschmack nach Blut.
Es ist da
»Es ist da!«
»Wie, es ist da?«
»Ja, es ist da.«
Stille am anderen Ende, nur Atem krächzte ins Mikrophon. »Bist du sicher?«
Seit Wochen wartete Nicolas auf diesen Anruf, doch jetzt, wo Tucano es ihm sagte, musste er sich den Satz wiederholen lassen, um definitiv zu wissen, dass der Tag endlich gekommen war, um die Nachricht im Geiste voll auszukosten. Und bereit zu sein.
»Ich laber nur rum? Mann, ich sag’s dir doch die ganze Zeit. Ist gerade geboren, adda murì mammà, hundertpro, die Koala liegt praktisch noch im Kreißsaal … Dentino ist nirgendwo zu sehen, bin sofort zum Krankenhaus gefahren.«
»Logisch, der hat nicht die Eier, sich blicken zu lassen. Wer sagt, dass das Kind geboren ist?«
»Ein Krankenpfleger.«
»Was soll denn der Scheiß jetzt? Wo kommt dieser Krankenpfleger her?« Allgemeine Informationen genügten Nicolas nicht mehr, diesmal wollte er Einzelheiten. Er konnte sich keine improvisierten Aktionen erlauben, nichts durfte schiefgehen.
»Hat für Biscottinos Vater gearbeitet, Enzuccio Niespolo heißt er. Ich hab ihm gesagt, die Koala ist unsere Freundin, und wir wollen als Allererste wissen, wenn das Baby kommt.«
»Und wie viel hast du ihm versprochen? Nicht dass das ein Bluff ist, weil du ihm keine hundert Euro gegeben hast?«
»Nein, hab ihm versprochen, er kriegt ’n iPhone. Der konnte es gar nicht erwarten, dass das Kind kommt. Hing mit dem Ohr immer direkt über Koalas Bauch.«
»Dann müssen wir schnell machen. Morgen, gleich wenn die Sonne aufgeht.«
Bei Tagesanbruch war er angezogen, bereit. Das Bett, auf dem er saß, war kaum zerwühlt, er hatte keine Minute geschlafen. Er schloss die Augen und atmete tief ein, dann stieß er die Luft aus, ein Zischgeräusch. Dies war der Tag. Er musste klar im Kopf bleiben, sich nicht von Erinnerungen aufweichen lassen. Er hatte eine Mission zu erfüllen, danach würde Zeit genug für alles andere sein.
Tucanos Stimme unten auf der Straße war wie ein Schalter, der den Strom anstellt. Nicolas steckte sich die Desert Eagle in die Jeans und war im Nu draußen.
Tucano trug schon seinen Integralhelm.
»Handy dabei?«, fragte Nicolas, während er seins einsteckte. »Ist noch in der Originalverpackung, oder?«
»Hab alles im Griff Maraja.«
»Dann los, Blumen besorgen.« Nicolas setzte sich hinter den Lenker und fuhr langsam los. Er verspürte eine Ruhe, die ihm den ganzen Körper wärmte. In einer Stunde würde alles wieder in Ordnung sein. Dann war das Kapitel abgeschlossen.
»Verdammte Asis …«, sagte Tucano, »immerzu heulen, dass sie nichts verdienen, und dann den Tag verpennen.«
Der Rollladen des Blumenhändlers war geschlossen, wo sie andere Blumenstände finden konnten, wussten sie nicht, und auf jeden Fall mussten sie sich beeilen. Nicolas bremste scharf, Tucanos Helm stieß gegen seinen.
»He, Maraja, Madonna!«
»Genau, die Madonna …«, sagte Nicolas und ließ den Scooter, sich mit den Füßen abstützend, zurück zum Anfang der Gasse rollen. Eine Andachtsnische im Schutz eines eisernen Käfigs, dessen Gitter, von einem kleinen Leuchtturm erhellt, in dem verfallenen Gemäuer wie Gold glänzte. Fotos von Votivgaben und Heiligenbildchen von Padre Pio bedeckten die Madonna fast ganz, doch sie lächelte aufmunternd, und Nicolas erwiderte ihr Lächeln. Er stieg vom T-Max, warf ihr einen Kuss zu, wie seine Großmutter es ihn gelehrt hatte, stellte sich auf Zehenspitzen und zog einen Strauß weißer Calla aus einer Vase.
»Wird die Madonna dann nicht sauer?«, fragte Tucano.
»Die Madonna wird nie sauer. Darum ist sie ja die Madonna.« Nicolas zog den Reißverschluss seines Sweatshirts hoch, um die Calla zu verstecken. Sie fuhren mit quietschenden Reifen los. In diesem Moment schritt Pesce Moscio, wie vereinbart, zur Tat.
Gleich hinter dem Gittertor erwartete sie der Krankenpfleger, in eine Daunenjacke gehüllt, mit den Füßen auf den Asphalt stampfend. Tucano winkte ihm zu, er hüpfte weiter auf der Stelle, allerdings war es jetzt weniger der Versuch, die Kälte zu vertreiben, als die leise Angst, die beiden Typen auf dem Motorroller mit ihren Integralhelmen könnten etwas anderes vorhaben, als ihm für seine Gefälligkeit zu danken.
»Bring uns rein, wir wollen dem Baby ’ne Überraschung bereiten«, fing Nicolas an.
Der Pfleger versuchte, Zeit zu gewinnen, um die Lage zu sondieren. Sie seien keine Verwandten, er könne sie nicht reinlassen.
»Was soll der Bullshit, wir sind keine Verwandten«, sagte Nicolas, »Verwandte sind ja nicht bloß die Cousins. Wir sind mehr als Verwandte, wir sind Freunde, die echte Familie.«
»Er ist im Säuglingszimmer. Gleich wird er zur Mutter gebracht.«
»Ein Junge?«
»Ja.«
»Besser so.«
»Warum?«, fragte der Pfleger, um Zeit zu gewinnen.
»Ist einfacher …«
»Was ist einfacher?«
Nicolas ignorierte seine Frage.
»Aufwachsen ist einfacher, wenn du ’n Junge bist, oder?«, schaltete sich Tucano ein. »Ist Mädchen sein etwa einfacher? Nach dem Motto, wenn du ficken kannst, kommst du wenigstens überall hin, wo du willst?«
Der Pfleger nahm Nicolas’ Schweigen als ein Zeichen, dass sie warten würden. Er zuckte mit den Schultern, als wollte er sagen, nichts zu machen, das sind die Regeln.
»Ich will das Kind sehen, bevor es zwischen den Titten seiner Mutter steckt.« Der ungeduldige, wütende Tonfall traf den Pfleger wie ein Peitschenhieb, und noch bevor er eine Antwort herausbrachte, klebte sein Gesicht schon am Visier von Nicolas’ Helm. »Ich hab dir gesagt, ich will dieses Kind sehen. Blumen für die Mutter hab ich auch dabei. Jetzt sag mir, wie ich da hinkomme«, und mit einem Stoß schickte Nicolas den Pfleger in eine aufrechte Haltung zurück.
Genaue Informationen folgten, der Weg war leicht zu finden. Tucano warf die Schachtel mit dem iPhone hoch in die Luft, und der Pfleger behielt sie, mit den Armen fuchtelnd, auf ihrer Flugbahn krampfhaft im Blick, aus Angst, das Handy könnte am Boden zerschellen. Er war so auf sein technisches Spielzeug konzentriert, dass er den dichten schwarzen Rauch nicht bemerkte, der wenige Meter entfernt aufstieg, und wahrscheinlich roch er nicht mal den beißenden Gestank brennender Autoreifen. Pesce Moscio hatte pünktlich ganze Arbeit geleistet. Nicolas hatte ihm gesagt, nein, befohlen: Ich will sehr viel Rauch. Du musst damit alles verdunkeln. Er wollte die Pförtnerloge leer haben, das Letzte, was er brauchen konnte, waren Wachleute, die einen Motorroller verfolgten. »Als Ablenkungsmanöver, Pescemò«, und Pesce Moscio hatte eine Toilette der Poliklinik in der Nähe der Pförtnerloge ausgesucht. Die Reifen hatte er noch am selben Morgen in einer Autowerkstatt geklaut, und mit ein bisschen Kerosin und einem Feuerzeug würde es ein großes Fest aus giftigem Rauch und Gestank werden und alle Aufmerksamkeit auf diese Toilette lenken.
Unterdessen fuhr der T-Max im Schritttempo durch das Tor. Bis hier war der Plan seiner eigenen Logik gefolgt. Nicolas hatte Zeiten berechnet und mögliche Schwierigkeiten einkalkuliert, und auch Tucano, der gewissenhaft seinen Part gespielt hatte, war sich wie ein Rädchen in diesem gutgeschmierten Getriebe vorgekommen. Doch nun gab Nicolas Gas und schickte jede Logik zum Teufel. Der Roller bäumte sich auf, um die erste Stufe zu nehmen wie ein Pferd, das über ein Hindernis springt, und kam, von einer Stufe zur nächsten hüpfend, oben am Eingang an. Die automatischen Türen des Krankenhauses öffneten sich, und der T-Max stürmte in die Eingangshalle.
Im geschlossenen Raum klang der Motor wie eine startende Boeing. Auf der Treppe war ihnen niemand begegnet, um diese Zeit hatte das Hin und Her der ambulanten Untersuchungen und Visiten noch nicht begonnen, doch nun eilten Leute vom Klinikpersonal herbei, kamen erschrocken aus den Türen im Korridor. Nicolas achtete nicht auf sie. Er suchte den Fahrstuhl.
In der Entbindungsstation empfing sie völlige Stille. Niemand auf den Fluren, keine Stimmen, kein Weinen, das den Weg zum Säuglingszimmer anzeigte. Das ganze Chaos, das sie unten ausgelöst hatten, schien die Ruhe dieses Stockwerks nicht zu stören.
»Wie heißt das Kind?«
»Irgendwo müssen doch die Nachnamen stehen, oder?«, erwiderte Tucano. Er kannte Maraja zu gut, als dass er riskiert hätte, ihn zu fragen, wie sie aus der Scheiße, in die sie sich geritten hatten, wieder rauskommen sollten. Genau das war ja Nicolas’ Stärke, dich bis an die Grenze zu treiben, ohne dass du es merkst.
Sie ließen den T-Max mitten im Flur stehen. Mit seinem glänzenden Schwarz sah der Roller aus wie ein riesiger Käfer zwischen den hellgrünen Wänden mit Plakaten, die die segensreichen Eigenschaften der Muttermilch priesen. Die Jungen liefen durch den Flur, auf der Suche nach dem Säuglingszimmer. Tucano voran, den Helm noch immer auf dem Kopf, Nicolas dicht hinter ihm. Eine endlose Reihe Türen rechts und links, und das Kratzen ihrer Sohlen auf dem Linoleum.
Sie kamen in ein Vorzimmer mit zwei leeren Schreibtischen, hinter denen die Fensterfront des Säuglingszimmers glänzte. Dort lagen sie, die Neugeborenen mit rotvioletten Gesichtern in ihren pastellfarbenen Strampelanzügen, einige schliefen, andere bewegten die winzigen Fäuste über dem Kopf.
Maraja und Tucano standen vor der Scheibe wie zwei Verwandte, die herausfinden wollen, ob das Kind eher der Mutter oder dem Vater ähnelt.
»Antonello Izzo«, sagte Tucano. Die hellblaue Decke mit dem in eine Ecke gestickten Namen hob und senkte sich fast unmerklich. »Da ist er«, und er drehte sich zu Nicolas um, der reglos dastand, die Handflächen auf dem Fensterglas, den Kopf dem Neugeborenen zugewandt, das jetzt lächelte, zumindest schien es Tucano so.
»Maraja …«
Schweigen.
»Maraja, was machen wir jetzt?«
»Wie tötet man ein Baby, Tucà?«
»Keine Ahnung, hast du ’ne Idee?«
Nicolas zog die Desert Eagle aus seiner Unterhose und entsicherte sie mit dem Daumen.
»Ist wahrscheinlich so, wie wenn man ’n Luftballon platzen lässt«, überlegte Tucano.
Vorsichtig öffnete Nicolas die Tür zum Säuglingszimmer, als wollte er rücksichtsvoll vermeiden, die anderen Kinder zu wecken. Er ging zum Bettchen von Antonello, dem Sohn von Dentino, dem Sohn des Menschen, der seinen Bruder Christian getötet hatte, mit einem Schuss in den Rücken wie den miesesten Verräter.
»Christian …«, sagte er sehr leise. Zum ersten Mal seit dem Tag der Beerdigung sprach er diesen Namen aus. Er schien unter einem Bann zu stehen, die schwarzen Augen starrten geradeaus, aber der Blick war leer. Tucano hätte gerne mit den Fäusten gegen das Fenster geschlagen, Nicolas angeschrien, er solle sich beeilen, die Brut dieses Dreckskerls erschießen, jetzt, sofort. Nicolas hatte die Mündung der Desert auf den kleinen Bauch gesetzt, aber der Finger am Abzug rührte sich nicht. Die Pistole bewegte sich leicht auf und ab, als könnten die Lungen dieses Würmchens wirklich zwei Kilo Metall anheben. Tucano blickte hinter sich, um den Flur zu kontrollieren, und sah, dass während Nicolas’ Zögern eine Krankenschwester im Flur aufgetaucht war. Sie kam rasch näher, die Stange für einen Infusionsbeutel wie eine Lanze schwingend. »Was machst du denn hier?« Dann entdeckte sie Nicolas hinter der Scheibe und fing an zu schreien: »Die Kinder! Sie holen die Kinder!« Tucano richtete seine Glock auf sie, und die Krankenschwester blieb sofort stehen, die Stange halb erhoben, aber sie hörte nicht auf zu schreien.
»Sie entführen die Kinder! Sie bringen die Kinder weg! Hilfe! Hilfe!« Ihre Stimme immer lauter, kreischend, wie eine Sirene.
»Maraja, schieß, mach schnell, sie haben uns entdeckt, zieh das jetzt durch …« Aber Nicolas hatte den Kopf zur Seite geneigt, als wollte er sich den Sohn von Dentino und der Koala genau ansehen. Der schlief friedlich, sein Atem ging noch tief und regelmäßig, trotz der Pistole. Auch Christian hatte so geschlafen, als seine Mutter nach der Entbindung aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen war. Nicolas hatte sich in einen Sessel gesetzt, sie hatte ihm das Neugeborene in die Arme gelegt, und Christian hatte weitergeschlafen. Um Antonello herum aber wachten die anderen Kinder auf. Sofort war im Säuglingszimmer die Hölle los, die Neugeborenen steckten sich eines nach dem anderen mit ihrem Geschrei an, eine ohrenbetäubende Welle, die Nicolas aus seiner Benommenheit rüttelte.
»Sie entführen die Kinder! Sie bringen die Kinder weg! Hilfe! Hilfe!« Die Krankenschwester hörte nicht auf zu schreien und ließ die Stange in der Luft kreisen, als wollte sie ihr mehr Fliehkraft verleihen, um sie dann mit größtmöglicher Wucht von sich zu schleudern.
»Nun schieß doch, Maraja, leg ihn jetzt um!«, schrie Tucano. Die Krankenschwester kam immer näher, und er wusste nicht, ob er sie mit einem Faustschlag ins Gesicht niederstrecken, mit einem Schuss verletzen oder töten sollte.
»Maraja, hier wird’s echt kritisch, wir müssen sofort weg. Ganz schnell!«
Nicolas legte seine linke Hand auf das Tattoo, das er sich im Nacken hatte stechen lassen, damit es ihm Kraft gab, damit es ihm auch hier, vor einem anderen unschuldigen Wesen, bestätigte, dass die Sache richtig war und getan werden musste. Für ihn, für seine Mutter, für seine Paranza, den Clan der Kinder. Denn dies war die Zeit des Sturms, und er war der Sturm, der über der Stadt tobte. Er drückte die Pistole in den Körper des Neugeborenen, und auch Antonello fing an zu weinen.
Tucano war jetzt so weit zurückgewichen, dass er mit dem Helm gegen die Scheibe stieß. »Halt, du fette Sau«, sagte er zu der Krankenschwester, »bleib stehen, ich bring dich um.« Aber sie kam noch näher, und von ihrem Geschrei angelockt, erschienen zwei weitere Schwestern auf dem Flur. Auch sie fingen sofort an zu schreien: »O Gott, die Kinder! Sie holen die Kinder!«
»Zurück! Ich bring euch um! Ich bring euch alle um!«, brüllte Tucano, und jetzt klebte er mit dem ganzen Körper an der Scheibe. Es gab nur einen Weg, hier rauszukommen. Er umfasste die Glock mit beiden Händen und zielte auf die Stirn der Schwester mit der Stange.
Peng.
Eine Explosion. Dann Stille. Tucano sah auf seine Hand, die nicht rechtzeitig hatte schießen können.
Die Kugel war von hinten gekommen. Sie hatte das Fenster des Säuglingszimmers durchschlagen und aus der Glasscheibe einen Regen scharfer Splitter gemacht. Klingelnd sprangen sie gegen Tucanos Helm, prallten von der Decke ab, bohrten sich in die Wände und den Boden und legten sich glitzernd auf die Kittel der Krankenschwestern, die ihre Gesichter mit den Händen bedeckten. Tucano drehte sich um. Nicolas hielt die Desert Eagle noch immer auf die zertrümmerte Fensterscheibe des Säuglingszimmers gerichtet. Hoch oben in der Wand gegenüber prangte das Loch, wo die Kugel eingedrungen war.
Das Geschrei der Kinder, das für einen Sekundenbruchteil abgebrochen war, setzte wieder ein, und Nicolas riss sich aus seiner Erstarrung. »Schnell weg, wir hauen ab«, sagte er zornig.
Sie fuhren die breiten Treppen der Poliklinik hinunter, dann über die Treppe an der Eingangstür bis zur Straße. Dort ließ Nicolas den Motor aufheulen und gab Vollgas, um sich zwischen Wachleuten, die nach ihren Pistolen griffen, und Feuerwehrmännern mit Gasmasken freie Bahn zu verschaffen. Der letzte Mensch, an dem sie vorüberrasten, war der Krankenpfleger, der sie hereingelassen hatte, aber der klebte mit den Augen am iPhone und bemerkte sie nicht.
Nicolas kam zurück, als das Haus gerade erwachte. Er hörte das Geräusch der Duschen, die Rufe nach den Kindern, sie sollten sich beeilen, das Schultor würde nicht warten, bis sie ausgeschlafen hatten. Nur seine Wohnung war stumm und leer. Seine Mutter war schon in der Wäscherei, jeden Morgen ging sie etwas früher hin. Sein Vater war sofort nach Christians Tod abgehauen, er war mit ihnen zum Begräbnis gegangen und nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Aber sie kamen ohne ihn aus, er zählte nicht, hatte nie gezählt. Nicolas verzog den Mund zu einer Grimasse, warf die Schlüssel auf den Tisch und machte den Fernseher an. Der Ton war sehr leise gestellt, auch die Fernsehnachrichten wollten die Stille in der Wohnung, die wie ein Vorwurf war, nicht stören. Nach Berichten über Lokalpolitik tauchten die Bilder vom Krankenhaus auf, die zersplitterte Scheibe, die Krankenschwestern, die Säuglinge mit verzerrten Gesichtchen aus den Betten hoben, die Reifenspuren auf dem Fußboden. Frecher Überfall in der Poliklinik lautete der Titel. Nach einer Minute war der Film vorbei, mehr Platz gab es nicht für einen Dummejungenstreich.
Nicolas ging ins Kinderzimmer, streckte sich auf dem Bett seines Bruders aus, faltete die Hände im Nacken und fuhr mit den Fingern über den Namen, den er sich dort hatte tätowieren lassen: Christian. Vor und zurück, als läse er Blindenschrift, dann im Kreis um das Oval der Handgranate, und wieder von Neuem langsam über die Buchstaben. Die Handgranate hatte er genau wie die haben wollen, die den Namenszug auf seiner Brust abschloss: Maraja.
Cos’aggio fatto?, fragte er sich. Was habe ich getan? Er drückte die Fäuste in seine Augenhöhlen.
Katz und Maus. Eine wütende Katze auf der Jagd nach einer Phantommaus.
Auf den Umschlagplätzen lief es gut. Ihr Koks war gefragt. Das Heroin von Scignacane fand reißenden Absatz. Der Erlös aus den Erpressungen kam jeden Monat pünktlich an. Über den Territorien seiner Paranza im Zentrum von Neapel strahlte die Sonne. Doch Dentino lebte noch, und mit diesem Gedanken konnte Nicolas keinen Frieden schließen. Er war wie Rückenschmerzen, die nicht weggehen, wie Karies, der den Schlaf stört: Der Verräter ist noch in der Stadt, irgendwo versteckt.
Seit fünf Monaten mühte er sich mit Hinterhalten ab. Zuerst hatte er Dentino vor dem Hof des Pfarrhauses aufgelauert. Dieses Rechteck trug noch die Spuren ihrer gemeinsamen Fußballspiele. Dann hatte er viele Nächte vor der Zahnarztpraxis verbracht, wo Dentino seine erste mesata, den monatlichen Verdienst, ausgegeben hatte, um sich die von Zigaretten und Drogen schwarz angelaufenen Schneidezähne bleichen zu lassen. Das Haus seiner Eltern, das seiner Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits, der Park von Capodimonte, weil jemand gesagt hatte, er habe Dentino dort auf einer Bank gesehen, und zuletzt war es Nicolas logisch erschienen, auch den Bahnhof abzusuchen. Penner für Penner, Klo für Klo. Mit zugehaltener Nase hatte er die verwahrlosten Männer umgedreht, die in ihren Lumpen schliefen. Dem Haus, wo Dumbos Mutter lebte, hatte er eine ganze Woche ununterbrochener Bewachung gewidmet, Tag und Nacht, überzeugt, dass der infame Verräter irgendwann der Versuchung erliegen würde. Vergebens.
Die Maus war nirgendwo hervorgekommen, also musste er das Mäuschen zerquetschen. Aber er hatte es nicht über sich gebracht … wie tötet man ein Neugeborenes?
»Schluss jetzt!«, schrie er, »Schluss!«, und stand auf. Eine einzige Bewegung mit dem Arm fegte alles weg. Heiligenfiguren, Bildchen von der Madonna, San Gennaro, Padre Pio, Fotos von Christian bei der Erstkommunion, in Badehose mit Nicolas an einem Strand, an den er keine Erinnerungen hatte. Er betrachtete den Haufen zu seinen Füßen, dann zog er sich die Schuhe, die Hose und das Sweatshirt aus. Er schlüpfte unter die Bettdecke, umklammerte seine Knie mit den Armen. Und tat das, was er seit geraumer Zeit hätte tun sollen.
Er weinte.
Treibsand
Ein Wespennest. Nicolas hörte sie um seinen Kopf summen und versuchte sie mit den Händen zu vertreiben, ohne die Augen zu öffnen. Dann gewann das Wachbewusstsein Oberhand, er öffnete ein Auge. Wespen? Die alten Motorola StarTAC, die er und die Paranza als Wegwerftelefone benutzten, damit man sie nicht abhören konnte. Wer weiß, wie lange das Ding schon auf dem Schreibtisch brummte.
Mit einem Satz war er aus dem Bett. Er hatte den ganzen Morgen und einen Teil des Nachmittags geschlafen, fühlte sich aber nicht erfrischt. Er wusch sein Gesicht mit eiskaltem Wasser, dann zog er sich die Kapuze des Sweatshirts über den Kopf, als könnte er sich so vor dem Schmerz schützen, der ihm den Nacken hochkroch. Eine dieser Migräneattacken, die sich in eine bestimmte, winzig kleine Stelle verbeißen und bohren, bohren wie ein Sadist mit der feinen Spitze seines Drillbohrers. Wenn er als kleiner Junge Fieber hatte oder ihm übel war, gab seine Mutter Mena ihm Zuckerwasser mit Zitrone. Das war ihr Allheilmittel, das hilft gegen jede Krankheit, sagte sie.
Aber jetzt war Mena nicht da, und er hatte erst versucht, den Schmerz mit einem Joint zu bekämpfen, dann mit einem Schlag gegen den Kopf, und schließlich hatte er sich für einen starken Kaffee entschieden und für eine Nachricht an die Paranza im Chat. Er wollte sie alle im Separee, Punkt fünf Uhr, es gab viel zu besprechen. Obwohl ihm gar nicht nach Reden war und er obendrein nichts zu sagen hatte. Er wollte sich nur vom Gequatsche seiner Leute einlullen lassen, damit sie verscheuchten, was er unter dem Brummen des Bohrers mit der feinen Spitze verspürte. Einen Klumpen Ohnmacht und Unzufriedenheit mit sich selbst, der immer größer wurde, je länger er allein war.
Das Nuovo Maharaja wurde renoviert. Zumindest erzählte Oscar, der Besitzer, das jedem, der abends vor dem Lokal stand. Totales Embargo. Er ging den Leuten entgegen, die das Gerüst vor der weißen Fassade betrachteten, und versicherte ihnen, mit den Händen seinen weichen Bauch haltend, dass sie bei der Wiedereröffnung ein noch prachtvolleres Nuovo Maharaja vorfinden würden. In Wirklichkeit bestanden die »Renovierungsarbeiten« aus dem Bohnern der Tanzfläche und einem Anstrich der weißen Fassade, aber Oscar setzte auf die Wartezeit. Er setzte auf Illusionen.
Für den Clan der Kinder war das Nuovo Maharaja immer geöffnet, auch wenn es geschlossen war.
Oscar sah den T-Max von Nicolas mit einer ungewohnten Geschwindigkeit ankommen, er fuhr gemächlich wie die Schiffe, die man von der Terrasse des Nuovo Maharaja bewundern konnte. Er beobachtete, wie Nicolas den Scooter wie irgendein Stück Alteisen fallen ließ und direkt auf den Eingang zusteuerte, ohne einen Blick auf ihn oder die beiden Frauen zu werfen, mit denen Oscar gerade sprach. Blonde, langbeinige, blutjunge Frauen.
»He, Maraja.« Oscar probierte ihn aufzuhalten. »Komm her, ich stelle dir die neue Tanztruppe vor.« Doch Nicolas hörte ihn nicht einmal, er wollte nur schnell ins Separee, sich auf dem kleinen Sofa ausstrecken und möglichst eine Weile im Dunkeln liegen, bevor die anderen kamen. Er versuchte zu ordnen, was nach seinem missglückten Überraschungsangriff im Krankenhaus Priorität hatte. Erst mit Tucano sprechen? Ihm mit allen Mitteln einbläuen, dass er den anderen nichts von dem, was passiert war, weitertratschen durfte? Oder sich Mena stellen, ihr von seiner Niederlage erzählen? Denn es gab kein anderes Wort dafür. Vielleicht wusste sie es schon, vielleicht war ihr der Bericht der regionalen Nachrichtensendung nicht entgangen.
Der Erste, der ankam, war Lollipop, gefolgt von Briatò. Sein alter Fußballkamerad humpelte noch immer sichtlich. Nachdem man ihm das Bein an vier Stellen gebrochen hatte, war es nicht mehr geheilt, und der Arzt hatte gesagt, er würde für immer hinken. Aber Briatò machte sich nichts draus, betonte seinen »De-Niro-Gang« sogar. Im dunklen Separee entdeckten sie Nicolas nicht sofort. Er saß, die Hände an die Schläfen gepresst, auf seinem Thron, damit die anderen ihn dort sahen, wo er sein musste, aber das Licht anzumachen, hatte er nicht gewagt.
»Ey, Maraja, wo bist du?«, rief Briatò.
»Hier«, sagte Nicolas, »was brüllt ihr so?«
Lollipop ließ sich auf das Sofa fallen, während Briatò das Separee taghell erleuchtete. Eine weiße Sonne explodierte hinter Nicolas’ Augen.
Ein Blick genügte, damit Briatò das Licht wieder löschte.
Nach und nach kamen die anderen. Der Letzte war Dragò, der sich neben Drone setzte und so den Halbkreis wiederherstellte, in dem sie genau an diesem Ort die Verteilung der Umschlagplätze festgelegt hatten. Sie waren farblose, mehr oder weniger kompakte Silhouetten, je nach der Lichtmenge, die sie einfangen konnten, wenn sie sich bewegten. Nur Nicolas, tief in seinem Thron versunken, schien die Linien seines sehnigen Körpers verloren zu haben.
Biscottino konnte die Hände nicht ruhig halten. Sie raschelten im Schatten. »Maraja, was soll diese Dunkelheit? Bezahlt Oscar die Stromrechnung nicht?«
»Der hat noch nie ’ne Stromrechnung bezahlt«, erklärte Pesce Moscio, »er zapft die Stromleitung vom Nachbarhaus an.«
Das Gelächter war wie Nadeln in Nicolas’ Schädel, aber er sagte nichts. Eine Nadel nach der anderen, damit würden seine Brüder ihn heilen.
»Aber habt ihr die geilen blonden Riesenweiber draußen gesehen? Oscar braucht ’ne Leiter, um die zu ficken«, sagte Lollipop.
Wieder Gelächter, wieder Nadeln, schon fühlte Nicolas sich ein bisschen besser. Es war das übliche Ritual, und er war seit eh und je der Zeremonienmeister: erst Rumalbern, dann langsames Versiegen der Flut aus Sprüchen, und zuletzt kam man zu den wichtigen Dingen. Die Piazze. Das Geld. Ihr Reich.
Anfangs hatte es einen Boom gegeben. So niedrige Preise waren noch nie da gewesen, in Forcella schien andauernd Weihnachten zu sein. Alle kamen in ihr Viertel, sogar aus dem Umland, der Stoff der Paranza ging schon an einem Vormittag weg, dann musste man für Nachschub sorgen. Alles war glattgelaufen, sie hatten mittlerweile massenhaft Kundschaft. Drone hat sich selbst zum Logistiker ernannt und sich einen Personenzähler besorgt, wie Stewardessen ihn benutzen, um die Anzahl der eingestiegenen Passagiere zu kontrollieren. Damit lief er von einer Piazza zur anderen, klick, klick, klick. Er postierte sich in einer Ecke, und bei jedem, der vorüberging, weil er Stoff kaufen wollte, drückte er mit dem Daumen auf den Knopf. Klick. Wenn zu viele Kunden kamen, stoppte Drone den Menschenfluss oder setzte die Operation Nachlieferung in Gang. Dieser Personenzähler war zur Verlängerung seiner Hand geworden, sogar wenn er im Nuovo Maharaja war, hörte man ständig dieses Klicken.
»Bei mir ist nichts mehr zu machen«, sagte Tucano, »ich kann sie nicht mehr zurückhalten. Sie wollen wieder das Zeug von Micione verkaufen. Ich hab die Dealer nicht mehr im Griff.«
Innerhalb von drei Monaten war die Euphorie geschwunden. Die Leute hatten der Paranza der Kinder den Stoff aus den Händen gerissen, doch jetzt ging er zur Neige. Also waren die Capi der Umschlagplätze aus ihrem Rausch erwacht und hatten sich wieder an ihren alten Lieferanten gehalten. Und der nutzte die Situation, indem er den Markt tonnenweise mit seinem Stoff überschwemmte.
»In San Giorgio dasselbe«, sagte Lollipop. »Wisst ihr, wie sie mich noch bis letzte Woche nannten? Don Vincè! Echt, das ist Fakt! Und jetzt, wo uns der Stoff ausgeht, machen sie es wie früher. Sie reden mit Micione, und wir sind wieder die Angeschissenen.«
»Dein Problem ist, dass du dich nicht wirklich anstrengst, Lollipop«, sagte Dragò. Er ging auf Lollipop zu, um ihm in die Wange zu kneifen, doch der wich ihm aus, und die beiden verknäulten sich in einer harmlosen Rangelei. Einen Moment lang erinnerten ihre Körper Nicolas an ein Video mit raufenden Kätzchen — oder waren es Bärenkinder? —, das Letizia gepostet hatte. So schnell, wie sie aufeinander losgegangen waren, trennten sie sich wieder, und Dragò kehrte auf seinen Platz zurück. Mit tönender Stimme erzählte er voller Genugtuung, dass er auf seinem Platz in der Via Vicaria Vecchia die Kunden vertreiben musste, weil es zu viele waren.
»Hab den Preis verdoppelt«, sagte er, »so geht die Ware langsamer weg, und die Dealer bleiben ruhig.«
»Hört, hört, der Unternehmer.«
»Du reißt es voll!«
»Ja, aber so verdienen sie weniger«, wandte Tucano ein.
»Sie verdienen weniger, vielleicht sogar langsamer«, sagte Dragò, »aber so geraten sie nicht zwischen Hammer und Amboss.«
»Mann, genial, Dragò«, rief Biscottino, »bist du Amboss, steckst du ein, bist du Hammer, teilst du aus. Ja, ja, die alte Weisheit Neapels!«
Hätte Nicolas den Mund aufgemacht, hätte er gesagt, dass es keinen Grund zum Witzeln gab. Sie steckten im Treibsand und waren kurz davor, unterzugehen. Eine Piazza nach der anderen, alle würden sie fallen, die eine früher, die andere später. Vielleicht würde jemand die Kontrolle über ein paar Straßen behalten, aber er würde ersticken zwischen der Schlagkraft von Micione und dem Schicksal, das dem blüht, der noch nie das Gesicht seines eigenen Lieferanten gesehen hat. Die Vorräte von Arcangelo schmolzen dahin. Nicolas wusste das, und alle anderen wussten es auch, aber keiner hatte den Mut, es offen auszusprechen. Ja, das Heroin von Scignacane kam immer noch regelmäßig an, aber allein reichte es nicht, um die zuverlässige Belieferung ihrer Plätze zu garantieren.
Das hätte er sagen müssen, doch der Kopfschmerz ließ nicht nach. Darum schwieg er und begnügte sich damit, Tucano im Auge zu behalten, der zu Boden blickte. Wartete er, bis er an die Reihe kam, um zu verraten, dass Nicolas in diesem Krankenhaus versagt hatte, um seine Schwäche bloßzustellen? Ein Wort hätte genügt, und mit Maraja wäre Schluss. Ich würde es tun, dachte Nicolas, warum redet Tucano nicht? Wollte er nicht auch eine Paranza ganz für sich allein?
»Maraja«, sagte Dragò, »Tucano und Lollipop haben recht. Der Stoff geht uns aus. Wir verlieren diese Piazze bald.«
»Wir legen sie alle um«, schlug Briatò vor. »So läuft das doch, oder? Wenn einer den Stoff von andren ohne Erlaubnis verkauft, muss er abgeknallt werden.«
»Entweder du verkaufst die Drogen von einem Boss, oder du musst ihm ’ne Abgabe zahlen, so funktionieren die Piazze doch«, meinte Drone. »Uns zahlt keiner Abgaben, und die Vorräte sind bald aufgebraucht.«
»Was meinst du, Nicò, lassen wir sie alle hier ins Maharaja kommen und vergasen sie?«, schlug Briatò vor. Großes Gelächter bei der Paranza. Nicolas konnte nur eine Grimasse ziehen, sie fingen schon wieder an, herumzualbern.
»Also einmal, da waren Maraja und ich, wir standen so da rum, ihr wisst schon, auf der Piazza Bellini, okay?« Pesce Moscio fing an zu erzählen. »Und da waren diese schnöseligen Sackratten mit ihren Polohemden. Sie glotzen uns an, ich hab schon die Hand am Eisen. Dann kommen die kleinen Arschlöcher auf uns zu, ich guck Maraja an, und er zuckt bloß mit den Schultern.«
»Quatsch uns nicht voll, Pesce«, sagte Drone, »du hörst dich an wie ’n Fernsehmoderator!«
»Einer von denen sagt, er ist vom Nachrichtenmagazin im Fernsehen«, fuhr Pesce Moscio ungerührt fort, »und fragt, ob er uns interviewen kann, stimmt’s, Maraja?«
Die sieben Silhouetten drehten sich zu Nicolas um, doch vom Thron kam kein Wort. Dragò stand auf, wich dem Arm von Lollipop aus, der seine Absichten geahnt hatte, und knipste das Licht im Separee an.
Nicolas ’o Maraja war verschwunden.
Schluss mit dem Geheule
Er kehrte so langsam, wie er hingefahren war, auf dem T-Max nach Forcella zurück. Den Gasgriff halb aufgedreht, keine Stufe darüber oder darunter, ein leichter Druck auf den Bremshebel, wenn nötig. Die Versammlung im Nuovo Maharaja hatte nicht viel genützt, außer ihm die beruhigende Gewissheit zu geben, dass kein Staatsstreich stattfinden würde. Als hätten seine Brüder gar nicht gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte, dass er sich fühlte, als wäre er auf einem Foto unscharf geraten. Nein, schlimmer: Er fühlte sich wie in diesem alten Film, Die Invasion der Körperfresser, den sein Lehrer De Marino ihnen mal gezeigt hatte. Bald würden die anderen merken, dass von ihm nichts übrig war als eine leere Hülle. Der T-Max, ein Gewohnheitstier, bog in die Via Viacaria Vecchia ein, fuhr dann eine weiche Rechtskurve. Via dei Carbonari. Nicolas war angekommen.
Was für Scheißgedanken, sagte er sich. Schuld war dieser Klumpen, der sich seit dem Aufwachen in seinem Nacken eingenistet hatte und ihn mit einem Gefühl quälte, das er sein ganzes Leben lang noch nicht gehabt hatte. Das Gefühl, zu nichts mehr nütze zu sein.
Mit gesenktem Blick parkte er den Roller und verließ die Gasse zu Fuß. Seit wann ging er nicht mehr durch seine Stadt?
Ohne es zu merken, kam er in die Via Mezzocannone. Ein paar Studenten riefen seinen Namen. Vielleicht alte Kunden aus der Zeit, als die Paranza noch für Copacabana dealte, wer weiß. Er beachtete sie nicht, ging weiter, schon lag Forcella hinter ihm und damit auch das große Bild von San Gennaro an der Mauer. Er machte schnellere Schritte, jede Kreuzung, jede Ecke, jedes einzelne Geschäft mit Blicken taxierend, der alte Zwang, das Territorium zu kontrollieren, der zum instinktiven Verhalten geworden war. Das Loch, das ein Kanonenschuss ins Bronzetor des Maschio Angioino gerissen hatte, weckte eine Erinnerung. Erst vor ein paar Jahren, als er mit Letizia hier spazieren gegangen war, hatte er geschworen, auch er würde ein Zeichen auf der Stadt hinterlassen, auf ihren Steinen, ihren Menschen.
Atemlos kam er am Castel dell’Ovo an, rang nach Luft, als würde er ertrinken. Er stieg die Treppen hinauf und trat auf den Balkon. An der Mauer ging er in die Hocke, den Rücken gegen den Tuffstein gelehnt, die Knie an die Brust gezogen. Vor ihm das Meer. Ein lustvoller Schauder richtete die Haare an seinen Armen auf. Das Meer. Ja, das war es, was er brauchte, das Heilmittel gegen die Gedanken. Dieses unermessliche Blau verlangte nichts von ihm, und er konnte nichts von ihm verlangen. Nur wenn er aufs Meer schaute, gelang es ihm, nicht nachzudenken, nicht zu planen. Vielleicht weil dieser weite Horizont ihn frei umherschweifen ließ, losgelöst von jedem Kalkül.
Er fühlte sich besser, doch etwas fehlte noch. Er zog sein iPhone hervor, ließ die unbeantworteten Anrufe und Nachrichten außer Acht und schrieb an Letizia:
NICOLAS
Bin an unsrem Platz am Meer.
Als Letizia ankam, saß Nicolas noch in derselben Haltung da, er drehte nur leicht den Kopf, um sie anzusehen, und sie setzte sich einfach neben ihn, ihr Kopf auf seiner Schulter. Sie wirkten wie das, was sie waren: ein Achtzehnjähriger und eine Sechzehnjährige. Der Wind wehte Letizias Haare über Nicolas’ Gesicht, doch er schob sie nicht beiseite, ließ sich von ihnen peitschen, füllte sich den Mund mit ihnen, dann ließ er sie los, damit sich das Spiel wiederholte. Er wandte die Augen vom Blau des Meeres, das jetzt dieselbe Farbe hatte wie der Sonnenuntergangshimmel, und küsste Letizia. Erst auf die Lider, dann aufs Kinn, er verweilte auf ihren Lippen und wanderte dann zu ihren Ohrläppchen. Sein Nacken lag bloß, und Letizia stürzte sich darauf, küsste und biss ihn.
»Immer wenn ich dich auf den Nacken küsse, sehe ich Christian vor mir«, sagte sie, »weil ich seinen Namen lese.«
Nicolas’ Mund, der weich von den Küssen war, verkrampfte sich.
»Sein Name muss da stehen.«
Letizia band sich die Haare mit einem Gummi zusammen, die Magie von eben war verflogen. »Aber ich fühl dann was Böses im Bauch, wie ein Bandit, als hätten wir das getan …«
Seit Monaten versuchte Nicolas mit diesem Banditen im Bauch abzurechnen, das hätte er Letizia gerne erklärt.
»Dieser Bandit muss sterben«, sagte er stattdessen. »Es ist meine Schuld, ich hab Christian nicht beschützen können. Als Scignacane mir gesagt hat, er will Dumbo umbringen, hätte ich die Eier haben müssen, Dumbo abzuknallen und Dentino auch. Ich hab nur die halbe Arbeit gemacht, und sie haben sich meine Hälfte genommen. Meinen Bruder.«
Letizia schüttelte den Kopf, ihr Pferdeschwanz flog hin und her. »Ich will diese Sachen nicht wissen, Nicò.«
»Fuck, warum erzählst du mir dann was vom Banditen im Bauch? Sag besser gar nichts, halt einfach die Klappe. Wenn du nichts wissen willst, darf es diese Sachen für dich gar nicht geben.«
Letizia stand auf, sie wollte Nicolas’ Körper nicht mehr spüren, seine Beine, die sich an sie schmiegten. Sie machte ein paar Schritte rückwärts und lehnte sich gegen die Mauer. Er ließ sie gewähren.
Wenn sie nichts wissen wollte, konnte sie ebenso gut wieder gehen.
»Was soll eigentlich diese Ananas beim N von Christians Namen, hier, auf deinem Hals?«, fragte Letizia mit ein bisschen wiedergewonnener Zärtlichkeit in der Stimme.
»Das ist eine Handgranate.« Nicolas drehte sich nicht zu ihr um.
»Weiß ich, Blödmann. Ich weiß so was.« Sie strich ihm schon wieder sanft über den Hals. »Aber was hat dieses hässliche Ding mit dem schönen Namen von deinem Bruder zu tun?«
»Das hässliche Ding erinnert mich daran, dass die, die ihn getötet haben, sterben müssen. Alle.«
»Du sollst mir so was nicht erzählen, hab ich dir doch gerade gesagt, das macht mir Angst. Behalt das für dich.«
»Dann frag mich nicht, kümmer dich um deinen eigenen Scheiß.«
»Madonna, Nicò, wenn du so redest, bist du wie ’n Tier…«
»’n Tier kann seinen Bruder beschützen. Halt die Fresse.«
»Du bist so ein verschissenes Arschloch, weißt du, Nicò? Ach, fick dich doch!« Die Worte kamen bebend. Noch nie hatte sie so mit Nicolas gesprochen, so roh und zornig. Aber er blieb ungerührt. Auch diese Gleichgültigkeit war neu zwischen ihnen.
Ihr kamen die Tränen, aber sie wollte nicht zeigen, dass sie verletzt war. Und erschrocken.
Bevor sie die Treppe hinunterging, hob sie den Mittelfinger hinter Nicolas, der weiter aufs Meer blickte.
Er wickelte die Straße wieder auf wie ein Band. Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, die Via Medina, San Biagio, Mezzocannone. Forcella. Sein Haus. Von unten konnte er das weit geöffnete Küchenfenster sehen, das Zeichen für Menas Anwesenheit, denn auch nach Christians Tod hatte sie ihre Gewohnheit, die Wohnung morgens und abends durchzulüften, nicht aufgegeben. Mit allem hatte Mena abgeschlossen, aber auf das Licht verzichtete sie nicht.
Er fand sie beim Zusammenlegen frisch gewaschener T-Shirts. Sie hob die Stoffhüllen an, ein gezielter Ruck aus den Handgelenken, die Hemden kehrten in ihre Form zurück, dann eine Drehung der Handgelenke unter den Ärmeln, schon entstand die Falte, schließlich ein letztes Umklappen für die endgültige Verwandlung — ein perfektes Rechteck.
Nicolas wartete, bis seine Mutter den Wäschekorb leer geräumt hatte, bevor er sie begrüßte. »Ciao, Mà.«
Ihr genügte ein Blick, um in seinem Gesicht die Last zu lesen, die er mit sich herumschleppte.
»Du warst am Meer?«, fragte sie.
Er nickte, hatte keine Lust auf Worte und spürte doch das Bedürfnis, ihre zu hören, als hätte er seit dem Aufwachen nichts anderes getan, als durch die Stadt zu irren, um hier anzukommen. Um nach Hause zu seiner Mutter zu kommen und vor das Gericht zu treten, das endlich sein Versagen, seine Unfähigkeit verkünden würde.
Er ging zum Tisch und legte eine Hand auf das oberste T-Shirt des Stapels. Es trug eine Zeichnung des London Eye. Er selbst hatte es Christian geschenkt, mit dem Versprechen, dass er ihn eines Tages wirklich nach London bringen würde, beide mit den Taschen voller Geld, und dann würden sie zusammen Riesenrad fahren. »Von da oben pissen wir allen arabischen Ölscheichs von London auf den Kopf«, hatte er zu Christian gesagt. Nicolas betrachtete das T-Shirt, und ihm war, als wollte auch dieses Ding ihn anklagen, dass der Körper fehlte, der es noch vor ein paar Monaten ausgefüllt hatte. Er nahm seine Hand weg und ballte sie zur Faust, bis er die Fingernägel in seiner Handfläche spürte.
»Siehst du, wie viele Sachen Christian hatte?«, fragte seine Mutter mit einem sanften Lächeln. »Unglaublich, man merkt gar nicht, wie viele Sachen es um einen Menschen herum gibt, auch nutzlose, ja, auch solche, die zu gar nichts zu gebrauchen sind. Wie viele T-Shirts, Schuhe, Spielzeug … und man hat nicht mal genug Zeit, das alles anzuziehen.« Sie fuhr sich mit einer Hand durch die Haare, die an den Schläfen weiß geworden waren, glanzlose Strähnen. Nicolas hielt die Augen gesenkt, er konnte nicht mal nicken, seine Hand war noch verkrampft, als hinge ihm die Pistole, die er nicht hatte benutzen können, sinnlos an den Fingern.
»Nicolas«, rief die Mutter ihn zu sich. Wenn sie seinen vollen Namen aussprach, nicht Nicolino, nicht Nicò, kündigte das eine Rede an. »Ich weiß nicht, was ich von deinem Gesichtsausdruck halten soll, Nicolas.« Sie stellte das Bügeleisen senkrecht auf die Halterung und fuhr ihm jetzt durch seine Haare, wie früher, als er klein war, kleiner noch als Christian.
»Alles in Ordnung, Mà«, sagte er in einem Tonfall, der überzeugend klingen sollte.
»Mir scheint, es ist nicht alles in Ordnung. Du siehst schlapp aus, traurig … Hör mir zu. Das sind Sätze, die man so sagt, aber es sind ehrliche Sätze, eine Mama weiß das. Eine Mama weiß, dass der schöne Sohn am Meer war. Eine Mama weiß, dass dieser Sohn eine Last mit sich herumträgt, die ihn auffrisst. Eine Mama trifft immer ins Schwarze, Nicò.«
»Mama …«, Nicolas versuchte zu sprechen, aber ihm fehlte die Luft in den Lungen.
»Und für eine Mutter«, fuhr Mena fort, während sie ihn mit den Augen eines Menschen ansah, der nichts mehr zu verlieren hat, »für eine Mutter sind alle Söhne gleich. Aber bei mir stimmt das nicht. Christian war mein Liebling, das weißt du, aber du bist immer anders gewesen. Christian war mein Baby. Du bist eine Sonderausgabe. Ihn hab ich zu viel gestreichelt, dich zu wenig. Das war falsch, es ist alles meine Schuld.«
Pause. Von unten eine Stimme, die jemanden suchte, dann wieder Stille.
»Ich bin die, die nichts gemerkt hat, ich bin die, die ihn nicht beschützen konnte. Ich dachte, ich sehe alles, denn dein Vater kapierte überhaupt nichts, ich dagegen … aber was hat es dann genützt, zu verstehen, was ihr macht, wohin sollte ich gucken? Ich habe mich getäuscht, basta.«
»Mama …«
»Du hast keinen Fehler gemacht, Nicolas, lass dir das von mir sagen. Sie haben unseren Kleinen umgebracht. Er hatte nichts getan, du hast ihn immer rausgehalten. Unschuldiger als ein Engel war er. Und der Kleine von ihr ist auch ein Engel. Wie kann man ein Engelchen töten? Das kannst du nicht, Nicò, ich sag es dir. Man bringt keinen Engel um.«
Nicolas spürte, wie sein Körper weich wurde und der Klumpen im Nacken sich erwärmte, als würde sein Blut endlich wieder fließen, im Körper zirkulieren.
»Dann wusstest du das von Dentinos Sohn, Mama, ich …«
»Eine Mama weiß alles, ich hab’s dir schon gesagt. Erinnerst du dich, als du klein warst? Als du bei den Nonnen warst und um die Palme im Hof herumgelaufen bist? Du hast plötzlich angefangen, deinen kleinen Schulkameraden zu schlagen, einfach so. Weißt du noch?«
Er hob nur den Kopf und schnalzte ein »’nzù«, weiß nicht. In Gedanken war er noch bei dem Engel. Nein, er hätte ihn nicht töten können. Seine Mutter hatte recht. Es war ganz einfach, ja darum, und je öfter er es wiederholte, desto mehr fühlte er sich wieder er selbst.
»Madre Lucilla, so eine mit Haube, erinnerst du dich? Sie ließ mich holen, und du warst sehr wütend. Als ich dich gefragt habe, warum du etwas so Böses getan hast, hast du gesagt: ›Mama, der hat mich gehauen, also hab ich ihn gehauen, weil wenn einer mir einmal wehtut, darf er mir nie mehr wehtun.‹ Du warst klein und warst schon der Stärkste, Nicò. Du bist immer noch der Stärkste. Bist immer auf eigenen Beinen gestanden, hast nie gezögert, und auch wenn du einen Fehler gemacht hast, war’s für was Richtiges. Du bist immer schon ein Mann gewesen, auch als du klein warst. Mehr Mann als dein Vater.« Sie stand vom Stuhl auf und ging zum Fenster. Eine leichte Brise hatte den Fensterladen bewegt, und sie beugte sich vor, um ihn am Haken zu befestigen. Sie drehte sich zu ihm um, im Rücken das schwache Licht der Gasse. Wie eine Heilige auf einem Gemälde sah sie aus. »Du hast getan, was du tun musstest, Nicò. Was auch immer die Kinder tun, ihre Mütter sind schuld. Auch wenn man ein Kind verliert, sind die Mütter schuld.«
Mena kam wieder auf ihn zu, und das sanfte Lächeln kehrte auf ihr Gesicht zurück. »Ich hab nicht genug auf euch aufgepasst, eine Mama muss immer bei ihren Kindern sein. Vielleicht hab ich dir zu wenig gegeben, aber was du gebraucht hast, hast du dir genommen. Was ich dir nicht gegeben habe, hast du dir genommen. Na gut, wenn du dir alles nehmen willst, nimm dir alles, aber tu’s wirklich. Es hat gar keinen Zweck, hier zu heulen. Und das sage ich auch mir, Nicò. Schluss mit dem Geheule, Mena. Wenn der Weg des Guten zu nichts geführt hat, führt der Weg des Bösen vielleicht zu was. Du bist ein besonderer Sohn. Achtzehn bist du jetzt, ein Mann. Also tu, was du tun musst, und mach es richtig. Wer mir Christian genommen hat, muss leiden.«
Nicolas bekam Lust, seinen Kopf an ihre Brust zu legen, wie mit fünf Jahren, wenn er sich im Schrank versteckt hatte und nach ihr rief, damit sie ihn dort fand. Aber der Impuls dauerte nur einen Augenblick. Er war jetzt ein Mann, nein, er war schon immer ein Mann gewesen. Ihm war unbehaglich. Einerseits fühlte er sich von den Worten seiner Mutter beschützt, andererseits spürte er, dass der Auftrag, den sie ihm gab, ihre Zustimmung, etwas Schlechtes war. Als würde er den Befehl einer Mutter brauchen, um zu tun, was er tun musste. Als würde er es allein nicht schaffen. Er versuchte, die Verwirrung auf die einzige Weise zu überwinden, die er kannte: »Mama, ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch, Nicolas.« Sie nahm sein Gesicht in ihre Hände und streifte seine Stirn mit einem Kuss. »Ich bin immer bei dir. Und jetzt noch mehr.« Dann zog sie den Stecker des Bügeleisens und ging mit dem Stapel T-Shirts ins Kinderzimmer. »Wer uns wehgetan hat, darf uns nie mehr wehtun«, hörte er sie flüstern.
Herzbube
Bevor er an die Grenze des Viertels Ponticelli kam, war der Tag warm und sonnig gewesen. Obwohl es Herbst war, brannte die Sonne heiß auf Nicolas’ frisch rasierten Schädel, doch ein leichter Wind wehte in seinem Rücken und schien den T-Max anzuschieben.
Am Morgen war er vor seinen Brüdern wieder aus dem Nichts erschienen, so wie er verschwunden war, und hatte gesagt: »Ich muss mit Don Vittorio Arcangelo reden, damit wir aus dem Treibsand rauskommen.« Er hatte sie im Schlupfwinkel zusammengerufen, die vollzählig versammelte Paranza hatte genickt, richtig, accussì s’adda fà, so muss man das machen. Über den gescheiterten Angriff im Krankenhaus hatte keiner ein Wort verloren, ohnehin wusste Nicolas jetzt, dass die Rache über andere Wege laufen musste. Er war wieder der Alte, ’o Maraja, und er blickte ihnen in die Augen, einem nach dem anderen, von Biscottino bis Dragò. Der Himmel ist die Grenze, ihre alte Losung.
Nicolas wollte von hinten in Conocal ankommen, ohne direkt nach Ponticelli hineinzufahren, um diese Luft auszukosten. Eine Luft, die alles mit sich forttrug, auf freundliche Art, als würde sie die bösen Gedanken an die Hand nehmen.
Er war schon länger nicht mehr beim Erzengel gewesen, seither hatte er es weit gebracht, und das Geld, das ihm gegen die Schenkel drückte, sollte das beweisen.
Die Männer von Micione sah er schon von weitem, denn nur sie konnten sich so seelenruhig auf der Motorhaube eines Mercedes sitzend einen Joint drehen, als wenn nichts dabei wäre. Sie trugen die Selbstsicherheit von Gefängniswärtern zur Schau, die einen wichtigen Gefangenen in Isolationshaft bewachen. Nicolas probierte andere Zugänge, er fuhr den Umkreis des Viertels ab, umsegelte den Rione Lotto Zero (auch in diesem Viertel zwei Männer, auf Motorrädern), streifte die Grenze zu San Giorgio a Cremano, überzeugt, in dieser Gegend wäre die Bewachung weniger scharf. Stattdessen stieß er auf einen SUV mit verdunkelten Scheiben.
Sie wollen Don Vittorio lebendig begraben, dachte er, dann parkte er in sicherer Entfernung, vor einer Bar mit leeren Tischchen. Der Tag hatte seine Schönheit verloren, auch der Wind von vorhin war abgeflaut. Nicolas rief Aucelluzzo an. Wenn der wusste, wie man aus Ponticelli herauskam, musste er auch wissen, wie man hineinkam. Fünf Minuten später hörte er das unverwechselbare Geräusch des Scooters. Er sah Aucelluzzo in voller Fahrt aus der Kurve kommen, in gefährlicher Schräglage, die Schläfe fast am Asphalt. Aucelluzzo bremste scharf vor Nicolas und hatte noch nicht mal beide Füße auf den Boden gesetzt, da hob er schon sein T-Shirt, um ihm sein neues Tattoo zu zeigen. Auf die blasse, magere Brust hatte er sich vier Einschusslöcher tätowieren lassen.
»Geil, Mann, genau wie Wolverine!«, sagte Nicolas, teils, um ihm zu schmeicheln, teils, weil er es wirklich dachte.
Kaum hatte Aucelluzzo das Hemd wieder fallen gelassen, legte er mit dem üblichen Geflenne los. Nico könne ihn nicht einfach so anrufen, wenn es ihm passte, sein Leben sei sowieso schon scheiße, er müsse für ein paar lumpige Euro dealen, und überall seien die Wachhunde von Micione.
»Maraja«, sagte er zum Schluss, »ich bin der Einzige, der hier rein- und rauskommt, ich bin wie der Wind.«
Nicolas drückte ihm sanft eine Faust an die Schulter.
»Weiß ich doch. Darum hab ich dich ja angerufen, Aucellù. Ich brauche deine Superkräfte.«
Aucelluzzo schwoll die Brust, und ohne ein Wort raste er sofort los, Nicolas hinterher. Sie fuhren auf einen Abstellplatz hinter der A3, ein Friedhof verrosteter Wohnwagen, und von dort zu einer Barriere aus Metallplatten, die an die Via Mastellone grenzte: der Eingang von Ponticelli. Aucelluzzo ging zu einer herunterhängenden Platte, riss sie ohne Mühe ab und warf sie auf den Boden, eine Wand aus Staub aufwirbelnd. »Jetzt kannst du durch, Maraja.« Nicolas schenkte ihm eine halbe Verbeugung und fuhr los.
Diese Ecke von Ponticelli war noch heruntergekommener, wenn das überhaupt möglich war. Hier trocknete das Leben aus. Die wenigen Geschäfte hatten ihre mit Graffiti beschmierten Rollläden heruntergelassen, und man sah keine Menschenseele.
Ein Atomkrieg, dachte Nicolas. Ein Erstickungskrieg, eine lange Belagerung mit dem einzigen Ziel, Arcangelos Ressourcen zu erschöpfen, ihn auszuhungern, ihn lahmzulegen, ihn in den Tod durch Entbehrung zu treiben. Früher oder später würde Micione seinen Sieg über ihn erringen, das dachten alle.
Alle außer ’o Maraja.
Er parkte unter den Arkaden des Mietshauses, in dem sich die Gefängniswohnung von Don Vittorio, dem Erzengel, befand. Ein Blick zu den Fenstern, um zu kontrollieren, ob hinter den geschlossenen Rollläden die Augen von Don Vittorios Faktotum Cicognone lauerten. Dann klingelte er an der Tür der Professoressa Cicatello. Sie öffnete in ihrem üblichen Hauskittel voller Flecken, und Nicolas setzte zum manierlichsten »Guten Tag« an, das er beherrschte, um dann alles mit »Mist, verflucht!« zu ruinieren, weil ihm die Ballerina aus Porzellan eingefallen war, die er im Gepäckfach des Rollers vergessen hatte. Er lief sie holen. Als er zurückkehrte, stand die Professoressa noch immer in der Tür, und er drückte ihr die Figur mit einem »Zahlung im Voraus, Signò, sonst vergess ich’s hinterher« in die Hand. Er war auf der Hinfahrt schon zu oft aufgehalten worden, konnte nicht noch mehr Zeit mit Höflichkeiten verlieren, außerdem kannte er den Weg. Er lief an den Schülern vorbei, denen die Professoressa Nachhilfestunden gab, und kam in die Küche: Treppchen, Luke, drei gut gezielte Schläge mit dem Besenstiel gegen die Falltür. Cicognone öffnete, sah ihn aber kaum an, denn hinter ihm brüllte Arcangelo: »Wichsgeburt! Mach ihn rein, verdammter Idiot!«
Nicolas fand den Erzengel vor dem Fußballvideospiel Iss Pro Evolution. Er hielt den Controller wie eine Fernbedienung in einer Hand und wedelte damit vor dem Bildschirm hin und her, als könnte er die Spieler auf diese Weise lenken. »So eine Scheiße!«, rief er und stand erregt auf. Nicolas bemerkte, dass die Jeans, die er trug, mindestens ein paar Nummern zu groß waren. Ein T-Shirt, das früher leuchtend rot gewesen sein musste, schlotterte ausgebleicht und zerknittert an ihm herunter, der Pullover, der schief über seinen Schultern lag, war mit Härchen übersät. Man sieht Don Vittòs Brustwarzen, dachte Nicolas, und dieser Anblick milderte die Nervosität, die ihn beim Betreten der Wohnung gepackt hatte. Heute spielte er um ein Stück seiner Zukunft und musste diesem Mann entgegentreten, der nach Dreck und Alter stank. Der nach Tod stank.
»Wie macht ihr das bloß«, fragte Don Vittorio, »wie könnt ihr euch mit so einem Mist vergnügen?«, und brachte die Playstation mit einem Hieb auf den Controller zum Schweigen. »Cicognò, mach Kaffee«, sagte er, »geh, wir haben einen wichtigen Gast.«
»Jaja, das Aschenbrödel geht Kaffee kochen.« Brummend verschwand Cicognone hinter der Küchentür. Als sie allein waren, brachte Nicolas den Erzengel auf den neuesten Stand, was die Geschäfte betraf. Es liefe alles ziemlich gut, sagte er mit Betonung auf »ziemlich« und zog zwei Bündel Geldscheine aus der Tasche. »Dies ist der Anteil des Grimaldi-Clans.«
Arcangelo bewegte die Bündel eine Weile in der Hand hin und her, zweifelnd, mit halb geschlossenen Augen.
»Zählt Ihr die Scheine nicht, Don Vittò?«
»Es gibt zwei Arten Männer, Nicolas. Die, die Geld zählen, und die, die es wiegen. Wer zählt, hat kein Geld. Wer es wiegt, hat welches. Weißt du, wie viel eine Milliarde Lire wiegt?«
»Lire?«
»Ja, Lire, du Schwachkopf! Die Währung, die’s vorm Euro gab. Dreizehn Kilo und vierhundert Gramm.«
»Oha. Und das hier, wie viel ist das, glaubt Ihr?«
»Etwa fünfzigtausend Euro. Ich hätte doppelt so viel aus dem Zeug rausgeholt, Nicò. Du und deine beschissene Google-Methode …«
Nicolas hielt sich zurück, besser nicht auf das Thema zurückkommen, er war aus einem bestimmten Grund hier. Was er fragen musste, wusste er, aber nicht wann, denn wenn der Alte schlechter Laune war, hätte er mit seiner Frage alles verdorben. Also versuchte er, das Terrain zu sondieren: »Kommt Euch eigentlich nie eine Frau besuchen, Don Vittò?«
»Nein, denn die Nummer von deiner Mama hab ich verloren. Aber was sind das für Fragen? Haben wir je vom selben Teller gegessen?« Der Alte war ein bisschen überrascht, aber er hatte es mit einem Lächeln gesagt.
»Ich mach mir aber wirklich Sorgen, Don Vittò, dass Ihr mit dem Aschenbrödel da« — er wies mit dem Kinn Richtung Küche — »so zwischen zwei Kaffees, Ihr und er, er und Ihr, na ja, vielleicht steckt Ihr ihm … ich weiß, dass Ihr alt seid, aber vielleicht steht Eurer ja noch.«
Don Vittorio hörte nicht auf zu lächeln. »Ich sollte mich lieber dran erinnern, ob ich deine Mutter gefickt habe, ein Prachtweib aus Forcella, vor achtzehn Jahren … vielleicht bist du mein Sohn.«
»Würd mir gefallen, Don Vittorio.«
Der Erzengel freute sich über diese Bemerkung und lud Nicolas, immer noch lächelnd, endlich ein, Platz zu nehmen. »Sag mal, Nicò, die Waffen, die ich euch gegeben habe, die bewahrt ihr doch nicht etwa im Unterschlupf im Vicolo dei Carbonari auf?«
»Wieso wisst Ihr denn was vom Unterschlupf?«
»Ich weiß alles von dir. Ich habe dich gemacht. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Du bist mein Apfel.«
»Entschuldigt, Don Vittò, aber das mit dem Apfel hört sich für mich bisschen schwul an. Ich bin Adam, nicht Eva.«
»Madonna, was bist du doch für ein Flegel … Also, wo habt ihr diese Waffen hingebracht?«
»Die sind in Sicherheit.«
»Wo denn, sag es mir.« Der Erzengel hatte eine Investition getätigt. Als Unternehmer hatte er ein Recht darauf, zu wissen, wie es darum stand. »Du magst deinen Kindern vertrauen, aber ich tue das nicht. In zwanzig Jahren hat man nie was bei mir gefunden.«
»Sie sind in Gianturco in der Wohnung einer Altenpflegerin. Sicherer ist nur noch die Kaserne der Carabinieri.«
»Bravo. Und deine Paranza auch, ihr habt alles gut organisiert. Du wirst der Fürst von Neapel werden, bravo.«
Nicolas hob die Augenbrauen. »Nein, Don Vittò, bei allem Respekt, Ihr irrt Euch, wisst Ihr denn nicht, was Maraja auf Sanskrit bedeutet?« Er betonte das Wort richtig, hatte vorher aber eine kurze Pause gemacht, als müsste er Anlauf nehmen, um nicht über die schwierige Aussprache zu stolpern. »Es bedeutet Großer König. Und Ihr könnt drauf schwören, dass ich nicht geboren bin, um ein Fürst zu sein, ich bin der König.«
»Großer König …«, wiederholte der Erzengel mit einer Miene, der man nicht ansah, ob er wütend wurde oder an die Jahre zurückdachte, als er der König von Neapel war. »Ein großer König hat ein Schwert, weißt du? Das ist sein Führerschein zum Kommandieren. Du bist achtzehn. Hast du den Führerschein?«
Nicolas nickte verlegen.
»Bravo«, fuhr der Erzengel fort. »Aber wichtiger ist der Schwert-Führerschein.«
Auf der Wachstuchtischdecke lag nun ein Springmesser. Nicolas nahm es in die Hand, als gehörte es ihm bereits. Der Griff war ein schwarzes Horn mit einer Plakette am oberen Ende. Der Stopp. Wozu der diente, wusste Nicolas. Schnitte in der Handfläche hatte er bei vielen gesehen, sie entstanden, wenn das Messer zu schnell aus dem Bauch eines Tiers oder eines Menschen herausgezogen wurde. Er drückte auf den Knopf an der Seite, und blitzschnell schoss die Klinge hervor. Auch das Geräusch, dieses Klacken, kannte Nicolas gut. Erst jetzt, als er sein Spiegelbild im Stahl sah, fiel ihm ein, sich zu bedanken. Doch die Höflichkeitsfloskel wurde sofort von der Neugier überrannt: »Habt Ihr getötet, Arcangelo? Mit eigenen Händen, meine ich?«
»Wieder diese Flegelei, Nicò! Ich bin sicher, deine Mama hat dir Anstand beigebracht, aber du hast ihn verloren.« Der Erzengel ließ die ausgebreiteten Arme langsam fallen.
»Nun sagt schon, Arcangelo.« Handfläche um den Griff und Daumen auf dem Knopf, um das Messer wieder einschnappen zu lassen.
»Schießen kann jeder«, erklärte Don Vittorio, »dazu gehört nichts. Die Technik ist der Tod der Werte, hat man dir das nicht in der Schule beigebracht? Die alten Bosse rührten Pistolen nicht an, darum wurden sie von allen respektiert, denn sie konnten sich mit eigenen Händen verteidigen.«
Nicolas öffnete das Springmesser immer schneller. Das metallische Geräusch nahm ihm wenigstens etwas von seiner Nervosität. Er dachte an Bücher über die Mafia, wo von alten Bossen berichtet wurde, die es für würdelos erachteten, eine Feuerwaffe in die Hand zu nehmen, für die es eine Frage der Ehre war, nur Messer zu benutzen.
»Einem Menschen entgegenzutreten und ihn zu besiegen, das verschafft dir Respekt, wenn du ihn auf der Straße erschießt, bist du genau wie alle anderen!«
Verschärfter Rhythmus. Übung macht den Meister, dachte Nicolas.