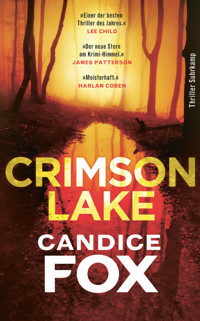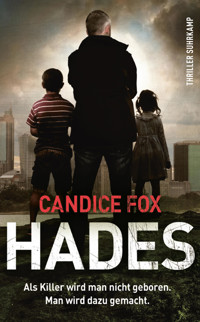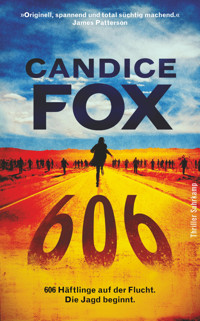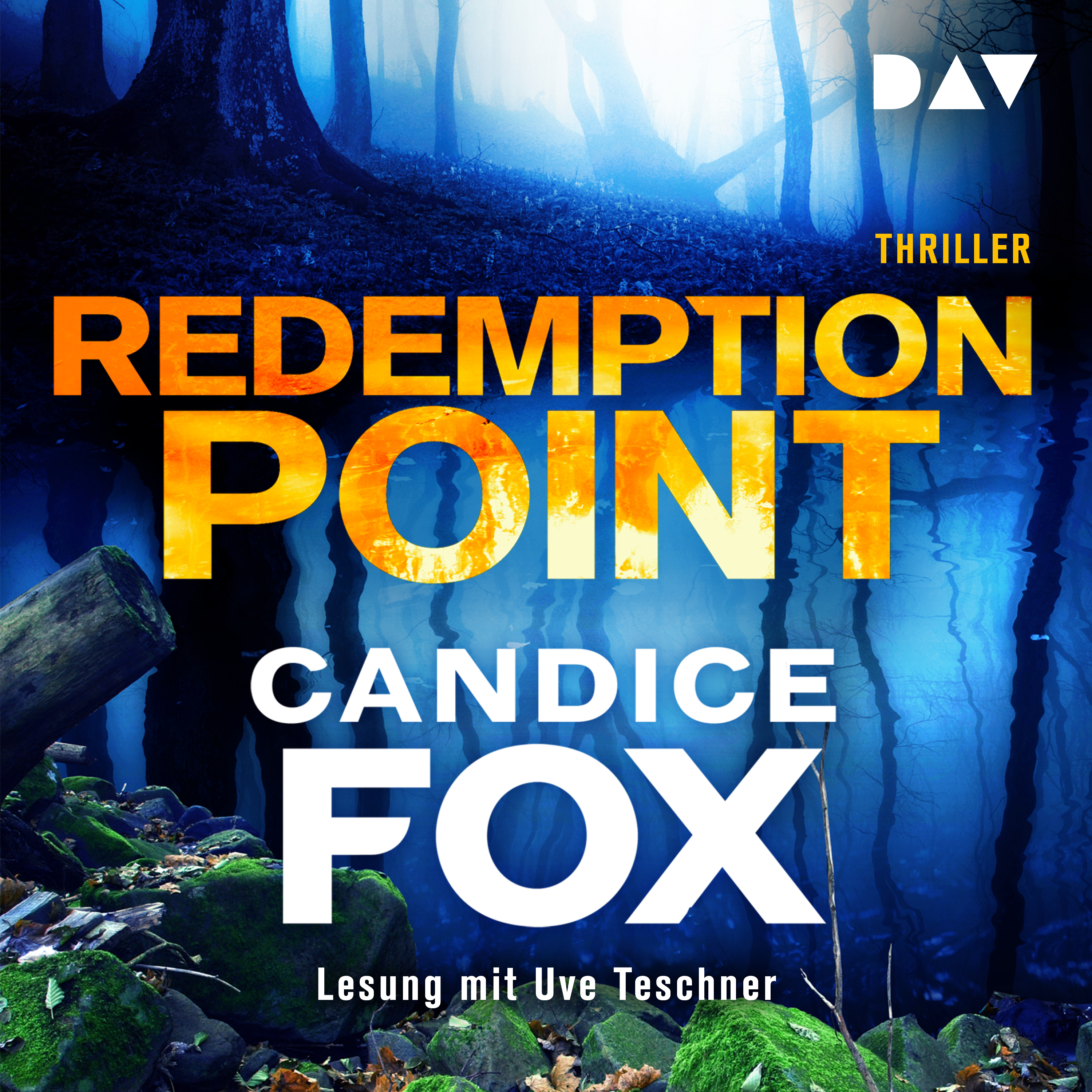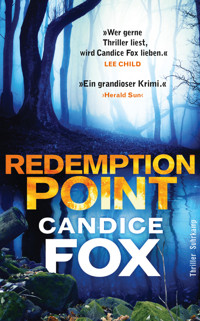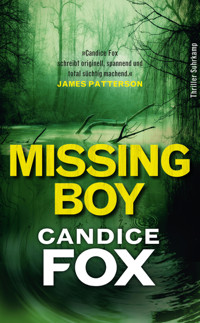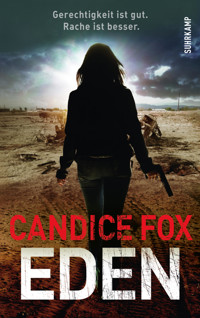9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hades-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Das fulminante Finale der phänomenalen Trilogie um Eden Archer und Frank Bennett: Eden, Top-Cop bei der Mordkommission von Sydney, ist nach ihrem Undercover-Einsatz schwer angeschlagen. Das hält sie aber nicht davon ab, mit dem weiterzumachen, was sie am besten kann: in nächtlichen Streifzügen Killer und Psychopathen aufzuspüren und für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Ihr Kollege Frank ahnt ihr dunkles Geheimnis, hält jedoch still – noch.
Als ein Killer in den Parks von Sydney eine Joggerin nach der anderen bestialisch ermordet, müssen die beiden Cops auf Gedeih und Verderben wieder zusammen arbeiten. Aber rasch eskaliert die Lage, weil Franks neue Freundin, die Psychologin Imogen Stone, in ihrer Freizeit für üppige Belohnungen alte Fälle wieder aufrollt und dabei auf die zwanzig Jahre alten Tanner-Morde stößt. In ihren Nachforschungen kommt sie Eden gefährlich nah, viel zu nah. Frank muss sich fragen, welche Maßnahmen Eden ergreifen wird, um sich zu schützen. Denn so gut kennt er Eden, dass er weiß: Diese Maßnahmen werden radikal sein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Der letzte Band der phänomenalen Trilogie um Eden Archer und Frank Bennett: Eden, Top-Cop bei der Mordkommission von Sydney, ist nach ihrem Undercover-Einsatz schwer angeschlagen. Das hält sie aber nicht davon ab, mit dem weiterzumachen, was sie am besten kann: in nächtlichen Streifzügen Killer und Psychopathen aufzuspüren und für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Ihr Kollege Frank ahnt ihr dunkles Geheimnis, hält jedoch still – noch.
Als ein Killer in den Parks von Sydney eine Joggerin nach der anderen bestialisch ermordet, müssen die beiden Cops auf Gedeih und Verderb wieder zusammen-arbeiten. Aber rasch eskaliert die Lage, weil Franks neue Freundin, die Psychologin Imogen Stone, in ihrer Freizeit für üppige Belohnungen alte Fälle wieder aufrollt und dabei auf die zwanzig Jahre alten Tanner-Morde stößt. In ihren Nachforschungen kommt sie Eden gefährlich nah, viel zu nah. Frank muss sich fragen, welche Maßnahmen Eden ergreifen wird, um sich zu schützen. Denn so gut kennt er Eden, dass er weiß: Diese Maßnahmen werden radikal sein …
Candice Fox in Hochform: rasant, böse, intelligent und vor allem höllisch spannend.
Candice Fox stammt aus einer eher exzentrischen Familie, die sie zu manchen ihrer literarischen Figuren inspirierte. Nach einer nicht so braven Jugend und einem kurzen Zwischenspiel bei der Royal Australian Navy widmet sie sich jetzt der Literatur, mit akademischen Weihen und sehr unakademischen Romanen. Für ihr Debüt Hades, den ersten Teil der Trilogie, wurde sie 2014 mit dem Ned Kelly Award 2014for Best First Fiction ausgezeichnet. Im Jahr darauf erhielt sie für den zweiten Teil, Eden, den Ned Kelly Award 2015 for Best Fiction. Das Finale der Trilogie, Fall, war auf der Shortlist für den Ned Kelly Award und den Davitt Award für den besten Krimi 2016.
CANDICE FOX
FALL
THRILLER
Aus dem australischen Englisch vonAnke Caroline Burger
Herausgegeben vonThomas Wörtche
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem TitelFallbei Bantam.
Published by Random
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4765.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Copyright © 2015 by Candice Fox
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie
der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München, unter Verwendung eines Fotos von Nicola Scarmagnani/iStock
eISBN 978-3-518-75125-1
www.suhrkamp.de
Für Danny, Adam und Jess
PROLOG
Vor dem Blut, vor den Schreien war es still auf dem Parkplatz des Black Mutt Inn. Nur die gedämpften Klänge der Jukebox drangen aus dem Pub nach draußen. In einer automatischen Endlosschleife dudelten die größten Partyhits, aber niemand grölte mit, stieß mit den Biergläsern an oder stampfte den Rhythmus auf der stinkenden Auslegware. Die Jukebox lief in der traurigen Leere des Wirtshauses immer weiter und klang draußen auf dem Parkplatz nur noch wie ein schauriges Stöhnen. Windig war es dort draußen, und die Sterne unsichtbar.
Üble Gestalten verkehrten im Black Mutt Inn, und das eigentlich, so lange man zurückdenken konnte. Als befände sich auf dem Grundstück ein Eingang zur Hölle, und die Stammgäste wurden von der vertrauten Hitze magisch angezogen. Ein Mal pro Nacht, mindestens, wurden auf der finsteren Veranda wegen einer Beleidigung oder eines Verrats Knochen gebrochen. Oder es wurde unter den mottenumflatterten Lampen zumindest geschworen, dass demnächst jemand das eine oder andere blaue Wunder erleben würde. Manchmal wurden auch Pläne geschmiedet – in den düsteren Ecken des schmucklosen Schankraums ließ sich gut flüstern, und den Wänden schienen die bösartigen Ideen wie Schlingpflanzen zu entwachsen, die sich um Köpfe und Hälse und Beine bis hinunter in die morschen Bodendielen rankten.
Die Barmänner im Black Mutt sahen nichts und sagten nichts, aber sie hörten eine Menge Geheimnisse und Forderungen. Ihre Ohren und Hände waren stets offen, ihre Lippen versiegelt. Sie schuldeten niemandem etwas und das verschaffte ihnen Respekt.
An diesem Abend betraten Sunny Burke und Clara McKinnie mit ihren Laptops, Tütchen mit Chili-Dörrfleisch und offenem Lächeln in den sonnengebräunten Gesichtern das Black Mutt Inn. Der Mann an der Theke sagte nichts, sah nichts. Er gab ihnen nur etwas zu trinken.
Auch wenn ihr zahnweißes Strahlen schnell vom trüben Licht geschluckt wurde, brachten sie dennoch ein wenig davon mit an die Theke, wo sie es sich vor dem Spiegel bequem machten. An der Wand hockten drei Männer und tuschelten miteinander, zwei andere standen an den Billardtischen und beäugten die beiden Rucksacktouristen, die direkt vom Surferparadies Byron Bay gekommen sein mussten. Die gute Laune und der Geruch nach billigem Gras waren unverkennbar. Clara bestellte sich einen Sekt mit O-Saft, den sie sich schnell hinter die Binde kippte, Sunny nippte an einem James Squire und streichelte ihr das Bein.
Einer der Männer vom Billardtisch trat in den schwachen Lichtkegel, und von diesem Augenblick an verdunkelte sich die Welt der Strahlekids Sunny und Clara.
»Tag, Mate«, sagte der Mann und hieb Sunny auf die Schulter. Der Mann war gebaut wie ein Schrank, und die beiden Hände an den sehnigen, überlangen Armen wirkten schrecklich groß. Sunny blickte auf, bewunderte den dichten Bartwuchs des Mannes neidisch und lächelte ihm zu.
»Hi.«
»Ihr kommt aus Byron, hm?«
»Wir waren eine Woche da«, strahlte Clara.
»Schön, schön.« Der Mann streifte Claras nackte Schulter mit der Fingerrückseite, ein kurzer, brüderlicher Gruß. »Hast ganz schön Sonne abgekriegt, Schatz.«
»Wir sind auf dem Weg zurück in die verrauchte große Stadt«, sagte Sunny.
»Na, wo ihr wart, wird es auch ordentlich verraucht gewesen sein, was?«, witzelte der Mann und versetzte Sunny einen ordentlichen Stoß in die Rippen. »Ich wette, ihr habt Gras dabei. Bitte sag mir, dass ihr was zu verticken habt.«
Sunny lachte. »Geht klar, Mate.« Er warf einen Blick hinüber zu dem anderen, der auf sein Queue gestützt am Tisch stand und im Schatten nicht zu erkennen war. »No problemo.«
»Ich schaff’s nicht oft genug rauf nach Byron. Mir tut der Arsch vom langen Fahren weh.«
Sunny nickte mitfühlend. Der Fremde streckte ihm die Pranke hin; Sunny fühlte die steinharten Schwielen, als er ihm die Hand schüttelte. »Alles klar. Wie viel brauchst du?«
»Darüber reden wir später. Ich bin übrigens Hamish. Spielst du eine Runde mit uns, Mate?«
»Super. Logisch. Das ist Clara. Ich heiße Sunny.«
»Mein Kumpel heißt Bradley, aber stört euch nicht an dem. Der quatscht nicht viel. Und Billard spielt er auch wie ’n Blinder mit Krückstock, was, Alter? Mensch, wach auf, du Trantüte.« Der Mann brüllte das in Richtung Billardtisch, aber sein Kumpel reagierte noch nicht einmal. »Tut mir leid, Miss, tut mir echt leid, aber unser alter Bradley, der pennt mir immer im Stehen weg, und keine Ohrfeige bringt ihn wieder zurück, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Schon klar.« Sie lachte.
»Stück Dörrfleisch gefällig?«, fragte Sunny.
»Nee danke, Mate, nee, nee. Brauch ich nicht. Gebiss ist nicht mehr das Beste, der Rücken auch nicht. Man wird nicht jünger.«
Die Männer sortierten die Kugeln ins Rack, Clara und der Schweigsame sahen zu. Hin und wieder warfen sie einander einen Blick zu. Der haarige Mann im Dunkeln schien schwer an seinen gerunzelten Brauen zu tragen, die junge Frau hatte sich auf das Queue gestützt und wiegte sich leicht verlegen in den Hüften. Sie trank ihren zweiten Sekt-O aus und hatte Lust auf mehr, aber die Männer redeten und lachten und freundeten sich an, dabei hatte Sunny immer Probleme, Leute kennenzulernen. Also unterbrach sie nicht.
»Wie wär’s mit einer kleinen Wette, Leute, nur um die Sache ein bisschen spannender zu machen?«, fragte Hamish.
»Na klar, warum nicht?« Sunny streckte die Brust raus und kümmerte sich nicht um Claras warnenden Blick. »Um was? Ich meine, was nehmt ihr da normalerweise so …?«
»Fünf Dollar?«
»Fünf Dollar?« Sunny lachte, hustete. »Klar, Mate, klingt doch klasse.«
Sie spielten. Clara war am extrovertiertesten, heulte laut auf, wenn sie die Weiße versenkte, johlte, wenn Sunny einen Punkt machte. Jede Menge Küsschen, Küsschen und Rücken streicheln. Die Männer in den Sitzecken beobachteten das Paar. Das fröhliche Grüppchen am Billardtisch war vom Rest der Welt durch den Lichtkegel, der auf sie fiel, abgeschnitten.
»Sehr ordentlich, junger Mann«, sagte Hamish und streckte ihm wieder die harte Hand hin. »Noch mal.«
»Diesmal um zwanzig, wie wär’s?«, fragte Sunny. »Kannst auch in Naturalien zahlen. Die Karre muss mal gewaschen werden.«
»Sunny!« Clara war entsetzt.
»Jetzt hört euch den Kerl mal an, Leute!« Hamish lachte. Er drückte die Schulter der jungen Frau, die knallrot anlief. »Riesenklappe, der kleine Scheißer. Kannst wirklich von Glück sagen, dass du so hübsch bist, Sunny, alter Kumpel, was. So eine Luxusfresse will keiner polieren, auch wenn du noch so viel Müll daherredest.«
Sie lachten und starteten das nächste Spiel. Hamish meckerte die ganze Zeit an Bradley herum. Die Kugeln knallten gegeneinander, krachten gegen die Bande, rollten in die Taschen. Clara war richtig gut, und das nicht erst seit gestern. Ihr Daddy hatte ihr schon früh das Billardspielen beigebracht, sich mit ihr über den grünen Filz gebeugt, sie mit seinen Hüften gegen den Tisch gedrückt. Aber sie wusste auch, wann ein guter Stoß zu opfern war, damit sie sich nicht zu weit übers Grün lehnen musste und Bradley ihr nicht in den Ausschnitt oder auf den Arsch schauen konnte.
Komisch sah der Mann sie an. Ihr wurde ganz seltsam davon.
»Noch eins?«, fragte Sunny. Außer dem Barmann, der reglos im Schatten stand, war die Kneipe mittlerweile leer. Sunny gewann, dann gewann er wieder.
»Eins machen wir noch, Kleiner, und dann gehst du schön ins Bett. Wie wär’s, wenn wir die Sache ’n bisschen spannender machen? Du gibst mir die Chance, alles zurückzugewinnen, was du mir gerade abgeknöpft hast. Dann sind wir quitt. Wenn ich verliere, kriegst du die Asche bar auf die Kralle, und ich muss die Kröte schlucken.«
»Wenn du dieses Spiel gewinnst, Mate«, lallte Sunny, »dann geb ich dir das Doppelte von dem, was du mir schuldest.«
»Sunny!«
»Oho! Jetzt hört euch das Großmaul an!«
»Sunny, hör auf.«
Der junge Mann zog Clara an sich. »Die haben den ganzen Abend nicht ein Spiel gewonnen. Reg dich nicht auf, Cla. Ich mach mir nur ein Späßchen.«
»Sunny …«
»Halt dich da raus, okay?«, blaffte Sunny sie an und warf ihr einen bösen Blick zu. »Ist doch nur Spaß, verdammt noch mal!«
Clara hielt den Mund, weil sie wusste, wie Männer sein konnten, und immer fing es mit diesem Blick an. Sie sah zu, wie die Männer sich die Hand drauf gaben und die Kugeln ins Rack ordneten. Das Spiel begann, und Clara musste sich sehr beherrschen, nicht laut loszuschreien, als Hamish sich vorbeugte, zielte und eine Kugel nach der anderen einlochte.
In weniger als zwei Minuten hatte Hamish all seine Kugeln abgeräumt. Und dann versenkte er die Schwarze mit einem einzigen Stoß. Sunny kam nicht mal an die Reihe.
»Mate«, sagte Hamish, als er sich aufrichtete und auf das Queue stützte. Gegrinse, Charme, Witzchen, all das war jetzt vergessen, und er musterte Clara mit trägem Blick von Kopf bis Fuß. »Ich glaube, du schuldest mir ’ne ziemliche Stange Geld.«
Bradley ging als Letzter hinter ihnen zum Parkplatz und warf hin und wieder einen Blick über die Schulter zum Black Mutt Inn, auch wenn das überflüssig war. Hier, wo eine verborgene Öffnung direkt bis hinunter in die Hölle reichte und die Brise über dem Asphalt erwärmte, die in Claras dicke, dunkle Locken fuhr. Hamishs Hand in ihrem Nacken fühlte sich an wie eine Schraubzwinge. Sie gingen auf das Wohnmobil zu, das als einziges noch auf dem Parkplatz stand. Das junge Paar hatte es in der Mitte der riesigen, leeren Asphaltfläche geparkt, damit es sich bei der Rückkehr nicht vor der schwarz aufragenden Wand dunkler Bäume zu fürchten brauchte. Clara streckte die Hände aus, damit Hamish sie nicht ungebremst gegen den Camper stieß, und drehte sich um. Bradley hielt plötzlich ein Stahlrohr in der Hand, das er im Ärmel versteckt hatte.
»Und, was habt ihr in der Karre?«, fragte Hamish.
»Wir haben den CD-Player, etwas Bargeld, Clara hat ein bisschen Schmuck«, stotterte Sunny, während er versuchte, den Schlüssel ins Schloss zu bekommen. »Und natürlich das Gras. Ihr könnt es haben! Bitte. Bitte tut uns nicht weh!«
»Dein Geseier kannst du dir sparen, du arrogantes Stück Scheiße«, sagte Hamish. »Du holst jetzt alles raus, was du da drin hast, und dann sehen wir, ob das reicht. Und wenn es nicht reicht, dann überleg ich mir, ob ich wem wehtue.«
»Schick sie zum Geldautomat«, knurrte Bradley. Clara fuhr erschrocken herum, als sie zum ersten Mal die Stimme des schweigenden Mannes hörte. Er starrte sie an; seine Augen waren helle Nadelköpfe in der Dunkelheit.
»Sunny«, krächzte Clara mit ausgedörrter Kehle. »Sunny. Sunny!«
»Schnauze und ein bisschen zackig!«, knurrte Hamish.
»Ich beeil mich ja. Bitte! Bitte!«, flehte Sunny ihn an. Clara hörte, wie sein Flehen im Auto weiterging, während er Kartons und Schubläden durchwühlte. Sobald ihr Freund im Wageninneren verschwunden war, spürte sie die steinharte Hand des Mannes unter ihrem Rock. Hamish grinste sie mit seinen großen, abgesplitterten Zähnen an und drückte sie gegen den Wagen.
»Na, Baby, schon ganz heiß von so viel Aufregung?«
»Sunny! Hilfe! Hilf mir doch!«
»Ich hoffe, unser Freundchen hat was Hübsches für mich, und zwar dalli, sonst musst du leider die Zeche zahlen, meine Süße.«
»Wie sieht es damit aus?«, sagte Sunny, als er mit vollen Händen aus dem Transporter wieder auftauchte und Hamish die Sachen schwungvoll an den Bauch drückte. »Reicht dir das?«
Hamish versteifte sich und schaute mit aufgerissenen Augen auf die Sachen in Sunnys Händen. Alles fiel klappernd zu Boden und gab den Blick frei auf den Ledergriff des langen Jagdmessers, das tief in Hamishs Bauch steckte. Wie üblich ließ Sunny dem Mann keine Zeit, den Überraschungsangriff zu verstehen. Er zog ihm das Messer aus dem Bauch und stieß sofort wieder zu, nach oben in Hamishs weiches Zwerchfell, und spürte, wie sich die Muskeln im Schock zusammenkrampften. Als ihr Freund zum dritten Stich ausholte, zog Clara ebenfalls ein Messer heraus, das sie flach am Körper zwischen den Brüsten trug, und stürzte sich auf Bradley. Der haarige Mann rannte davon, aber Clara wusste, wie man zielt. Sie blieb mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, holte aus, atmete durch und warf. Das Messer grub sich direkt zwischen die Schulterblätter, und der Mann ging zu Boden und rollte über den Asphalt wie ein angefahrenes Tier.
Sie ging zu dem Stummen, zog das Messer heraus und wischte es am Saum ihres weißen Minirocks ab. Bradley lebte noch, und das freute sie, weil sie sich nun Zeit mit ihm lassen konnte. Clara spielte gern; Sunny stand weniger darauf, aber vielleicht würde er ja bei ein paar Spielchen mitmachen, wo sie doch gerade im Urlaub waren. Sie drehte sich um und sah ihn an, während Bradley Blut auf den Asphalt unter seinem Gesicht spuckte.
»Süßer«, flötete sie ihrem Partner zu. »Wär das okay, wenn wir den hier mitnehmen und –«
Ein Pfeifen, dann machte es Klatsch.
Erst meinte Clara noch, Sunny sei hingefallen, bis sie die Blutspritzer im Gesicht spürte. Seine Blutspritzer. Sie versuchte, das Geräusch einzuordnen, das Pfeifen und das Klatschen, aber nichts ergab einen Sinn. Zitternd kroch sie zu ihrem Freund und versuchte, mit den Händen die gespaltenen Hälften seines Schädels zusammenzudrücken, griff panisch nach den Hirn- und Fleischbrocken, die um ihn herum auf dem Asphalt verteilt lagen. Sunny konnte man nicht wieder ganzmachen. Sie kniete im Blut, in seinem und Hamishs, und versuchte zu verstehen. Wimmerlaute drangen aus ihr wie unterdrückter Husten. Hamish lehnte aufrecht am Wohnmobil und drückte die Hände auf die Stichwunden.
Ein Pfeifen, dann machte es Klatsch, und der obere Teil seines Kopfs war weg. Er fiel zu Boden.
Clara blickte hinter sich zu den garantiert hundert Meter entfernten Bäumen, dann zum Waldrand vor sich, genauso weit weg und genauso tintenschwarz. Die Stille dröhnte ihr in den Ohren. Unter dem fürchterlichen Gewicht dieser Stille kroch sie davon, versuchte sich aufzurappeln, in den Pub zu flüchten. Ein weiteres Pfeifen, ein weiteres Klatschen, und ihr Fuß war weg. Clara fiel aufs Gesicht und umklammerte ihren Beinstumpf. Sie heulte nicht auf und schrie auch nicht, weil das Grauen sie völlig erfüllte, und reines Grauen macht kein Geräusch.
Schwer atmend lag Clara da, nach einer Weile fing sie wieder an zu kriechen. Sie hörte das ungleiche Geräusch von Schritten, dazwischen immer wieder ein metallisches Klappern. Als sie aufblickte, sah sie eine Gestalt langsam auf sich zukommen, die vor dem finsteren Wald kaum zu erkennen war. Leises Wimmern kam immer noch aus Clara, der schaudernde Atem aus ihrem Mund, aber dazwischen ertönte immer wieder das metallische Klappern. Eine Frau schob sich in den Lichtstrahl, der aus dem Camper fiel. Wie auf eine Krücke stützte sie sich auf ein riesiges Gewehr.
Schweigend trat die Frau zwischen die Männerleichen, und Clara in der Blutlache sah zu ihr hoch. Langsam setzte der Schock ein, aber sie dachte noch, wie schwarz das Haar der Frau war, wie das Blau der Nacht darin schimmerte, blauschwarz, wie eine Rabenfeder. Die Frau mit der Flinte bückte sich und ließ sich mithilfe der monströsen Schusswaffe in die Hocke hinab. Clara fragte sich, welche Wunden der anderen Mörderin solche Schwierigkeiten bereiteten, als sie sich hinunter auf Augenhöhe mit dem sterbenden Mädchen begab.
Eden blickte in die Ferne, zum Wald, zum Pub, schließlich hinab auf die Frau am Boden.
»Gerade, wenn du glaubst, du wärst der tödlichste Fisch im Becken«, sagte Eden zu dem Mädchen.
Clara keuchte. Sie fingerte an dem nassen Stumpf herum, der einmal ihr Fuß gewesen war. Eden seufzte.
»Ich muss euch ja bewundern«, sagte Eden. »Gutes Spiel. Raffiniert. Zwei naive kleine Backpacker, die nur darauf warten, dass sie schikaniert werden. Ihr plantscht durch die Gegend, als würdet ihr jeden Augenblick vor lauter Blödheit ersaufen, und dann wartet ihr ab, wer den zappelnden Köder schluckt. Euch kann keiner widerstehen, was? Ihr seid viel zu niedlich. Ihr lockt sie raus ins offene Meer, und dann kommt ihr aus der Tiefe aufgetaucht. Schlagt die Zähne rein und zieht sie runter.«
Clara fiel mit weit aufgerissenem Mund und vor Schock blockierter Luftröhre aufs Pflaster und schnappte nach Luft.
»Wenn’s mir besser ginge, dann wär’s persönlicher ausgefallen«, sagte Eden und schloss die Hand mit dem Lederhandschuh fest um das Gewehr. »Ich bin momentan nicht ganz fit und hab insofern leider gerade keine Muße für nette Spielchen.«
Clara versuchte, etwas zu sagen, brachte aber außer dem Wimmern nichts heraus. Wie Schluckauf klang es. Die Frau mit dem langen, dunklen Haar richtete sich langsam wieder auf, stützte sich schwer auf das Gewehr, und als sie wieder in der Senkrechten war, entsicherte sie die Riesenflinte mühsam und schob die Patrone mit geschwächten Händen in die Kammer.
»In diesem Becken bin ich der einzige Haifisch«, knurrte Eden.
Der letzte Schuss hallte bis hinüber zum Black Mutt Inn. Aber niemand hörte ihn.
Die Selbsthilfegruppe für Verbrechensopfer in Surry Hills trifft sich alle vierzehn Tage. Ich habe mich nur dazu überreden lassen, weil mein alter Kumpel Anthony Charters von North Sydney Homicide auch hingeht. Ohne Begleitung hätte ich nie auf meine Freundin Imogen gehört, die fand, ich brauchte Hilfe nach »dem, was in den letzten Monaten mit mir passiert ist«. Das vage Konzept von dem, was da »mit mir passiert« sein soll, stellte sich in den ersten Wochen unserer Beziehung immer wieder zwischen die schöne Psychologin und mich, als ihr klar wurde, dass sie mich noch nie völlig nüchtern erlebt hatte. Sie meinte, sie kenne mich gar nicht »entspannt«. Ganz unter uns gesagt, finde ich natürlich, dass ich wesentlich entspannter bin als Imogen. Sie braucht morgens anderthalb Stunden, um sich fertig zu machen, und als ich das erste Mal in ihrer Nähe gefurzt habe, hätte sie beinahe die Polizei gerufen. Das, meine Damen und Herren, ist nicht gerade das, was ich entspannt nennen würde.
Aber so sind Beziehungen nun einmal. So was sagt man ihnen nicht. Und sie hören nicht hin.
Meine Affäre mit Dr. Imogen Stone begann in der gefährlich angespannten Zeit zwischen dem Tod meiner Freundin, die einem bestialischen Serienmörder zum Opfer gefallen war, und der versuchten Ausweidung meiner Teampartnerin durch ein Paar Outback-Monster. Imogen mochte mich wirklich, aber sie musste mit den psychologischen Nachwehen dieser traumatischen Ereignisse zurechtkommen. Ich war ein unberechenbarer, schwer zu handhabender Liebhaber. Sie konnte sich nicht darauf verlassen, dass ich pünktlich auftauchen, was Nettes zu ihren Bekannten sagen oder sie irgendwohin fahren würde, ohne dass sie Angst haben musste, dass ich uns um den nächsten Telegrafenmast wickele. Wenn ich mich im Kino kurz entschuldigte, konnte sie nicht sicher sein, ob ich in der himmlischen Stille der Herrentoilette nicht vielleicht eine Handvoll Schmerztabletten einwarf oder einfach gedankenverloren verschwand, um dann um Mitternacht stinkbesoffen wieder bei ihr aufzukreuzen. Ich war ein Alptraum von einem Freund, aber sie sah Potenzial in mir. Warum, war mir unklar. Ich war genau der kaputte Typ Mann, von dem frau am besten die Finger ließ. So verkündeten es zumindest die Psychologiehandbücher in ihrer Praxis, in denen ich manchmal blätterte: Die gut aussehenden, angeknacksten Herzensbrecher mausern sich anscheinend besonders häufig zu Missbrauchstätern.
Wie dem auch sein mochte. Imogen ließ sich von meinem schlechten Benehmen nicht abschrecken, lag mir allerdings ständig in den Ohren, dass ich Hilfe brauche. Und so trabte ich voll pubertären Aufbegehrens gegen die Ungerechtigkeit der Welt jeden zweiten Sonntag in den Kellerraum der Polizeiwache Surry Hills, saß unter Leuchtstoffröhren und lauschte verpfuschten Lebensgeschichten. Imogen machte es glücklich, Anthony machte es glücklich, und ich betrachtete es als meinen Dienst am Glück der Welt.
Irgendjemand hat mal festgelegt, dass Selbsthilfegruppen auf eine bestimmte Art und Weise abzulaufen haben, und nach dem Muster laufen jetzt alle Selbsthilfegruppen Australiens oder der Welt ab – ob man nun über seine Crackabhängigkeit oder den sexuellen Übergriff auf einer öffentlichen Toilette hinwegkommen will. An der Wand haben graue Kunststoffklapptische zu stehen, an deren Kanten sich die oberste Schicht mit den vielen weißen Ringen ablöst, von den Kaffeebechern, die dort im Lauf des Gesprächs einfühlsam abgestellt werden. Darauf sind zwei Heißwasserspender aus Edelstahl zu platzieren, an denen man sich unweigerlich verbrennt, wenn man in ihre Nähe kommt. Selbst wenn man sich nur in die Teilnehmerliste einträgt, bespucken sie einen mit kochendem Wasser. Weiterhin ist eine Kollektion unbequemer Klappstühle aus Plastik notwendig, die in einem möglichst engen Kreis stehen, um so grauenhafte Dinge wie das versehentliche Berühren eines Nachbarknies, das Einatmen bazillengeschwängerter Luft und unfreiwilligen Blickkontakt zu ermöglichen. Und schon hat man seine Selbsthilfegruppe.
Auf dem grauen Industrieteppichboden standen fünfzehn Stühle im Kreis, auf einem davon saß bereits Anthony. Sein Anblick löste bei mir einen Anfall lähmender Übelkeit aus. Wenn man versucht, von einer Schmerzmittel- und Alkoholabhängigkeit wegzukommen, wird einem von allem möglichen übel. Sogar beim Sex. Das kann Monate dauern.
Zwei Wochen lang hatte ich mit dem kahlköpfigen Detective Anthony Charters, Markenzeichen Kinnspalte, und seinem Partner zusammengearbeitet, da beging meine bisherige Teampartnerin Selbstmord. Die Chefs versuchten, mir eine neue Spielgefährtin zu finden. Ich wäre liebend gern mit Charters zusammengeblieben. Er inspirierte mich, und das ist jetzt nicht kitschig, internetspruchmäßig gemeint, sondern ganz ehrlich: Er hatte eine Art, die einen morgens zum Aufstehen motiviert. Er glaubte trotz allem immer noch an Gerechtigkeit und Justiz und war so begeistert von der Verbrecherjagd, als wäre es der Sinn seines Lebens, obwohl sein siebzehnjähriger Sohn selbst im Knast saß. Der hatte seinem Kumpel an Silvester eins übergebraten und ihm damit unbeabsichtigt einen Hirnschaden zugefügt. Wenn Anthony es nach so einem Schicksalsschlag aus dem Bett schaffte, dann konnte ich das auch. Auch nachdem Martina ermordet worden war (ich hatte es zugelassen) und Eden um ein Haar geschlachtet worden wäre (ich hatte tatenlos danebengestanden). Wenn Anthony nach all dem nicht aufgab, dann könnte ich vielleicht auch über die Frauen hinwegkommen, die ich im Stich gelassen hatte. Irgendwann zumindest. Vielleicht könnte ich darüber hinwegkommen, dass ich nichts gegen die seelische Gewalt unternommen hatte, die mein Vater meiner Mutter jahrelang zugefügt hatte. Dass ich Martina nicht gerettet hatte. Dass ich Eden nicht gerettet hatte. Dass ich nicht da gewesen war, als meine Exfrau ein totes Kind zur Welt brachte.
Anthony war genauso machtlos gewesen und hatte nichts für seinen Sohn tun können. Und dennoch strahlte er mich jetzt an, als ich mich neben ihn setzte. Vielleicht war Machtlosigkeit gar nicht so schlimm.
Als ich Anthony einmal gefragt hatte, woher er seinen unbeirrbaren Optimismus nahm, hatte er geantwortet: Selbsthilfegruppen. Er ging zu einer für Drogenabhängige, einer für Verbrechensopfer und einer für Angsterkrankungen. Ich dachte mir, was soll’s? Wenigstens würde Imogen mich dann in Ruhe lassen.
»Francis«, sagte er. Ich hielt meine Kaffeetasse in der einen Hand und leckte mir den verbrannten kleinen Finger der anderen.
»Hey, Anthony.«
»Wie läuft der Entzug?«
»Der Tatterich ist vorbei, guck.« Ich hielt die Hand waagerecht vor ihm in die Luft. Nur mein Daumen zuckte leicht. »Aber für einen Scotch würde ich dich trotzdem abmurksen.«
»Scotch steht wahrscheinlich auf deiner Liste von Triggern.«
»Wahrscheinlich. Die Liste ist lang.«
In manchen Genesungsgruppen darf man bestimmte Wörter nicht benutzen, weil sie etwas auslösen können, »triggern« heißt das. Manche Teilnehmer sind so hochgradig süchtig, dass sie selbst vom Klang des Namens ihrer Droge einen Rückfall erleiden können. Selbst wenn man nicht süchtig ist und in einer Gruppe für Opfer von Straftaten oder häuslicher Gewalt oder Insektenattacken ist, muss man anerkennen, dass andere Gruppenmitglieder möglicherweise auch in einer Suchtgruppe sind, und deswegen darf man ihnen zuliebe diese Wörter nicht aussprechen.
Die erste Regel der Drogenselbsthilfegruppe lautet: In der Selbsthilfegruppe wird nicht über Drogen gesprochen.
Mir kam das wie ein Haufen Bullshit vor. Wem sollte es helfen, auf Zehenspitzen um alles Böse herumzuschleichen? Ich hatte einen Selbstversuch mit Triggern gemacht und allein im Auto laut »Panadol« gesagt. Ich kam mir vor wie ein Grundschüler, der hinten im Klassenzimmer ein schlimmes Wort wispert. Ich war nicht zur nächsten Apotheke gerannt und hatte Pillen eingeworfen. Aber ich hielt mich immer gern an die Regeln und deswegen sagte ich also nicht »Panadol«, wenn ich an einem der Treffen teilnahm. Ich sagte auch nicht »Scotch« oder »Bourbon« oder »Koks« oder »Ecstasy« oder »Valium« oder »Oxy« – alles heimliche Laster, denen ich in den vergangenen Monaten und Jahren gefrönt hatte. Beim ersten Mal erwähnte ich, dass ich in der Vergangenheit Erfahrung mit »Rauschgift und Arzneimitteln« gesammelt hatte, seitdem hielt ich den Mund.
Ansonsten hatte ich noch gar nichts gesagt. Imogen hatte mir nur aufgetragen, ich müsse an der Gruppe »teilnehmen«. Von »mitmachen« war nicht die Rede gewesen.
Als die Gruppenleiterin, eine kleine, kantige Blondine namens Megan, mit einer dicken Mappe voller Handzettel und Broschüren hereinkam, bewegten die Teilnehmer sich endlich von den gemeingefährlichen Heißwasserbereitern weg. Sicher fünfundzwanzig der fotokopierten Handzettel flogen bei mir im Auto herum und wurden zusammen mit den Fastfood-Verpackungen und Papiertüten festgetreten. Manchmal lachte mich eine Überschrift unter dem Bodensatz aus Altpapier an: Sechs Methoden zur Bekämpfung negativer Gedanken. Wie sage ich meinen Freunden, dass ich mir etwas antun will? »Nein« heißt »Nein«. Kurz nach dem ersten Treffen verlor ich schon mein Acht-Schritte-Trauertagebuch. Ich hatte nicht mal meinen Namen draufgeschrieben. Tagebücher sind was für kleine Mädchen.
Als Megan in der Runde Platz genommen hatte, wurde der Begrüßungsspruch aufgesagt, was ähnlich monoton und lustlos geschah wie damals das »Guten Morgen, Misses Towers« in der dritten Klasse.
»Ich bin auf dem Weg zu einem Ort, der erhaben ist über Rache, erhaben über Zorn, erhaben über die Angst. Ich bin auf dem Weg zu einem Ort der Heilung und mache jeden Tag einen neuen Schritt.«
Ich sprach den Begrüßungsspruch nicht mit. Mir war das viel zu albern. Was Megan zugestoßen war, wusste ich nicht, aber ich hatte den düsteren Verdacht, dass sie eventuell nur ein Riesenbohei um eine geklaute Handtasche machte. Über Zorn ist man nie erhaben. Zornig ist jeder. Nonnen sind zornig auf Sünder. Kindergärtnerinnen sind zornig auf die Regierung. Wenn man Gewalt erlebt hat, echte Gewalt – wenn der Gatte einen zum ersten Mal schlägt oder man im sonnigen Berufsverkehr an einem stinknormalen Donnerstagmorgen mit dem Messer bedroht wird – dann weiß man, dass es keinen Ort gibt, der über Zorn erhaben ist. Der Zorn steckt in dir. In uns allen. Scheißegal, wie sehr man ihn unterdrückt, aushungert, vergräbt oder verleugnet. Zorn ist ein Urinstinkt. Er ist Teil unserer DNA.
»Wir haben heute Abend zwei neue Mitglieder unter uns«, sagte Megan, während Justin, der Arschkriecher der Gruppe, ihr einen Pappbecher mit grünem Tee brachte. Justin war einmal mit einundzwanzig beim Karneval von Schwulenhassern um ein Haar totgeschlagen worden. Verbrechensopfergruppen waren sein Leben. »Das sind Aamir und Reema.«
Das muslimische Paar mit dem Rücken zur Tür nickte. Reema schaute tief in ihren leeren Pappbecher, als gäbe es dort drin einen Ausweg aus dem Gruppenraum. Ich war neidisch. Nervös zupfte sie die Schulterpolster ihres Kleides zurecht. Aamir, ein sehr großer Mann, rutschte mit den Händen zwischen den Knien nach vorne auf die Stuhlkante.
»Hallo, Aamir«, sagten alle. »Hallo, Reema.«
»Ihr braucht nichts zu erzählen«, versicherte Megan ihnen. »In dieser Gruppe braucht niemand etwas zu erzählen, der das nicht will. Es kann auch sehr heilsam sein, wenn man sich nur die Geschichten der anderen anhört und versteht, dass man nicht allein ist mit dem Trauma, das man nach einem Verbrechen durchlebt. Und auch der Weg hin zur Heilung ist uns allen gemeinsam. Manchmal beginnen wir unser Beisammensein mit den ›Triumphen der Woche‹ oder mit einem Text. Aber wir sind hier nicht so schrecklich festgelegt.«
»Wir können gern was sagen«, meinte Aamir. Man konnte seinen angespannten Schultern und aufeinandergebissenen Zähnen den unterdrückten Zorn richtiggehend ansehen. Anthony sah ihn auch. Als junger Cop lernt man schnell, wie ein Mann aussieht, der jemandem eine reinhauen will, wenn man zwischen den Horden von Obdachlosen am Cross, in Blacktown oder Parramatta unterwegs ist. Gestalten, die vor den Clubs an der George Street abhängen, während Autos voll junger Kerle vorbeifahren, die den Frauen hinterherbrüllen. Man erkennt sie sofort.
»Gut. Schön.« Megan lächelte. »Ausgezeichnet. Wie ich schon sagte, wir üben keinen Druck aus. Es gibt Teilnehmer hier, die noch nie was gesagt haben.« Sie warf mir einen schnellen Blick zu. Mir war schlecht. »Das hier ist ein solidarisches Umfeld mit teilnehmerzentrierten Mechanismen und –«
»Ich kann gern was sagen.« Aamir sprang auf. Im Stehen war er noch größer. Niemand wies den Riesen darauf hin, dass Stehen nicht Teil der Gruppendynamik war, dass es ganz im Gegenteil die Vergewaltigungsopfer einschüchterte. Er wischte sich die Hände vorn an seinem Polohemd ab, was dunkle Schweißspuren hinterließ. »So. Dann fange ich mit einer Frage an. Gibt es jemanden hier in der Gruppe, der mich kennt? Kennt jemand meine Frau?«
Ich kapierte gar nichts mehr. Es war phantastisch. Bisher hatten sämtliche Sitzungen nichts als Übelkeit und Langeweile in mir ausgelöst. Endlich mal was Neues. Die Teilnehmer sahen einander an. Sahen Aamir an. Aamir hob fragend die Achseln.
»Nein? Nein? Ihr kennt mich nicht? Ihr habt mich noch nie gesehen?« Aamirs schwarze Augenbrauen standen hoch auf seiner schwitzenden Stirn. Er drehte sich ein wenig im Kreis, als würden die anderen ihn leichter erkennen, wenn sie das schwarze Kraushaar in seinem Stiernacken sahen. Seine Frau wischte sich mit der Hand über das Gesicht. Keiner sagte etwas. Anthony musterte Aamirs Gesicht.
»Ich glaube, die anderen verstehen nicht –«, versuchte Megan zu vermitteln.
»Unser Sohn Ehan wurde vor einhunderteinundvierzig Tagen entführt«, fuhr Aamir fort. Er setzte sich wieder hin. »Vor einhunderteinundvierzig Tagen entführten zwei Männer in einem blauen Auto meinen achtjährigen Sohn an der Bushaltestelle an der Prairie Vale Road in Wetherill Park. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen.«
Er machte eine Pause. Alle warteten.
»Ihr kennt weder mich noch meine Frau, weil die Medien nichts über die Entführung bringen. Es gab eine einzige Pressekonferenz im überregionalen Fernsehen und einen größeren Zeitungsartikel. Mehr nicht. Das war’s.«
Aamir war ein Löwe in Menschengestalt. Die Frau ihm gegenüber, die einen Bankraub miterlebt hatte und seitdem unter Panikattacken litt, versuchte, sich in ihrem Sitz zu verkriechen und zog verzweifelt an ihrem Pferdeschwanz. Megan öffnete den Mund, um ihr Beileid auszusprechen und irgendeine Überleitung zurück in die Normalität des Gruppengesprächs hinzubekommen, aber Aamir tobte weiter. Die einstudierten Sätze, mit denen er seit dem Verschwinden seines Sohns jeden überfiel, der ihm in die Quere kam, brachen regelrecht aus ihm hervor.
»Wenn Ehan ein kleiner blonder, weißer Junge namens Ian aus Potts Point wäre, dann wären wir immer noch in den Schlagzeilen.«
»Äh, hm.« Megan sah mich hilfesuchend an.
»Wir hätten zweihunderttausend Dollar Belohnung auf den Täter ausgesetzt und Dick Smith würde ein Banner an einem Zeppelin fliegen lassen, verdammt noch mal! Aber wir haben gar nichts. Zwei Tage lang hat das Telefon geklingelt, seitdem Schweigen im Walde. Manchmal vergesse ich sogar, dass er nicht mehr da ist. Jeden Abend um acht Uhr denke ich: Ehan muss ins Bett. Ich muss ihm Gute Nacht sagen. Jeden Abend, egal, wo ich bin.«
Megan sah mich vielsagend an.
»Warum schaust du mich so an?«, fragte ich. Mir war übel.
»Hab ich doch gar nicht.« Megan wandte das Gesicht wieder Aamir zu. »Das war nicht so gemeint. Verzeihung, Frank, ich habe nur nachgedacht, und du hast gerade zufällig in meinem Blickfeld gesessen und …«
»Arbeitest du bei der Zeitung?« Aamir wandte sich mir zu. Ich verstand nicht, warum ich auf einmal in das Gespräch hineingezogen wurde, aber Megan hob den Blick partout nicht von ihrem Notizbuch. Genau so hatte sie es auch gemacht, als ich der Gruppe beigetreten war.
»Nein«, antwortete ich. Ich blickte Aamir in die Augen. »Nein, ich arbeite nicht bei der Zeitung. Meine Freundin wurde ermordet. Ich bin der einzige andere hier, der wegen einem Mord Unterstützung sucht. Deswegen hat sie mich so angestarrt. Ich soll dir etwas Aufbauendes erzählen.«
»Unser Sohn ist nicht ermordet worden«, sagte Reema.
»Na, Megan scheint das anders zu sehen.«
Megan war entrüstet. »Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt!«
»Deine Freundin wurde ermordet.« Aamir sank auf seinem Stuhl in sich zusammen. Er saß so weit vorn auf der Kante, dass der Stuhl eigentlich schon längst hätte umkippen müssen. Seine Knie waren wenige Zentimeter von meinen entfernt. Seine aufgerissenen schwarzen Augen hatten sich an meinen festgesaugt. Er wusste, dass sein Sohn tot war. Und er war voller Zorn. Voll weiß loderndem Zorn auf jeden, den er vor sich hatte.
»Ja. Sie wurde ermordet«, sagte ich.
»Und wie hieß sie?«
»Martina.«
»Und was ist passiert, nachdem sie ermordet worden war?«, fragte Aamir.
»Wie meinst du das?«
»Was ist passiert?«, insistierte er. »Was war dann?«
»Nichts.« Ich zuckte die Achseln. Alle sahen mich an. Ich befeuchtete die Lippen. Zuckte wieder die Achseln. »Nichts. Sie wurde ermordet. Sie lebt nicht mehr. Danach … kommt nichts, falls ihr das meint.«
Aamir musterte mich, als wäre außer uns niemand im Raum.
»Nichts ist hinterher passiert«, fuhr ich fort. »Es gibt keine … Lösung. Man geht zur Arbeit. Man kommt nach Hause. Man kommt zu den Gruppentreffen und man …« Ich zeigte auf die Kaffeemaschine. »Man trinkt Kaffee. Man sagt das Mantra auf. Es gibt kein Hinterher.«
Alle sahen Megan erwartungsvoll an, ob sie meine Einschätzung bestätigen oder ihr widersprechen würde. Aber Megan klappte nur ihre Mappe auf, blätterte in den Broschüren, sammelte sich. Einer der Heißwasserbereiter fing in den Sekunden angespannten Schweigens wieder an zu kochen. Ich hörte, wie er Wassertröpfchen auf den Plastiktisch spuckte.
»Warum sehen wir uns nicht ein paar Merkblätter an?«, sagte Megan.
Nach der Zusammenkunft wartete Anthony am Snackautomaten auf mich. Wir gingen zusammen die Treppe hoch und traten hinaus auf die Straße.
»Das war ja ein bisschen brutal«, sagte er.
»Was?«
»Das von wegen ›Es gibt kein Hinterher‹.«
»Die Realität ist brutal«, sagte ich. Wir blieben stehen und sahen Aamir und Reema nach, die zu ihrem Auto gingen. Der große, zornige Mann warf mir einen Blick zu, als er seiner Frau die Beifahrertür öffnete. Seine Miene wirkte undurchdringlich. Es war das erste Mal, dass seine Miene undurchdringlich wirkte, seit ich ihn eine Stunde zuvor zum ersten Mal gesehen hatte. Die Wut, die ich im Versammlungsraum miterlebt hatte, hatte etwas anderem, Kaltem Platz gemacht. Seine Schultern hingen schlaff herab. Seine Energie war wie verpufft.
»Glaubst du das allen Ernstes?«, fragte Anthony mich. »Dass es nichts bedeutet?«
»Mord?«
»Genau.«
»Ja, das glaube ich wirklich«, antwortete ich. »Man kommt nicht darüber hinweg. Man versteht nicht irgendwann auf einmal, dass es irgendeinen mystischen Sinn hatte. Man akzeptiert nicht, dass alles seinen Grund hat. Das weißt du doch selbst, Tony.« Er blies mir Zigarettenrauch ins Gesicht.
»Der Typ will seinem toten Sohn jeden Abend um acht gute Nacht sagen.« Ich nickte Aamirs Wagen hinterher, der gerade auf die Straße fuhr. »Und das wird er bis an sein Lebensende tun.«
Bei Anbruch der Nacht fühlte Tara sich immer besser. Die Dunkelheit umhüllte sie wie eine schützende Decke. Das Licht war nie ihr Freund gewesen. Es schien sie von allen Seiten zugleich zu beleuchten, schien sich in ihre Hautfalten zu graben, um ihre Kurven zu tanzen, ihre gesamte Oberfläche zu offenbaren. Und davon hatte es an Taras Körper schon immer eine Menge gegeben. Sie hatte es nie geschafft, sämtliche Körperteile gleichzeitig im Blick zu behalten, und Joanie wies sie stets auf die übersehenen Stellen hin, die Schwimmringe und Fettlappen, die aus Gummis und Gürteln rutschten.
Zieh dir das Hemd runter, Tara. Zieh die Hose hoch, Tara. Krempel die Ärmel herunter! Mein Gott! Jeder kann dich sehen.
Jeder kann dich sehen.
Am Esstisch griff Joanie gern nach einer von Taras Speckfalten, die immer irgendwo heraushingen, und kniff hinein, sei es in den Hüftspeck über der Jeans oder in das weiche weiße Fleisch unter den Armen. Jemanden wie Tara könnte man nicht mal mit einem Zirkuszelt bedecken, das war so ein Lieblingsspruch von Joanie. Mit ihr könnte man ein ganzes Dorf in Afrika sattmachen. Nach und nach wurde es Tara zu anstrengend, zum Essen nach unten zu kommen. Deswegen fing sie an, die Mahlzeiten in ihrem Zimmer unterm Dach zu sich zu nehmen, von wo sie auf den Park und die Jogger hinausblickte, die dort unten zwischen den Bäumen ihre Runden zogen. Manchmal war es ihr sogar zu anstrengend, aufzustehen und hinüber zum Computer zu gehen. Tara blieb einfach unter der Decke liegen und träumte von afrikanischen Eingeborenen, die sie stückchenweise aufteilten und Scheiben von ihrem Schenkel säbelten wie von einem Weihnachtsbraten, bis nur noch der Knochen übrig war – ein schöner, starker, sauberer, weißer Knochen. Tara verlor sich in ihren Träumen.
Ihre Mitschülerinnen hatten über die Fettwülste mit den vielen blauen Flecken gekichert. Jahrzehnte waren seitdem vergangen, aber die Mädchenstimmen schwebten immer noch durch den Dachboden wie rote Luftballons voller Hass.
Warum nennst du deine Mom ›Joanie‹?
Hat sie dich denn gar nicht lieb, Tara?
An diesem Abend stand Tara an der Fensterfront, die auf den Park hinausging, und sah zu, wie die Nacht sich herabsenkte und die Fledermäuse aufflatterten, und sie gedachte ihrer Mutter. Neun Monate waren vergangen, seit Tara aus dem Koma aufgewacht war, seit Joanie nicht mehr da war, aber manchmal hörte Tara immer noch ihre Stimme, hörte ihre Schritte auf dem Flur, wie sie sich für eine Party oder ein Dinner oder eine Wohltätigkeitsveranstaltung fertig machte und vor dem Spiegel ihren seidengefütterten Mantel anzog. Joanie mit den eleganten, aschblonden Korkenzieherlocken.
Allmählich schwand das Licht des warmen Tages und wurde von der wunderbaren Dunkelheit verdrängt. Tara stand am Fenster und sah den Läufern im Centennial Park zu, wie sie in den Schatten verschwanden. Kleine Blinklichter an Armen und Beinen zeigten an, wo sie sich gerade auf ihren endlosen Runden befanden. Dann verschwanden auch sie.
Die Tara, die gerade die Läufer beobachtete, war ganz anders als die von damals, als ihre Eltern noch lebten. Die neue Tara schlang die Arme um sich und ließ die Finger über die noch unvertraute Landschaft ihres Körpers wandern. Knubbel und Knoten und steinharte, herunterhängende Haut, wulstige Narben an den ganzen Armen, wo das Fett abgesaugt, weggeschnitten und der Rest zusammengetackert worden war. Knochen ragten aus dem Chaos an ihren Hüften, an Brustkorb und Schlüsselbein. Ihr Gesicht war ihr ein Rätsel. Sie hatte ihr Spiegelbild nicht mehr gesehen, seit sie aus dem Koma erwacht war. Den ersten Monat im Krankenhaus hatte sie schweigend verbracht. Hatte nur dagelegen und sich selbst gespürt. Neurologen kamen und spielten mit ihr und bestätigten, dass Tara sie ganz gut verstehen konnte. Dann war eine Krankenschwester aus dem Nebel aufgetaucht und hatte ihr mit ruhiger Stimme erklärt, was sie sich angetan hatte. Tara hatte ihr neues Ich im Spiegel betrachtet. Es angefasst, Geräusche von sich gegeben. Für sie war es ein Lachen gewesen, aber für die Krankenschwester klang es wie das wütende Knurren eines Tieres.
Ich stand in der Küche meines Reihenhauses in Paddington und betrachtete die verbrannten Wände, die schwarzen Brandflecke, die bis hoch zum verkohlten Dachstuhl reichten. Die Dachziegel waren heruntergefallen, und ich blickte direkt in den blauen Himmel und die orangeverfärbten Blätter. Ich lächelte. Der Herd war weggeschmissen worden, die Küchenschränke herausgerissen, die Spüle abmontiert, sodass jetzt nur noch schwarze Löcher in der Wand übrig waren. Die Bodendielen auf dem Weg zum Bad und in den Minigarten hatten sich in der Hitze verformt. Mit verschränkten Armen betrachtete ich das Chaos, roch den Gestank geschmolzenen Plastiks.
Mir ist natürlich klar, dass die meisten Leute ihre erste Wohnung wesentlich früher im Leben kaufen, und dann auch eine, die sich in einem besseren Zustand befindet als diese hier. Das Reihenhaus an der William Street war ein Abschreibungsobjekt; eigentlich hatte sich die Anzeige an Immobilienhaie gerichtet, die das Ding kaufen, abreißen, ein schickes Bistro an die Stelle setzen und sich die Hände über den satten Gewinn reiben würden. Die Küche sah aus, als hätte eine Granate eingeschlagen, der Garten war eine Müllhalde und das Obergeschoss als menschliche Behausung ungeeignet. Auch vor dem Brand war die Wohnung jahrzehntelang vernachlässigt worden. Die Böden hatte es am schlimmsten getroffen. Laut Bescheid des Oberbürgermeisters von Sydney durfte ich in der Bruchbude noch nicht mal übernachten, und bei der Arbeit waren Mundschutz und Helm vorgeschrieben. Ich kümmerte mich nicht darum. Ich schlief in dem vorderen Zimmer, in das ich eine Matratze und ein paar Wäschekörbe mit Klamotten, meinem Handy und einem Haufen Junkfood geschleppt hatte. Immerhin war das Bad funktionstüchtig. Das Apartment in Kensington hatte ich außerdem auch noch, und natürlich Imogens Wohnung. Aber ein, zwei Nächte in der Woche verbrachte ich in meinem neuen Haus, nur damit ich dem Ächzen und Knacken des Gebäudes lauschen konnte, den ungewohnten Geräuschen der heimkehrenden Nachbarn, den auf der Straße spielenden Kindern. Notarztwagen rasten mit kreischenden Sirenen zum St. Vincent, Trunkenbolde grölten auf dem Heimweg. Irgendwo in der Nähe raschelten Ratten. Nicht schön, aber meins. Ich hatte mich dauerhaft auf etwas festgelegt. Für mich eine große Sache.
Mich festlegen. Mich auf meine Freundin richtig einlassen. Arzneimitteln und Alkohol abschwören. Ja, ich war auf dem Weg hin zu etwas Gutem, wenn auch vielleicht nicht zu einem mystischen Ort jenseits des Zorns, der sowieso nicht existierte. Ich war nämlich aus tiefstem Herzen von dem überzeugt, was ich zu Aamir gesagt hatte. Über einen Mord kommt man nicht hinweg. Mit einem Mord lässt sich nicht handeln, feilschen oder argumentieren – wenn ein dir nahestehender Mensch getötet wird, tritt etwas in dein Leben und weicht dir nie wieder von der Seite, ein schwarzer Schatten am Rand deines Blickfelds, den man irgendwann so wenig beachtet wie die eigene Nase. Trotz allem muss man weitermachen, wieder sehen lernen. Sich etwas aufbauen. Dinge verändern. Sachen besitzen. Martina würde nicht zurückkommen. Es wurde Zeit, ins Leben zurückzukehren.
Ich stand in der Morgensonne, die – ungewollt – durch das Dach hereinfiel, da hörte ich, wie die Haustür auf- und wieder zuging, dann Edens humpelnden Gang auf den schiefen Bodenbrettern. Sie stützte sich auf eine Aluminiumkrücke. Das war ein Fortschritt im Vergleich zu den zwei Krücken, die sie vorher benötigt hatte. Im Fitnessraum des Präsidiums hatte ich sie ein paar Tage zuvor auf dem Laufband gesehen. Sie hatte einen seltsamen Trott zwischen Gehen und Laufen drauf und musste sich zwischendurch immer wieder an der Konsole festhalten. Ich vermutete, dass ihr immer noch die Kraft im Rumpf fehlte, aber ich war mir nicht sicher. Zwei Serienmörderinnen hatten sie vom Brustbein bis zum Nabel aufgeschlitzt. Eigentlich wollten sie sie ganz zerlegen. Eine Flinte war direkt vor ihrem Gesicht abgefeuert worden, sodass sie im linken Ohr den Großteil ihres Gehörs verloren hatte. Ihre Nase war nicht mehr gerade. Doch wenn ich sie jetzt vor mir sah, war es trotz dieser kleinen Schönheitsfehler schwer vorstellbar, dass sie beinahe in meinen Armen gestorben wäre. Als ich sie auf dem Bauernhof gefunden hatte, schien sie nur aus blutigem Fleisch zu bestehen.
»Ach, unsere Invalidin ist da«, begrüßte ich sie in meinem bescheidenen Heim. Eden war garantiert der schönste Krüppel der Welt, auch wenn sich hinter ihrer gertenschlanken Gestalt und den melancholischen, dunklen Augen ein Wesen verbarg, das alles andere als schön war. Ich hatte keinen Zweifel, dass die dunkle Macht nach wie vor in ihr wohnte, auch wenn Eden noch nicht rennen konnte, schnell müde wurde und ihr trockener Humor etwas von seiner Schärfe verloren hatte. Sie war nach wie vor dieselbe Bedrohung für die Killer, Vergewaltiger und Bösewichte, auf die sie nachts Jagd machte. Genau wie für mich. Sie gesellte sich zu mir und betrachtete die verkohlten Wände, hob langsam den Kopf und schaute hinauf zu einer Taube, die am Rand des Lochs im Dach gelandet war.
»Warum hast du Hades nicht einfach gesagt, er soll sein Geld behalten?« Sie seufzte. »Der hätte es besser angelegt.«
Edens Vater, Hades Archer, ehemaliger Herr der Unterwelt und geschicktester Leichenentsorgungsexperte aller Zeiten, hatte mir hunderttausend Dollar dafür gezahlt, dass ich herausfand, was mit der Liebe seines Lebens geschehen war. Sunday White war lange vor meiner Geburt verschwunden, und Hades hatte mich eigentlich angeheuert, um einen ihrer Verwandten loszuwerden. Aber dann hatte es ihn doch interessiert, was aus dem jungen Mädchen geworden war. Den Batzen Geld legte ich mit meiner Erbschaft zusammen und kaufte mir davon das Reihenhaus an der William Street. Kopfschüttelnd schob Eden mit einem ihrer eleganten Lederstiefel die alten Zeitungen zur Seite.
»Ich hätte gedacht, wenn jemand sieht, was man aus dieser Bruchbude machen kann, dann du. Schönheit hat ihren Ursprung an vergessenen Orten wie diesem«, sülzte ich und zeigte auf die zukünftige Küche. »Da kommt der Herd hin, hier die Schränke mit Edelstahl-Arbeitsplatte, da eine große Kücheninsel. Du weißt schon, mit dicker Holzplatte und Schubfächern. Die Wand hier kommt weg und stattdessen ein Riesenfenster rein. Das wird super.«
»Edelstahl ist längst wieder out.«
»Von mir aus, dann halt Marmor. Da kommt das Weinregal hin.«
»Du bist ein trockener Alkoholiker, Frank.«
»Dann eben mein Kochwein.«
»Und wer soll das alles machen?« Sie sah mich aus zusammengekniffenen Augen an.
»Ich natürlich.«
»Du kannst doch nicht mal eine Glühbirne ohne Aufsicht eines Erwachsenen auswechseln.«
»Na, dann halt du. Du bist doch handwerklich veranlagt!«
»Nein.«
»Aus dir spricht doch bloß der Neid.« Ich schüttelte den Kopf. »Komm, jetzt sei mal nicht so, Eden. Du darfst mich auch in meinem neuen Superhaus besuchen kommen. Darfst sogar ein Selfie machen, damit du vor deinen Freunden angeben kannst.«
Die Taube auf dem Dachsparren putzte sich die Federn und kackte uns vor die Füße. Wir blickten beide hoch zu dem Vieh.
»Wir werden hier die schönsten Dinnerpartys veranstalten«, sagte ich.
»Jetzt schau dich mal einer an! Vor nicht mal einem Jahr waren deine Teller vor lauter Vernachlässigung eingestaubt und der Inder aus dem Imbiss hat dich zu seiner Hochzeit eingeladen. Und jetzt planst du auf einmal eine Soiree.«
»Soiree – tolles Wort. Soiree, klingt doch herrlich nostalgisch!«
»Na, wahrscheinlich ist eine eigene Butze ein Fortschritt, auch wenn es so ein Drecksloch ist«, seufzte sie. »Hat sich also doch was getan. Glückwunsch.«
»Bei mir hat sich eine Menge getan, Eden. Du hast es nur nicht mitgekriegt.«
»Wenn du schon mal dabei bist, Verpflichtungen einzugehen, könntest du doch gleich noch die Psychotante heiraten und eine sommersprossige Kinderschar in die Welt setzen.«
»Na, wir wollen mal nichts überstürzen.«
Als hätte meine Freundin Imogen gehört, dass wir über sie redeten, kam sie prompt in ihren zweitliebsten lavendelfarbenen Wildlederpumps zur Tür hereingestöckelt. Sie rümpfte angesichts des Brandgeruchs die Stupsnase. Sie hatte eine Ikea-Tüte in jeder Hand. Sie war einfach ein Schatz.
»Tut mir leid, Frank. Ich wusste nicht, dass du Besuch hast«, strahlte sie. »Wie geht es Ihnen, Eden?«
»Dr. Stone«, nickte Eden. Ihrem Tonfall fehlte selbst der kleinste Anflug von Wärme. Eden brauchte mehrere Stunden, um mit jemandem warm zu werden, genau wie ein alter Kachelofen. Aber zwischen den beiden spielte sich noch etwas anderes ab. Eden ließ den Blick über meine fehlenden Küchenschränke schweifen, doch Imogen musterte meine Kollegin weiter prüfend, als suche sie nach etwas. Ich räusperte mich verlegen. Wie die meisten Männer habe ich keinen blassen Schimmer, was Frauen mit ihren Blicken und ihrem Tonfall nun wirklich meinen. Möglicherweise würden die beiden sich jeden Moment mit Kung-Fu-Tritten und Gebrüll aufeinanderstürzen. Oder sie würden sich leidenschaftlich umarmen. Welches von beidem, war mir komplett unklar. Hoffentlich würde das Räuspern den Showdown hinauszögern oder die dicke Luft womöglich sogar ganz vertreiben. Imogen verkündete, sie müsse sich die Hände waschen gehen. Am Knauf an der Haustür klebte irgendwas Undefinierbares.
Eden spielte mit einem stromführenden Kabel, das aus der Decke hing, wickelte sich die Plastikummantelung um den Finger.
Ich machte eine Kinnbewegung in ihre Richtung. »He, was ist los mit dir? Wenn man gefragt wird, wie’s einem geht, dann antwortet man nicht mit Namen und akademischem Grad des andern.«
»Ach, entschuldige bitte. Hätte ich mit einer Liste seelischer Dysfunktionen antworten sollen?«
»Seit dem Vorfall auf der Rye-Farm bist du kaltherzig geworden, Eden. Das ist mir schon länger aufgefallen. Du bist noch seltsamer als früher, falls das möglich ist.«
»Möglich ist alles.«
»Du bist mir eigentlich seltsam genug.«
»Was für ein beschissener Chauvi-Spruch. Willst du mir auch noch vorschreiben, wie ich die Haare tragen soll?«
»Hochgesteckt.«
»Ich habe die vorgeschriebenen Therapiestunden absolviert.« Eden zuckte die Achseln. »In meiner Freizeit brauche ich mich nicht therapieren zu lassen. Wenn Imogen unbedingt jemanden therapieren will, dann hat sie doch bei dir mehr als genug zu tun.«
»Sie therapiert dich nicht. Sie ist meine Freundin. Sie hat dich begrüßt, weiter nichts.«
»Therapeuten therapieren immer. Sie therapieren in jeder wachen Minute, bis alles um sie herum tottherapiert ist.«
»Du kannst sie also nicht leiden«, schloss ich. »Natürlich nicht.«
»Sie ist Therapeutin.«
»Hör auf, ständig Therapeutin zu sagen.«
»Wo Sie gerade hier sind, Eden.« Imogen kam die Treppe herunter, wobei sie sich das Wasser von den Fingern schüttelte – ich hatte noch keine Handtücher. »Ich sage schon eine Weile zu Frank, dass es doch nett wäre, wenn wir drei Mal zusammen essen gehen würden. Was meinen Sie? Wahrscheinlich hat er Ihnen das noch gar nicht ausgerichtet. Ich fände es schön, Sie ein bisschen besser kennenzulernen … Sie wissen schon, jetzt, wo Frank und ich … wo wir jetzt –«
»Miteinander vögeln?«, beendete Eden den Satz. Ich warf den Kopf in den Nacken und lachte brüllend los. Die Taube flatterte davon.
»Eine Beziehung führen.« Imogen seufzte.
Edens Telefon brummte. Sie zog es aus der Hosentasche, warf einen Blick darauf und steckte es wieder ein.
»Wir müssen los, Frank«, sagte sie. »Sofort.«
»Unter der Woche kann ich jeden Abend.« Imogen folgte uns zur Tür. Ich schnappte mir meine Jacke von der Matratze in meinem Zimmer und lauschte auf Edens Antwort, aber sie war schon draußen auf dem Bürgersteig. Ich gab Imogen einen Abschiedskuss und spielte auf eine Art mit ihrem Pferdeschwanz, die hoffentlich als Entschuldigung durchgehen würde. Dann rannte ich zur Tür hinaus.
Ruben war sich ziemlich sicher, dass er den coolsten Job in ganz Sydney ergattert hatte. Er reinigte jetzt seit drei Wochen die dreistöckige Riesenvilla am Centennial Park und hatte bisher weder den Besitzer gesehen noch sonst jemanden, der mit dem Haus zu tun hatte. Als er im Ankunftsterminal am Sydney Airport gesessen und auf den Bus gewartet hatte, hatte er mithilfe seines Smartphones Stellenanzeigen aus dem Telegraph übersetzt. Er hatte mit der kürzesten angefangen. Putzhilfe gesucht, 2x pro Woche. Er schickte der Jobvermittlungsagentur eine E-Mail und bekam die Stelle, mit der Erklärung, dass er selbst aufschließen, das Haus von Staub, Insekten und Schimmel befreien und wieder gehen solle.
Er war noch keine zehn Minuten in Australien und hatte schon einen Job – super Bezahlung, keinerlei Kundenkontakt, keinen Chef. Zu schön, um wahr zu sein. Es war wie der Anfang eines altmodischen Gruselfilms.
Der einzige Haken an der Sache war, dass Ruben nicht die beste Reinigungskraft aller Zeiten war. Er besaß immer noch die schlechte Teenagerangewohnheit, seine Klamotten einfach unter sich fallen zu lassen, was bei vielen anderen Backpackern in den Dutzenden von Hostels, in denen er auf seiner Reise quer durch Europa, halb Asien und nun entlang der australischen Ostküste abgestiegen war, für Unmut gesorgt hatte. Obendrein hatte er ein Faible für Taschentücher, Kaugummis und Gummibänder – nach dem Benutzen ließ er sie fallen oder wegschnalzen und sagte sich, dass er sie später aufräumen würde. Liebend gern verteilte er Zahnpastatröpfchen auf sauberen Spiegeln und Bartstoppeln in Waschbecken. Ein Job als Reinigungskraft war eindeutig eine Herausforderung für Ruben, aber er würde das schaffen.
Postalisch wurde ihm ein Schlüssel zugestellt, per E-Mail ein Lageplan der Villa an der Lang Road, gegenüber des Centennial Parks. Er sollte im ganzen Haus, auf jedem Stockwerk die durch Nichtnutzung entstandenen Schäden begrenzen helfen. Dem Staub zu Leibe rücken. Die Kissen ausschütteln. Gift auf Schimmelwucherungen sprühen. In den E-Mails wurde nicht erwähnt, ob jemand in dem Haus wohnte oder wann die Bewohner zurückkehren würden. Ruben erkundigte sich nicht danach. Dafür war die Bezahlung zu gut.
Am ersten Tag sah er sich erst einmal gründlich um und suchte sich die Reinigungsmaterialien zusammen, die an allen möglichen Stellen in dem riesigen Haus verteilt waren. In der Küche standen ausreichend Putzmittel, trotzdem war alles voller Schimmel und Staub. Um die Böden richtig sauber zu kriegen, bräuchte er einen neuen Staubsauger. Ruben vermutete, dass er notgedrungenerweise angeheuert worden war, damit das Haus nicht völlig verfiel. Schimmel und feuchte Stellen hatten sich schon so weit ausgebreitet, dass sie der Struktur womöglich bald dauerhaften Schaden zufügen würden. Ruben war gerade noch rechtzeitig eingetroffen, um das Ungeziefer, das sich bereits im Erdgeschoss eingenistet hatte, von schwerwiegenden Zerstörungen abzuhalten.
Der zugewucherte Garten war ein Paradies für die Spinnen, die in jeder Fensterecke ihre Netze gespannt hatten. Seltsamerweise war der Vorgarten, der von Passanten eingesehen werden konnte, hingegen perfekt gepflegt. Im Haus war es dunkel und überall knarrte und knackte es, sodass Ruben die ganze Zeit Musik laufen ließ, damit er sich nicht totgruselte. In den zahlreichen Badezimmern hielt er sich so wenig wie irgend möglich auf. In Horrorfilmen tauchten die Geister immer als Erstes in den Spiegeln auf.
Erst ganz am Ende seines ersten Arbeitstages merkte Ruben, dass er nicht allein war. Bis dahin hatte er das Dielenknarren, das ihn überall verfolgte, nicht weiter beachtet, aber als er in das oberste Stockwerk kam, hörte er einen Fernseher laufen. Anfangs dachte er, die Geräusche kämen von draußen, vielleicht von nebenan, aber als er stehen blieb und lauschte, wurde ihm klar, dass sie vom Dachboden kamen. Jemand schien ein Video abzuspielen: Ein Werbespot lief in seiner Gänze, wurde dann zurückgespult und abschnittsweise wiederholt. Das Jingle und mehrere Worte kamen immer und immer wieder. Ruben schüttelte die Bettdecken in den Zimmern darunter aus und versuchte dabei mit seinem schlechten Englisch, die Wörter zu verstehen.
Mit meinem zehnwöchigen Programm schaffen Sie es – entkommen Sie dem Ich, mit dem Sie unzufrieden sind, und entdecken Sie die Person, die Sie sein möchten. Fangen Sie heute noch damit an! Es ist ganz leicht.
Die Worte wiederholten sich immer wieder, brachen ab, verstummten.
…entkommen Sie dem Ich, mit dem Sie unzufrieden sind
… entkommen … Sie …
… entdecken Sie die Person, die Sie sein möchten…
… entdecken Sie die Person …
Es ist ganz leicht.
Ruben lauschte nach Stimmen, Bewegungen, irgendetwas, das auf einen Menschen hingedeutet hätte, der sich den Werbespot anschaute. Doch da war nichts. Es war, als wäre dort oben ein Gespenst.
Ich ging nicht auf kürzestem Weg zum Tatort. Ich folgte Eden den grünen Hügel hinauf zu dem Baum, unter dem die Leiche gefunden worden war, da bemerkte ich Amy Hooku. Sie stand ziemlich verloren herum, starrte auf den Rasen und wirkte trotz der verschränkten Arme wie das kleine Mädchen, das sie im Grunde noch war. Amy war gerade mal siebzehn, und das sah man ihr auch an. Sie trug ein knallrotes Oberteil mit tanzenden Pandas darauf, schwarze Jeans und silberne Doc Martens. Der auffällig blondierte, stachlig gestylte Bürstenschnitt biss sich mit ihren vietnamesischen Gesichtszügen. Elektronische Ausrüstung hing an ihr wie rankende Schmarotzer an einem dünnen Bäumchen: um den Hals fette Kopfhörer, weiteres Equipment am Gürtel und in den Gesäßtaschen gleich zwei Handys – ein privates und eins von der Polizei. Sie war der einzige Teenager in ganz Australien mit einem Cop-Phone, und das hatte sie sich hart erarbeitet. Ich schlich mich von hinten an sie ran und packte ihren schmalen Nacken.
»Ich habe sie. Verstärkung! Ich brauche Verstärkung, Leute! Ich habe die schlimmste Lügnerin in ganz Sydney gefasst!«
»Mann, nimm die Flossen weg, du Depp!«
Sie schlug nach mir, aber ich hielt sie einfach am Handgelenk fest und brachte sie mit einem leichten Tritt in die Kniekehle zu Fall. Eine Sekunde ließ ich sie hilflos zappeln. Die Teenager-Genervtheit über mein unglaublich peinliches Benehmen war ihr deutlich anzusehen. Die Leute hinter der Polizeiabsperrung begafften uns misstrauisch – ein großer Weißer mit verrückter Fratze behelligte ein kleines asiatisches Mädchen.
»Mensch, was soll der Scheiß?«
»Ich freu mich einfach, dich zu sehen, Kleine. Du bist ja die reinste Bohnenstange geworden.« Ich stellte sie wieder auf die Füße, grinste sie an und boxte sie hart in die Schulter. Sie war tatsächlich gewachsen, aber nur in die Länge. Sie war momentan noch eine Kleinausgabe der großen, langbeinigen Schönheit, die sie einmal werden würde. Ihre Eltern waren ein phantastisch aussehendes Paar gewesen – er ein breitschultriger Rugbyspieler-Typ, sie ein knochiges Model, das immer golden zu leuchten schien. Ich kannte Mrs. Hooku von ihren Autopsiefotos und dem 60-Minutes-Beitrag über den Mordfall. Amys Vater hatte ich bei North Sydney Metro häufiger gesehen, ein stiller, in sich gekehrter Mann, der stets in Eile war.
»Was machst du denn hier, Hooky-Schnucki?«
»Ich bin auf dem Weg zur Uni, wenn du’s genau wissen willst. Hab nur eben Simmons gesehen.« Sie nickte in Richtung eines glatzköpfigen Polizeifotografen, den wir beide von North Sydney Metro her kannten. »Da dachte ich mir schon, dass was Interessantes passiert ist.«
Amy »Hooky« Hooku war ein Junggenie, aber ich versuchte, nicht daran zu denken. Sie hatte einen seltsamen Klamottenstil – japanischer Punkrock mit Hello Kitty oder was weiß ich – jedenfalls war sie so was von hochbegabt, dass sie mit siebzehn von der Highschool abgegangen war und sofort im Informatikstudiengang an einer Eliteuni, Hauptfach Ingenieurswissenschaften, gelandet war. Das Ganze mit siebzehn. Ich hatte sie bei North Sydney Metro kennengelernt, wo ich damals für die Asiaten-Gangs zuständig war. Ich hatte hauptsächlich die großen Drogenmafia-Familien auf dem Schirm, die Turf Wars gegeneinander führten. Im Mordfall der Familie Hooku war ich lediglich unter der irrtümlichen Annahme eingeschaltet worden, ich spräche Vietnamesisch.
Vor etwas über einem Jahr war mir die Aufgabe zugefallen, Amy im Direxbüro ihrer Schule mitzuteilen, dass ihre kleine Schwester an diesem Morgen ihre Eltern ermordet hatte. Es war ein schreckliches Blutbad gewesen, dem Amy nur deswegen entkam, weil sie zufällig bei einer Freundin übernachtet und am nächsten Tag direkt zur Schule gegangen war.
Ich war nicht gerade prädestiniert für die Aufgabe. Ich hatte nun wirklich gar nichts mit einer asiatischen Jugendlichen gemeinsam. Aber die Vertrauenslehrerin hatte sich verspätet, die Direktorin rannte wie eine Geistesgestörte auf dem Gang auf und ab, und da blieb es an mir hängen, Amy die Nachricht zu überbringen. Und irgendwie meisterten wir zusammen die schreckliche Situation im Büro der Direktorin.