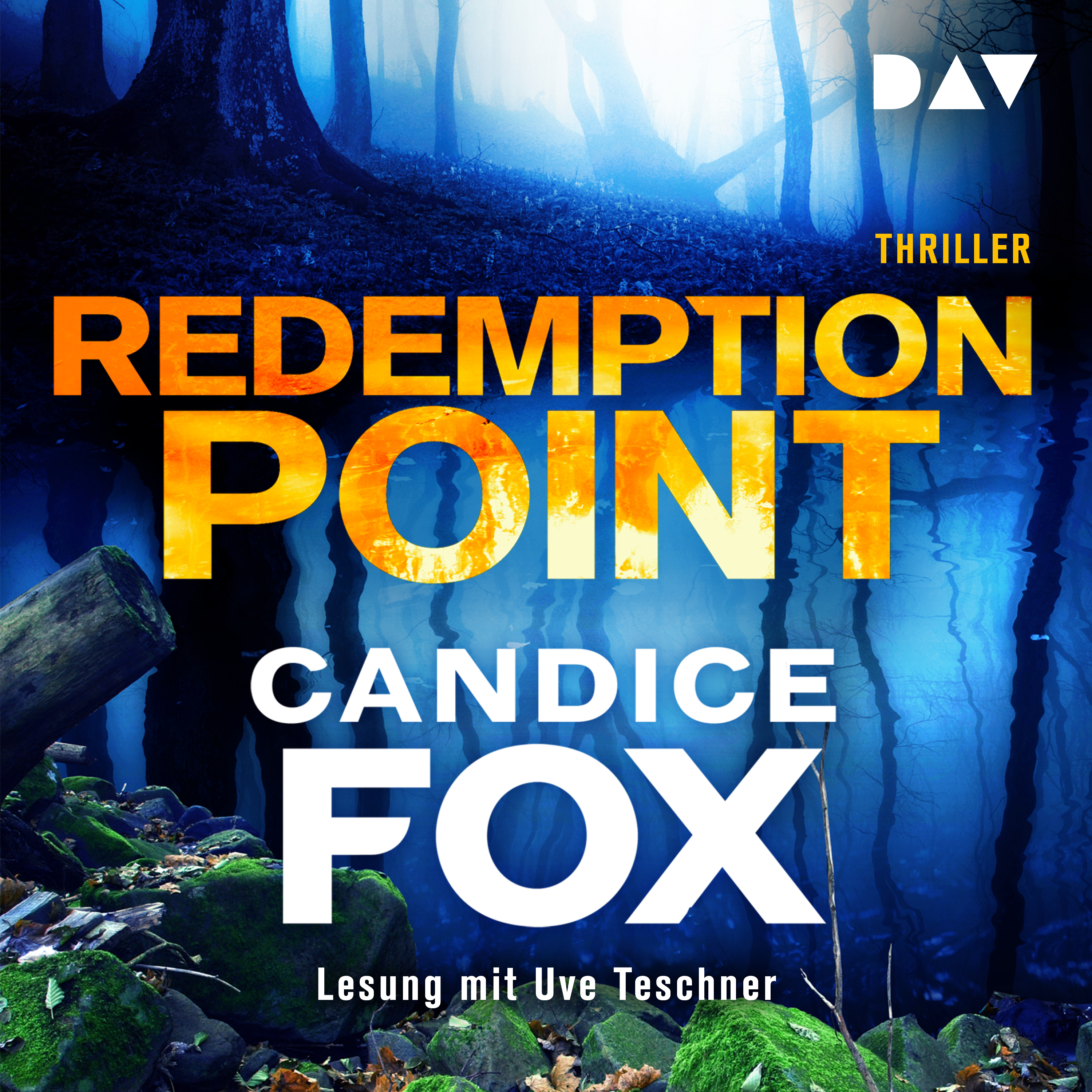15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die junge Tilly Delaney ist vor zwei Jahren auf mysteriöse Weise verschwunden. Die Polizei von Los Angeles hat ihren Fall inzwischen längst zu den Akten gelegt. Aus Verzweiflung über die Untätigkeit des LAPD dringen Tillys Eltern, in das forensische Labor der Strafverfolgungsbehörden ein und stellen ein Ultimatum: Findet endlich unsere Tochter, oder wir werden Stunde um Stunde alle Beweise für andere ungeklärte Fälle vernichten.
Detective Charlie Hoskins ist seit fünf Jahren undercover in einer mörderischen Motorradgang. Sollte das Labor brennen, verliert er alles, wofür er gearbeitet hat.
Lynette Lamb war Polizeibeamtin ‒ bis sie vor ihrem ersten Einsatz in LA gefeuert wurde. Herauszufinden, was mit Tilly passiert ist, ist ihre einzige Chance, wieder in den Beruf einzusteigen, auf den sie sich ihr ganzes Leben lang vorbereitet hat.
Hoskins und Lamb haben nicht viel Zeit, um diesen cold case zu lösen, denn die Situation droht völlig außer Kontrolle zu geraten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Candice Fox
Stunde um Stunde Thriller
Aus dem australischen Englisch von Andrea O’Brien
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5358.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© 2023 by Candice Fox
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagabbildung: FinePic®
eISBN 978-3-518-77766-4
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Stunde um Stunde
Vier Tage vorher
Zwei Tage vorher
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Epilog
Danksagung
Informationen zum Buch
Stunde um Stunde Thriller
Stunde um Stunde
Fürs Troppo-Team.
Vier Tage vorher
Im Wasser umklammerte irgendwas ihre Wade. Ihr Hirn kreischte ein einziges Wort.
Hai.
Mina verkrampfte sich, vorbei war es mit dem Freistilschwimmen, den entspannten, langgezogenen Zügen, statt-dessen schlug und trat sie wild um sich, die Klippen über ihr, das diesige, goldene Band des Horizonts vor der Abalone Bay nur noch wirre Fragmente vor ihren im wilden Kampf panisch aufgerissenen Augen. Beim Aufheulen atmete sie eine volle Ladung Gischt ein. Es war ein Mann. Ein Mann klammerte sich an ihr fest. Nicht der gefürchtete Weiße Hai, das Schreckgespenst ihres frühmorgendlichen Sprungs in die dunklen Fluten – mit angezogenen Knien natürlich. Hustend versuchte sie, sich von seinem Klammergriff zu befreien, sie trat ihm in den Bauch, die Alarmglocken in ihrem Hirn schrillten noch immer, obwohl sich in einem anderen Winkel bereits Erleichterung breitmachte.
»Ogottogott!«, japste sie. »Lass mich los!«
Mit einem tätowierten, leichenblassen Arm griff er nach ihr und rief: »Hilfe!«, wobei Meerwasser aus seinem Mund schwappte.
Dann tauchte er wieder ab. Mina schaltete den Turbo ein, vom Überlebensmodus in den Rettungsmodus. Blind fischte sie in der Tiefe herum, erwischte eine Faustvoll langer Haare. Eine Welle hob sie an, die Meeresgötter trieben sie und den Mann zusammen, sie bekam ihn unter den Achseln zu fassen und konnte sich so um ihn herummanövrieren.
»Schaffs nicht«, keuchte er. »Schaffs nicht mehr.«
»Ich hab dich«, sagte sie.
Was zutraf. Nur war der Mann unglaublich schwer, seine Beine hingen schlaff im Wasser, der Kopf auf ihrer Schulter. Jetzt, da sie ihn festhielt, hatte er einfach aufgegeben. Sie tauchte ab, kämpfte sich wieder an die Oberfläche, sah sich um, auf der Suche nach Hilfe. Als sie nur eine Stunde zuvor ins Wasser gegangen war, der Horizont ein roter Striemen am schiefergrauen Himmel, hatte es vor Menschen nur so gewimmelt. Fischer hatten wie schwarz ummantelte Kormorane auf den Felsen rund um Portuguese Point gestanden, Jogger waren ihrer Wege getrabt, und ein paar versprengte Stammgäste hatten am Rand des Gezeitenbeckens in der kleinen Bucht gesessen. Jetzt aber kam es ihr vor, als würde sich eine unbewohnte Küste vor ihr auftun, der steil hinter dem Strand aufragende Felsen still und tot wie nach einer Apokalypse. Mina blieb keine Wahl. Sie umschlang die Brust des Mannes, wandte sich um und paddelte drauflos.
Sie zog und trat, zog und trat, ließ sich oft treiben, sein nackter Hintern an ihrer vom Neopren geschützten Hüfte. Ständig versicherte sie ihm, dass sie ihn nicht loslassen würde, obwohl sich ihre Hoffnung, endlich Sand unter den Füßen zu spüren, immer wieder zerschlug und sie stattdessen in die eiskalte Leere trat. East Beach, ihr Zielhafen, wollte einfach nicht näher kommen. Ihre Panik steigerte sich umso mehr, als sie feststellte, dass der Ertrinkende schwer verwundet war. Eine tiefe Fleischwunde an der Brust. Blutunterlaufene Flecken und Schnitte an den Armen. Mina winkte und winkte. Niemand kam. Panisch suchte sie mit Blicken die Wellen ab, jede Spitze erschien ihr wie eine zuckende tintenschwarze Flosse.
Als sie endlich, endlich Boden unter den Füßen spürte, schrie sie triumphierend auf.
In den schäumenden, wogenden Wellen schien auch der Mann seine letzten Reserven zu mobilisieren, er stellte sich breitbeinig hin und stolperte dann, den behaarten Arm auf ihre Schulter gestützt, an Land. Mit ihrer Hilfe hoppelte er ein paar Schritte vorwärts, bis endlich zwei Surfer herbeieilten und dafür sorgten, dass er nicht zusammenbrach und sie unter sich begrub.
Im Sand rang er um jeden Atemzug, der Brustkorb mit den ausufernden blauen Tätowierungen hob und senkte sich sichtbar. Sie kniete neben ihm, zitternd vor Erschöpfung, und ließ den Blick über Totenköpfe, Adler und Gitarren wandern. Die Surfer kümmerten sich nicht um die Tintenlandschaft auf der Haut des Mannes, einer schob ihm die nassen braunen Haare aus dem demolierten, bärtigen Gesicht, der andere stapelte neben Mina einen Haufen Handtücher und Klamotten auf. Mit einem Handtuch drückte sie auf die Brustwunde, während der erste Surfer mit einem anderen den nackten Unterkörper des Mannes bedeckte.
»Hey, Kumpel? Kumpel? Alles okay bei dir? Bleib bei uns, Bro!«
Der zweite Surfer berührte Minas Arm. »Hat ihn ein Hai erwischt?« Er war älter, seine nackten Schultern waren mit karamellfarbenen Flecken übersät.
»Nein, ähm, nein«, sagte sie. »Keine Ahnung. Ich glaub nicht.«
»Was ist denn passiert?«
»Weiß nicht.«
»Wo sind seine Klamotten?«
»Weiß ich nicht! Ich weiß es doch auch nicht.«
Der Mann im Sand umklammerte Minas Unterarm, derselbe eiserne Griff wie im Wasser.
»Handy«, murmelte er.
»Krankenwagen ist schon unterwegs, Bro. Halt durch«, sagte der jüngere Surfer. Mina folgte seinem Blick zum Strandpfad, wo ein paar Joggerinnen glotzend stehengeblieben waren. Eine hatte ein Handy am Ohr, die Augen weit aufgerissen, während sie Einzelheiten schilderte und dabei mit dem Finger auf den Strand zeigte, als könnte der Einsatzleiter sie sehen. Ganz in der Nähe hatte sich eine Schar Möwen versammelt, die die ganze Aktion mit eingeklappten Flügeln und missbilligenden Blicken verfolgten.
Mina wandte sich wieder dem bärtigen Mann zu. Er sah sie mit blutunterlaufenen Augen an.
»Handy. Sofort. Bitte.«
Ihre Tasche war im Auto. Aber dann drückte der ältere Surfer Mina achselzuckend sein Gerät in die Hand. Als Mina spürte, dass sich um sie herum eine Menschenmenge gebildet hatte, wurde sie plötzlich wütend. Wo waren all diese Leute gewesen, als sie in den Wellen um ihr Leben gekämpft hatte? Vor Erschöpfung fühlten sich ihre Glieder bleischwer an, als wäre sie stundenlang gegen die Strömung angeschwommen. Aber vielleicht war es gar nicht so gewesen. Mina reichte dem Mann das Handy. Der rollte sich mit sichtlicher Anstrengung auf die Seite, umklammerte mit zitternden Fingern das Handy und versuchte, mit der andern zu wählen.
Mina, die Surfer, die Glotzer, die Möwen, alle sahen zu, wie der Mann aus dem Meer im Sand gegen die Ohnmacht ankämpfte und darauf wartete, dass jemand seinen Anruf entgegennahm. Der Morgen war so still, alles war so ruhig, dass Mina die Stimme der Frau am anderen Ende der Leitung hören konnte.
»Hallo?«
»Hellfire, Hellfire, Hellfire«, sagte der Mann. Kaum hatte er die Worte hervorgestoßen, ließ er den Kopf in den Sand fallen. Er verlor so schnell das Bewusstsein, dass sich Mina fragte, ob er tot war. Sie nahm das Handy aus seinen schlaffen Fingern und hielt es sich ans Ohr.
»Hoss?«, fragte die Frau. »Du liebe Güte, Charlie! Bist du sicher?«
Zwei Tage vorher
Die Nähnadel stieß ruckartig durch das dicke, steife Material von Lambs kohlrabenschwarzem Uniformhemd und bohrte sich unversehens ins weiche Fleisch ihres Zeigefingers. Sie jaulte auf, saugte am Finger herum und vergewisserte sich sofort mit hektischen Blicken, dass niemand im Umkleideraum sie gehört hatte. Sie war allein. Mit ihrer Nervosität hatte sie wahrscheinlich alle vertrieben. Nervosität war ansteckend, und das hier war ein Beruf, in dem zitternde Finger, ein leichenblasses Gesicht und ein unsicherer Gang nicht besonders nützlich waren.
Sie kauerte in Unterwäsche auf der abgescheuerten Holzbank zwischen den übereinandergestapelten Spinden und ließ die vergangenen demütigenden Momente vor ihrem geistigen Auge Revue passieren. Bei ihrer Ankunft im Polizeihauptquartier von Van Nuys hatte sie sich vor dem mit Speichelschutzscheiben ausgerüsteten Empfangstresen eingefunden und den hinteren Bereich nicht wie ihre Kolleginnen und Kollegen mithilfe einer Karte durch den Personaleingang betreten. Auf dem Weg in den Umkleideraum hatte sie wie ein schreckhaftes Pferd mit blähenden Nüstern auf die unvertrauten Gerüche und Anblicke im Großraumbüro des Erdgeschosses reagiert. Und war direkt vor den Augen zweier Zivilfahnder über ein am Boden festgeklebtes Kabel gestolpert.
Der an einem einzigen gekringelten Faden von ihrer Brusttasche baumelnde Knopf war ihr erst aufgefallen, als sie ihre Zivilkleidung ausgezogen hatte, um ihre Uniform anzulegen. Herrje! Warum ausgerechnet jetzt? Wie oft war sie am Wochenende in ihr Schlafzimmer gelaufen, um ihre im Kleiderschrank hängende Uniform zu bewundern und ehrfürchtig die makellosen Ärmel zu berühren, ohne dass ihr der lose Knopf aufgefallen war? Das Nähset hatte sie am Boden ihres prall gefüllten Rucksacks gefunden, zwischen ihren sorgfältig gepackten Notutensilien: Elektrolyt-Tabletten, Aspirin, Tampons, Snacks, ein Satz Zivilkleidung, drei verschiedene Haargummis, falls das, was sie gerade benutzte, gegen die Kleiderordnung verstoßen sollte. Warum zum Teufel hatte im Handbuch nichts über Haargummis gestanden? Mit tauben Fingern nähte Lamb den Knopf jetzt wieder an, streifte das Hemd über und strich es mit zackigen Bewegungen glatt.
Sie betrachtete noch schnell ihr Spiegelbild, dann schlug sie die Spindtür zu. Sämtliche Farbe war ihr aus dem Gesicht gewichen. Am Handtuchspender riss sie ein Knäuel Papier heraus und tupfte sich zum zigsten Mal an diesem Tag die schweißnassen Achselhöhlen ab. Dann trat sie an die Tür und legte die Hand an den Knauf.
Mit geschlossenen Augen flüsterte sie sich etwas zu.
»Du hast es verdient, hier zu sein.«
Lynette Lamb, P1 Officer beim Los Angeles Police Department, atmete tief ein und langsam wieder aus. Dann schob sie die Tür auf und marschierte in ihren ersten Tag bei der Polizei.
Auf dem Flur vor der Umkleide kam sie sich vor wie die Neue auf dem Schulhof; starr vor Schreck, angreifbar. Als sie das Großraumbüro betrat, stand die Kollegin, die sie zur Umkleide geführt hatte, an der Kaffeestation, eine Hand auf dem Tresen, Daumen und Zeigefinger der anderen an der Nasenwurzel. Die Geste sollte wohl so viel wie Mal wieder die Arschkarte gezogen kommunizieren. Ihr Kollege tätschelte ihr tröstend den Ellbogen, bevor er davonging.
Lamb straffte den Rücken und reckte das Kinn vor. Sie hatte vollstes Verständnis. Diese Frau, wer auch immer sie sein mochte, war vermutlich angewiesen worden, Lamb an ihrem ersten Tag wie ein Babysitter zu betreuen. Lamb konnte ihre Enttäuschung nachvollziehen. Frischlinge waren nervig. Aber Lamb hatte eine schnelle Auffassungsgabe, ein hervorragendes Gedächtnis und einen Blick für Details. Ihre Noten auf der Akademie bestätigten das. Sie hatte es schriftlich, schwarz auf weiß: Sie hatte es verdient, hier zu sein. Lamb rang sich ein Lächeln ab, trat vor die Frau und stand stramm.
»Ich wäre dann so weit, Officer …«, Lamb warf einen raschen Blick auf das Namensschild der älteren Kollegin, »… Officer Milstone.«
Milstone würdigte sie keines Blicks.
»Mitkommen«, sagte sie stattdessen und ging einfach los.
Lamb folgte ihr eifrig, nickte und lächelte den Kollegen und Kolleginnen zu, die sie aus ihren Arbeitsnischen beobachteten, einige am Telefon, andere hinter ihren Monitoren hervor. Milstone und Lamb gingen über einen Korridor ins Treppenhaus und erklommen schweigend die Stufen zum oberen Stockwerk. Büros, ein paar Vernehmungsräume, ein Wartezimmer. Vor einer Tür mit Milchglasscheibe, neben der das Namensschild »Lieutenant Gordon Harrow« angebracht war, blieb Milstone stehen.
Natürlich, dachte Lamb, zuerst muss ich mich beim Chef vorstellen. Sie bedankte sich stumm beim Universum, dass ihre Panik sich langsam in freudige Erregung auflöste. Ihr brannten die Wangen. Nachdem sie erfahren hatte, dass man sie in Van Nuys einsetzen würde, hatte sie eine Menge über Gordon Harrow recherchiert. Sie kannte seinen Werdegang, seine wichtigsten Fälle, seinen Familienstand, seine Hobbys: Surfen und Golf. Lamb konnte es kaum erwarten, seine Ansprache über das Valley, sein Team und seine Arbeitsweise zu hören. We work hard and play hard.
Lamb war bereit – für beides.
Milstone klopfte einmal.
»Jap«, sagte jemand.
Milstone schob die Tür auf. Lamb wartete, dass sie vorausging. Tat sie aber nicht. Als Lamb sich immer noch nicht rührte, machte Milstone eine ungeduldige Handbewegung. Mach schon! Lamb huschte ins Zimmer. Hinter dem verbeulten und mit Papierstapeln übersäten Metallschreibtisch saß eine müde Version desselben Gordon Harrow, dessen Konterfei sie seit zwei Wochen auf ihrem Monitor angestarrt hatte. Ohne die Polizisten-Schirmmütze, die er sonst immer bei Pressekonferenzen trug, wirkte er seltsam unvollständig. Er strich sich über die Borsten auf seinem kleinen Kopf und begrüßte Lamb mit einem erstaunlich laschen Händedruck.
»Sir, guten Morgen«, setzte sie an. »Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzu…«
»Setzen!«
Sie gehorchte.
Er betrachtete den Computerbildschirm zu seiner Linken, es sah aus, als würde er dort etwas lesen. Die Welle der Erregung, die sich noch vor der Tür bei ihr aufgebaut hatte, hielt auf dem Kamm kurz inne.
Harrow wandte sich vom Computer ab und faltete die Hände.
»Lynette«, sagte er.
Da wusste sie Bescheid.
Lynette. Nicht »Officer Lamb«.
Ganz schlechtes Zeichen.
»Ich muss Ihnen ein paar wichtige Fragen stellen«, sagte Harrow. »Und damit das gleich klar ist: Wie Sie diese Fragen beantworten, hat keinerlei Auswirkung auf das Endergebnis, das Sie hier heute erwartet. Das steht bereits fest. Daran kann ich nichts mehr ändern. Ich überbringe nur die Botschaft.«
»Okay«, sagte sie.
Lamb wartete auf die Pointe. Die nicht kam. Hinter der Milchglasscheibe schlenderten Leute vorbei, lachten, telefonierten. Sie lauschte, in der Hoffnung, von ihren zukünftigen Kollegen ein verräterisches Flüstern oder Kichern zu hören, irgendein Zeichen, dass das alles hier nur ein harmloser Streich war, den man der Anfängerin spielen wollte. Aber sie hörte nichts dergleichen. Die Welt da draußen ging ohne sie weiter. Die Welle brach. Krachte herab, tiefer, tiefer, tiefer, unglaublich schwer, unglaublich schnell.
Harrow richtete die grauen Augen direkt auf sie. »Vor einer Woche, am Abend des elften Oktober, waren Sie in der Stadt unterwegs. Sie feierten Ihren Akademieabschluss. Dabei waren Sie in Begleitung Ihrer Freundinnen und Freunde. Allesamt Kadetten. Ist das korrekt?«
»Ja«, sagte sie.
»Sie besuchten einige Bars in der Gegend um West Hollywood?«
»Ähm. J-Ja.«
»Und in den frühen Morgenstunden, gegen zwei Uhr am nunmehr zwölften Oktober, trennten Sie sich von Ihrer Gruppe«, sagte Harrow. »Sie buchten ein Uber. Zusammen mit einem Mann, den Sie als Brad kannten, ließen Sie sich heimfahren. Sie und Brad gingen in Ihr Apartment in Koreatown. Korrekt?«
Lamb konnte nichts sagen. Ihr Mund war trocken, die Zunge klebte am Gaumen. Es ist nur ein Scherz, redete sie sich ein. Ein wahnsinnig witziger Scherz! Gleich würden die anderen zur Tür reinplatzen, ihr auf die Schulter klopfen und durchs Haar wuscheln. In der Büroküche gäbe es eine Willkommensparty. Kuchen. Harrow wartete auf irgendeine Reaktion von ihr, ließ die Stille schwerer und schwerer lasten. Schließlich kam er wohl zu dem Schluss, dass sie zu keiner Antwort fähig war, denn er seufzte wie ein Bauer, dem nichts anderes übrigblieb, als das Schaf zu erschießen, das sich in seiner Erntemaschine verheddert hatte.
»Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein.« Harrow wischte mit ausladender Handbewegung über seinen Schreibtisch. »Der Kerl, den Sie in jener Nacht mitgenommen haben, ist ein ganz schlimmer Verbrecher. Uns ist noch nicht ganz klar, ob er Sie persönlich ausgesucht hat oder einfach versucht hat, eine Frau aus Ihrer Gruppe dazu zu bringen, ihn mit zu sich nach Hause zu nehmen. Sicher ist, er wusste genau, dass er es mit einer Gruppe frisch von der Akademie entlassener Polizeikräfte zu tun hatte.«
»Worum …«, der Rest blieb Lamb in der Kehle stecken. Sie räusperte sich, nahm erneut Anlauf: »Worum geht es hier eigentlich?«
»Dieser Kerl, Brad Alan Binchley? Er ist ein vollwertiges Mitglied einer Outlaw-Motorradgang namens Death Machines«, sagte Harrow. »Schon mal gehört?«
»Nein«, stammelte Lamb. »J-Ja. Ähm, vielleicht hab ich mal davon in der Zeitung …«
»Genau. Das sind richtig fiese Leute. Brad hat mit Ihnen geflirtet, und Sie haben ihn mitgenommen, und während Sie geschlafen haben, nehme ich zumindest an, also zwischen ungefähr vier und fünf Uhr morgens, hat er sich Zugang zu Ihrem Computer verschafft, der irgendwo in Ihrer Wohnung stand.«
»Er hat was?«
Lambs Gedanken rasten. Sie erinnerte sich an Brads Körper. Seinen nikotingeschwängerten Atem. Sein Lachen. Es hatte sie auf seltsame Weise erregt, ihr Apartment am nächsten Morgen leer vorzufinden, der hochgeklappte Toilettensitz der einzige Beweis seines Besuchs. Ganz schön durchtrieben, Lynette! Sie hatte in sich hineingegrinst. Das war völlig untypisch für sie. Nächte in der Stadt, One-Night-Stands, ihr Traumjob, ein Leasingvertrag für ein nagelneues Auto auf dem Sofatisch. Das war die neue Lamb. Die erwachsene Lamb.
Harrow setzte seinen Rundumschlag fort, zerstach Lambs Seifenblase und ließ sie auf den Boden der Tatsachen plumpsen. »Brad Binchley hat Ihr LAPD-Sicherheits-Login benutzt, um in Ihr dienstliches E-Mail-Konto zu kommen.«
»Das kann nicht sein«, sagte Lamb. »Das kann einfach nicht sein. Mein Passwort ist nirgends aufgeschrieben. Es ist nicht …«
Harrow machte eine abwertende Geste. »Es gibt immer Möglichkeiten, das zu umgehen. Binchley ist ein Hacker. Die Gangs machen sich fit für die Zukunft. Holen sich Leute wie ihn ins Boot. Bleibt ihnen auch nichts anderes übrig.«
Lamb schluckte schwer.
»Binchley hat einem Detective namens Daniel Keon drüben in der Verwaltung eine Mail geschickt«, sagte Harrow. »Keon hat sie geöffnet. Sie war intern, also war er nicht misstrauisch. Die Mail enthielt einen Virus. Brad Binchley und seine Gang haben sich damit Zugang zu streng geheimen polizeilichen Akten verschafft.«
»Darüber weiß ich nichts.« Lamb hielt sich die Hände vors Gesicht und spähte durch die Finger. »Ich habe keine Ahnung, nicht die leiseste.«
Harrow machte stoisch weiter. »Zusätzlich zu anderen kompromittierenden Einzelheiten haben die Täter alles über einen Undercover-Agenten herausgefunden, den die Polizei vor fünf Jahren erfolgreich in ihre Gang eingeschleust hat.«
Lamb krümmte sich, drückte ihr Gesicht gegen die Knie. Die Welle ging auf sie nieder, schleuderte sie herum, warf sie in den Sand.
»Sie haben unseren Mann in ein Boot verfrachtet und ihn auf hoher See gefoltert«, sagte Harrow.
Kaum hatte er das ausgesprochen, beugte Lamb sich vor, schnappte sich den Abfallkorb und würgte. Nichts kam, aber der Würgereiz ließ nicht nach. Wie durch einen Nebel sah sie, dass Harrow den Hörer seines Telefons hob und hörte, wie er jemanden bat, ihr ein Glas Wasser zu bringen. Als der Würgereiz endlich nachließ, bemerkte Lamb, dass ihr Schoß und ihre Achseln schweißnass waren.
Officer Milstone kam mit einem Glas Wasser herein, stellte es auf die Kante von Harrows Schreibtisch und verschwand wortlos. Lamb traute sich nicht, danach zu greifen. Stattdessen starrte sie es an und konzentrierte sich aufs Atmen.
»Ist er tot?«, stieß sie nach einer Weile hervor.
»Nein. O nein, ist er nicht. Sorry, das hätte ich wohl dazusagen sollen.« Harrow lachte kurz und fies auf, dann besann er sich und verstummte. »Er ist entkommen, ans Ufer geschwommen. Dank der Strömung und seiner Bemühungen ist er schließlich an einem Strand in der Nähe von Palos Verdes angelandet. Er wird wieder.«
Lamb nickte, hielt sich mit einer Hand den Bauch und mit der anderen an der Schreibtischkante fest. Harrow lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, ein Mann, der einem verletzten Tier den Gnadenstoß verpasst hatte und das alles jetzt schnellstmöglich wieder vergessen wollte.
»Ich muss Sie bitten, jetzt nach unten zu gehen«, sagte er zu Lamb, »und diese Uniform wieder auszuziehen.«
1
Zwei Sekunden nachdem Doktor Gary Bendigo auf seinen Parkplatz vor dem Hertzberg-Davis Institut für Forensische Forschung gefahren war und den Motor abgestellt hatte, schiss ihm ein Vogel auf die Windschutzscheibe. Bendigo betrachtete den dünnen weißen Spacker, hörte das unverwechselbar melancholische Gurren der Trauertauben aus den Bäumen über ihm, doch statt diese eindeutigen Zeichen als Omen zu verstehen, dachte er verbittert darüber nach, wie viele Stunden es her war, seit er sein nun wiederum vollgesautes Fahrzeug gewaschen hatte. Er kam auf neun.
Er seufzte. Ein Grund dafür, dass er sein Auto überhaupt in die Waschanlage gebracht hatte, war der Überfall vor einer Woche gewesen, der genau an dieser Stelle stattgefunden hatte. Hier auf seinem Parkplatz vor dem Labor war er ausgestiegen, den Papp-Kaffeebecher von McDonald’s in der Hand, die Krawatte auf Halbmast. Ein junger Reporter mit gewachsten Brauen und knallengem Anzug hatte ihm mit Fragen nach dem Bearbeitungsrückstand in seinem Labor aufgelauert, während sein Kameramann im Hintergrund filmte. Bendigo hatte seinen eigenen Auftritt im Fernsehen gesehen, bei Dateline. Und dabei war ihm, wie auch dem Rest des Landes, aufgefallen, dass auf seiner vor Schmutz starrenden Heckscheibe die Worte »Wasch mich« geschrieben standen, vermutlich vom Nachbarsjungen mit dem Finger hineingemalt.
Das hatte nicht gut ausgesehen. Genauso wenig wie der Rest seines Auftritts.
Doktor Gary Bendigo: ist zu beschäftigt, um sich die Krawatte zu binden.
Oder sich Kaffee zu kochen.
Oder seinen Wagen zu waschen.
Oder endlich die mehr als fünfhundert Testkits in seinem Labor auszuwerten, die der Polizei von Los Angeles bei der Aufklärung von Vergewaltigungen helfen würden.
Er hatte sich gedacht, mit einem sauberen Wagen könnte er der amerikanischen Bevölkerung vielleicht einen anderen Eindruck vermitteln. Doch die Tauben spielten da nicht mit.
Heute standen keine beanzugten Reporter auf dem Parkplatz. Und seltsamerweise hatte auch kein Wachmann neben der Schranke gestanden, so wie an den letzten drei Sonntagen, die Bendigo hier zur Arbeit erschienen war. Noch ein Omen, das er ignoriert hatte. Auf dem State University Drive, den man hinter dem Zaun sehen konnte, herrschte nicht viel Verkehr, auf dem Freeway war es dunkel. Seit drei Wochen war Bendigo hier täglich angetreten, noch bevor sich der Morgennebel über den Hügeln der University of Los Angeles aufgelöst hatte, und hatte erst am Abend, am Ende des Arbeitstags, unter dem orangefarbenen Schein der Straßenlampen den einsamen Weg zu seinem Wagen zurückgelegt. Er hatte sich daran gewöhnt, gelegentlich einem Waschbären, Opossum oder anderem nachtaktiven Getier zu begegnen, das sich in die freie Betonwüste wagte.
Jetzt zog er wie immer seine Karte durch den Leser, trat durch die großen Automatiktüren ins luftige Foyer, warf den üblichen Blick auf das große kalifornische Staatswappen über dem Empfangstresen, eine fröhliche gelbe Sonne, unter die Insignien des Sheriffs und der Polizei gequetscht. Die Tür zu dem Gebäudeflügel, in dem sich die Forensische Spurenanalyse befand, öffnete sich wie üblich nicht beim ersten, sondern erst beim dritten Durchziehen seiner Karte, erst dann schaltete das rote Lämpchen auf Grün und das Quittierungssignal ertönte. Während er mit quietschenden Schuhen über den Linoleumboden des Korridors lief, schaltete er die Beleuchtung ein. Neonröhren blinkten auf, erhellten große, sterile Labore.
Er schaltete weitere Lampen ein, es wurde hell im Computerlabor, Aktenraum und über dem Schild an der Wand, das ihn darauf aufmerksam machte, dass er die Abteilung Forensische Biologie und DNA betrat. Bendigo marschierte direkt in die Büroküche und machte die Kaffeemaschine an, warf einen raschen Blick aufs Schwarze Brett über dem Zucker, Süßstoff und den Teedosen. Seit gestern hing dort eine Liste, auf der man sich fürs Weihnachts-Grillfest eintragen konnte, eingeteilt nach Mitbringseln. Drei Leute hatten ihren Namen bereits in der Spalte »Salat/Beilagen« hinterlassen. Bendigo sah auf seine Uhr und seufzte erneut. Es war gerade mal Mitte Oktober. Nur Wissenschaftler planten einen Salat drei Monate im Voraus.
Mit dem Becher in der Hand, in Gedanken noch bei den zukunftsfixierten Salatneurotikern, betrat er schließlich Labor 21, blieb aber wie angewurzelt stehen, als er im trüben Licht drei Gestalten erblickte. Er brauchte einen Moment, bis er die Einzelteile im Hirn zusammengesetzt hatte und sein Verstand aufschrie. Weil das, was er gerade gesehen hatte, an sich nichts Ungewöhnliches war. Im Labor gab es eine Menge Waffen. In Bendigos Abteilung wurden wöchentlich ein Dutzend Waffen eingeliefert und wieder abtransportiert. Aber diese Waffe in der Hand des Mannes in Jeansjacke war nicht mit einem Schild gekennzeichnet.
Und sie zeigte direkt auf Bendigos Gesicht.
Das war durchaus ungewöhnlich.
Eine Frau hielt eine weitere ungekennzeichnete Waffe in der Hand, diese war auf den Wachmann gerichtet, der zusammengerollt am Boden lag, die Hände hinter dem Rücken gefesselt.
Nicht die Waffen oder das Blut oder die Kabelbinder waren verantwortlich für Bendigos nackte Panik, sondern die Kombination aller drei. Ihre eigenartige Verbindung. Bendigo wurde schlecht. Der Unbekannte in der Jeansjacke bewegte den Lauf der Pistole kurz von Bendigos Gesicht weg auf seinen Becher.
»Gute Idee«, sagte er. »Davon könnten wir mehr gebrauchen.«
***
Sie hatten ihn angewiesen, sich hinzuknien. Bendigo hatte dagestanden wie ein Ölgötze, den Kaffeebecher noch in der Hand, und sich gefragt, wie man zu einem solchen Menschen wurde. Wie wurde ein, sagen wir mal, stinknormaler Typ Mitte sechzig, der gerade zur Arbeit angetreten war und sich wie immer erst mal durch seine E-Mails kämpfen musste, zur – ja, zu was eigentlich? Zur Geisel? Diese beiden sahen aus, als wären sie direkt von ihrem morgendlichen Gassi-Gang mit dem Hund hier ins Labor spaziert. Sie trug Skinny Jeans und hatte ihr gelblich-blondes Haar zu einem wirren Knoten zusammengebunden, er trug eine dicke Brille, so eine mit kantigem Rahmen, wie sie junge Männer heutzutage bevorzugten und mit ausgeblichenen Jeans und penibel zurechtgestutzten Bärten kombinierten. Keine schwarze Einbrecherkluft, keine Balaklavas, keine Bombengürtel. Bendigo zuckte zusammen, als der Mann ihn anherrschte.
»Auf die Knie, verdammt!«
Er stellte den Kaffeebecher auf den Stahltisch, lupfte die Hosenbeine und ging auf die Knie. Als die Frau hinter ihn trat, ihn an den fleischigen Handgelenken packte und einen Kabelbinder überstreifte, versetzte ihm das Adrenalin einen Tritt in die Magenkuhle. Beim Ratschen des Kabelbinders stellten sich ihm die Nackenhaare auf. Das hier passierte wirklich. Der junge Wachmann auf dem Boden sah aus, als wäre er ohnmächtig. Er hatte eine tiefe Wunde an der Stirn und getrocknetes Blut auf dem stoppeligen Kinn. Während er da so lag, schnarchte er auf verschleimte, intime Weise, ähnlich angreifbar hatte Bendigos bester Kumpel ausgesehen, damals, als sie noch klein waren und ihn jemand mit einem Ball umgehauen hatte.
Plötzlich war Bendigos Kehle rau wie Sandpapier.
»Wir haben hier kein Bargeld«, krächzte er. »Das hier ist eine Forschungs- und Testabteilung für …«
»Wissen wir, Gary, wissen wir«, sagte die Frau. Dass sie seinen Vornamen kannte, steigerte seine Angst nur noch mehr. Er zitterte, als sie ihm Armbanduhr und Geldbörse abnahm. Bendigo dachte an Leichen, daran, wie man ihnen sämtliche persönlichen Gegenstände abnahm und sie sorgfältig auf nackten Oberflächen aufreihte. Bereit fürs Eintüten und Kennzeichnen.
»Wer sind Sie?«
»Ich bin Elsie Delaney, und das hier ist Ryan«, sagte die Frau. »Du wirst schon bald kapieren, was hier los ist. Ich helfe dir jetzt beim Aufstehen. Du setzt dich rüber zu Ibrahim hier und dann …«
»Nein. Lass das«, sagte Ryan. »Die beiden bleiben getrennt. Setz ihn da drüben hin.«
Elsie nickte, »Ah, okay. Ich dachte nur, dass die beiden einander vielleicht Gesellschaft leisten möchten. Zum gegenseitigen Trost.«
»Denen geht’s gut«, sagte Ryan. »Alles bestens. Los, mach Kaffee. Immer schön geschmeidig bleiben.«
Bendigo rappelte sich unsicher auf und hoppelte mit Elsies Hilfe in eine Ecke des Labors, einige Meter von Ibrahim, dem Wachmann, entfernt. Jedes Wort, das die beiden Einbrecher miteinander wechselten, hallte in Bendigos Hirn wider, als wären sie in einem Tunnel. Geräusche wurden aus- und plötzlich wieder eingeblendet. Er ließ die Unterbrechung Revue passieren, analysierte alles ganz genau. Der scharfe Ton. Nein. Lass das. Ryan machte die Ansagen. Elsie war offenbar völlig unerfahren. Vielleicht waren sie das beide. Er wusste nicht, was ihm lieber wäre – unerfahrene oder erfahrene Geiselnehmer. Ein Schweißtropfen rann ihm übers Kinn.
Elsie ging in die Büroküche, um Kaffee zu machen. Eine Tasse für sie, eine für Ryan. Sie standen dampfend auf einem Tisch, aber keiner von beiden trank davon.
»Hören Sie«, setzte Bendigo an, »ich bin nicht …«
»Klappe.« Ryan stellte einen Laptop auf den Stahltisch, direkt neben Bendigos Kaffee und seine Armbanduhr. »Das ist die Regel. Du rührst dich nicht. Du hältst die Klappe. Du redest nur, wenn man dich dazu auffordert.«
Bendigo hielt die Klappe. In der Zwischenzeit schob er die gefesselten Handgelenke hin und her und kam sich unnütz vor, er schämte sich, fühlte sich irgendwie schuldig, wie ein Kind, das in der Ecke stehen muss. An jedem Handgelenk trug er einen Kabelbinder, beiden waren mit einem dritten verbunden. Das war gut. So hatte er etwas Spielraum, um seine Schultern zu bewegen, die Arme zu drehen, bei einem einzigen Kabelbinder wäre es für Bewegungen viel zu eng gewesen. Über einige Dinge hatten sich die beiden offenbar schon vorher Gedanken gemacht, bei anderen improvisierten sie einfach.
Sie tranken ihren Kaffee. Jeder nahm zwei Schlucke, mit hängenden Mundwinkeln tauschten sie über den Tassenrand hinweg Blicke, als hätte man sie gezwungen, aus einem Giftkelch zu trinken. Stumm versicherten sie sich und einander, dass alles bestens war.
Dann trat Elsie an eine der drei Reisetaschen auf dem Boden und begann, den Inhalt auszupacken: schwarzglänzende U-förmige Fahrradschlösser, die sie sich wie riesige Armbänder an den Unterarm hängte. Mit sechs Schlössern behängt verschwand sie durch die Doppeltüren, durch die Bendigo vor nicht allzu langer Zeit hereingekommen war. Aus einer anderen Tasche zog Ryan einen Haufen Elektronikzeug und legte es auf die stählerne Oberfläche – Laptops, ineinander verwickelte Kabel, zwei iPhones und riesige Akkus. Aus der Ecke kam ein Stöhnen. Bendigo sah, dass der junge Wachmann wieder zu Bewusstsein gekommen war, er versuchte, seinen Kopf zu heben und sich aufzurichten. Doch vergebens, kurz darauf sackte er wieder in sich zusammen. Ryan, der Bendigos Blick gefolgt war, zuckte ungerührt die Achseln.
»Wir wollen keine Gewalt anwenden, aber wenn es sein muss, machen wir kurzen Prozess«, sagte er, den bohrenden Blick auf Bendigo gerichtet. »Das verstehst du sicher, oder?«
»Ja«, antwortete Bendigo.
»Tu einfach, was wir sagen, dann passiert dir auch nichts.«
»Wozu das alles?«, fragte Bendigo.
Ryan wandte den Blick ab, schwieg. Er trank einen Schluck Wasser aus der Flasche, die er aus der zweiten Tasche genommen hatte. Unter dem Reißverschluss erspähte Bendigo einen Kasten mit Lebensmitteln.
Rationen. Das hier würde länger dauern. Die vorsichtige Art, wie Ryan das Wasser trank und die Flasche wieder zuschraubte, erfüllte Bendigo mit einem mulmigen Gefühl. Sie rationierten ihr Wasser in einem Gebäude voller Waschbecken.
Elsie kehrte zurück, schnappte sich weitere Schlösser und verschwand wieder. Ryan tippte auf dem Laptop herum, öffnete eine Reihe grauer, in Kästen unterteilter Fenster. Sah aus wie Überwachungsbilder.
Als Elsie zurückkehrte, herrschte plötzlich angespanntes Schweigen zwischen den beiden, sie beobachteten einander mit grimmigen Mienen. Elsie holte tief Luft und atmete hörbar aus.
»Bist du noch dabei?«, fragte Ryan.
»Ich glaube schon.«
»Es muss die Mutter sein«, sagte Ryan. »Die Leute empfinden sofort Sympathie, wenn es die Mutter ist.«
»Weiß ich doch. Hab ich nicht vergessen.«
Ryan nahm ein Handy vom Tisch. Damit zeigte er auf Elsie, und Bendigo sah, wie die weiße Lampe neben der Kamera aufleuchtete.
2
Untenrum trug Saskia Ferbodens Computermonitor ein Tutu aus gelben Post-it-Stickern, allesamt mit ihrer schnörkeligen Handschrift bedeckt. Als die Polizeichefin den Hörer wieder aufs Diensttelefon gelegt hatte, zupfte sie eine dieser Notizen von der äußersten Ecke des Bildschirms, es stand nur ein Wort darauf: Hoss. Sie zerknüllte sie und warf sie in den Abfallkorb neben ihrem Schreibtisch. Mehr konnte sie in diesem Moment nicht tun für Charlie Hoskins. Man munkelte, der Undercover-Cop, einer aus ihrem Team, schlafe sich nach seinem unfreiwilligen Schwimmmarathon an der kalifornischen Küste entlang erst mal gründlich aus. Das Pflegeteam hatte ihr mitgeteilt, dass sich seine »Werte« gebessert hätten, was »erfreulich« sei. Keine Ahnung, was das heißen sollte. Er sei außerdem schon wieder in der Lage, »Festnahrung« zu sich zu nehmen. Das klang gut. Saskia stammte aus einer Hundezüchterfamilie, Schäferhunde, von denen einige es sogar in die Ränge der LAPD-Hundestaffel geschafft hatten. Weil sie sich schon von klein auf um die Welpen gekümmert hatte, wusste sie, dass diejenigen, die fraßen, auch durchkommen würden. Hoss würde es schaffen.
Sie blätterte die restlichen Post-its durch und überlegte, was sie bei ihrer üblichen Sonntags-Stippvisite im Büro als Nächstes in Angriff nehmen sollte, bevor sie den Rest des freien Tages genießen konnte. Saskia mochte es nämlich überhaupt nicht, wenn sie am Montagmorgen mit den Restposten der vergangenen Woche beladen an den Start ging. Bei den übrigen Notizen ging es um zwölf Häftlinge, die Ausbeute derjenigen Mitglieder der Death Machines, die sich ihr Einsatzkommando in den vergangenen 96 Stunden hatte schnappen können, also seit dem Anruf, mit dem Hoss ihr atemlos mitgeteilt hatte, dass Operation Hellfire vorbei war. Am Abend zuvor hatte Saskia das Männergefängnis besucht, um ihren Fang zu begutachten. Sie war schwer enttäuscht gewesen. Zwölf Biker, das war echt mickrig, und darunter befand sich kein einziger dicker Fisch. Dean Willis, Franko Aderhold und Mickey Randal – das Trio Infernale – waren untergetaucht, nachdem ihr Versuch, Charlie Hoskins an die Haie zu verfüttern, fehlgeschlagen war. Die einzigen Mitglieder der Outlaw-Bikergang, die Saskias Leute erwischt hatten, waren entweder zu blöd gewesen, um die Warnung ihrer Anführer ernst zu nehmen und sich aus dem Staub zu machen, oder nicht wichtig genug, um überhaupt eine Warnung erhalten zu haben.
Als Nächstes zupfte Saskia einen Zettel mit der Aufschrift »Frischling« vom Monitorrand. Das Polizeirevier von Van Nuys hatte ihr bestätigt, dass die Anfängerin, die für diese ganze Shitshow verantwortlich war, wie auch immer sie hieß, zwei Tage zuvor ihre Entlassungspapiere erhalten hatte. Saskia zerknüllte den Zettel und warf ihn weg.
Dann erhob sie sich, streckte die Arme so hoch sie konnte, bis in der Mitte ihres Rückens ein scharfes Knacken ertönte und sie das Gefühl hatte, dass sich dort etwas gelöst hatte. Durch die Fenster ihres Büros im Verwaltungstrakt hatte sie einen Blick auf die Skyline, die sich heute diesig zeigte. Sie war gerade auf dem Weg zur Tür, um dem Großraumbüro einen kurzen Besuch abzustatten, als ihr Telefon klingelte. Sie kehrte zurück an den Schreibtisch und nahm ab.
»Ferboden«, sagte sie.
»Sass, ich hab Jason von der LA Times auf Leitung drei«, sagte die Frau von der Zentrale. Aus Gewohnheit gab Saskia ihren speziellen Seufzer von sich, reserviert für Journalisten und Reporter, die es wagten, sie direkt anzurufen, aber weil es sich um Jason handelte, nahm sie den Anruf trotzdem entgegen. In den vergangenen Jahren war sie ein paarmal mit ihm um die Häuser gezogen, wenn es in größeren Fällen zu einer Verurteilung gekommen war, und einmal waren sie in einer Karaoke-Bar in Chinatown gelandet, er ohne Hemd, sie mit ein paar zu viel Negronis im Kahn. Das gegenseitige Vertrauensverhältnis wollte gepflegt werden.
»Sass?«
»Hallo, Jason. Wie geht’s, wie steht’s?«
»Besser als bei dir, kann ich mir vorstellen.«
»Jo.« Saskia seufzte so tief, dass es in der Leitung knisterte. Er wollte vermutlich ein Update zu Hoss. »Immer eine Freude, dieser Job.«
»Bist du schon auf dem Sprung?«, fragte Jason. »Ich hab dich wohl gerade noch erwischt.«
Saskia lief es eiskalt den verspannten Rücken herunter. »Was? Wie? Auf dem Sprung wohin genau?«
»Zum Labor?«, fragte Jason.
»Wovon redest du?«
Schweigen. Saskia wurde schlecht.
»Ach du lieber Himmel.« Jasons Atem ging schneller. »Vielleicht haben sie … vielleicht haben sie es nur an uns geschickt …«
»Jason, ich verstehe nicht …«
»Schau in deine Mails«, sagte er.
Mit flauem Gefühl in der Magengegend umrundete Saskia ihren Schreibtisch und tappte den Computer aus dem Schlaf. Die Mail von Jason war bereits eingegangen. Sie klickte auf den Anhang, ein Video. Eine Frau um die vierzig mit einem wirren Haarknoten auf dem Kopf. Sie war schlank, kantig, die deutlich zu erkennende Anspannung ließ ihre Kehle sehniger und das Kinn spitzer wirken. Sie kam Saskia irgendwie bekannt vor. Rasch klickte sie sich vor, bemerkte die Kante eines Stahltischs neben der Frau, mehrere Schilder an der Wand über einer Stahlspüle. Eine Kantinenküche? Labor? Auf dem Tisch stand etwas. Der Rand eines Laptops, vielleicht. Ein paar Kabel.
Die Frau hielt sich ein Schild vor die Brust, klammerte sich daran fest wie ein Kind an sein Stofftier.
»Hallo«, sagte sie mit zitternder Stimme. Sie räusperte sich, danach klang sie härter, bestimmter. »Ich heiße Elsie Delaney.«
Saskia bekam weiche Knie. Sie ließ sich auf ihren Stuhl fallen.
Elsie drehte das Schild um. »Das hier ist meine Tochter, Tilly Delaney.«
Saskia betrachtete das Foto des Kindes. Obwohl sie es schon hundertmal gesehen hatte, berührte sie es immer noch. Das breite Lächeln. Die Apfelbäckchen und schokobraunen Kringellöckchen. Das Eis, wie ein Mikrofon in die Kamera gestreckt.
»An diesem Tag vor … zwei … Jahren« – Elsies Augen waren jetzt schmal, ihre Hände zitterten vor Wut – »ist Tilly am Santa Monica Beach verschwunden. In den siebenhundertdreißig Tagen seit ihrem Verschwinden hat die Polizei nichts – absolut nichts – getan, um sie zu finden und zu ihrem Vater, ihrer Schwester und zu mir zurückzubringen.
»Um Gottes willen«, flüsterte Saskia in den Hörer, mittlerweile schweißfeucht an ihrem Ohr. »Jason, das ist jetzt kein Selbstmordvideo, oder? Ich will nicht sehen, wie …«
»Schau einfach zu«, sagte Jason.
Die Perspektive wechselte. Derjenige, der Elsie filmte, machte jetzt einen Kameraschwenk, der die Umgebung zeigte. Saskia erkannte, dass sie sich wie vermutet in einem Labor befanden. Leere Stahltische. Spülen. Maschinen, Geräte, Forschungsapparaturen. Ihr Blick scannte den Bildschirm ab, sie versuchte, so viele Einzelheiten wie möglich abzuspeichern. Wie Elsies Gesicht lösten auch diese Bilder etwas bei Saskia aus, sie wusste nur noch nicht genau, aus welchem Kontext sie ihr vertraut vorkamen. Schließlich richtete sich die Kamera auf zwei Männer. Einer lag auf der Seite am Boden, er war jung und trug eine Art Uniform. Weißes Hemd, Schulterklappen, schwarze Hose. Der andere, älter, mit Bierbauch, saß mit erschütterter, schicksalsergebener Miene an einen Stahltisch gelehnt am Boden. Beiden hatten die Hände hinter dem Rücken gefesselt.
Elsie Delaneys Stimme war weiterhin aus dem Off zu hören. »Mein Mann Ryan und ich haben das Labor 21 im Hertzberg-Davis Institut für Forensische Forschung besetzt. Und wir werden hier … eine Menge Schaden anrichten, wenn man … unsere Forderungen nicht erfüllt.«
»Fuck!« Saskia raufte sich mit einer Hand die Haare, mit der anderen umklammerte sie den Hörer fester. »Verdammte Scheiße!«
»Wir wollen, dass man uns innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden unsere Tochter zurückbringt«, sagte Elsie.
Saskias Handy vibrierte auf dem Schreibtisch. Sie spähte aufs Display und las dort den Namen des Anrufers: Ike Grimley, Bürgermeister von Los Angeles.
»Wir wollen nur unsere Tochter zurück. Mehr nicht«, schloss Elsie. Die Kamera richtete sich nun wieder auf die Mutter mit dem Foto ihrer Tochter vor der Brust. Jetzt konnte Saskia erkennen, dass sie in der anderen, gesenkten Hand eine Waffe hielt. Wie unzählige andere Mütter, deren Kinder vermisst wurden, hatte auch Elsie diese aufgerissenen, feuchten Augen und wirkte wie von einer mächtigen, gefährlichen Mischung aus Panik und Zorn getrieben.
»Wir wollen niemanden verletzen«, sagte Elsie.
Saskia schluckte schwer.
»Aber wenn es sein muss, werden wir auch das tun.«
Das Video endete.
***
Zehn Minuten lang herrschte Schweigen. Bendigo zählte mit, den Blick auf die Wanduhr gerichtet. Dann atmete Elsie Delaney hörbar aus, offenbar wollte sie Ryans Aufmerksamkeit. Der Mann mit der dicken schwarzen Brille ließ sich nicht ablenken, er starrte aufs Display seines Handys. Bendigo konnte nicht anders, er analysierte jedes Detail ihrer Mimik und Gestik, den Klang ihrer Stimmen, ihren Ton, die Tatsache, dass Elsies Haarknoten sich langsam löste und Ryan an den Fingernägeln kaute. Hatten diese beiden die Situation tatsächlich im Griff? Wie angreifbar waren sie?
Elsie schnaubte erneut, diesmal hob Ryan die Hand, ohne den Blick von seinem Handy abzuwenden.
»Ich weiß«, sagte er, »ich weiß.«
»Nichts?«
»Nein, nichts.« Ryans Daumen schwebte über dem Display. »Ich würde es dir sagen, El. Das weißt du doch.«
»Sie sollen doch keinen Artikel über uns veröffentlichen! Es ist ein scheiß Erpresservideo«, zischte Elsie.
»Komm mal wieder runter.« Ryan nahm sie ins Visier, sein Blick war finster. »Entspann dich, okay? Sie brauchen Zeit. Jemand muss sich das Video ansehen. Sie müssen prüfen, ob es ein Scherz ist oder echt. Dann müssen sie es der Chefetage vorlegen. Dann müssen die entscheiden, ob es veröffentlicht wird. Und das sind nur die Reporter bei der LA Times. Die müssen es weiterleiten ans LAPD, wo das ganze Prozedere wieder von vorn losgeht. Eine Reaktion erfordert mehr als dreißig Sekunden.«
»Das waren keine dreißig Sekunden, sondern zehn Minuten.«
»Elsie, komm schon.«
Bendigo zuckte zusammen, als sich der Sicherheitsmann abrupt aufsetzte. Aus der schlaffen, schnarchenden Marionette war innerhalb von Sekunden ein lebendiger Mensch geworden, der jetzt baff und mit blutverschmierter Stirn dasaß.
»Was zum Teufel?« Der junge Mann kam umständlich auf die Knie und versuchte, seine Hände zu befreien. »Was … was ist hier los?«
»Bleib ganz ruhig«, sagte Bendigo. »Alles okay, Kumpel. Alles okay.«
Der Sicherheitsmann entdeckte Elsie und Ryan, die über dem Handydisplay kauerten. »Wo sind wir?«, fragte er.
Bendigo seufzte. »In einem von unseren Laboren. Nur … nur Ihre Hände sind gefesselt, junger Mann. Halten Sie still. Sie haben vermutlich eine Kopfverletzung und eine Gehirnerschütterung.«
Der Sicherheitsmann erstarrte. Jetzt, da er aufrecht saß, sah Bendigo seine Marke, die er an seiner Hemdtasche festgeklippt hatte. Ein körniges Foto und sein Name in dicken Lettern: Ibrahim Solea.
Ryan legte das Handy auf den Tisch. Das, worauf die beiden Geiselnehmer wohl gewartet hatten, war offenbar vollbracht. Sie fielen sich in die Arme, Elsie kuschelte sich an Ryans Brust, Ryan legte ihr seine Riesenpranke in den Nacken.
»Wir finden sie«, sagte Ryan. »Wir finden unsere Kleine. Egal, wie.«
»Ich weiß«, sagte Elsie.
Plötzlich schrillte eine Klingel. Alle vier Personen im Labor zuckten zusammen. Es war die Notglocke am Vordereingang. Als Ryan und Elsie vom Tisch zurücktraten, erkannte Bendigo auf dem Laptopmonitor eine Frau, die am Lieferanteneingang neben dem Haupteingang stand. Er spähte angestrengt auf den Bildschirm und meinte zu erkennen, dass sie einen Notizblock unterm Arm hatte.
»Wer zum Teufel ist das?«, stieß Ryan hervor, seine Augen waren aufgerissen und panisch. Er wandte sich an Bendigo, drehte den Laptop, damit der besser sehen konnte. »Raus mit der Sprache. Es ist Sonntag. Niemand außer dir und dem hier sollte hier sein. Wer ist das, verdammte Hacke?«
Bendigo wurde es auf einmal eiskalt. Ryan und Elsie wussten, dass er jeden Sonntag hergekommen war, Sonderschichten eingelegt hatte, um den Verzug aufzuholen Hatten sie ihn etwa observiert?
»Wer ist das?«, frage Elsie.
»Woher soll ich das wissen? In diesem Gebäude arbeiten sicher fünfhundert Leute. Warum drücken Sie nicht einfach auf die Gegensprechanlage und fragen sie?«
Ryan überlegte kurz. Aber vielleicht erkannte er in Bendigos Augen so etwas wie Hinterlist, sah, dass sich seine Halsmuskeln anspannten, als wollte er gleich losschreien. Bendigo hatte nämlich schon Sekunden nach dem Schrillen der Klingel einen Plan gefasst. Er würde tief Luft holen und der Frau zubrüllen, dass sie abhauen sollte, sobald Ryan den Knopf der Gegensprechanlage gedrückt hätte. Doch Ryan verzog die Lippen zu einem fiesen Grinsen und schüttelte den Kopf.
»Ich bleibe bei den beiden«, sagte er zu Elsie. »Du holst sie hier rein. Drei Geiseln sind besser als zwei.«
3
LEERanchos Palos Verdes Parks and Recreation, Ranger Lee.
HOSKINSHey, Lee! Wie geht’s?
LEEGut. Bestens. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir?
HOSKINSMein Name ist Charlie Hoskins. Ich bin Detective beim LAPD.
LEEAh. Okay. Ich höre.
HOSKINSDie Leute vom Hauptquartier haben mir Ihre Nummer gegeben. Sie meinten, Sie könnten mir helfen, eine Person zu finden.
LEEMal sehen, ob ich das kann.
HOSKINSLetzten Mittwoch gab es in der Nähe vom East Beach einen Rettungseinsatz. Ein Mann trieb in der Bucht und wurde von einer Frau aus dem Wasser gezogen. Haben Sie davon gehört?
LEEJa! Hab ich! Ja. Unglaublich war das.
HOSKINSTotal.
LEEEin paar Typen, Surfer, haben sich darüber unterhalten.
HOSKINSLiegt Ihnen dazu ein Einsatzbericht vor?
LEENein. Hören Sie, Detective. Um diese Jahreszeit haben wir an den Stränden keine Rettungsschwimmer. Wir müssen uns mit ein paar Rangern wie mir und meinem Team begnügen, die auch ab und zu mal an den Stränden vorbeischauen, Sie wissen schon, illegale Camper und Betrunkene.
HOSKINSAha.
LEEWenn jemand im Wasser in Not gerät und ein anderer ihm hilft, tja, dann erfahren wir das nur, wenn es jemand bei uns meldet. Oder wenn die Einheimischen drüber reden.
HOSKINSAlso war sie keine Rettungsschwimmerin? Die Frau, die ihn aus dem Meer gezogen hat?
LEENee. Also zumindest keine von uns. Ich habe zwei Rettungsschwimmerinnen im Team und eine ist im Urlaub in Italien und die andere ist meine Frau. Ich gehe mal davon aus, dass sie mir davon erzählt hätte, wenn sie einen nackten Mann aus dem Wasser gezogen hätte.
HOSKINSVerstehe.
LEEWer auch immer das war, die Frau hat gewusst, was sie da macht. Überhaupt da rauszuschwimmen. Die Strömung in der Bucht ist nicht witzig. Und eigenhändig einen Kerl reinschleppen? Der war kein Hänfling, haben Flick und Zero jedenfalls gemeint.
HOSKINSWer?
LEEFlick und Zero. Die beiden Surfer, die mitgeholfen haben.
HOSKINSAha.
LEEKeine Ahnung, wie die in echt heißen, falls Sie das wissen wollen. Obwohl … Moment … Zero heißt in Wahrheit John, glaub ich.
HOSKINSSie könnten mir nicht zufällig Johns Handynummer geben?
LEEÖhm … warum nicht. Ich muss nur … äh … nachschauen, irgendwo müsste sie …
HOSKINSDanke.
LEEWer war der Typ denn überhaupt? Darf ich das fragen? Nur so ein Idiot, der sich zu weit rausgewagt hat, oder …?
HOSKINSSo was in der Art, ja.
Charlie Hoskins saß in seinem winzigen Krankenzimmer und ließ die Haarschneidemaschine in seiner Hand vibrieren. Es dauerte einen Moment, bis er sich daran erfreuen konnte, das laute Surren zu hören. Fünf Jahre lang hatte er von diesem Augenblick geträumt. Sich die Maske vom Gesicht zu reißen. An den Koteletten setzte er an, dann schob er das Gerät langsam Richtung Schläfe. Im Waschbecken lag bereits sein abgeschnittener Rattenschwanz, schlaff und feucht wie ein kleines, verletztes Tier. Während er sich die Maschine über den Schädel schob, regneten immer mehr Haarsträhnen ins Becken, lautlos, sanft.
An der bereits kahlrasierten Stelle manövrierte er die Maschine vorsichtig um die lange, vertikale Wunde, die in der Mitte prangte, vernäht, aber die Fäden noch nicht gezogen. Die gezackte, an den Rändern aufgeworfene Linie befand sich an seinem Oberkopf, wo Franko ihm mit einer Eisenstange den Schädel eingeschlagen hatte. Beim Rasieren sah er es plötzlich wieder vor sich: Dean, der ihn ablenkte, während Franko sich von hinten anschlich. Er erinnerte sich noch deutlich an die letzten Sekunden von Operation Hellfire. Seine nackte Panik, als Deans Lippen sich zu einem wissenden Grinsen verzogen hatten, das alles erstickende Gefühl des Terrors, als würde ihn ein Riese in den Schwitzkasten nehmen. Er war aufgeflogen. Das Spiel war aus.
Die Gang hatte herausgefunden, wer er wirklich war.
Als die Eisenstange auf seinem Schädel landete, waren die Lichter an der fernen, nächtlichen Küste zersprungen wie Glasscherben, und der Horizont war seitlich weggekippt. Dann gaben seine Beine nach und er krachte mit dem Kinn aufs Deck. So winzig fühlte er sich, wie er da auf dem Boot lag, mitten im weiten, endlosen Ozean.
O Gott, dachte er, als er Frankos Hände an seinen Fesseln spürte und man ihn über die Schiffsbalken zog, auf die Decksluke zu. O Gott, bitte, bitte nicht!
Nicht jetzt.
Nicht hier.
Schon zu Beginn seiner Karriere hatte Charlie gelernt, dass man Erinnerungen nicht unterdrücken sollte. Wenn man traumatische Erlebnisse verdrängte, gab man ihnen nur noch mehr Macht. Es war besser, sie laufen zu lassen. Er war fertig mit der Rasur, sein Bart ab, der Kopf geschoren, und die Bilder von der Nacht auf See, als er fast gestorben wäre, zogen langsam ab.
Er säuberte das Waschbecken, schob die Maschine wieder in den Rucksack, den sein Freund Surge ihm gebracht hatte, und zog einen Satz frische Klamotten hervor. Nachdem er sich des Krankenhausleibchens entledigt hatte, schlüpfte er in Jeans und streifte ein schwarzes T-Shirt über. Charlies Körper war wund, alles ächzte und knirschte, die Wundnähte ziepten, die Blutergüsse schmerzten, und seine müden Muskeln verweigerten ihm den Dienst. Am liebsten hätte er sich wieder hingelegt, sich dem seltsamen Hintergrundkonzert hingegeben, dem Piepsen und Rasseln und gemurmelten Lautsprecheransagen, aber er war hier nicht sicher. Tief im Rucksack vergraben lagen eine Beretta, ein Wegwerfhandy und ein Autoschlüssel. Genau das, was er bestellt hatte, sogar die Marke der Waffe stimmte, und die gewünschte Zusatzmunition war auch dabei. So war Surge. Gründlich. Zuverlässig. Die Charlie verschriebenen Schmerztabletten und Antibiotika standen auf seinem Nachttisch parat, in Papiertüten mit dem Logo der Krankenhausapotheke. Charlie stopfte sie in den Rucksack und zog den Reißverschluss zu.
Mit dem neuen Handy rief er in der Zentrale an und bat darum, mit dem Schwesternzimmer auf Station C im Ostflügel verbunden zu werden. Kurz darauf hörte er das nur ein paar Meter von ihm entfernte Telefon klingeln.
»Station C, Schwester Lori am Apparat.«
»Lori, hier ist Thomas vom Empfang«, log Charlie.
»Verzeihung, wer ist da?«
»Tom Edgeworth, Krankenhaus-Security. Ist die Oberschwester in der Nähe? Schwester Allison?«
»Nein. Tut mir leid. Sie hat jetzt keinen Dienst. Kann ich Ihnen weiterhelfen?«
»Sie haben auf Station C zwei Polizisten, oder?«
»Ähm … ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen …«
»Hier in meinem Sicherheitslogbuch ist notiert, dass zwei Polizisten zur Bewachung eines Patienten auf Station C abgestellt sind.«
»Ja«, sagte Lori, »das stimmt.«
»Könnten Sie einen von ihnen ans Telefon holen?«
Charlie wartete. Schon bald hörte er, wie sich auf dem Flur vor seinem Zimmer eine Unterhaltung entspann; Schwester Lori hatte das schnurlose Telefon mitgenommen, um es einem der beiden Polizisten zu übergeben, die auf Charlie aufpassen sollten. Er setzte sich aufs Bett und mühte sich unter Schmerzen mit seinen Stiefeln ab, das Handy zwischen Ohr und Schulter festgeklemmt. Die Stiefel waren zu klein, aber sie mussten reichen.
»Hallo?«
»Hier ist Tom Edgeworth.« Charlie nahm die Beretta vom Bett und schob sie sich hinten in den Bund seiner Jeans. »Ich bin von der Security.«
»Ja, und?«
»Ihr passt da oben auf einen besonderen Patienten auf, richtig?«
»Kann sein, aber was …?«
»Ich hab mir gedacht, ich sollte euch vielleicht informieren. Wir haben hier gerade einen verdächtig aussehenden Typen in den Lift steigen sehen, er ist offenbar auf dem Weg zu Station C. Ich verfolge ihn hier auf dem Überwachungsmonitor. Kann harmlos sein, aber ich dachte, euch vorwarnen schadet nicht.«
»Jep. Jep, wir kümmern uns drum.«
»Ich schicke euch noch zwei von unseren Männern hoch. Vielleicht solltet ihr …«
»Wir halten ihn auf.«
Der Polizist beendete das Gespräch. Charlie lauschte an der Tür. Er zählte bis zehn, dann schob er sie vorsichtig auf und spähte in den Flur. Die beiden Uniformierten waren auf dem Weg zum Schwesternzimmer: angespannt, den Blick nach vorn gerichtet, wie Hunde in einer Wohnung, die im Treppenhaus Schritte gehört hatten. Charlie seufzte und trat kopfschüttelnd hinaus auf den Gang, um sich in die entgegensetzte Richtung, zum Notausgang, zu schleichen.
***
Schon im Vorbeigehen war ihm die junge Frau in der Raucherecke aufgefallen, die ihm jetzt folgte. Charlie eilte mit gesenktem Kopf quer über die halbkreisförmige Auffahrt vor dem Krankenhaus in Richtung Hauptstraße, als er sie aus dem Augenwinkel bemerkte. Sie stürzte aus dem Eingang und joggte die Auffahrt entlang, vorbei an besorgten Patienten und Besuchern, die das Letzte aus ihren Glimmstängeln herausholten und die Kippen dann in die mickrige Hecke entsorgten. Dann wurde sie auf einmal langsamer, sie hatte ihn entdeckt, beobachtete ihn, wartete auf den passenden Moment – was genau sie vorhatte, wusste er nicht. Während er die Normandie Avenue überquerte, behielt Charlie sie ihm Blick, verfolgte ihre Bewegungen im Schaufenster eines kleinen Cafés. Für die Death Machines war sie zu jung und hübsch, aber verlassen wollte er sich nicht darauf. Unvermittelt bog er von der 257sten in eine Seitenstraße ab und verschwand in ein Einkaufszentrum, blinzelte ein paarmal, um die grünlichen Flecken zu vertreiben, die ihm vor den Augen flirrten, weil er plötzlich aus dem grellen Sonnenlicht ins Halbdunkel abgetaucht war. Er hastete an einem Doughnut-Laden und Nagelstudio vorbei durch den Hinterausgang und die Auffahrtsrampe hinunter ins Parkhaus. Hinter einem der Stützbalken wartete er auf sie. Als sie an ihm vorbeikam, trat er dahinter hervor, packte sie so heftig am T-Shirt, dass sie den Bodenkontakt verlor.
»Was willst du, verdammt?«
»O Scheiße!« Ihre weichen Finger krallten sich an ihm fest, sie hing in ihrem T-Shirt wie eine Schildkröte im Panzer. »O Gott, es tut mir leid. Tut mir so leid. Ich …«
»Warum verfolgst du mich?«
»Bitte, lassen Sie mich los. Sie tun mir weh!«
Charlie ließ sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Die junge Frau zog sich das T-Shirt zurecht und zupfte am Bündchen herum, um Zeit zu gewinnen, während ihre Lippen zitterten und ihr die Tränen kamen.
»Ich bin Lynette Lamb«, sagte sie schließlich, als würde sie Charlie mit dieser Information irgendwie weiterhelfen. Er gab sich alle Mühe, die Puzzleteile zusammenzusetzen: dieses junge Ding hier, ihr Name, ihr unmittelbar bevorstehender Nervenzusammenbuch. Wer auch immer sie sein mochte, sie kämpfte tapfer, aber auf verlorenem Posten gegen die Öffnung ihrer Schleusentore. Ihr Gesicht war puterrot, die darin herumwischenden Hände zitterten.
»Der Name sagt mir gar nichts, mein Täubchen«, sagte Charlie. »Falls du ein Interview willst, hast du leider Pech gehabt.« Mit diesen Worten wandte sich Charlie zum Gehen.
»Ich bin keine Reporterin! Ich bin die Polizistin«, sagte sie.
Charlie blieb stehen. Auf einmal war die Atmosphäre aufgeladen. Irgendwo hupte jemand, ein Motor heulte auf. Sein Kiefer war so angespannt, dass es schmerzte. Als Charlie sich umwandte, sah er direkt in die verheulten Augen der jungen Frau.
»Diejenige, wegen der Sie aufgeflogen sind«, fügte sie hinzu.
»Du?« Er musterte sie von Kopf bis Fuß. Seine Augen wurden schmal. »Du?«
»Ja, ich.« Sie schien sich wieder in den Griff zu bekommen, wenn auch nur aus Empörung. »Was soll das heißen?«
Er wollte antworten, aber er war einfach zu müde.
»Was?«, forderte sie.
»Du bist noch so jung.«
Während Charlie überlegte, wie er aus dieser Situation rauskommen sollte, pulte er an den Fäden in seiner Kopfwunde herum. »Hör zu. Es tut mir leid, dass ich dich so hart angefasst habe. Und ich bin sicher, dass es dir leidtut, dass du mich fast umgebracht hast. Also sind wir quitt, Miss Lamb. Okay?«
Sie öffnete den Mund.
»Adiós«, sagte er und dampfte ab.
Er war schon fast an der Ecke des Parkhauses angelangt, wo Surge den Wagen bereitgestellt hatte, als sie, erstaunlicherweise immer noch hinter ihm, endlich was sagte.
»Mir tut es nicht leid, dass Sie fast ums Leben gekommen sind.«
Charlie blieb stehen.
Er wandte sich um.
»Es war nicht meine Schuld«, fuhr Lamb fort. »Ich hab nichts falsch gemacht, okay? Absolut nichts. Ich war mit meinen Freunden was trinken, hab meinen Erfolg gefeiert, was mir völlig zusteht. Und dann habe ich einen Mann mit nach Hause genommen, was mir genauso zusteht. Dann bin ich eingeschlafen, und der Mann war noch bei mir, unüberwacht, denn auch das steht mir zu.«
»Was erzählst du da für einen Bl…«, setzte Charlie an, aber sie hatte ihre Rede angefangen, also würde sie sie auch zu Ende bringen.
»Dass dieser Brad Alan Binchley sich eigenmächtig Zugang zu meinem Computer verschafft und meine Polizei-Logindaten benutzt hat, um sich in geheime Dateien zu hacken, ist nichts, was ich oder irgendein normaler Mensch auf dieser Welt hätte vorausahnen können!«, zischte Lamb und tippte sich zur Betonung auf die Brust.
Charlie beobachtete sie. Die Schranke zum Parkhaus ging hoch und entließ die Autofahrer in den Sonnenschein. Als die junge Frau einen tiefen, zittrigen Atemzug nahm, fiel ihm auf, wie müde und derangiert sie aussah. Nachdem sie von seinem Schicksal erfahren hatte, war sie vermutlich direkt ins Krankenhaus geeilt und hatte stundenlang in der Wartehalle herumgesessen, in der Hoffnung, ihn beim Herausgehen zu erwischen. Es bewies ein gewisses detektivisches Gespür, dass sie in den Polizeiakten ein Foto von ihm erspäht und erraten hatte, in welchem Krankenhaus er lag. Auch ihr Plan – wenn auch hanebüchen –, ihn mit etwas Geduld in der Wartehalle abzupassen, war fast aufgegangen. Und jetzt setzte diese Lynette Lamb all ihre Karten darauf, dass er ihr bis zum Ende ihrer Ansprache zuhören würde. Es gelang ihm allerdings nicht, diese seltsame Entschlossenheit, ja diesen Mut, mit dem sie ihn ausfindig gemacht und ihm unter die Augen getreten war, mit ihrer Unfähigkeit zusammenzubringen, ihre Emotionen unter Kontrolle zu bringen. Beim Anblick ihres zarten, zitternden Kinns kam er sich richtig schäbig vor.
»Was Ihnen passiert ist, ist wirklich bedauerlich, Detective Hoskins«, sagte sie, während sie sich zur vollen Größe aufrichtete – also ein paar Zentimeter mehr –, um ihre Ansprache zu beenden. »Aber ich habe Ihnen das nicht angetan.«
Charlie gönnte ihr ein paar Sekunden Triumph. Dann sagte er: »Bist du jetzt fertig?«
»Ja.«
»Gut, ich muss nämlich los.«
»Sie gehen nirgendwohin.« Sie hatte ihre Schlacht gewonnen, ihre Augen waren trocken, und in Sekundenschnelle hatte sie sich neben ihm positioniert, noch während er die Autoschlüssel aus seinem Rucksack zog. »Sie müssen mir helfen.«
Charlie lachte auf. »Ach, muss ich das?« Er drückte auf den Knopf und sah in der äußersten Ecke des Parkdecks die Rückleuchten eines silberfarbenen Kia aufblinken. »Das wird ja immer besser.«
»Ich wurde gefeuert. Wussten Sie das?«
»Nein. Aber es überrascht mich nicht.«
»Ich hatte keinen einzigen Einsatztag.«
»Noch weniger überraschend.«
»Jetzt wissen Sie Bescheid.« Sie seufzte dramatisch und fuchtelte herum. »Und weil Sie jetzt meine Situation kennen und verstehen, können Sie mir helfen, meinen Job wiederzukriegen.«
Charlie schüttete sich schier aus vor Lachen, derart heftig war sein Anfall, dass er sich an der Autotür festhalten musste, um nicht umzukippen. So herzlich hatte er schon lange nicht mehr gelacht, herrlich war das, auch wenn ihm dabei alles wehtat.
»Hahaha!«, stieß er hervor.
»Was? Was ist daran so witzig?«, zischte Lamb. »Wieso lachen Sie?«
Charlie seufzte, rieb sich das stoppelige Kinn. »Hör gut zu, Miss Lamb. Die Sache ist die: dass der Typ, den du aus einem Nachtclub abgeschleppt hast, sich als eingeschworenes Mitglied der Outlaw-Bikergang entpuppen könnte, der dich nur benutzt, um sich Zugang zu geheimen Polizeiakten zu verschaffen? Ja, du hast recht, das klingt ziemlich abwegig. Auf keinen Fall hättest du das ahnen können.«
Lamb sah ihn dankbar an.
»Aber du hast mir hier gerade wunderbar demonstriert …« – Charlie wandte sich um und wies auf den Weg, den sie soeben zurückgelegt hatten – »dass du dich aus unzähligen Gründen nicht für den Polizeidienst eignest.«
»Wa… Wie bitte?« Ihre Stimme überschlug sich fast vor Empörung.
»Du passt nicht in diesen Job.«
»Tu ich wohl! Ich bin nämlich …«
»Schon beim ersten Problem kommst du angelaufen und bittest jemanden um Hilfe, statt es auf eigene Faust zu lösen«, sagte Charlie. »Dazu hast du dir auch noch den genau Falschen ausgesucht. Ich bin müde, verstehst du? Außerdem verstecke ich mich vor den Vollstreckern der Death Machines, die sie nicht erwischt haben, als Operation Hellfire in Flammen aufgegangen ist. Wegen dir, wegen dem Mist, den du verzapft hast, auch wenn du es nicht wolltest, habe ich jetzt eine Metallplatte im Schädel und bin mit genug Schmerzmitteln zugedröhnt, um ein Rennpferd ins Koma zu versetzen. Das macht mich so ungefähr zur letzten Person auf der Welt, die dir im Moment helfen würde oder könnte.«
Nachdem Charlie die Fahrertür geöffnet und seinen Rucksack auf den Rücksitz geworfen hatte, wandte er sich um und sah seiner Verfolgerin ins Gesicht. In ihren Augen hatten sich schon wieder Tränen gesammelt.
»Das ist das vierte Mal, dass du während einer einzigen Unterhaltung fast in Tränen ausgebrochen wärst«, sagte er. »Du hast nicht das Zeug zur Polizistin. Okay? Kapierst du das? Für den Polizeidienst ungeeignet.«
Kaum war er ins Auto gestiegen und hatte die Tür zugeknallt, musste er fassungslos mit ansehen, wie sie auf die Beifahrerseite flitzte, die Tür aufriss, bevor er noch die Zentralverriegelung aktivieren konnte, und sich wie selbstverständlich neben ihn pflanzte.
Er stöhnte auf. »Hau ab! Bitte.«
»Nein.« Sie wischte sich mit dem Handrücken die Nase ab. »Meine Tränen sind nur eine Reaktion auf einen emotionalen Erregungszustand, den ich normalerweise unter Kontrolle habe. Nur weil ich weine, heißt das nicht, dass man mich nicht ernst nehmen kann.«
Charlie schnaubte. »Nicht?«
»Nein, heißt es nicht. Auf der Akademie habe ich intensiv daran gearbeitet und habe die Sache mittlerweile im Griff.«
»Ach ja?«