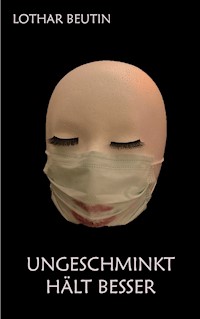Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Berlin, kurz nach dem Mauerfall 1990. In einer Behörde für Lebensmittelsicherheit kommt der frischgebackene Universitätsabsolvent und Mikrobiologe Leo Schneider mit einer Welt in Berührung, in der nur die Bedürfnisse eines bürokratischen Apparates und die persönlichen Vorlieben seines Chefs zählen. Mitten in einer persönlichen Beziehungskrise begegnet Leo Schneider seiner französischen Kollegin Sandrine Martin, die in Frankreich keine Arbeit mehr findet, weil sie mit ihren Forschungen einem kriminellen Geflecht von Alkoholpanschern und Lebensmittelvergiftern gefährlich geworden ist. Gemeinsam schaffen es Sandrine Martin und Leo Schneider in Berlin, weitere wissenschaftliche Beweise für die kriminellen Aktivitäten eines Netzwerkes aus Politik und Wirtschaft zusammenzutragen. Die Rückkehr von Sandrine nach Frankreich und Leos Suche nach der Wahrheit in der Normandie mündet in dem dramatischen und tragischen Höhepunkt dieser Geschichte um Liebe und Treue, Wahrheit und Verrat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lothar Beutin
Fallobst
ein Wissenschaftskrimi
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
1. Das Leben ist ganz einfach, man muss nur wissen, was zur rechten Zeit zu tun ist!
2. Bonnesource, Normandie, 15. August 1990
3. Université Paris-Sud, 16. August 1990
4. Université Paris-Sud, 17. August 1990
5. Berlin-Friedenau, 1. September 1990
6. Berlin-Dahlem, 3. September 1990
7. Berlin-Dahlem, 4. September 1990
8. Université Paris-Sud, 1. Oktober 1990
9. Berlin-Dahlem, 8. Oktober 1990
10. Berlin-Dahlem, 5. November 1990
11. Université Paris-Sud, 14. November 1990
12. Berlin-Dahlem, im Frühjahr 1991
13. Berlin, Friedrichstraße, 15. April 1991
14. Berlin-Dahlem, Juni 1991
15. Université Paris-Sud, 21. Juni 1991
16. Issy-les-Moulineaux, Juli 1991
17. Berlin-Dahlem, 25. Juni 1991
18. Berlin-Dahlem, 26. Juni 1991
19. Sète, Côte d’Azur, 27. Juni 1991
20. Berlin-Dahlem, 28. Juni 1991
21. Berlin-Dahlem, Juli 1991
22. Paris-Berlin, Juli 1991
23. Berlin-Dahlem, Juli 1991
24. Issy-les-Moulineaux, Juli 1991
25. Université Paris-Sud, 15. Juli 1991
26. Blagny, Pays d’Auge, 19. Juli 1991
27. Berlin-Dahlem, 26. Juli 1991
28. Bonnesource, 26. Juli 1991
29. Berlin-Dahlem, 29. August 1991
30. Domrémy, Lothringen, 6. September 1991
31. Berlin-Charlottenburg, 7. September 1991
32. Lisieux, Normandie, 8. September 1991
33. Berlin-Dahlem, 9. September 1991
34. Université Paris-Sud, 23. September 1991
35. Bonnesource, Pays d’Auge, 25. September 1991
36. Boulogne-Billancourt, 23. September 1991
37. Université Paris-Sud, 26. September 1991
38. Berlin-Charlottenburg, 26. September 1991
39. Moulineaux, Normandie 23. September 1991
40. Compiègne, Picardie, 27. September 1991
41. Moulineaux, Normandie, 24. September 1991
42. Lisieux, Normandie, 27. September 1991
43. Château de Robert le Diable, Normandie, 24. September 1991
44. Rouen, Normandie, 27. September 1991
45. Blagny, Pays d’Auge, 24. September 1991
46. Rouen, Normandie, 27. - 28. September 1991
47. Bonnesource, 29. September 1991
48. Orsayville, Île-de-France, 28. September 1991
49. Berlin-Charlottenburg, 29. September 1991
50. Berlin/Paris, 30. September 1991
51. Orsayville, 30. September 1991
52. Berlin-Dahlem, 1. Oktober 1991
53. Paris, Freitag, 4. Oktober 1991
54. Berlin-Dahlem, Luise, 4. Oktober 1991
55. Issy-les Moulineaux, 8. Oktober 1991
56. Berlin-Dahlem, 8. und 9.Oktober 1991
57. Bonnesource, 10. Oktober 1991
58. Université Paris-Sud, 10. Oktober 1991
59. Bonnesource, 10. Oktober 1991
60. Orsayville, 10. Oktober 1991
61. Pays d’Auge, 11. Oktober 1991, 13 Uhr
62. Université Paris-Sud, 11. Oktober 1991, 9 Uhr
63. Pays d’Auge, 11. Oktober 1991, 14 Uhr
64. Domaine Guérin et Fils, 11. Oktober 1991, 15 Uhr
65. Blagny, 11. Oktober 1991, 16 Uhr
66. Domaine Guérin et Fils, 11. Oktober 1991, 16 Uhr
67. Domaine Guérin et Fils, 11. Oktober 1991, 17 Uhr
68. Bonnesource, 11. Oktober 1991, 17 Uhr
69. Domaine Guérin et Fils, 11. Oktober 1991, 18 Uhr
70. Bonnesource, 11. Oktober 1991, 18 Uhr
71. Rouen, 14.10.1991
EPILOG
Zu diesem Buch
Über den Autor:
Impressum neobooks
Widmung
Für Lydia
Dieses Buch ist allen Menschen gewidmet, die in einem von politischen und persönlichen Interessen gelenkten und missbrauchten Wissenschaftsbetrieb ihren Drang zur Suche nach Erkenntnis nicht verloren haben. Ich danke allen, die mir bei der Entstehung des Romans gewollt oder ungewollt geholfen haben. Ganz persönlich möchte ich Lydia, Elena, Sabine und Larissa für ihre vielen Ratschläge danken, die in das Buch eingeflossen sind.
1. Das Leben ist ganz einfach, man muss nur wissen, was zur rechten Zeit zu tun ist!
Leo Schneider war Biologe, Ende zwanzig und ein neugieriger Mensch. Er war in Berlin auf die Welt gekommen und hatte sein bisheriges Leben auch in dieser Stadt verbracht.
Seine Schulzeit verlief anfangs ruhig, das änderte sich jedoch in den letzten Jahren, als er auf dem Gymnasium war. Mitte der 1970er Jahre war die Welt im Umbruch, und Leo blieb davon nicht unbehelligt. Auch er rebellierte, wie viele aus seiner Generation, gegen Verhältnisse und Konventionen, die ihm als unsinnig und rückständig erschienen. Der Geist dieser Zeit hinterfragte vieles von dem, was vorher als naturgegeben hingenommen worden war. Leo entwickelte eine skeptische Einstellung gegenüber Menschen, die ihre Macht missbrauchten, nur um sich selbst nicht verändern zu müssen. Damals war es die Sehnsucht nach neuen Ufern, die ihn, wie viele andere seiner Generation, vorwärtstrieb. Die alten Gestade wollte man hinter sich lassen und über die neuen Ufer gab es oft nur vage und wenn, dann ganz unterschiedliche Vorstellungen.
Nachdem er das Abitur bestanden hatte, schrieb er sich an der Freien Universität Berlin für die Fächer Politik und Biologie ein. Die Beschäftigung mit Biologie und Politik hatte viel mit seiner Sehnsucht nach Neuland zu tun. Die Biologie stand, was ihm erst später bewusst wurde, für die Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit. Beide Vorstellungen folgten Idealen, waren mehr vom Gefühl, als vom Verstand geleitet und sicherlich auch naiv.
Nach dem ersten Semester zog Leo Bilanz. Die Sehnsucht nach neuen Ufern in der Politik hatte sich im Nebel von endlosen Theoriediskussionen, bei denen Machtfragen die wichtigste Rolle spielten, verflüchtigt. In der Biologie fand Leo mehr Einklang mit sich selbst. Das Versprechen, in die Natur und ihre Geheimnisse hineinschauen zu dürfen, zog ihn in den Bann.
Leo fühlte sich wohl an der Universität und wäre am liebsten für sein weiteres Berufsleben dort geblieben. Für seine Promotionsarbeit bekam er für drei Jahre ein Stipendium, damit war er zum ersten Mal in seinem Leben finanziell unabhängig. Ein paar Monate nach seinem Universitätsabschluss verbrachte er noch mit einem Forschungsvorhaben, aber diese Zeit näherte sich ihrem Ende.
Wenige Monate zuvor war aus der Inselstadt Westberlin Festland geworden. Die Mauer war noch schneller gefallen, als sie 1961 errichtet worden war. In alle Richtungen jenseits des ehemals befestigten Grenzstreifens erstreckte sich offenes Land bis zum Horizont. Orte und Menschen, die über Jahrzehnte unerreichbar schienen, lagen nur einen Fußmarsch entfernt. Das in den langen Jahren der Mauerzeit und der Insellage mit allen möglichen Vorstellungen behaftete Neuland lag plötzlich vor der Haustür. Ungeahnte Möglichkeiten lagen darin verborgen. Dies allein war für Leo spannend genug, um einen Umzug an einen anderen Ort als nicht verlockend erscheinen zu lassen. Zudem wollte er die Menschen, mit denen er in Berlin persönlich verbunden war, nicht missen.
Gegen Ende seiner Zeit an der Universität hatte er begonnen, sich nach einer neuen Beschäftigung umzusehen. Auf seine Bewerbungen erhielt er eine Zusage, die es ihm ermöglichte, in Berlin zu bleiben. Es handelte sich um ein auf drei Jahre befristetes Forschungsvorhaben am Lebensmittel- und Agraramt, das in Berlin-Dahlem, unweit der Universität angesiedelt war. Er bekam noch andere, wissenschaftlich gesehen, interessantere Angebote an anderen Orten. Aber Leo wollte in Berlin bleiben, in einer Stadt, die sich gerade häutete wie ein Insekt und sich im vollständigen Wandel befand.
Dafür nahm er auch in Kauf, von der Universität an eine Behörde zu wechseln. Wenn er in Berlin bleiben wollte, blieb ihm keine andere Wahl. Ihm war bewusst, er würde sich damit in mancher Hinsicht umgewöhnen müssen und ein paar Kollegen von der Uni hatten ihn vor diesem Schritt gewarnt. Damit bist du raus aus der Forschung und kannst nie wieder zurück, hieß es.
Aber so schlecht schien die Alternative, in einer Behörde zu arbeiten, nicht zu sein. Das Lebensmittel- und Agraramt, kurz LEAG genannt, war mit Aufgaben an einer Schnittstelle von Verbraucherschutz, Industrie und Landwirtschaft betraut. Eine Tätigkeit im Brennpunkt. Zumindest schien es so, denn die Interessen der Verbraucher, der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft waren viel mehr von Gegensätzen als von Gemeinsamkeiten geprägt. Endlich eine Möglichkeit, seine Forschungen zum Wohle der Menschen umzusetzen, so stellte Leo sich das vor. An der Universität war ihm doch manches ziemlich abgehoben erschienen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er noch nicht, dass die Politik, von der er meinte, sie nach dem ersten Semester endgültig abgewählt zu haben, ihn in seiner neuen Arbeitswelt wieder einholen würde.
Leos neue Aufgabe am LEAG hatte ihren besonderen Reiz. Es ging um Lebensmittelsicherheit, ein Thema, das alle Menschen gleichermaßen betraf. Leo sollte ein Labor zum Nachweis von erbgutschädigenden Substanzen aufzubauen. Es ging um Stoffe, die potentiell Krebs erzeugen konnten. In einigen Lebensmitteln hatte man solche gefährlichen chemischen Verbindungen schon nachgewiesen, wie das Schimmelpilzgift Aflatoxin in verdorbenen Nüssen. Aber eine noch viel größere Anzahl von Lebensmitteln war in dieser Hinsicht noch gar nicht untersucht.
Arbeit gab es genug und für das LEAG besaß ein solches Labor eine Pilotfunktion. Es war ein Testballon, mit dem Leo Schneider hoch aufsteigen oder tief abstürzen konnte. Er aber sah diese Aufgabe als fachliche Herausforderung, die zu meistern war, denn er hatte Vertrauen in seine wissenschaftlichen Fähigkeiten.
Leo stellte bald fest, dass es gewisse Vorteile hatte, in einer Behörde zu arbeiten. An der Universität war die finanzielle Ausstattung oft knapp bemessen, am LEAG schien man hierfür besser aufgestellt zu sein. Am LEAG gab es auch keine Pflicht zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen, die an der Universität obligatorisch waren. Für deren Vorbereitung und Durchführung musste man in jedem Semester viel Zeit und Nerven aufbringen. Somit hatte er am LEAG viel mehr Zeit für die Forschung und mit diesem Gedanken war Leo auch mit seinem zuvor gefassten Entschluss zufrieden. Für die kommenden drei Jahre musste er sich keine finanziellen Sorgen machen. Wenn die Zeit am LEAG zu Ende ging, würde sich schon etwas Neues für ihn finden.
Mit dem Geld, das Leo an der Universität verdiente, konnte er sich eine Dreizimmerwohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg leisten. Es war eine ruhige, eher bürgerliche Gegend, die nicht das Flair eines Szenebezirks wie Kreuzberg hatte. Trotzdem war die Miete günstig, denn die im vierten Stock gelegene Wohnung befand sich in einem noch nicht von der Modernisierung betroffenen Altbau. Zu seiner Wohnung gehörte auch ein Balkon, den Leo mit einem kleinen runden Tisch und zwei Klappstühlen ausgestattet hatte. Von dort hatte er einen ungehinderten Blick über die Dächer der Stadt. Auf der anderen Seite seiner Straße gab es keine Häuser, dort lag die Trasse der Berliner Stadtbahn, deren rotgelbe Züge er alle paar Minuten vorbeifahren sah. Die ab fünf Uhr morgens regelmäßig wiederkehrenden, unverwechselbaren Geräusche der S-Bahn waren der einzige Nachteil, der ihm spontan einfiel, wenn man ihn nach seiner Wohnung fragte. Die Ofenheizung war die Garantie für eine niedrigere Miete und sorgte zudem für regelmäßiges Muskeltraining beim Kohlenschleppen aus dem Keller. Einen Aufzug gab es nicht. Die Vorteile, die Wohnung war schön geschnitten, in einer guten Lage und sehr hell, überwogen diese Kleinigkeiten.
Nur ein paar Schritte von seiner Wohnung entfernt gelangte man in einen Park, in dessen Mitte sich ein kleines Gewässer, Lietzensee genannt, befand. Ein beschaulicher Ort, zu dem es Leo manchmal hinzog, wenn er in seiner Stadtwohnung den Wunsch verspürte, der Natur auf kurzem Weg nahe zu sein.
Im Park am Lietzensee hatte er auch seine Freundin Christine kennengelernt. Es war ein schöner Sommertag gewesen. Christine saß in der Sonne auf einer Bank und war gerade damit beschäftigt, sich eifrig in einem Heft Notizen zu machen. Das Sonnenlicht fiel schräg über ihre halblangen, kastanienbraunen Haare und tauchte ihr Gesicht in einen überirdischen Schein, so dass Leo, als er vorbeilief, einfach auf sie aufmerksam werden musste.
Christine war enttäuscht und daher schlechter Laune. Sie wartete bereits seit einer halben Stunde auf ihre Verabredung und wollte diese Zeit wenigstens mit den letzten Sonnenstrahlen im Park für sich angenehm nutzen. Als Leo vorbeilief, hatte ihr Kugelschreiber gerade seinen letzten Tropfen Tinte vergossen. Christine sah Leo vorbeigehen und fragte, ob er nicht zufällig etwas zum Schreiben bei sich hätte. Leo fand einen Kugelschreiber in seiner Jacke, den er ihr gab. Christine bedankte sich, beugte sich wieder über ihr Heft und schrieb emsig weiter.
„Du kannst ihn gerne behalten.“ Leo wollte seinen Weg fortsetzen, als er sah, wie vertieft sie in ihre Arbeit war. Aber Christine hielt ihn zurück. „Warte, ich muss nur kurz etwas aufschreiben, ich geb ihn dir gleich wieder.“
Sie beugte sich wieder über ihren Block und schrieb, ohne weiter auf ihn zu achten. Leo nahm Christines Bemerkung als Einladung, sich neben sie auf die Bank zu setzen. Als Christine nach ein paar Minuten mit dem Schreiben fertig war, fragte Leo, ob sie hier neu zugezogen wäre. Er hätte sie vorher nie im Park gesehen.
Christine schüttelte den Kopf. Sie erzählte Leo von dem Zufall, der sie in diesen Teil der Stadt geführt hatte. Eigentlich hatte sie in der Herbartstraße, die um den Park herumführte, schon vor einer halben Stunde jemand treffen müssen. Doch ihre Verabredung kam nicht. Später hatte sich das Ganze als eine Verwechslung entpuppt. Ihre Verabredung hatte in der fast gleichnamigen Herbertstraße in Schöneberg vergeblich auf sie gewartet. Aber die Verwechslung der Straßennamen hatte bewirkt, Christine und Leo zusammenzuführen.
Ihr zufälliges Zusammentreffen lag inzwischen fast zwei Jahre zurück, und Leo war in dieser Zeit oft mit Christine am Ufer des Lietzensees spazieren gegangen. Christine war der wichtigste Grund, warum Leo in Berlin bleiben wollte, als seine Stelle an der Uni auslief. Trotzdem war die Beziehung mit Christine nicht einfach und bewegte sich auf einem Zickzackkurs zwischen Nähe und Distanz. So als wüssten beide nicht, ob sie sich auf Dauer binden wollten. Christine behielt ihre kleine Zweizimmerwohnung in Friedenau. Sie sahen sich nur, wenn sie verabredet waren, und nicht regelmäßig wie Menschen, die zusammenwohnten. Beide verbrachten ihre gemeinsame Zeit entweder bei Christine in Friedenau oder bei Leo in Charlottenburg. Dadurch hatten sie zwei Kieze in der Stadt, wo man sie abends anzutreffen konnte. Wenn sie bei Leo waren, gingen sie häufig in die Kneipen und Lokale rund um den nicht weit entfernten Savignyplatz. Waren sie bei Christine, dann besuchten sie die Gegend rund um den Winterfeldplatz in Schöneberg.
Den Zeitpunkt, an dem sie sich hätten entscheiden können, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen, hatten Leo und Christine verstreichen lassen, und keiner von beiden hätte genau sagen können, warum. Etwas Unausgesprochenes in ihrer Beziehung hinderte sie daran, den Schritt zu wagen, der ihr Verhältnis entweder mehr gefestigt oder zum Platzen gebracht hätte. Mit der Zeit nahmen Leo und Christine an, dass es ihrer Zweisamkeit gut tat, wenn jeder die Freiheit besaß, sich jederzeit in sein Privatleben zurückziehen zu können.
Finanziell waren beide unabhängig genug, um sich diese Freiheit zu leisten. Viele Paare hätten nicht diese Wahl und zögen vielleicht nur aus finanziellen Gründen zusammen, hatte Christine einmal vor Freunden gesagt und Leo wollte dem nicht widersprechen. Er hatte seine Arbeit an der FU und Christine eine gutbezahlte Stelle bei dem neu gegründeten deutsch-französischen Radiosender AFT in Berlin. Christine sprach fließend Französisch und hatte Romanistik und Publizistik studiert. Für ihre Arbeit reiste sie oft nach Frankreich und stellte Features über deutsch-französische Unterschiede und Gemeinsamkeiten zusammen, die in unregelmäßigen Abständen in das Kulturprogramm des Senders einflossen.
2. Bonnesource, Normandie, 15. August 1990
Christine war es auch gewesen, die Leo auf die Französin Sandrine Martin und deren Untersuchungen über Giftstoffe im Calvados gebracht hatte. Diese Geschichte fiel ihr wieder ein, als Leo von seiner neuen Aufgabe erzählte, am LEAG ein Labor zum Nachweis von krebserzeugenden Substanzen aufzubauen.
Leo hatte vorher weder von Sandrine Martin gehört, noch wusste er etwas über Calvados. Christine begann ihm von ihrer Recherche zu erzählen, die sie einen Monat zuvor in Frankreich durchgeführt hatte. Genauer gesagt war es in der Normandie gewesen, für eine Reportage, bei der es um die traditionelle Herstellung von Cidre und Calvados ging. Cidre ist ein moussierender Apfelmost, der in Frankreich vor allem in der Normandie und der Bretagne hergestellt wird. Calvados ist ein aus Cidre gebrannter, hochprozentiger Alkohol, der traditionell von den Bauern in der Normandie erzeugt wird. Vor etwa dreißig Jahren hatte dieser, nicht nur die Verdauung anregende Tropfen, internationale Popularität erlangt und machte den alten Traditionsbränden Cognac und Armagnac Konkurrenz. Aus manchem bescheidenen normannischen Obstbauern wurde ein reicher Spirituosenproduzent, denn mit der Herstellung und dem Verkauf von Calvados ließ sich eine Menge Geld verdienen. Das lag unter anderem auch daran, weil die Marke Calvados durch europäische Gesetze geschützt und ihre Herstellung auf eine kleine Region Frankreichs begrenzt war.
Erst gegen Ende ihrer Reportage war Christine auf den Namen Sandrine Martin gestoßen. Christine hatte sich für eine Woche entlang der malerischen Route du Cidre bewegt. Diese sogenannte Apfelweinstraße war ein etwa vierzig Kilometer langer Rundweg, der durch die wichtigsten Produktionsorte der Region führte.
Zum Abschluss ihrer Reihe von Interviews sprach sie mit Théodore Leroy, seines Zeichens conseiller général im Department Calvados. Dieser Titel ließ sich am besten mit Generalrat übersetzen, ein hochrangiger Gemeindevertreter im Department, der alle sechs Jahre durch Wahlen neu bestätigt werden musste. Leroy empfing Christine auf seinem Landsitz in Bonnesource, einem kleinen Ort im Herzen des Departments Calvados, das den gleichen Namen wie der dort hergestellte Apfelbranntwein trug. Die in dieser Region aus Äpfeln hergestellte Spirituose durfte sich zudem noch mit dem Prädikat Calvados du Pays d‘Auge schmücken.
Théodore Leroy war ein Mann Ende fünfzig mit längeren, gewellten, graumelierten Haaren und einem geschwungenen Oberlippenbart. Er war ein guter Unterhalter, ein Bonvivant, aber zu Christines Enttäuschung wusste er nicht mehr über die Tradition des Cidre und Calvados, als was sie nicht schon vorher erfahren hatte. Christine überlegte bereits, wie sie sich am besten verabschieden könnte, aber dann nahm das Gespräch mit dem Generalrat eine unerwartete Wendung.
Leroy war durch Christines Gesellschaft gesprächig geworden. Er begann sich bitter über eine Frau zu beklagen, die von einer Universität aus Paris mit der Absicht hierher geschickt worden war, den Calvados in den Dreck zu ziehen. Genauso drastisch hatte er es ausgedrückt. Auf die Frage von Christine, was es denn nun mit dieser Frau aus Paris auf sich hätte, strich sich der Generalrat mit seinem linken Zeigefinger über seinen geschwungenen Oberlippenbart. Er stand auf, ohne ein Wort zu sagen, und kam mit einer Flasche und zwei Gläsern an den Tisch zurück.
„Probieren Sie zuerst, Mademoiselle Bergmann, bevor wir weiter über diese infamen Unterstellungen reden. Dann sagen Sie mir, was Sie als Ortsfremde von unserem Calvados halten.“
Christine hatte Calvados schon vorher probiert. Allerdings machte sie sich nicht allzu viel aus hochprozentigen Getränken. Doch in diesem Moment bemerkte sie, dass es Théodore Leroy mit der Verkostung ernst war. Sie würde kein weiteres Wort mehr aus ihm herausbekommen, bevor sie nicht mit ihm angestoßen hatte. Der Generalrat füllte zwei tulpenförmige, sich nach oben verjüngende Gläser mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit aus der Flasche, die er danach auf dem Tisch vor ihr abstellte. Er schwenkte sein Glas mit einer übertrieben wirkenden Geste und hielt Christine dazu an, es ihm nachzutun.
„In diesen speziellen Gläsern kommt das Aroma des Calva, so wie wir ihn hier nennen, am besten zur Geltung. Nehmen Sie erst den Duft auf, bevor Sie kosten, Christine. Ich hoffe, Sie erlauben mir, Sie bei Ihrem Vornamen zu nennen?“
Christine nickte, hob ihr Glas und sagte höflich: „À la votre, Théodore“.
Sie nahm das starke, nach Äpfeln duftende Bouquet des Calvados auf, bevor sie ihn kostete. Es war doch überraschend, wie gut dieser Calva schmeckte. Auch, wie sanft er sich in ihrem Gaumen ausbreitete und nach dem Trinken nicht das brennende Gefühl hinterließ, welches sie mit Spirituosen allgemein in Verbindung brachte. Einen Calvados dieser Qualität hatte sie bisher noch nicht kennengelernt. Aber trotzdem konnte Christine sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, zu dieser Tageszeit mehr als ein Probiergläschen zu trinken. Als Théodore Leroy ihr erneut einschenken wollte, verwies sie auf die Fahrt nach Rouen, die sie noch vor sich hatte und auf die Alkoholkontrollen, die in letzter Zeit von der Polizei besonders intensiv auf den Landstraßen durchgeführt wurden. Leroy nickte ihr mit bekümmerter Miene zu, sagte, er kenne dieses Problem leider sehr gut und trank, wie zur Bekräftigung seiner Worte, sein zweites Glas Calvados in einem Zug.
Nachdem er sich bereits ein drittes Glas einschenkt hatte, welches er aber zunächst nicht anrührte, begann er mit glänzenden Augen zu erzählen. Jedoch kam er nicht sofort auf Sandrine Martin zu sprechen. Vielmehr redete er von der Schönheit des Pays d’Auge, von den bäuerlichen Traditionen, der Naturverbundenheit der Menschen und von den gastronomischen Schätzen, mit denen die Region von sich reden lassen konnte.
„Das alles ist reine Natur, keine Chemie, alles ist rein biologisch erzeugt“, bekräftigte Leroy und klopfte dabei mit seinem Fingernagel auf die Flasche.
Christine, die ihn nach seinen Worten zuerst für einen Sympathisanten der französischen Grünen gehalten hatte, erfuhr bald, dass er Mitglied einer neu gegründeten Partei war, die sich PCP (Parti des Chasseurs-Pêcheurs) nannte. Sie wusste, dass es mit der PCP so eine Sache war. Diese Partei vertrat vor allem die Interessen von fanatischen Jägern und Anglern und setzte sich aus Leuten zusammen, die mit den Grünen in erbitterter Feindschaft lebten. PCP Vertreter galten als nicht zimperlich, wenn man den Tierschützern zeigen musste, wo es lang ging. Es gab Berichte von Bauern, die sich mit Jägern angelegt hatten, als diese sturzbetrunken mit einer Meute Hunde über die Felder zogen und das Weidevieh in panische Flucht trieben. Von Jägern, die den protestierenden Bauern bedrohlich mit der Schrotflinte vor dem Bauch herumfuchtelten. Eine Abgeordnete der Grünen hatten sie mitten in Paris zuerst angepöbelt und dann geohrfeigt. Kurz gesagt, es waren Leute fürs Grobe. Christine verkniff sich gegenüber Leroy ihre Meinung über die PCP. Sie brachte ihn, der in seinem Monolog abschweifte und begann, über die letzten Kantonalwahlen zu reden, mit der Erwähnung des Namens Sandrine Martin auf ihre Frage zurück.
„Eine Nestbeschmutzerin“, entfuhr es Leroy. Er hatte mittlerweile sein viertes Gläschen Calva vor sich stehen und lächelte Christine an, wie um sich für seine heftigen Worte zu entschuldigen.
„Sie müssen wissen, Mademoiselle Martin stammt auch aus der Normandie, genauer gesagt aus Lisieux. Man hat sie in Paris wohl auch gerade deswegen ausgesucht, um uns hier in der Region über die wahren Hintergründe ihrer Mission zu täuschen.“
Da müsste er aber schon etwas mehr ins Detail gehen, meinte Christine. Als der Generalrat damit gerade beginnen wollte, betrat seine Haushälterin mit einem Tablett in der Hand den Salon und tischte einige kulinarische Köstlichkeiten auf.
„Alles erzeugt im Umkreis, sagen wir, von nicht viel mehr als fünfzig Kilometern“, meinte Théodore Leroy stolz und zeigte auf die Servierschale mit dem Essen. „Nicht wahr, Madame Boulignier?“ Seine Haushälterin mit den streng nach hinten zu einem Dutt frisierten Haaren nickte und lächelte Christine zu.
„Außerdem haben Sie ja heute Nachmittag noch einen längeren Weg vor sich, da ist es gut, neben dem Calva auch noch etwas Festes im Magen zu haben.“
Christine nickte, lächelte und prostete Théodore Leroy diesmal mit einem großen Glas Burgunder zu, den er ihr zum Essen eingeschenkt hatte.
„Nur Wein produzieren wir nicht, da spielt unser Klima nicht mit.“ Leroy lachte und deutete auf das Glas, als er mit ihr anstieß.
Er holte tief Luft, als wollte er die ganze Geschichte in einem Atemzug erzählen. „Mademoiselle Martin kam angeblich von der landwirtschaftlichen Fakultät der UniversitéParis-Sud, um eine Doktorarbeit über die traditionellen Methoden bei der Herstellung von Calvados anzufertigen. Sie sprach auch bei mir vor und im Gemeinderat fanden alle das Vorhaben für die Region sehr positiv. Da ihre Familie aus Lisieux stammt, gerade mal zwanzig Kilometer von hier entfernt, gewann sie schnell das Vertrauen unserer örtlichen Produzenten. Damit hatte sie Zugang zu allen Stationen der Produktion von der Obstplantage bis hin zur fertigen Flasche, wenn man es so sagen will.“
Leroy rülpste, nachdem er die ersten Bissen, während er weitersprach, zu hastig verschlungen hatte. Er entschuldigte sich und fuhr fort: „Leider erfuhren wir erst spät, was Mademoiselle Martin wirklich vorhatte. Sie war auch nicht von der landwirtschaftlichen Fakultät, sondern Lebensmittelchemikerin und hatte einen ganz anderen Auftrag, als sie vorgab …“
Er machte eine Pause, wie um die Spannung zu erhöhen und sah Christine, die ihm mit wachsendem Interesse zuhörte, bedeutungsvoll an.
„Und was war das für ein Auftrag?“ Christine dehnte ihren Satz immer weiter in die Länge, während Leroy sich zu ihr vorbeugte und sie immer intensiver musterte. Für einen Moment war Christine unsicher, ob er nicht ganz andere Absichten hegte, als sie angenommen hatte.
„Ha!“, rief Leroy plötzlich. „Es hätte allen im Landkreis schon längst vorher auffallen müssen!“
„Sie machen es aber wirklich spannend“, sagte Christine.
„Es hätte allen auffallen müssen, dass sie überall fotografierte, sie konnte gar nicht genug Bilder kriegen. Auf mehreren Höfen in der Gegend war sie gewesen und es war immer das Gleiche.“
„Nun ja“, warf Christine vorsichtig ein, „eine fotografische Dokumentation kann viele Worte ersetzen, nicht wahr?“
Leroy schüttelte heftig den Kopf. „Nein, nein, nein, Mademoiselle. So war es nicht. Da war noch viel mehr. Sie wurde dabei beobachtet, als sie Proben nahm.“
„Proben?“ Christine war erstaunt.
„Ja genau, Proben! Sie hatte immer eine große Tasche bei sich. Wir dachten, die wäre für ihre Bücher und für die Kamera. Aber da waren Reagenzgläser drin und sie nahm Proben von allem! Von den Äpfeln, dem Cidre, dem Wasser, von den Gerätschaften, von allen Stationen der Produktion, bis hin zum fertigen Calvados.“
„Nun ja ...“
Christine wollte etwas sagen, aber Leroy schnitt ihr das Wort ab.
„Ich frage Sie, wozu braucht man solche Proben, wenn man über die traditionelle Herstellung von Calvados berichten will?“
Leroy hielt ihr angriffslustig den Zeigefinger vor das Gesicht. „Aber damals haben wir uns noch nichts weiter dabei gedacht, bis …“
„Bis?“
„Bis herauskam, zu welchem Zweck sie diese Proben genommen hatte.“
„Aha!“
„Jemand, der Name spielt keine Rolle, hatte Zweifel bekommen, bei der Universität in Paris angerufen und sich nach Mademoiselle Martin erkundigt. So bekamen wir heraus, wer diese infame Person war und was sie wirklich vorhatte.“
Christine dachte sich ihren Teil, wer dieser Jemand wohl gewesen war, sagte aber nichts weiter und sah Leroy erwartungsvoll an. Sie hatte gut gegessen und getrunken. Wäre Leroys Geschichte nicht so spannend gewesen, hätte sie sich gerne auf der Terrasse des Landhauses in einem der bequemen Gartenstühle auf ein Nickerchen ausgestreckt.
Sie konnte ein Gähnen gerade noch unterdrücken, als Leroy hinzufügte: „Sie wurde mit dem eindeutigen Auftrag geschickt, Giftstoffe im Calvados nachzuweisen!“
Er sah Christine an, als wollte er ihre Reaktion darauf testen, aber das Einzige, was er bemerkte war, dass ihre Augen noch größer wurden.
„Was denn für Giftstoffe?“
„Ja, das ist eine gute Frage, Mademoiselle. Das Ganze ist sowieso lächerlich, nicht wahr? Wir produzieren hier schließlich keinen Fusel.“ Leroy stieß ein empörtes Lachen aus und zeigte auf die geschwungene Flasche, die auf dem kleinen Tisch vor ihnen stand.
„Haben Sie denn Mademoiselle Martin daraufhin angesprochen?“
Théodore Leroy hatte die Flasche mit dem Calvados in seine Hand genommen und streckte sie Christine entgegen. „Noch einen Calva zur Verdauung? Bei uns nennen wir das ein trou normand. Wenn der Magen voll ist, wird dadurch Platz geschaffen und man kann wieder etwas essen.“
Christine lachte amüsiert und hob abwehrend ihre Hand: „Nein danke, Théodore! Ihr Calva ist wirklich sehr gut, aber ich brauche nichts zur Verdauung. Ein Espresso zum Wachbleiben wäre für mich jetzt genau das Richtige.“
Leroy nickte und klingelte nach seiner Haushälterin. „Ich hoffe, ich habe Ihnen mit dieser Geschichte nicht den Calvados verekelt“, entschuldigte er sich. „Glauben Sie mir …“
„Was sollten das denn nun für Giftstoffe sein?“, hakte Christine nach.
Leroy winkte ab und verzog verdrießlich sein Gesicht. „Als Mademoiselle Martin das letzte Mal hier auftauchte, wussten alle Bauern längst Bescheid. Ich hatte leider keine Gelegenheit, vorher mit ihr über diese leidige Geschichte zu reden.“
Er schwieg einen Moment und starrte vor sich hin.
„Unbedarft, wie sie nun einmal war, ging sie wieder auf den Hof von Patrick Guérin. Der liegt ein paar Kilometer von hier entfernt in der Nähe eines kleinen Dorfes namens Blagny. Dort hatte sie bei ihrem letzten Besuch aufgehört, weil sie zwischendurch immer wieder nach Paris fuhr. Wahrscheinlich, um dort ihre Proben zu untersuchen.“
„Ja und dann?“
Leroy seufzte. „Patrick war davon überzeugt, dass sie von einem Konkurrenten kam und seine Produktionsgeheimnisse ausspionieren wollte, gerade weil er mit seinem Calvados sehr erfolgreich ist. Er meinte, das Gerede von den Giftstoffen wäre nur ein Manöver gewesen, um sein Produkt schlechtzumachen. Als er sie kommen sah, hat er sofort seine Hunde auf sie gehetzt. Sie hatte Glück, dass sie es gerade noch geschafft hatte, ihre Autotür zu schließen und schleunigst zu verschwinden.“
Christine war perplex und Leroy bemerkte das. „Ich hätte mit ihr vorher geredet, aber es hat sich nun einmal nicht ergeben. Patrick ist impulsiv, ein richtiger Haudrauf. Der diskutiert nicht groß. Ich konnte das leider nicht verhindern.“ Leroy machte eine Geste, als wollte er sich dafür entschuldigen.
„Danach habe ich im Namen des Landkreises der Universität in Paris mitgeteilt, dass wir uns hintergangen fühlen und weitere Besuche von Mademoiselle Martin hier unerwünscht sind. Natürlich habe ich keine Antwort von dort bekommen. Soll sie doch ihr Glück in der Bretagne versuchen, die produzieren schließlich auch Cidre!“
„Aber keinen Calvados!“
„Genau!“, gab Leroy zurück, „das wäre ja noch schöner! In der Bretagne brennen sie auch einen Alkohol aus Cidre, den nennen sie Lambig. Haben Sie schon davon gehört?“
Christine schüttelte den Kopf.
„Sehen Sie, das habe ich mir gedacht. Selbst Sie, als Kennerin Frankreichs, haben nichts vom Lambig gehört. Da sehen Sie es. Der Lambig hat gegenüber dem Calvados keine Bedeutung. Dagegen ist unser Calvados ein zertifiziertes, regionales Produkt. Gesetzlich geschützt, sogar durch europäische Verordnungen. Da kann keiner von irgendwoher kommen und versuchen, sein Destillat unter dem Namen Calvados anzubieten.“
„Ja, zum Glück ist das so“, antwortete Christine, die mit ihren Gedanken bereits woanders war. Es wäre doch interessant zu erfahren, was die Chemikerin aus Paris tatsächlich im Calvados gesucht hatte. Wenn es nicht um Betriebsgeheimnisse ging, die sie ausspionieren wollte, was konnten das denn für Giftstoffe sein? Vielleicht handelte es sich um Spritzmittel? Da hörte man doch so einiges. Von Firmen, die tonnenweise Pestizide an die Bauern verteilten, und danach wuchsen auf deren Äckern nur noch die Pflanzen aus dem Saatgut der gleichen Firmen, die die Pestizide herstellten. So schaffte man Abhängigkeiten und hatte außerdem einen Weg gefunden, das gentechnisch manipulierte Saatgut aus eigener Produktion an die Bauern zu verkaufen.
Christine wollte Théodore Leroy nicht weiter nach Sandrine Martin und den Giftstoffen fragen. Es würde ihn nur misstrauisch machen. Rouen lag auf dem Weg nach Paris, von dort ging ihr Rückflug nach Berlin. Sie hatte jetzt alle Stationen für die Kulturreportage zum Calvados abgeklappert. Der Generalrat war die letzte, aber nicht die uninteressanteste Station gewesen. Was sprach dagegen, nach dem Aufenthalt in Rouen einen Zwischenstopp an der Universität Paris-Sud bei Sandrine Martin einzulegen? Vorausgesetzt, die Chemikerin wäre damit einverstanden.
Nachdem Théodore Leroy sie noch über sein Anwesen geführt hatte, musste Christine ihm zweimal versprechen, in ihrer Reportage nicht über die Geschichte mit den angeblichen Giftstoffen im Calvados zu berichten.
„Das beste Beispiel, dass es kompletter Unsinn ist, sind doch wir beide“, hatte Leroy zum Abschied gesagt. „Wir haben Calvados getrunken, und es geht uns doch blendend, nicht wahr, Mademoiselle Christine?“
Nachdem sie sich von Leroy, der immer zudringlicher geworden war, verabschiedet hatte, war Christine nach Rouen gefahren. Dort war sie mit einer französischen Kollegin zum Abendessen verabredet, um die Einzelheiten zu der neuen Sendung zu besprechen.
3. Université Paris-Sud, 16. August 1990
Als sie den Hörer aufgelegt hatte, zitterte Sandrine Martin so sehr, dass sie die Tasse mit dem Kaffee in ihrer Hand nicht stillhalten konnte und einen Teil davon verschüttete. Der dunkle Kranz um ihr linkes Auge, den sie der Faust dieses Dreckskerls zu verdanken hatte, war mittlerweile von Dunkelblau zu einem grünlichen Farbton gewechselt. Danach würde er gelb werden, blasser und irgendwann auch nicht mehr zu sehen sein. Die anderen Verletzungen, die ihr zugefügt worden waren, sah man nicht auf den ersten Blick. Genauso wenig wie die Angst, die sich auf Dauer in ihrem Kopf eingenistet zu haben schien.
Im Institut hatten sich alle mit ihr solidarisiert, als sie sahen, wie übel zugerichtet sie am Montag zurückgekommen war. Aber in den Tagen danach begann sie zu spüren, wie ihre Kollegen allmählich von ihr abrückten. Pierre Duval, der für sie die Untersuchungen der Proben am Massenspektrometer vornehmen sollte, meinte plötzlich, das dafür benötigte LC-MS/MS Gerät wäre für dringendere Projekte reserviert, und vertröstete sie von einer Woche auf die andere.
Dann hatte Professor Fromentin, der Dekan der Fakultät, sie überraschend zu einem Gespräch gebeten. Sandrine, die anfangs noch geglaubt hatte, er würde ihr Projekt weiterhin unterstützen, wurde eines Besseren belehrt. Eugène Fromentin knetete nervös die Finger seiner Hände, als Sandrine in sein Büro kam. Nachdem er sie gebeten hatte, sich doch zu setzen, war er allmählich damit herausgerückt, worum es ihm wirklich ging. Sie sollte mit dem Projekt aufhören, jetzt, nachdem sie bereits sechs Monate Arbeit mit dem Literaturstudium, der Einrichtung des Labors, der Dokumentation und der Probenentnahme verbracht hatte. Alles für die Katz. Dabei war es ursprünglich seine Idee gewesen, sie hatte Gefallen daran gefunden und die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Der Dekan bot ihr an, mit einer neuen Arbeit zu beginnen. Und ihr Stipendium? Sandrine war finanziell darauf angewiesen. Sechs der achtzehn Monate Förderzeit waren bereits verstrichen. Nun sollte sie noch einmal bei null anfangen? Sie hatte geheult, aber Fromentin hatte sich abgewendet und ihr wortlos eine Packung Papiertaschentücher über den Schreibtisch geschoben.
„Sagen Sie mir einen sachlichen Grund, warum ich das Forschungsvorhaben jetzt plötzlich beenden soll?“, hatte Sandrine mit verweinten Augen gefragt.
Der nüchterne Akademiker Fromentin mochte keine Gefühlsausbrüche. Er sah seine Studentin nicht an und ließ seine Augen durch den Raum wandern. Die Sache war ihm sichtlich unangenehm, und er hatte nur erwidert, die Fakultät existiere nicht im luftleeren Raum und sei auf Unterstützung von außen angewiesen. Gewisse Dinge hätten sich eben anders entwickelt, als man ursprünglich gedacht hatte. Das müsse man akzeptieren und mehr könne er dazu nicht sagen. Ob sie denn wirklich ernsthaft glaube, sie könne nach dem Vorfall weiter an diesem Projekt arbeiten? Sandrine Martin sollte sich in der Gegend besser nicht mehr sehen lassen, hatte der Generalrat aus Bonnesource am Telefon betont.
Schließlich hatte ihr der Dekan angeboten, das Projekt eines Doktoranden, der seine Arbeit aus persönlichen Gründen abgebrochen hatte, weiterzuführen. Da gab es bereits Ergebnisse aus den Vorarbeiten, und so wären die sechs Monate ihrer Förderzeit auch nicht verloren.
Sandrine hatte sich Bedenkzeit erbeten und Fromentin entließ sie mit aufmunternden Worten: „Nehmen Sie sich Bedenkzeit, Mademoiselle Martin, aber warten Sie auch nicht zu lange.“ Danach hatte er sie aus der Tür seines Büros sanft, aber bestimmt hinauskomplimentiert.
Sandrines Kaffee war inzwischen kalt geworden. Fromentin war ein Opportunist, aber in einem hatte er recht. Nach dem, was passiert war, konnte sie sich im Pays d’Auge nicht mehr sehen lassen. Zwar hatte sie bereits genug Proben für die Analysen genommen, aber was half das noch? Sie durfte die Proben nicht weiter untersuchen. Wahrscheinlich wäre es sogar besser für sie, die Universität zu wechseln.
Gestern war ein Brief für sie angekommen, ohne Absender. „Wir können es dir auch von hinten besorgen, wenn du nicht Vernunft annimmst, du Schlampe!“, stand auf der Rückseite des Fotos, das sie voller Entsetzen angestarrt hatte. Während dieser schrecklichen Stunden hatte sie nicht mitbekommen, dass jemand ihre schlimmsten Momente fotografisch festgehalten hatte.
Und heute war dieser Anruf gekommen. Von einer Frau, angeblich Journalistin. Im ersten Moment hatte Sandrine gedacht, es wäre vielleicht diejenige, die dabei gewesen war. Sie hatte die Gesichter der Gaffer in der Scheune nicht sehen können, wusste nicht einmal, wie viele es gewesen waren. Nach dem Faustschlag war sie benommen zu Boden gegangen. Als sie wieder zu Bewusstsein gekommen war, hatte man ihr einen Sack über den Kopf gestülpt. Sie lag auf dem Rücken und das Gewicht des Mannes, der sie gerade vergewaltigte, drückte sie erbarmungslos nieder. Sie hatte nicht die Kraft gehabt, sich zu wehren. Auch dann nicht, als er ihr seine Zunge in den Mund drückte und danach die Flasche mit dem Fusel, von dem sie notgedrungen trinken musste. Und das Foto davon hatten sie ihr geschickt. Ihr Kopf war halb von dem des Mannes verdeckt, aber was da gerade stattfand, war auf dem Foto deutlich zu sehen. Und die Drohung auf der Rückseite des Fotos war es auch.
Für einen Moment hatte sie bereut, nicht gleich zur Polizei gegangen zu sein. Vielleicht hätte man den Kerl auf dem Foto auch von seinem Hinterkopf her identifizieren können? Aber das hätte sie gleich nach der Vergewaltigung machen müssen. Ins Krankenhaus gehen, dort hätte man ihren Zustand dokumentiert und Abstriche genommen, dachte sie bitter. Spermaproben, um die Täter zu überführen. Aber selbst das hätte ihr wahrscheinlich nichts genützt. Die in der Scheune dabei gewesen waren, hätten alle bezeugt, dass sie freiwillig bei einer kleinen Orgie mitgemacht hatte.
Stattdessen hatte sie nach ihrer Rückkehr selbst bei sich Vaginalabstriche vorgenommen und diese in Probenröhrchen eingefroren. Nur sie wusste, was sich hinter den Kürzeln auf den Röhrchen verbarg. Und diese Scheusale sollten nicht glauben, ungeschoren davonzukommen. Weder für die Panschereien mit dem Calvados noch für das, was sie ihr angetan hatten. Der Tag der Abrechnung würde kommen.
Sandrine konnte sich nicht mehr daran erinnern, was in den Stunden nach ihrer Vergewaltigung passiert war. Sie hatte das Bewusstsein verloren und irgendwann mussten sie von ihr abgelassen haben. Als sie wieder aufwachte, war es bereits dunkel und sie lag im Gras auf einer feuchten Wiese. Es war kalt geworden und der Brechreiz überkam sie, immer wieder, bis es nichts mehr zum Auskotzen in ihrem Magen gab. Als sie festgestellt hatte, dass ihre Verletzungen nicht zu schwer waren, war sie über die Landstraße nach Blagny gehumpelt, wo sie ihr Auto abgestellt hatte.
Bei der Rückfahrt nach Paris war es ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen, bis sie am frühen Morgen in ihr kleines Appartement im Studentendorf in Orsayville gelangt war. Dort hatte sie zwei Tage zusammengekrümmt wie ein Embryo im Bett gelegen, unfähig einen klaren Gedanken zu fassen. Erst am Montag, an dem ihre Rückkehr eingeplant war, tauchte Sandrine wieder in ihrem Institut auf. Ihren Kollegen hatte sie erzählt, man hätte ihr ins Gesicht geschlagen, sie wäre ohnmächtig geworden und hätte den Schläger nicht erkannt. Aber sie wusste, dass Patrick Guérin der erste der beiden Männer gewesen war, die sie vergewaltigt hatten.
Und jetzt hatten sie vielleicht vor, sie mit einer Frau in die Falle locken. Wenigstens eine Frau hatte bei ihrer Vergewaltigung zugeschaut und vulgäre Gemeinheiten von sich gegeben, als sie am Boden lag und alles hilflos über sich ergehen lassen musste.
Aber da war der Akzent. Die Frau, die gerade angerufen hatte, hatte einen leichten Akzent. Sie hatte sich als Christine Bergmann vorgestellt. Eine Deutsche, Journalistin bei dem deutsch-französischen Radiosender AFT. Der Akzent passte dazu, obwohl die Frau ansonsten perfekt Französisch sprach. Sandrine konnte sich nicht erinnern, bei ihren Exkursionen entlang der Route du Calvados einer Deutschen begegnet zu sein. Trotzdem wollte sie Vorsicht walten lassen.
Sie hatte sich mit der angeblichen Journalistin im Labor verabredet, nachdem diese ihr erklärt hatte, sie interessiere sich für ihre Untersuchungen an Giftstoffen im Calvados. Woher sie davon wüsste, hatte Sandrine gefragt, und die Frau sprach von Andeutungen, die ihr während einer Reportage in der Normandie zu Ohren gekommen seien. Sie wirkte ehrlich und Sandrine hatte sich vorgenommen, sie zumindest anzuhören. Zur Sicherheit hatte sie sich aber eine Spritzflasche mit konzentrierter Natronlauge in Reichweite gestellt. Wenn diese Frau von denen geschickt worden war, um sie zu bedrohen, würde sie sich danach im Spiegel nicht mehr wiedererkennen können.
4. Université Paris-Sud, 17. August 1990
Christine gelangte auf Umwegen in das modern ausgestattete Gebäude des Institutes für Lebensmitteltechnologie der Université Paris-Sud. Sie hatte sich durchfragen müssen, die Gebäude auf dem Universitätsgelände lagen weitläufig voneinander entfernt. Nun war sie bis zu einem großen Laborraum vorgedrungen, in dem sie eine zierliche, mit einem weißen Kittel bekleidete Frau in steifer Haltung an einem mit Gerätschaften vollgestellten Labortisch erwartete.
Sandrine Martins Labor war ein großer, heller Raum, der mit einem Mitteltisch, auf dem verschiedene Geräte standen, ausgestattet war. Es sah hier sehr aufgeräumt aus, im Gegensatz zu Leos Labor, dessen Arbeitsplatz immer zur Hälfte mit allem möglichen Zeug vollgestellt war.
„So weiß ich wenigstens, wo alles steht“, hatte Leo ihr einmal gesagt. „Zumindest, solange keiner dazwischen fummelt und die Sachen umstellt.“ Christine hatte Leo manchmal aus seinem Labor abgeholt. Wenn es zeitlich passte, gingen sie zusammen in die Mensa der FU zum Mittagessen.
Sandrine Martin trug ihre dunklen Haare halblang, ihr herzförmiges Gesicht war blass, ihr Mund war ungeschminkt und Sommersprossen lugten auf ihren vollen Wangen unter den hellen Augen hervor. Irisch, ja keltisch sah sie aus, fand Christine. Der distanziert musternde Blick von Sandrine Martin war ihr nicht entgangen, ebenso wenig wie die Spuren eines Faustschlags, die um das linke Auge der Chemikerin herum sichtbar waren. Sandrine Martin hatte versucht, das Veilchen zu überschminken, aber es war ihr nicht ganz gelungen. War diese junge Frau ein Opfer häuslicher Gewalt? Unwillkürlich starrte Christine auf Sandrine Martins Hände; einen Ehering trug sie nicht, aber was hieß das schon?
Hinter ihnen öffnete sich eine Glastür, ein beleibter Mann, der mit einem blauen Kittel bekleidet war, erschien und lud wortlos Eimer mit benutztem Laborgeschirr auf einen Rollwagen.
„Merci, Rémi!“, rief die Chemikerin und rührte sich nicht von der Stelle. Der Mann machte eine scherzhafte Bemerkung und schob den beladenen Laborwagen zurück in den Flur. In der Zwischenzeit hatte Christine ihre Tasche geöffnet und einen Schreibblock herausgeholt. „Möchten Sie hier mit mir reden oder haben Sie einen gemütlicheren Ort, wo wir uns auch hinsetzen können?“
„Vielleicht, aber zuerst möchte ich wissen, wer Sie sind“, sagte Sandrine Martin distanziert. „Haben Sie etwas Brauchbares, dass Sie als deutsche Journalistin ausweist?“
Allmählich kam Christine der Verdacht, dass die Spuren im Gesicht dieser Frau doch nicht von häuslicher Gewalt stammten. Sandrine Martin hatte eindeutig Angst und war misstrauisch gegenüber Fremden. Christine kramte ihren Reisepass und ihre Akkreditierung als Journalistin aus der Handtasche. Die Chemikerin musterte die Dokumente schweigend und ihre Anspannung schien etwas nachzulassen.
Schließlich sagte sie: „Okay, kommen Sie mit.“
Sie verließen das Labor und gingen ein Stück über den Flur in ein Büro. Im Gegensatz zur Ordnung im Labor sah es hier ziemlich chaotisch aus. Auf dem Schreibtisch der Chemikerin stand ein voller Aschenbecher und daneben eine geöffnete Flasche mit Mineralwasser. Sandrine Martin räumte einen mit Büchern vollgestellten Stuhl frei. Sie bedeutete Christine, sich dort hinzusetzen. Dann zündete sie sich eine Zigarette an, inhalierte tief und setzte sich Christine gegenüber.
„Sagen Sie mir zuerst, was und woher Sie überhaupt von mir wissen.“
Christine erzählte von ihrer Reportage und dem Interview mit dem Generalrat aus Bonnesource, der sie auf die Arbeit von Sandrine Martin gebracht hatte.
„Und der hat Ihnen nicht gesagt, um welche Giftstoffe es sich handelt?“, fragte die Lebensmittelchemikerin spöttisch.
„Nein. Ich vermute, es sind Spritzmittel, Pestizide, oder?“
Sandrine Martin winkte müde ab. „Das ist noch ein anderes Kapitel, aber er hat Ihnen also nichts vom Patulin erzählt?“
„Patulin?“ Christine hatte dieses Wort noch nie gehört. „Was ist das?“
„Das kann ich mir denken, dass er nicht darüber reden wollte“, erwiderte Sandrine Martin wie zu sich selbst. „Patulin ist ein Schimmelpilzgift, es entsteht in Faulstellen an Obst, und besonders stark bei Äpfeln ...“
Sie machte eine Pause, zog an ihrer Zigarette und legte sie dann in den Aschenbecher, der von Kippen überquoll.
„Patulin ist hochtoxisch und steht im Verdacht, Mutationen und Krebs zu erzeugen.“
„Und der Zusammenhang …“
„Wenn man bei der Herstellung von Apfelsaft angefaulte Früchte nimmt, dann gelangt das Patulin aus den Faulstellen in den Saft. Patulin ist nicht leicht kaputtzukriegen. Es ist säurebeständig, hitzebeständig und übersteht die Pasteurisierung des Saftes gut.“
„Und solche Früchte …?“
„Fallobst, Madame! “, warf Sandrine Martin ein, „darum handelt es sich.“
„Und Sie haben gesehen, dass Fallobst für …“
„Gesehen!“, unterbrach sie Sandrine Martin, deren Stimme einen bitteren Klang bekommen hatte, „gesehen habe ich eine Menge. Fallobst wird häufig zum Mosten verwendet, denn man kann die beschädigten Früchte so, wie sie sind, nicht mehr verkaufen. Aber für die Saftgewinnung muss man die braunen Stellen vorher großzügig entfernen. Sonst hat man das Patulin im Apfelsaft. Am Anfang hielt ich es für eine Ausnahme, dass sie solche gammligen Früchte nicht aussortierten oder wenigstens die Faulstellen abschnitten. Aber bei bestimmten Leuten war das keine Ausnahme, es war System. Ich begann dann, Fotos von den Produktionsabläufen zu machen und danach Proben zu nehmen.“
„Aber, warum haben Sie die Bauern denn nicht auf diese Gefahr aufmerksam gemacht?“
Sandrine Martin winkte ab. „Das weiß jeder dort, der mit der Vermarktung von Äpfeln zu tun hat.“
„Aber warum?“
„Aber wenn bestimmte Leute nichts davon wissen wollen? Es kostet viel Arbeit und Geld, wenn man die Vorschriften einhalten möchte. So behauptet man einfach, das sei Tradition, man hätte es schon immer so gemacht und das Ganze bla, bla, bla!“
Christine schüttelte ungläubig den Kopf. Sie hatte die Obstbauern in der Normandie als ehrliche Menschen kennengelernt, die anfänglich spröde waren, aber auftauten, wenn sie merkten, dass man sie und ihre Belange ernst nahm.
„Der Generalrat erzählte, Sie hätten die Bauern über Ihre Absichten getäuscht.“
„Der Generalrat sagt das! Dieser Wolf im Schafspelz!“ Sandrine Martin lachte gellend. „Wer hat hier wen getäuscht, Madame Bergmann? Meinen Sie, wir haben diese Studie einfach aus Lust und Laune begonnen? Bestimmt nicht! Wussten Sie, dass in der Normandie die Häufigkeit von Speiseröhrenkrebs weit über dem Landesdurchschnitt liegt?“
Christine schüttelte wortlos den Kopf.
„Es gibt verschiedene Vorstellungen, woran das liegen könnte. Eine davon ist Acetaldehyd, das beim Abbau von Alkohol entsteht und als krebserzeugend gilt. Aber warum betrifft das dann nur die Normandie und nicht andere Regionen, in denen auch Hochprozentiges getrunken wird?“
„Und die andere …,“ Christine suchte nach dem richtigen Wort, „Theorie, ist?“
„Die andere Theorie erklärt die regionale Häufigkeit des Krebses viel besser“, sagte Sandrine Martin. „In Proben von Apfelsaft und in Cidre wurden manchmal hohe Mengen an Patulin gefunden und wir konnten uns nicht erklären, wie das möglich war.“
Sie war aufgestanden, hatte sich eine neue Zigarette angezündet und lief in ihrem Büro auf und ab.
„Die Leute wussten, dass laut Vorschrift nur sauberes Obst für die Herstellung von Saft verwendet werden darf. Und trotzdem!“
„Der Generalrat meinte, Sie wollten den Calvados in den Dreck ziehen.“
„Einen in den Dreck ziehen, ja das können sie!“ Sandrine Martin begann unwillkürlich zu schluchzen.
Sie fing sich wieder und ihre Stimme war jetzt eiskalt: „Sie wissen gar nichts, Madame. Man hat Ihnen Märchen erzählt. Es geht um die Ausgangsstoffe, die Äpfel. Das Patulin wird bei der Vergärung und bei der alkoholischen Destillation zum größten Teil zerstört. Das Gift ist im Apfelsaft.“
Sandrine Martin wischte sich die Tränen aus den Augen und warf das Taschentuch mit einer heftigen Bewegung in den Papierkorb.
„Aber wenn das Patulin durch die Vergärung zerstört wird, wie Sie gerade sagen, wieso findet man es dann noch im Cidre, das ist doch vergorener Apfelsaft, Apfelmost, oder?“
„Richtig, Sie schlaue Journalistin, aber was passiert, wenn der Cidre nicht völlig vergoren ist? Oder, wenn er nach der Vergärung mit Apfelsaft gestreckt wird?“
Sandrine Martin lachte böse.
„Traditionelle Verfahren, alte Rezepte, klar! Aber wenn finanzielle Interessen ins Spiel kommen, wenn immer mehr Früchte benötigt werden, um profitable Absatzmengen zu erreichen, dann nehmen bestimmte Leute einfach alles. Sogar völlig verfaulte Äpfel, die auf den Wiesen herumliegen. Sie haben keine Ahnung, wie es mancherorts zugeht, Madame Bergmann!“
Sie drückte ihre Zigarette aus und stellte sich Christine gegenüber. „So, nun haben Sie die Antwort auf ihre Frage, Madame Journalistin, aber wenn Sie darüber berichten wollen, dann stammen diese Informationen nicht von mir. Offiziell gesehen sind das nur Annahmen und es gibt keine veröffentlichte Studie, die so etwas belegt.“
Sandrine machte eine Pause und um ihren Mund erschien plötzlich ein trauriger Zug: „Jedenfalls nicht von mir.“
„Aber ich dachte, Sie arbeiten daran …“
„Das Projekt wurde eingestellt. Es ist für die Universität nicht mehr relevant. Wenn Sie sich weiter damit befassen wollen, dann passen Sie gut auf, wem Sie damit auf die Füße treten.“
Christine war über die Heftigkeit von Sandrine Martins Reaktion überrascht. Hatte sie ihr wirklich die Wahrheit gesagt? Christine hatte Leroys Andeutung mit der Betriebsspionage ihr gegenüber nicht erwähnt. Vielleicht war diese ganze Aufregung nur gespielt, um über den wahren Auftrag von Mademoiselle Martin hinwegzutäuschen? Diese hatte jetzt die Tür zu ihrem Büro geöffnet und deutete mit einer Geste zum Flur.
Christine erhob sich aus ihrem Stuhl und überreichte der Chemikerin ihre Visitenkarte. „Sie rauchen ziemlich viel und scheinen das für sich sehr gelassen zu sehen, was krebserzeugende Substanzen betrifft.“ Sie sah ihr Gegenüber an und lächelte hilflos.
Sandrine Martin zuckte mit den Schultern. „Als Chemikerin bin ich sowieso gefährdet. Außerdem weiß ich ja um das Risiko. Nein, ich fürchte die Reaktionen mancher Menschen mehr als meine Zigaretten und die Giftstoffe, mit denen ich jeden Tag zu tun habe.“
Christine ging zur Tür. Als sie auf dem Flur war, hörte sie Sandrine Martin hinter ihrem Rücken sagen: „Aber es ist etwas anderes, wenn Sie, ohne es zu wissen, Gift zu sich nehmen. In Lebensmitteln, die noch dazu als hochwertige Produkte bezeichnet werden. Denken Sie mal darüber nach! Adieu und gute Reise, Madame Bergmann.“
5. Berlin-Friedenau, 1. September 1990
Als Leo diese Geschichte von Christine gehört hatte, war er doch ziemlich erstaunt. Sie fragte ihn, ob das mit dem Patulin überhaupt möglich wäre, oder ob es nicht nur ein Vorwand gewesen war, um über Sandrine Martins wahren Auftrag, der Betriebsspionage, hinwegzutäuschen. Leo hatte danach über das Thema Patulin recherchiert, aber das wenige, was er über Sandrine Martin fand, war eine Arbeit über den Nachweis von Aflatoxinen in Lebensmitteln. Es gab nichts, was auf ein Projekt hinwies, über das sie in der Normandie geforscht hatte. Auch aus den Bekanntmachungen ihrer Fakultät gab es keinen Hinweis zu einem Forschungsprojekt über Patulin.
Den Samstag verbrachten sie in Christines Wohnung in der Albestraße. Nach dem Mittagessen begann Leo zu erzählen, was er über Sandrine Martin und über Patulin herausgefunden hatte. Am Nachmittag war der Himmel dunkel geworden, es fing an zu regnen und sie hatten es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht.
„Auf jeden Fall ist Sandrine Martin Expertin, was Pilzgifte betrifft. Sie hat bereits über Aflatoxine, das sind Schimmelpilzgifte, gearbeitet.“
„Die sind doch auch krebserzeugend, oder?“, rief Christine aus der Küche. Sie war kurz aufgestanden, um etwas zum Knabbern zu holen.
„Aber wie! Es gibt immer wieder Berichte, dass Pistazien, Erdnüsse und Paranüsse besonders häufig mit Aflatoxinen belastet sind.“
„Und der Apfelsaft?“ Christine war mit eine Schale Nüssen und zwei Gläsern Apfelsaft zurückgekommen und setzte sich wieder zu Leo auf das Sofa.
„Da habe ich auch ein bisschen nachgeforscht. Bisweilen findet man auch hierzulande Patulin im Apfelsaft, aber das ist eher die Ausnahme und die Grenzwerte werden angeblich nicht überschritten. Mit zunehmendem Alter des Saftes nimmt übrigens der Gehalt an Patulin wieder ab.“
„Na toll!“ Christine lachte und trank einen Schluck. „Also den Saft möglichst lange stehenlassen, bevor man ihn trinkt!“
Jetzt mussten sie beide lachen und stupsten sich dabei an.
„Aber vielleicht ist an der Geschichte doch mehr dran“, meinte Leo nachdenklich. „Besonders, wenn auch der Cidre damit verseucht ist. An Cidre denkt doch niemand, wenn es um Patulin geht.“
„Und der Calva?“ Christines Gesicht war auf einmal dicht vor ihm und sie blickte ihm tief in die Augen.
„Wer weiß?“ Leo gab ihr einen Kuss.
„Das mit dem Patulin wäre doch ein gutes Projekt, um dein neues Labor am LEAG einzuweihen!“ Christine hatte sich inzwischen neben ihm ausgestreckt und zog ihn sanft zu sich herunter.
„Offiziell kann ich denen aber damit nicht kommen“, antwortete Leo, nachdem er sie wieder und diesmal länger geküsst hatte. „Die warten doch im LEAG nicht darauf, dass ich ihnen irgendwelche Projekte anschleppe.“
Christine schlang einen Arm um seine Schultern und nestelte ihm mit dem anderen sein Hemd aus der Hose.
„So etwas muss man bestimmt extra beantragen!“, fügte Leo hinzu.
„Schon genehmigt“, meinte Christine und zog sich ihren Pullover über den Kopf.
„Quatsch, ich meinte doch das mit dem Patulin …“
Christine lachte nur und sagte: „Ist mir schon klar, aber ich meine jetzt etwas ganz Anderes …“
Ihre Lippen verschmolzen zu einem langen Kuss und beide waren für einen Moment damit beschäftigt, sich ihrer restlichen Kleidungsstücke zu entledigen.
Sie lagen beide auf Christines Sofa. Leo schmiegte sich an Christines warmen, einladenden Körper. Er begehrte sie mit einer Leidenschaft, die er vom Anfang ihrer Beziehung kannte. Er nahm sie, die dazu bereit war, ungestüm und zärtlich zugleich und fühlte die Wellen der Erregung in sich auf und abschwellen. Es war, als wäre es das letzte Mal, an dem sie sich so vorbehaltlos lieben konnten. Auch Christine schien von diesem Gefühl gefangen zu sein. Ihr Atem ging stoßweise und sie antwortete auf sein Begehren in der gleichen Weise, wie sie ihm entgegenkam. Ihre Körper verschmolzen miteinander in dem Moment des Höhepunktes, der sie beide gleichzeitig überraschte.
Von irgendwo her kam Leo der Gedanke, als wäre es zugleich ein Abschied. Ein Fenster war offen gewesen, durch das sie das Licht ihrer gegenseitigen Erfüllung sehen konnten. Aber mit den Wellen der langsam verebbenden Erregung würde sich auch dieses Fenster für immer schließen. Er hielt Christine, die lächelnd neben ihm lag, fest im Arm und vergaß diesen Gedanken im gleichen Moment, als er ihr in die Augen sah.
Die Zeit war für eine Weile stehengeblieben, und als Leo seine Augen wieder öffnete, lag er allein auf dem Sofa. Er warf einen Blick aus dem Fenster. Der Himmel war voller grauer Wolken und es regnete noch stärker. Christine war aufgestanden. Nach einer Weile hörte Leo aus der Küche das Zischeln der Espressokanne und der Duft des Kaffees verbreitete sich in der kleinen Wohnung. Gleich darauf kam Christine mit zwei Espressotassen zurück.
„Spontane Einfälle sind doch die besten.“ Leo zog sich an, während Christine den Kaffee auf den Tisch stellte.
„Eben“, sagte sie und lachte.
In der Zeit, als Christine in der Küche war, hatte Leo wieder daran gedacht, was Christine von Sandrine Martin erzählt hatte.
„Hattest du, nachdem du bei ihr an der Uni warst, noch einmal Kontakt mit Sandrine Martin?“
„Nein, nie wieder. Sie hatte ja kein Interesse gezeigt, mir noch mehr darüber zu erzählen.“
„Ich dachte nur, wir könnten sie ja zu einem Vortrag im LEAG einladen, um dort für das Thema Pilzgifte in Nahrungsmitteln Interesse zu wecken.“
Christine trank ihren Espresso und machte ein skeptisches Gesicht: „Nachdem, wie sie damals reagiert hat, habe ich nicht den Eindruck, dass sie mit jemandem darüber reden will. Aber wer weiß, vielleicht doch mit einem Kollegen vom Fach?“
Sie sah Leo verschmitzt an. „Ich habe noch ihre Kontaktadresse an der Université Paris-Sud und du kannst doch mal versuchen, sie dort zu erwischen.“
6. Berlin-Dahlem, 3. September 1990
Es war Montagmorgen und Leo erinnerte sich an das vergangene Wochenende und die schönen Stunden, die er gemeinsam mit Christine verbracht hatte. Heute war sein erster Arbeitstag am LEAG. Der Himmel war so grau, wie er schon am Wochenende gewesen war, aber immerhin regnete es nicht mehr.
Als Leo das Gelände des LEAG betrat, überkam ihm eine Ahnung, als gehöre sein bisheriges Leben einer Vergangenheit an. Eine Zeit, die mit dem heutigen Tag ihren unwiderruflichen Abschluss gefunden hatte. Die Arbeit an der Hochschule war ihm eher wie eine Verlängerung seiner Studentenzeit erschienen. Er hatte sich damit die Illusion eines Lebens bewahrt, das mit dem Alltag an einer Behörde schwer in Einklang zu bringen war.
Sein erster Gang in seiner neuen Dienststelle führte ihn in das Verwaltungsgebäude, ein grauer vierstöckiger Betonriegel aus den sechziger Jahren. Der Vormittag war dafür vorgesehen, dort diverse Unterschriften zu leisten, mit denen seine Anstellung amtlich besiegelt werden sollte.
Als er über den langen, vom Neonlicht spärlich beleuchteten Flur ging, um das für sein Anliegen zuständige Büro zu suchen, sah er dort eine große, nach vorne gebückte Gestalt vor einer Tür stehen. Die Schultern und Arme zusammengepresst, wie eine Inkarnation der Demut, wartete der Mann auf Einlass in ein Büro, vor dem er stand wie vor einem Heiligtum, an dessen Pforte er kaum gewagt hatte, anzuklopfen. Wie ein Blitz durchfuhr Leo eine Vorahnung, was ihn hier erwarten würde. Die wenigen Menschen, die er hier sah, begegneten ihm wortlos mit abgewandtem Blick. Sie wirkten dabei wie Schatten, an denen er vorüberging. Aus ihren Gesichtern sprach Angst, Resignation oder Leere. Abgestumpftheit. Welchen Sinn sah man dann noch in seiner Existenz? Leo wurde plötzlich unsicher, wer er selbst noch war, in dieser Umgebung.
Er sprach jemanden auf dem Flur an und fragte nach dem besagten Büro. Ihm begegnete kaum verhülltes Misstrauen, garniert mit knapper Information: Raum B232 zweiter Stock, erster Flur links. Leo ging weiter, vorbei an einer schier endlosen Reihe von Türen. Er lief über voneinander abzweigende Flure, die ihm wie ein Labyrinth erschienen. Die Reihe der geschlossenen Türen wirkte mit ihrem glänzenden Anstrich wie die Phalanx eines antiken Heeres, das ihm seine spiegelnden Schilder bedrohlich entgegenhielt.
Eintritt nur nach Aufforderung. Versteckte sich hinter diesem Hinweis auf der Tür nicht die Angst, bloßgestellt zu werden in der eigenen Überflüssigkeit? Schließlich fand er das gesuchte Büro. Leo überlegte einen Moment, was er gerade im Begriff war, zu tun.
Der gespenstische Eindruck war so plötzlich verflogen, wie er gekommen war. Leo klopfte kurz an. Er öffnete die Tür, noch bevor er dazu aufgefordert wurde. Nachdem er den Stapel Formulare ausgefüllt und unterschrieben hatte, machte er sich auf den Weg über das Gelände des LEAG. Sein Ziel war das Haus 23. Das Gebäude, in dem ihn sein zukünftiger Vorgesetzter, ein Herr Dr. Bernhard Malus und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin aus Malus Fachgruppe, Frau Dr. Anke Barkowski-Gertenbauer, erwarteten.
Bernhard Malus war ein Mann von untersetzter, kompakter Statur, ohne dadurch übermäßig beleibt zu wirken. Leo schätzte ihn etwa auf Mitte bis Ende vierzig. Sein Haar war so schwarz wie sein Jackett, welches mit der blassblauen Krawatte über einem weißen Hemd kontrastierte. Anke Barkowski-Gertenbauer hatte dunkelblonde, halblange Haare. Sie schien jünger als Bernhard Malus, aber in ihrem dezent geschminkten Gesicht hatten sich um die Mundwinkel harte Züge eingegraben, die ihr Gesicht älter erscheinen ließen. Sie war geschmackvoll gekleidet und trug ein halblanges, rötliches Kostüm, dazu farblich passende hochhackige Schuhe, in denen sie Malus um fast eine Kopfeslänge überragte.
Nachdem sie sich vorgestellt hatten, gingen sie über das Institutsgelände an Büschen und Bäumen entlang, bis sie zu einem rosa gestrichenen Flachbau gelangten. In diesem Gebäude befand sich Leos künftiger Arbeitsplatz, der sich als ein Büro mit zwei dazugehörigen Laborräumen herausstellte. Eines der beiden Labore war mit einem Abzug für das Arbeiten mit giftigen Lösungsmitteln ausgestattet. In dem anderen Labor stand eine Werkbank für Sterilarbeiten, eine etwas in die Jahre gekommene Kühlzentrifuge sowie ein paar Kleingeräte auf den Tischen. Zusammengenommen war das bei weitem zu dürftig, um ein modernes Untersuchungslabor betreiben zu können.
„Da muss man aber noch einiges an Geräten anschaffen, um hier ein Labor für die Mutagenitätstestung zum Laufen zu bringen“, bemerkte Leo verdrossen. Die Besichtigung der Räume hatte ihn ernüchtert, was seine beruflichen Zukunftsaussichten betraf.
Bernhard Malus schien über Leos Bemerkung erstaunt zu sein. „Das müssen Sie alles gesondert beantragen, Herr Schneider. Es sollte prinzipiell kein Problem sein, da Gelder für dieses Projekt reserviert worden sind.“
Nach diesen Worten sah Leo seinen neuen Chef genauer an. Ein untersetzter Mann mit dunklen Augen, dessen wächserne, bleiche Haut mit seinen pechschwarzen, nach hinten gekämmten Haaren kontrastierte.
„Allerdings müssen Sie sich beeilen, damit es für das nächste Jahr auch noch klappt. Sonst können Anschaffungen von Großgeräten erst wieder im darauf folgenden Haushaltsjahr vorgenommen werden.“ Malus Stimme hatte inzwischen einen belehrenden Tonfall angenommen.
Leo glaubte, nicht recht gehört zu haben. Malus, der um einen Kopf kleiner war als er, hatte sich vor ihm postiert. Leo entdeckte kleine Fetteinlagerungen, die sich wie Inseln im Gesicht des Mannes verteilten, das dadurch merkwürdig uneben wirkte.
„Wo das Projekt doch nur auf drei Jahre begrenzt ist, da werden die Geräte erst im dritten Jahr angeschafft? Mir erscheint ein so zeitraubendes Verfahren als nicht sehr sinnvoll.“
Malus verzog spöttisch seine Mundwinkel und sah Anke Barkowski vielsagend an. „Also ich weiß nicht, wie Sie es bisher kennengelernt haben, Herr Schneider, aber am LEAG müssen die Regeln für das Bestellwesen und das Haushaltsjahr eingehalten werden. Am besten Sie setzen sich gleich daran, eine Liste von der Ausstattung anzufertigen, die Sie in nächster Zeit am dringendsten brauchen.“
Malus beugte sich dicht vor und sein zugeknöpftes Jackett verzog sich dabei, so dass es auf merkwürdige Weise von seinem Oberkörper abstand.
„Sicherlich gibt es das eine oder andere Gerät, das Sie für den Anfang bei den anderen Arbeitsgruppen im LEAG mitbenutzen können“, meinte Anke Barkowski beschwichtigend. „Morgen erwarten wir übrigens Frau Kollberg, Ihre zukünftige technische Assistentin. Frau Kollberg kann Ihnen dann bei der Aufstellung der ganzen Materialien, die Sie brauchen, behilflich sein.“
Leo nickte dankbar und lächelte seiner neuen Kollegin tapfer zu. Anke Barkowski wirkte entgegenkommender als sein Vorgesetzter Bernhard Malus.