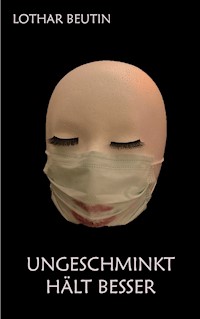Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Berlin im November 2015. Als der angepasste Pharmamanager Herbert Hintersinn auf dem Weg in seine Firma einen Zwergpudel überfährt, ahnt er nicht, dass sein Leben damit eine entscheidende Wendung nimmt. Ausgerechnet er wird dazu bestimmt, Geschäftsbeziehungen mit der syrischen Pharmaunternehmen Erkalaat anzuknüpfen. Herbert merkt schnell, wer hinter diesem Betrieb steckt. Ein Fabrikant von Chemiewaffen, der an Substanzen zur Herstellung des Nervengifts Tabun interessiert ist. Im Spagat zwischen seinem Gewissen und der Loyalität zu seiner Firma versucht Herbert, dieses Waffengeschäft zu verhindern. Seine Freunde Frank und Harry, die gegensätzlichen politischen Lagern angehören, drängen ihn dabei zu sehr unterschiedlichen Maßnahmen. Die Liebe zu seiner Kollegin Elsa gibt Herbert die Kraft, auf sich selbst zu vertrauen und sich aus gesellschaftlichen Zwängen zu lösen. Bei der entscheidenden Begegnung mit einem skrupellosen Terroristen beweist Herbert seine wahre Größe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lothar Beutin
Muttis Erben
oder vom schlechten Gewissen im Lande der Freudlosigkeit
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Montag, 19. Januar 1829
Mittwoch, 11. November 2015
Donnerstag, 12. November 2015
Freitag, 13. November 2015
Samstag, 14. November 2015
Sonntag, 15. November 2015
Montag, 16. November 2015
Dienstag, 17. November 2015
Mittwoch, 18. November 2015
Donnerstag, 19. November 2015
Freitag, 20. November 2015
Samstag, 21. November 2015
Sonntag, 22. November 2015
Montag, 23. November 2015
Dienstag, 24. November 2015
Mittwoch, 25. November 2015
Donnerstag, 26. November 2015
Freitag, 27. November 2015
Samstag, 28. November 2015
Sonntag, 29. November 2015
Montag, 30. November 2015
Dienstag, 1. Dezember 2015
Mittwoch, 2. Dezember 2015
Donnerstag, 3.12.2015
Freitag, 4.12.2016
Zu diesem Buch
Danksagungen
Impressum neobooks
Montag, 19. Januar 1829
Andrer Bürger:
Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und FeiertagenAls ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,Wenn hinten, weit, in der Türkei,Die Völker aufeinander schlagen.Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen ausUnd sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten;Dann kehrt man abends froh nach Haus,Und segnet Fried und Friedenszeiten.
Dritter Bürger:
Herr Nachbar, ja! so laß ich's auch geschehn:Sie mögen sich die Köpfe spalten,Mag alles durcheinander gehn;Doch nur zu Hause bleib's beim alten.
Johann Wolfgang von Goethe: Faust: Eine Tragödie - Kapitel 5 (Auszug)
Mittwoch, 11. November 2015
Die aufgeweckte Stimme aus dem Radio erklang um 6:55 Uhr, wie an jedem Tag, wenn ich zur Arbeit ging. Fünf Minuten hatte ich mir gegeben, um die Sieben-Uhr-Nachrichten bei halbwegs klarem Kopf mitzubekommen. Es war bald Mitte November, der Himmel war noch dunkel, und bis das blasse Morgenlicht in mein Schlafzimmer schien, brauchte es noch eine Weile. Aber dann würde ich schon auf dem Weg in die Firma sein.
Als das Licht der Nachttischlampe die Finsternis um mich herum vertrieb, richtete ich mich auf und starrte blicklos auf mein zerwühltes Bett. Die linke Hälfte blieb seit langem kalt, meine unruhigen Nächte weckten niemanden, außer mich selbst. Vor einem Monat war ich vierundvierzig geworden. Eine Schnapszahl, die meinem Zustand gut entsprach. Seit meiner Scheidung vor zwei Jahren war die Einsamkeit meine ständige Begleiterin. Kontakt mit meiner Familie hatte ich kaum, nachdem es um den Nachlass meines Vaters Streit gegeben hatte. Meine Mutter Ursula lebte mit meiner Schwester Karin und deren Mann Richard weiterhin in derselben Kleinstadt, in der auch ich groß geworden war.
Meine Exfrau Erika hatte ich vor dreizehn Jahren im BIFI, dem Berliner Institut für Infektionskrankheiten, kennengelernt. Ich war damals noch neu in der Firma Sündermann, einem bekannten Berliner Pharmaunternehmen, das sich in den Sparten Chemie, Diagnostik und Pharmazeutika aufgestellt hatte. Als Biochemiker mit Spezialisierung auf Neurologie war ich in einem Unternehmen gefragt, das sich im Bereich der Psychopharmaka stärker engagieren wollte. Ich besuchte Kunden, stellte Produkte vor und handelte Rabatte für Großeinkäufer aus. Das BIFI war ein bedeutender Neukunde und Erika Seidler war dort für die Beschaffung von pharmazeutischen Produkten zuständig. Während wir unser Bestes taten, um die Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma Sündermann und dem BIFI zu intensivieren, vertieften wir auch unsere privaten Kontakte. Nach ein paar Wochen war aus unserer Verbindung eine feste Beziehung geworden, die wir nach einem Jahr in Form einer Ehe beim Standesamt Schöneberg amtlich besiegeln ließen.
Unsere Ehe lief anfangs gut, wir machten Pläne bis hin zum eigenen Haus. Doch die zuerst als reizvoll empfundenen Unterschiede zwischen uns fraßen an unserer Zweisamkeit, bis nach dreizehn Jahren nichts mehr davon übrig war. Als Erika von Trennung sprach, wollte ich nichts davon wissen. Aber mit dem immer offener gelebten Verhältnis, das sie mit einem Kollegen aus dem BIFI eingegangen war, brachte sie mich dazu, der Scheidung schließlich zuzustimmen.
Kinder hatten wir nicht. In dieser Hinsicht waren wir uns immer einig gewesen. Es gab schon genug Kinder auf der Welt, denen es noch dazu schlechtging. So spendeten wir Geld für Amanda, einem kleinen Mädchen aus Burkina Faso, das uns von einer Hilfsorganisation zugeteilt worden war. Da wir beide finanziell unabhängig waren, brachten wir die Scheidung als letztes gemeinsames Vorhaben ohne Streit über die Bühne. Ich war darüber erleichtert, zumal die Arbeit bei Sündermann meine ganze Kraft erforderte.
Der Kontakt mit Erika riss nach der Trennung schnell ab. Ich hatte das nicht gewollt und war darüber enttäuscht. Sie war zu ihrem Arbeitskollegen und Geliebten gezogen, ich kannte ihre neue Adresse, denn es gab noch ein paar Dinge, die wir regeln mussten, aber mehr auch nicht. Ich vermutete, dass es ihr neuer Freund gewesen war, der Erika dazu gebracht hatte, den Kontakt zu mir abzubrechen. Zumindest tröstete mich diese Vorstellung über ihr Schweigen hinweg.
In der Firma hatte ich von unserer Scheidung nichts erzählt. Dr. Thomas Sündermann legte großen Wert auf stabile persönliche Verhältnisse bei seinen Angestellten. Es hätte meiner Karriere geschadet, wenn ihm das Ende unserer Ehe zu Ohren gekommen wäre, zumal Erika in der Beschaffungsstelle eines unserer Großkunden arbeitete. Zudem besaß ich den Ruf eines zuverlässigen Mitarbeiters. Ein Angestellter, der den Erwartungen gemäß funktionierte, Anweisungen nicht widersprach und auch sonst nicht auffiel. Die Anpassung an die Firmenhierarchie war mir auch nicht schwergefallen. Schon als Kind hatte ich gelernt, mich einzufügen. Als Erwachsener richtete ich meine Einstellung danach, was ich für die Meinung der Mehrheit hielt. Nachdem ich eine Position als Manager im Marketing-Segment erreicht hatte, strebte ich nicht mehr danach, mich beruflich groß zu verändern.
Das ging solange gut, bis Thomas Sündermann den Betriebswirtschaftler Axel Lange als Teilhaber in die Firma aufnahm. Mit dem neuen Firmennamen, der Sündermann & Lange KG, änderte sich fast alles. Meine früheren Verdienste waren Schnee von gestern. Mein Arbeitsplatz, den ich auf einem soliden Fundament wähnte, lag plötzlich auf einer Eisscholle, die immer schneller ins Rutschen geriet.
*
Die Tonsequenz, welche die Nachrichten ankündigte, holte mich zurück aus meinen Gedanken. Ich richtete mich auf, hievte meine Beine aus dem Bett und sah, wie meine nackten Füße in dem Teppichboden einsanken. Müde bewegte ich meine Zehen im weichen Flor. Meine Gedanken drifteten ab ins Uferlose. Ein paar Sekunden verblieben noch bis sieben Uhr.
Die Nachrichten boten meist nicht viel Neues. Trotzdem wollte ich sie nicht verpassen. Von der mir vertrauten Stimme verlesen, erschienen sie mir oft wie losgelöst von der Zeit. Ähnliches hatte ich doch schon vor Wochen und Monaten gehört, verlesen von einer Stimme, deren besorgtes Timbre stets Anlass zur Beunruhigung gab.
„Die Versicherten werden sich im nächsten Jahr auf eine deutliche Erhöhung der Krankenkassenbeiträge einstellen müssen. Unter den gesetzlichen Krankenversicherungen haben bereits die ...“
Nach einer unmerklichen Pause erfolgte die nächste Meldung. „Die Bundesregierung kann eine Verlängerung des Solidaritätsbeitrages über den ursprünglich geplanten Termin hinaus nicht mehr ausschließen ...“
Nach einer Atempause fuhr die Sprecherin fort. „Halter von Dieselkraftfahrzeugen müssen im nächsten Jahr mit höheren steuerlichen Belastungen rechnen ...“
Mir war leicht übel, als würde mir das Abendessen immer noch im Magen liegen. Die Erhöhung der Sozialabgaben, der Versicherungsbeiträge, und die Kraftfahrzeugsteuer für meinen 5er-BMW Diesel, den ich mir nach der Scheidung angeschafft hatte, würden meine finanzielle Lage verschlechtern. Auch mit einer Mieterhöhung für die Dreizimmerwohnung, in der ich nach der Scheidung geblieben war, musste ich im nächsten Jahr rechnen.
An eine Gehaltserhöhung war zudem nicht zu denken. Auf der letzten Betriebsversammlung hieß es, die Firma hätte durch die EU-Sanktionen gegen Russland erhebliche Einbußen erlitten.
„Die Sündermann & Lange KG fühlt sich in erster Linie ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verpflichtet. Aus diesem Grund zieht das Unternehmen den Erhalt von Arbeitsplätzen etwaigen Gehaltsanpassungen für die Mitarbeiter vor.“ Der Juniorchef hatte bei diesem Satz seinen Blick auf mich gerichtet, bevor er die Versammlung in den Feierabend schickte.
Ich begann auszurechnen, wie viel Geld mir im kommenden Jahr noch zur Verfügung stand. Bevor ich damit fertig war, durchschnitt die Stimme aus dem Radio meine Gedanken. „Der demographische Wandel wird nach Ansicht führender Finanzexperten Deutschland in den nächsten Jahrzehnten erheblich zusetzen ...spätestens in zwanzig Jahren wird das Altersvorsorgesystem nicht mehr finanzierbar sein. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ist nach Ansicht von Wirtschaftsweisen kaum noch auszuschließen.“
Ich zog meinen Pyjama aus, faltete ihn zusammen und legte ihn aufs Bett. Mein Blick fiel auf meinen winterblassen, untrainierten Körper und die deutlichen Anzeichen einer Gewebeerschlaffung um den Bauchbereich herum. Ein Gefühl der Resignation zwang mich dazu, meine Augen zu schließen, um diesen Eindruck auszublenden. Der Zeitraum, für den der Kollaps der Altersvorsorge vorhergesagt wurde, entsprach meinem Eintritt ins Rentenalter. Dann war es ziemlich egal, wie viel ich vorher in die Rentenversicherung eingezahlt hatte.
Ich zog einen frischen Slip an und stieg in meine Jogginghose. Während ich meine Hausschuhe suchte, die irgendwo unter dem Bett lagen, trug mir der Radiowecker das Elend der Welt in mein achtzehn Quadratmeter großes Schlafzimmer: „Die syrische Regierung hat offiziell zugegeben, Chemiewaffen wie Tabun, Sarin und Senfgas besessen zu haben. Die letzten Bestände davon wurden unter Aufsicht von UNO-Inspektoren zerstört. Giftige Rückstände gehen an Spezialbetriebe in Deutschland zur Weiterverarbeitung.“
Chemiewaffen waren durch die Genfer Konvention weltweit geächtet. Aber einige Länder hatten sich nie darum geschert. Sarin und Tabun standen für tödliche Nervengifte. Ich kannte mich gut damit aus, denn ich hatte mich in meinem Studium intensiv mit neurotoxischen Substanzen beschäftigt. Die Mechanismen der Erregungsübertragung an den Nervenbahnen waren faszinierend. Zudem gab es jede Menge Pharmaka, die das Nervensystem in der einen oder anderen Weise beeinflussten.
„Der Krieg im Nahen Osten hat sich weiter verschärft, mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen nach Europa ist zu rechnen.“
Man sprach von über einer Million Flüchtlingen, die bereits in Deutschland waren. Die meisten sollten aus Syrien stammen, doch genaue Angaben über ihre Zahl und die Herkunftsländer gab es nicht. Die Beliebigkeit, mit der immer wieder neue Zahlen in den Raum geworfen wurden, versetzte mich jedes Mal in Erstaunen. In der Firma hätten sie mich entlassen, wenn ich ihnen mit solchen Unstimmigkeiten gekommen wäre. Doch für die Politik und die Medien galten andere Regeln. Man dachte global, hatte Visionen und solche Kleinlichkeiten störten dabei nur.
Es war fünf Minuten nach sieben. Mit der Zeitansage endeten auch die Frühnachrichten. Ich ging ins Bad, in das wir bei unserem Einzug viel Geld investiert hatten. Über der Wanne hatte ich ein Radio befestigt, das mit einer Spritzschutzeinrichtung versehen war. Ich füllte meinen Zahnputzbecher. Das summende Geräusch der elektrischen Zahnbürste mischte sich mit dem Frühkommentar aus dem Radio.
Während ich mich rasierte, war die Journalistin zur Hochform aufgelaufen: „Deutschland hat die moralische Pflicht, sich um die Situation der Menschen im Nahen Osten und in Afrika zu kümmern ... trägt man hierorts ein gehöriges Maß an Schuld an den Zuständen, die in den Entwicklungsländern herrschen … der demographische Wandel zwingt Deutschland zum Umdenken. Wir müssen offener werden für die Migration aus den von Krieg und Armut betroffenen Ländern …“
Ihre weiteren Worte wurden vom Rauschen des Wasserstrahls übertönt, unter dem ich meinen Rasierer ausspülte. Doch ich brauchte nicht mehr zu hören, um zu wissen, worum es ihr ging. Wie jedes Mal nach einem solchen Weckruf blieb in mir ein Gefühl, als sei ich verantwortlich für den Schlamassel, der sich jeden Tag neu auf der Welt ereignete.
Während ich die Ergebnisse des Zähneputzens und meiner Rasur im hellen Licht des Spiegels überprüfte, breiteten sich Schuldgefühle in mir aus. Warum machte ich mich so verrückt, mit meinen kleinlichen Sorgen um die Miete, um mein Auto und um eine Rente, die ich, wenn überhaupt, erst in mehr als zwanzig Jahren bekommen würde? Wir schaffen das, hieß es. Ich nahm mir vor, den heutigen Tag unter diesem Motto zu beginnen. Deutschland ging es doch gut! Mir ging es doch gut! Wenn ich meine Probleme mit dem Elend in den Kriegsgebieten und mit der Lage der Flüchtlinge verglich, waren das doch Kinkerlitzchen. So hörte man es aus den meisten Medien. Und in den Talkshows waren alle, bis auf ein oder zwei Dödel, die man nur zum Abwatschen eingeladen hatte, auch dieser Meinung.
Natürlich sollte man noch mehr gegen die Missstände in der Welt unternehmen. Ich spendete Geld an Hilfsorganisationen, blieb aber trotzdem auf meinem schlechten Gewissen sitzen. Für mein Leben im Luxus, für meine egoistischen Bequemlichkeiten, und nicht zuletzt für den Zufall, dass ich in einem reichen Land geboren war und dort gut lebte.
Als ich mich einmal bei meinem alten Schulfreund Harry Teubner darüber beklagte, hatte er darüber nur den Kopf geschüttelt: „Hast du dich einmal gefragt, was das alles mit dir persönlich zu tun hat, Herbert? Was kannst du denn für die Probleme in der ganzen Welt? Mach dir lieber Gedanken über Dinge, die du selbst ändern kannst.“
Für einen Moment glaubte ich, nicht recht zu hören. Aber Harry war es schon in der Schule egal gewesen, was andere von ihm dachten. Nach dem Abitur hatte er Philosophie und Psychologie studiert, seinen Kopf mit theoretischem Krimskrams vollgestopft. Vielleicht bekam er deswegen so eigensinnige Ansichten. Ich hielt mich lieber an die Naturwissenschaften. Da gab es feste Bezugspunkte, Fakten und Zahlen.
Als ich mich über seine Worte aufregte, winkte er nur ab: „Ach Herbert! Du schlechtes Gewissen im Lande der Freudlosigkeit!“
Ich warf ihm vor, sich über mich lustig zu machen. Doch er meinte, es wäre wegen meiner naiven Vorstellungen über das, was in der Welt ablief.
Das empörte mich umso mehr. „Harry, du kannst doch nicht die Augen vor den bestehenden Ungerechtigkeiten verschließen! Wir sind durch die Kolonialzeit und die Ausbeutung der Dritten Welt mitschuldig an dem Elend dort!“
„Wieso wir? Man will uns als Bürger dieses Landes gerne für das alles verantwortlich machen. Hast du dir einmal überlegt, wer das behauptet und warum? Wir beide haben persönlich doch keine Schuld an diesen Zuständen. Außerdem gibt es Länder mit kolonialer Vergangenheit, die heute ebenso gut dastehen, wie manche der ehemaligen Kolonialmächte. Nimm China, Südkorea, aber auch Malaysia, Vietnam, Singapur …“
Zugegeben, ich hatte mich nie besonders mit Kolonialgeschichte beschäftigt. Aber es gab viele arme Entwicklungsländer und es war doch bekannt, dass die Europäer für das Elend in der Dritten Welt verantwortlich waren.
„Und warum können manche Länder, obwohl sie enorm viele Reichtümer besitzen, nicht einmal ihre Bevölkerung ernähren?“, bohrte Harry.
Ich zuckte mit den Achseln. Woher sollte ich das wissen?
„Weil diese Länder in einem korrupten Feudalsystem verharren und die Menschen sich dort in Bürgerkriegen seit Jahrzehnten massakrieren. Und dann sagt man, das sei alles unsere Schuld. Natürlich macht unsere Regierung schmutzige Geschäfte, Waffenlieferungen und noch viel mehr. Aber dafür kannst du doch nichts, Herbert. Hat man dich je gefragt, ob du damit einverstanden bist? Vieles kann nur von den Menschen in diesen Ländern selbst geändert werden! Auch wir mussten das in unserer Geschichte tun, sonst lebten wir heute noch im Mittelalter!“
„Trotzdem fühle ich mich dafür mitverantwortlich!“
„Hör doch auf, dich für alles Elend in der Welt anzuklagen, Herbert! Du kannst diese Konflikte nicht lösen, also werden sie dir ewig ein schlechtes Gewissen bereiten. Damit erzeugst du in dir Schuldgefühle, die dich krankmachen. Vielleicht will man das auch!“
„Wieso sollte das jemand wollen?“
„Ganz einfach. Wenn wir uns mies und schuldig fühlen, lassen wir uns leichter manipulieren. Wir lassen uns zu Worten und Handlungen beeinflussen, hinter denen wir nicht stehen und die für uns manchmal nachteilig sind! Aus einem schlechten Gewissen heraus verspricht und tut man häufig etwas, das man später bereut!“
*
Ich ertappte mich dabei, wie ich in Gedanken versunken vor dem Spiegel stand. In meiner Jugend war es der Pfarrer gewesen, der uns ein schlechtes Gewissen vermittelte. Doch das war nur am Sonntag und hielt nie lange vor. Heute hatten diese Funktion die Journalisten übernommen, die rund um die Uhr viel mehr Menschen erreichten, die sich dafür auch nicht extra in eine Kirche bequemen mussten.
Ich weiß nicht mehr, wie Harry und ich damals auseinandergegangen waren, doch haben wir uns bei solchen Diskussionen nie ernsthaft gestritten. Ich stellte mir nur gerade vor, wie das Gespräch verlaufen wäre, wenn mein Studienfreund Frank dabei gewesen wäre.
Frank Koestner hatte ich an der Uni in Berlin kennengelernt. Wir waren beide im gleichen Studiengang und trafen uns regelmäßig in Seminaren und Vorlesungen. Frank war außerdem politisch aktiv und trat bald in eine Partei ein, die sich dem Umweltschutz und den Menschenrechten verschrieben hatte. Sie fußte auf den Wurzeln der Studentenbewegung von 1968, zu deren Erben sich Frank und viele in seiner Partei zählten.
Doch seit 1968 waren bald fünfzig Jahre vergangen. Frank und seine Partei hatten sich längst in dem damals bekämpften System eingerichtet. Mit der Zeit war er zu jemand geworden, der ich schon immer gewesen war, ein an die Gesellschaft Angepasster. Als ich das einmal andeutete, behauptete er, es wäre genau umgekehrt. Nicht er, sondern die Gesellschaft hätte sich inzwischen an seine Ideen und die seiner Partei angepasst. Ich widersprach ihm nicht, es war mir auch egal. Man konnte das von dieser oder jener Warte sehen. In jedem Fall hatten wir gemeinsam, zu den Anständigen der Gesellschaft zu gehören.
Harry hingegen hatte sich nie einer Partei angeschlossen. Über den vielerorts beschworenen Aufstand der Anständigen hatte er nur gelästert. Die das propagierten, seien Heuchler, meinte er. Ihre Phrasendrescherei diene nur dazu, kritische Meinungen abzuwerten und zum Schweigen zu bringen. Harry und ich waren im gleichen Jahr zum Studium nach Berlin gezogen. Kaum war er in der Stadt angekommen, machte er schon seinen Taxischein. Im Laufe der Jahre wurde er zu einem typischen Langzeitstudenten, der seinen Lebensunterhalt mit Taxifahren verdiente. Harry war noch an der Uni, als ich bereits verheiratet war und für Sündermann auf Geschäftsreisen ging. Erika hatte für Harry nie etwas übrig gehabt. Sie hielt ihn für einen Versager, der einen schlechten Einfluss auf mich hatte.
Neben seiner Arbeit als Taxifahrer betrieb Harry eine Internetseite mit dem Titel Ansichten eines Droschkenkutschers. Es war eine andere Welt, verglichen mit dem, was man in den offiziellen Medien hörte. Doch Harry war es egal, ob das, was er schrieb, politisch korrekt war oder nicht. Mir dagegen war es immer sehr wichtig gewesen, was andere über mich dachten.
„Die Welt ist so, wie man sie sieht“, hatte der Paartherapeut mir damals in der Scheidungsphase gesagt. Doch das hatte mich nicht besonders angesprochen. Für mich war wichtiger, wie die Welt mich sah. Dazu gehörte auch, dass man sich nicht durch politisch unkorrekte Ansichten gesellschaftlich ins Abseits stellte.
Ein erneuter Blick in den Spiegel erinnerte mich daran, dass ich dringend zum Friseur musste. Ich fuhr mir mit den Fingern durch meine hellbraunen Haare und kämmte die Strähnen nach hinten. Eigentlich waren meine Sorgen lächerlich, wenn man sie mit den Problemen vieler Menschen verglich. Ich hing das nasse Handtuch zum Trocknen über die Zentralheizung. All das hier, die große Wohnung, das überheizte Bad, waren purer Luxus. Es erinnerte mich daran, wie Frank mir mein Konsumverhalten vorgeworfen hatte. Als ich noch mit Erika verheiratet gewesen war, hatten wir uns regelmäßig mit Frank getroffen und über Gott und die Welt diskutiert.
Erika fand Franks Ansichten am Anfang ziemlich daneben, sie liebte den Luxus. Doch Frank hatte sie irgendwann soweit gebracht, dass sie von sich aus auf politische Veranstaltungen ging. Sie begann sich verstärkt für Frauenrechte zu engagieren. Schließlich wurde sie in ihrer Dienststelle zur Gleichstellungsbeauftragten gewählt. Damit war sie von ihrer monotonen Arbeit in der Beschaffungsstelle freigestellt und hatte noch dazu im BIFI an Einfluss gewonnen.
Im Jahr vor der Scheidung hatte ich Frank aus den Augen verloren. Ich hatte mich damals von allen zurückgezogen und litt still vor mich hin. Von den gemeinsamen Freunden aus der Zeit unserer Ehe ließ kaum noch einer etwas von sich hören. Als Reaktion darauf hatte ich mich immer mehr in die Arbeit gestürzt.
Doch dann hatte ich Frank eines Tages zufällig auf der Straße wiedergetroffen. Wir gingen auf ein Bier in eine Kneipe, die wir noch von früher her kannten, sprachen über alte Zeiten und wie es uns seitdem ergangen war. An der Uni war es damals für mich wichtig gewesen, von dem bewunderten, zwei Jahre älteren Frank Koestner anerkannt zu werden. Frank besaß vieles, was mir fehlte. Er war selbstsicher, konnte gut reden, und mit seiner Art hatte er bei Frauen schnell Erfolg. Auf irgendeine Weise ließ er mich immer spüren, was für ein kleiner Durchschnittstyp ich selbst war.
Als wir uns wiedersahen, war ich über Franks bürgerliche Erscheinung überrascht. Statt des üblichen Rollkragenpullovers und der ausgewaschenen Jeans trug er ein weißes Hemd unter einem modischen Sakko mit einer dazu passenden Hose. Nur seine weißblonden Haare hingen noch genauso strähnig auf beiden Seiten seines Gesichts herunter, wie in früheren Zeiten. Ich hatte mir daher nichts weiter dabei gedacht, als ich Frank von meinem 5er-BMW vorschwärmte und von den Annehmlichkeiten, die ich mir als leitender Angestellter bei Sündermann & Lange leisten konnte.
Doch Frank reagierte ganz anders, als ich es erwartet hatte. „Deine egoistische Bequemlichkeit und dein Konsumverhalten gefährden die Existenz anderer Menschen. Mit der Energie, die du für dein angenehmes Leben verpulverst, kann in Afrika ein ganzes Dorf leben!“
Er beschrieb lebhaft die Situation von Menschen, denen der Klimawandel die Ernte vernichtete und deren Heimat durch das Ansteigen des Meeresspiegels und immer häufigere Dürreperioden bedroht war. Und irgendwann kam die Frage: „Und was tust du dagegen, Herbert?“
Frank hatte mich dabei so eindringlich angesehen, dass mir ganz mulmig wurde. Er hatte seinen zweiten Halben geleert, und mit seinen Gesten unterstrich er seine anklagenden Worte. Seine grauen Augen, die hinter den Brillengläsern verkleinert wirkten, hatten mich nicht aus ihrem Blick gelassen.
Ich kannte diesen Blick noch von früher. Es war besser, in diesem Moment nichts zu sagen. Ich dachte daran, was Harry mir über das schlechte Gewissen und dessen psychische Folgen gesagt hatte und umklammerte mein Glas. Ich hatte nur ein kleines Bier bestellt, denn ich musste ja noch mit dem Auto fahren.
In diesem Moment hatte ich es bereut, Frank von meinem schicken BMW und meiner großen Wohnung vorgeschwärmt zu haben. Doch woher hätte ich wissen können, dass er immer noch die gleichen Ansichten teilte wie früher? Wo er doch von seinem Äußeren auch als Angestellter bei Sündermann & Lange problemlos durchgegangen wäre.
Als ich ihm erzählte, ich würde Greenpeace und andere Hilfsorganisationen regelmäßig mit Spenden unterstützen, fiel er mir ins Wort: „Petitionen zu unterschreiben und Hilfsprojekte zu unterstützen, das allein reicht nicht! Du fährst einen überdimensionierten Spritfresser und lebst allein in einer zentralbeheizten, komfortabel eingerichteten Dreizimmerwohnung. Gerade jetzt, wo immer mehr Flüchtlinge ankommen, die kaum noch untergebracht werden können. Du könntest zumindest einen oder zwei davon bei dir aufnehmen!“
Als er das gesagt hatte, hielt ich lieber den Mund, bevor ich in ein neues Fettnäpfchen trat. Frank hatte sicherlich recht. In letzter Zeit war der Andrang der Flüchtlinge ja noch viel größer geworden. Aber so einfach war das trotzdem nicht. Inzwischen hieß es überall, man müsste den Flüchtlingen helfen, aber für mich war schon das Zusammenleben mit Erika nicht einfach gewesen. Wie sollte das erst mit Menschen gehen, für die ich, wie es offiziell hieß, zwar verantwortlich, die mir aber völlig fremd waren?
Nachdem ich zu einem anderen Thema wechseln wollte, verlor unsere Unterhaltung an Fahrt. Nach einer Weile hatte Frank auf die Uhr geschaut und gemeint, er hätte noch eine Verabredung.
„Wir könnten uns ja wieder mal treffen, wenn du Zeit hast“, schlug ich vor. In diesem Moment war ich froh, dass er überhaupt damit einverstanden war.
Doch Frank ließ mich gleich wissen, dass er wenig Zeit hatte: „Ich bin oft auf Achse und ziemlich ausgebucht. Aber du kannst ja meine Facebook-Seite abonnieren. Dann bist du auf dem neuesten Stand, was bei mir so läuft. Vielleicht engagierst du dich auch einmal für eine gute Sache!“ Bevor er ging, hatte er mir noch seine E-Mail-Adresse auf einen Bierdeckel geschrieben.
Ich nahm mein Handy und suchte gleich bei Facebook nach Frank Koestner. Es gab mehrere, doch er war der Einzige, der über zehntausend Facebook-Freunde hatte. Auf seiner Seite standen Ankündigungen seiner Partei und Aufrufe zu diversen Veranstaltungen. Doch Persönliches von ihm fand ich nicht. Sein Profilfoto zeigte ihn in erster Reihe bei einer Demonstration gegen die Braunkohlenwirtschaft.
Bei Facebook war ich damals nur wegen Erika eingestiegen. Es war in dem Jahr, bevor wir uns scheiden ließen. Erika nahm seit einiger Zeit an der Volkshochschule Bauchtanzkurse und war abends oft mit ihrer Tanzgruppe unterwegs. Ich hatte mitbekommen, dass sie regelmäßig mit anderen chattete. Es machte mich eifersüchtig, und als ich sie fragte, mit wem sie sich da die ganze Zeit unterhielt, hatte Erika nur unwillig reagiert: „Salima und die anderen von der Bauchtanzgruppe sind alle bei Facebook. Sie postet uns Links zu Tanzvideos und zu Veranstaltungen. So wissen alle aus der Gruppe zur gleichen Zeit Bescheid.“
Als ich ihr vorschlug, ob wir uns nicht auch über Facebook verlinken sollten, hatte sie schallend gelacht: „Aber wozu denn, Herbert? Wir sehen uns doch jeden Tag!“
Ich hatte mich dann, ohne ihr davon zu erzählen, bei Facebook angemeldet. Auch wenn es auch nur dazu diente, mir von Zeit zu Zeit die Seite von Erika anzusehen. Aber da wir nicht als Freunde verbunden waren, konnte ich nicht viel daraus entnehmen. Nur, dass sie zahlreiche Bekanntschaften mit Leuten hatte, von denen ich so gut wie keinen kannte. Eigene Bekannte hatte ich nicht viele und keiner von denen war bei Facebook. Auch Harry nicht. Er müsste schon genug Anfeindungen wegen seines Blogs ertragen, meinte er, als ich ihn danach fragte.
Das hatte meine Neugierde geweckt. Als ich einmal allein in meiner Wohnung saß, hatte ich mir ein paar seiner Aufsätze durchgelesen. Das meiste davon fand ich ziemlich schräg. Doch nun war mir klargeworden, warum Harry den Unmut so vieler Leute auf sich zog. Seinen Aufsatz über den Klimawandel hatte ich sogar ein paarmal gelesen. Hauptsächlich deswegen, weil Frank mir meine miese CO2-Bilanz vorgeworfen hatte. Harry stritt die Möglichkeit eines Klimawandels nicht ab. Trotzdem waren seine Ausführungen dazu ziemlich provokant. Irgendwann kam mir zu Ohren, dass ein Meteorologe vom französischen, staatlichen Fernsehen fristlos entlassen worden war, nur weil er Zweifel am Klimawandel geäußert hatte. Als ich Harry davon erzählte, hatte er gelacht. So etwas könne ihm zum Glück nicht passieren, denn er sei ja Freiberufler und nicht beim Staat angestellt.
*
Nachdem Frank gegangen war, war ich noch eine ganze Weile in der Kneipe geblieben. Ich hatte die Biere bezahlt und über mein Leben nachgedacht. Irgendetwas machte ich falsch. Warum wurde ich von allen immer so kritisiert, wo ich doch versuchte, jedem möglichst gerecht zu werden? Frank schien ein Musterbeispiel dafür zu sein, wie man verantwortungsvoll lebte. Wahrscheinlich fuhr er das ganze Jahr über nur Fahrrad und wohnte in einer Wohngemeinschaft, in der jeder mit jedem alles teilte. Ich hatte mich aber nicht getraut, ihn danach zu fragen.
Wahrscheinlich hätte er mir auch nichts darüber verraten, denn er tat ziemlich geheimnisvoll. Später las ich in einer Analyse, dass die Wähler von Franks ökologischer Partei häufiger das Flugzeug benutzten, als die der anderen Parteien. Frank gehörte bestimmt zu den Vielfliegern. Nach seinen Einträgen bei Facebook war er weltweit auf Konferenzen und Protestversammlungen unterwegs. So einen Terminmarathon konnte man nur mit dem Flugzeug bewältigen. Seine Reise zum Whale Watching in Patagonien, von der er Fotos gepostet hatte, konnte er nicht zu Fuß angetreten haben. Es hätte mich gereizt, ihm dazu einen kritischen Kommentar auf seine Facebook Seite zu schreiben, von wegen seiner CO2-Bilanz. Aber ich ließ es doch lieber sein. Wahrscheinlich hätte er mich gleich geblockt, und ich wollte unseren neu aufgenommenen Kontakt nicht abreißen lassen.
An dem besagten Abend in der Kneipe war mir meine Kompromissbereitschaft naiv und unbeholfen vorgekommen. Egal, was ich tat, ich lag sowieso falsch. Der Gedanke, ich könnte mich ebenso gut umbringen, ging mir durch den Kopf. Glücklicherweise hielten solche Anwandlungen bei mir nicht lange vor. Auf dem Weg nach Haus war ich nur noch froh, mit meinem kleinen Bier die Promillegrenze nicht überschritten zu haben.
Im Spiegel sah ich mein von der schlaflosen Nacht gezeichnetes Gesicht. Wenn Selbstmord die richtige Lösung wäre, hätten sich andere längst vor mir von der Welt verabschieden müssen. Schließlich hatten Erika und ich mit dem Verzicht auf eigene Kinder dafür gesorgt, die Spirale der Konsumgesellschaft nicht weiter fortzusetzen. Ich hätte gerne gewusst, ob Erika auch in ihrer neuen Beziehung so konsequent dabei geblieben war.
Natürlich hatte der demographische Wandel etwas mit den sinkenden Geburtenraten zu tun. Erika und ich hätten uns Kinder leisten können. Für die Jüngeren wurde es aber immer schwieriger, Beruf und Familie zu vereinbaren. Unsichere und schlechtbezahlte Jobs, steigende Mieten und die Konkurrenz mit Menschen, die für ihre Berufskarriere auf alles andere verzichteten, machten das zu einem persönlichen Risiko.
Doch nun hieß es, die demographische Katastrophe könnte durch die vielen Flüchtlinge vermieden werden. Die meisten von denen waren noch jung genug, um eine Familie zu gründen. Die Regierung und die Leitmedien begrüßten den Zustrom der Flüchtlinge als ersehnten Ausstieg aus einer vergreisenden Gesellschaft. Schon deswegen sollte man die Neuankömmlinge nicht nur aus humanitären, sondern auch aus volkswirtschaftlichen Gründen herzlich willkommen heißen. Auch wenn ich in dieser Sache zwiespältig fühlte, so sollte mein Verstand es doch begrüßen, sagte ich mir. Vielleicht war damit auch meine Rente nicht so sehr gefährdet, als wie es im Moment erschien.
Mich fröstelte, wie ich halbnackt vor dem Spiegel stand, und ich warf einen kritischen Blick auf mein Gesicht. Über das Altwerden hatte ich bis vor kurzem kaum nachgedacht. Doch im ungetrübten Licht des Badezimmers erschien mir meine Haut nicht mehr so glatt wie noch vor ein paar Jahren. Es gab Flecken und Unebenheiten, die vorher nicht dagewesen waren. Die Falten hatten sich tiefer in die Winkel meines Mundes eingegraben, der mit den Jahren immer schmaler geworden war.
Ich mochte mein Spiegelbild nicht sehr. Es hatte zu wenig mit der Vorstellung von mir selbst gemein. Ich wandte mich ab und versuchte mich an eine Zeit zu erinnern, in der ich mein Antlitz noch gemocht hatte. Wann das genau gewesen war, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Nur, dass es viele Jahre her gewesen sein musste. Jetzt war ich weder jung noch alt. Eigene Kinder heranwachsen zu sehen, hätte mich zu sehr an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Ich blickte auf meine Armbanduhr. Es war schon spät. Ich musste bald los, wenn ich rechtzeitig zur Sitzung in der Firma erscheinen wollte!
Ich zog mich rascher an als gewöhnlich und ging in die Küche, um noch etwas zu essen. Wie jeden Morgen machte ich mir zwei Brote, eins mit fettarmem Schinken und das andere mit Käse. Die Kaffeemaschine hatte ich schon gestern befüllt. Während sich das heiße Wasser mit leisem Gurgeln den Weg durch das Kaffeepulver bahnte, dachte ich an die heutige Sitzung. Sie war unter dem Thema AG Neue Märkte als außerordentlich wichtig angekündigt worden. Ich ließ mich auf einen Küchenstuhl sinken und stützte meinen Kopf in meine Hände. Die Müdigkeit kroch an mir hoch, während ich die Tropfen der schwarzen Flüssigkeit zählte, die sich in der Glaskanne sammelten.
Die Flusen auf dem Boden erinnerten mich daran, dass es längst an der Zeit war, gründlich Staub zu saugen. Schlechtgelaunt fegte ich mit der Hand die Brotkrümel vom Tisch. So hatte ich wenigstens mehr Veranlassung, endlich sauberzumachen. In Gedanken verschob ich die Putzaktion auf das Wochenende. Lustlos auf meinem Brot kauend, notierte ich mir die heutigen Besorgungen auf einem Zettel.
Als wir noch zusammenlebten, hatte Erika meine Versuche, sie für eine gesunde Ernährung zu gewinnen, schon zur Kenntnis genommen. Doch sie scherte sich nicht besonders darum, wenn es im Widerspruch zu ihren Vorstellungen stand. Ich fand es bedenklich, dass sie jeden Abend zwei Gläser Rotwein trank. Einmal hatte ich ihr eine Broschüre zur Alkoholprävention auf den Teller gelegt, während sie noch mit den Essensvorbereitungen beschäftigt war. Erika hatte einen Blick darauf geworfen und sie mir dann mit einem amüsierten Lächeln über den Tisch zurückgeschoben. „Warum legst du mir so etwas hin, Herbert?“ Ich sah sie noch vor mir und erinnerte mich an ihren spöttischen Blick. An jenem Abend trank sie absichtlich drei Gläser Rotwein.
Nach der Scheidung hatte ich meinen häuslichen Speiseplan den Empfehlungen der Gesundheitsverbände angepasst. Die Neueinstufung der Cholesterinwerte hatte in der Firma für viel Aufsehen gesorgt. Der alte Grenzwert von 130 Milligramm LDL-Cholesterin war um fast die Hälfte herabgesetzt worden. Damit eröffnete sich ein neuer Markt. Mit den neuen Grenzwerten konnte man jeden vierten Deutschen als therapiebedürftig einstufen. Durch den Verkauf von Statinen, neu entwickelten Medikamenten zur Senkung des Blutfettspiegels, lockten Millionenumsätze. Die Sündermann & Lange KG war dabei, wenn es darum ging, sich von diesem Kuchen ein dickes Stück abzuschneiden.
Trotz meiner guten Vorsätze war es mir nie leicht gefallen, mein Gewicht zu halten. Als wir noch verheiratet waren, geizte Erika nicht mit spitzen Bemerkungen. Gerne in Situationen, wo es mich am meisten traf, wenn wir am Strand oder zusammen im Bett waren. Ich schränkte mich dann mit dem Essen ein, bis ich mir ein oder zwei Kilo abgehungert hatte. Doch nach unserer Trennung stand Erika mir nicht mehr als personal coach zur Verfügung. Das häufige Kantinenessen, Restaurantbesuche mit Kunden und ein Heißhunger auf Süßigkeiten, der mich in manchen Momenten wie aus dem Nichts überfiel, ließen die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nur theoretisch auf mich wirken. Ich hatte vier Kilo zugenommen. Wenn ich mein Jackett auszog, war der Ring über meinem Hosenbund nicht zu übersehen. So behielt ich die Jacke bei Sitzungen lieber an, selbst wenn ich dabei ins Schwitzen geriet.
Dabei waren körperliche Fitness und eine entsprechende Erscheinung Kennzeichen für erfolgreiche Menschen. Axel Lange war ein asketischer Typ. Seine Größe von einem Meter neunzig und seine muskulöse Erscheinung verschafften ihm schon äußerlich den nötigen Respekt. Meine Kollegen Friedhelm Berger und Torben Tüsselhover waren beide ehrgeizig, sportlich und Workaholics. Dr. Berger hatte mit jenseits der Fünfzig sogar noch Preise bei Segelregatten gewonnen. Damit konnte ich nicht mithalten, obwohl ich zwölf Jahre jünger als Berger war.
Das Konkurrenzverhältnis zu meinen beiden Kollegen war auch der Hauptgrund für meine Schlafprobleme. Dahinter stand das in der Firma kursierende Gerücht, eine der drei Leitungspositionen im Bereich Einführung und Distribution von Pharmazeutika würde in absehbarer Zeit gestrichen. Es war noch nicht klar, wen von uns es treffen würde, doch ich hatte das Gefühl, die Zeichen standen gegen mich.
Dr. Berger war bereits Manager bei Sündermann gewesen, als ich vor fünfzehn Jahren eingestellt worden war. Es hieß, er wäre vorher im Ausland an der Durchführung von medizinischen Studien beteiligt gewesen. Angeblich hatte es Probleme gegeben, die ihn zwangen, nach Deutschland zurückzukehren. Als ich ihn daraufhin ansprach, riet er mir, ich solle mich nicht um Gerüchte kümmern, wenn ich bei Sündermann Karriere machen wollte. Fortan hielt ich mich daran und behielt zu Berger über lange Jahre ein kollegiales Verhältnis.
Das änderte sich jedoch, als Torben Tüsselhover unserem Team zugeteilt wurde. Die Anstellung Tüsselhovers war die erste Handlung des neuen Teilhabers Axel Lange gewesen. Mit ihm hatte er mir einen zehn Jahre jüngeren Konkurrenten gegenübergesetzt. Ich hatte nie verstanden, welche sachlichen Gründe für die Einstellung Tüsselhovers gesprochen hatten. Neben einem abgebrochenen Chemiestudium und einem Master in Betriebswirtschaft wies Tüsselhover keine Berufserfahrung auf. So konnte ich mir nur erklären, dass Langes Schwäche für Tüsselhover persönlicher Natur war. Tüsselhovers feminines Auftreten, seine dunkelblonden Locken, sein geschwungener Mund und die auffallend langen Wimpern hatten etwas Laszives. Von Anfang an hielt ich ihn für schwul. So locker, wie die beiden miteinander umgingen, nahm ich an, dass er mit Axel Lange ein Verhältnis hatte.
Torben Tüsselhover lehnte zudem den Verzehr von tierischen Nahrungsmitteln ab. Wie er betonte, machte er das aus ethischen und ökologischen Motiven. In der Firma kam so etwas gut an. Ich selbst hatte es nie geschafft, auf Fleisch zu verzichten. Ich dachte dabei an Franks Vorhaltungen zu meiner CO2–Bilanz. Doch die fiel gegenüber der Tatsache, dass in Deutschland über achtzig Millionen Rinder, Schweine und Hühner gehalten wurden, deren Gasausdünstungen erheblich zum Klimawandel beitrugen, kaum ins Gewicht.
Ich nahm mir trotzdem vor, meinen Fleischkonsum einschränken. Auch in der Firma konnte ich ein paar Worte darüber fallenlassen. Den letzten Bissen vom Schinkenbrot ließ ich auf dem Teller. Ich griff stattdessen zu einem Kugelschreiber, um meine Einkaufsliste um zwei Büchsen mit vegetarischem Brotaufstrich zu erweitern.
*
Es war höchste Zeit aufzubrechen, wenn ich nicht zu spät zur Sitzung kommen wollte. Bevor ich ging, vergewisserte ich mich ein paarmal, alle Lichtquellen und elektrischen Geräte ausgeschaltet zu haben. Das war so eine Manie von mir, die sich aus der Furcht entwickelt hatte, es könnte sich während meiner Abwesenheit in der Wohnung etwas entzünden. Ein letzter Blick auf die Uhr trieb mich zur Eile. Ich schloss die Tür und lief die Treppe hinunter.
Im Hausbriefkasten steckten die Wochenzeitung und ein Brief von der Hausverwaltung. Draußen vor der Haustür wehte mir der Wind einen feinen Sprühregen ins Gesicht. Mein Blick glitt über die Dächer der Häuser. Die rötliche Farbe des Himmels wechselte am Horizont in ein diffuses Grau. Ich bedauerte es, wieder den ganzen Tag im Büro verbringen zu müssen. Auf dem Weg zur Garage riss ich den Briefumschlag auf. Der böige Wind zerrte an dem Papier, es war die Ankündigung einer Mieterhöhung für das kommende Jahr.
Die metallene Garagentür schwang mit einem knarrenden Geräusch nach oben. Ein Druck auf den Schlüssel und die Zentralverrieglung meines 5er-BMW öffnete sich mit einem satten Klacken. Vor dem Einsteigen trat ich auf etwas Weiches. Ich sah auf meinen Schuh, es war Hundekot. Der Rest davon lag plattgetreten auf dem mit Laub übersäten Grünstreifen vor der Garage. Verzweifelt versuchte ich, die klebrigen Fäkalreste von der Schuhsohle abzustreifen. Ein Geruch nach Verwesung stieg hoch. Doch ich musste los, wenn ich nicht zu spät zur Sitzung erscheinen wollte.
Aus dem Augenwinkel sah ich Frau Steckenborn ganz in der Nähe. Sie stand auf einem Rasenstück und verfolgte interessiert mein Tun. Frau Steckenborn wohnte drei Etagen unter mir. Sie war eine kleine, gedrungene Person um die fünfzig mit auffallend hellrot gefärbten Haaren. Ihr weißer Kleinhund rannte auf mich zu, wobei sie die Leine meterweise abspulen ließ. Sie besaß noch einen zweiten Hund ähnlichen Kalibers, den ich aber im Moment nicht ausfindig machte. Als sie nicht aufhörte, mich anzuglotzen, wusste ich Bescheid. Sie hatte ihre Hunde absichtlich vor meine Garage geführt, damit sie dort ihr Geschäft verrichteten. Vermutlich machte sie das, weil ich mich bei der Hausverwaltung über sie beschwert hatte. Ihre Hunde bellten jedes Mal, wenn ich auf der Treppe an ihrer Wohnungstür vorbeilief.
Ich bedachte diese infame Person mit einem vernichtenden Blick. Daraufhin zog sie ihren Hund mit kräftigen Zügen an der Leine zurück, als hole sie einen Anker ein. Mit den Resten der Exkremente, die ich mit einem Aststück aus der Sohle kratzte, hatte sich auch Frau Steckenborn verkrümelt. Mein Schuh war immer noch schmutzig, doch ich durfte nicht zu spät kommen und setzte mich ans Steuer.
Ich gab Gas, um die verlorene Zeit wieder einzuholen. Franks Worte über das Auto als Klimakiller hatten mir eine Zeitlang das Fahrvergnügen vermiest. Doch nur solange, bis ich mich genauer mit Kohlendioxid-Emissionen beschäftigt hatte. Aus einer Bedarfsanalyse der Firma für ein Zeckenspray wusste ich, dass in Deutschland elf Millionen Katzen und sieben Millionen Hunde gehalten wurden. Schon eine Katze gab ebenso viel an schädlichem Treibhausgas in die Umwelt, wie einer dieser Heizpilze, mit denen Restaurants die Plätze auf dem Bürgersteig für ihre Kundschaft warmhielten. Doch darüber sprach man auch in Franks Partei nicht. Man war zwar gegen Autos, doch vermutlich hielten sich viele ihrer Wähler Kleintiere und man wollte sie mit solchen Geschichten nicht verprellen.
Der Nieselregen hatte glücklicherweise aufgehört. Nach fünfhundert Metern bog ich ab, um auf der Geraden wieder zu beschleunigen. Es dauerte nicht lange, da endete mein Sprint hinter einem blauen Kleinwagen. Die Tachonadel pendelte zwischen vierzig und fünfzig. Angespannt wartete ich auf die nächste Gelegenheit, um an dem blauen Nissan vorbeizuziehen. Je länger es sich hinzog, desto klarer wurde, dass ich den neun Uhr Termin verpassen würde. Ich dachte an den hämischen Blick aus Tüsselhovers Augen, die so blau waren, wie der Nissan vor mir. Meine Kopfschmerzen pulsierten. Ich rieb mir die Augen, um die aufkommende Müdigkeit zu vertreiben.
Endlich bot sich eine Lücke. Ich überholte, grinste der empörten Frau im Nissan ins Gesicht, um knapp vor ihr wieder einzuscheren. Sie blieb schnell hinter mir zurück. Die Straße vor mir war frei. Mein Auto beschleunigte mit einem satten Brummton. In diesem Moment fühlte ich mich von allem losgelöst, was mich vorher bedrückt hatte.
Den Hund sah ich erst, als es zum Bremsen zu spät war. Das Tier mit dem wolligen Fell und dem Stummelschwanz, der in einem putzigen Haarbüschel endete, rannte zielgerichtet vor mein Auto. Als es vom rechten Vorderreifen erfasst wurde, machte sich das nur als ein leichtes Ruckeln bemerkbar. Im Rückspiegel sah ich die schwarze Silhouette des Hundes regungslos auf dem Asphalt, von hinten näherte sich der blaue Nissan. Ich beschleunigte, und das blaue Viereck des Kleinwagens schmolz zu einem kleiner werdenden Fleck zusammen. Für einen Moment hatte ich Abstand gewonnen, doch die nächste Ampel war nicht weit. Ich bog in eine Nebenstraße ein, um den schwarzen Hund und den blauen Nissan endgültig Vergangenheit werden zu lassen. Doch es kostete Zeit, bis ich mich aus dem Geflecht der Nebenstraßen auf der mir bekannten Strecke wiederfand. Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigte inzwischen auf fünf Minuten nach neun.
Ich unterdrückte den Impuls, wieder zu beschleunigen. Das Bild des reglos auf der Straße liegenden Hundes stand mir noch vor Augen. Ich hoffte, dass sich das Tier nicht gequält hatte. Ich hatte den Unfall nicht gewollt. Doch war es nicht fahrlässig, wenn jemand seinen Hund an einer dichtbefahrenen Straße frei herumlaufen ließ? Wahrscheinlich entlaufen oder ausgesetzt. Ein streunender Hund, der früher oder später elender gestorben wäre, als durch den kompromisslosen Druck eines Neunzehn-Zoll-Reifens mit Flachbettfelge in die ewigen Jagdgründe geschickt zu werden.
Im Radio lief der Wetterbericht; es war zu warm für die Jahreszeit. Auch die Winter in den Jahren davor waren eher mau gewesen. Es hieß, der globale CO2-Ausstoß wäre schuld an der Klimaerwärmung und das Auto sei der Klimakiller an sich. Doch schon ein mittelgroßer Hund war ebenso klimabelastend wie ein SUV mit Allradantrieb, der zehntausend Kilometer im Jahr verfuhr. Wenn man das mit den achtzehn Millionen Hunden und Katzen in Deutschland multiplizierte, kam eine Menge zusammen. Ohne es zu wollen, hatte ich diese Belastung um den Faktor X minus eins reduziert.
*
Die Uhr am Portal der Firma Sündermann & Lange KG zeigte auf 9:25, als ich mich mit meiner Chipkarte einloggte. Die Kollision mit dem Hund hatte keine sichtbaren Spuren hinterlassen, wie mir ein kurzer Blick auf mein Auto bestätigte. Mit der Aktentasche unter dem Arm betrat ich die Eingangshalle des dreistöckigen Hauptgebäudes. Frau Kamischke, unsere Empfangsdame, begrüßte ich im Vorbeigehen, um über die bogenförmig nach oben verlaufende Treppe in den zweiten Stock zu eilen. Eine Helix, so hatte Thomas Sündermann diese Treppe anlässlich meiner Einstellung genannt. Sie sollte an die DNA-Stränge erinnern, die Bausteine des Lebens.
„Herr Hintersinn, die Herren warten bereits auf Sie“, hörte ich Frau Kamischke noch sagen, als ich die ersten Stufen bereits hinter mir gelassen hatte. Es klang, als läge ein Vorwurf in ihrer Stimme. Wahrscheinlich hatten sie sich schon nach meinem Verbleib erkundigt. Bei diesem Gedanken beeilte ich mich noch mehr. Ich nahm jeweils zwei Stufen auf einmal, bis ich außer Atem vor dem Konferenzraum im zweiten Stock stand.
Das Schild mit der Aufschrift Sitzung hing an der geschlossenen Tür. Ich klopfte und nachdem sich nichts tat, öffnete ich vorsichtig. Mein erster Blick fiel auf Thomas Sündermann, der pfeiferauchend neben Axel Lange am ovalen Konferenztisch saß. Ich schrak zusammen. Wenn beide Chefs an der Besprechung teilnahmen, musste es sich um eine Sache von höchster Wichtigkeit handeln.
Ich machte einen zaghaften Schritt in den Saal und entschuldigte mich dabei für die Verspätung. Meine Augen richteten sich auf einen freien Platz, der abseits von meinen Kollegen Tüsselhover und Berger lag. Als ich darauf zusteuerte, deutete Thomas Sündermann mit seiner Pfeife auf den freien Stuhl zwischen meinen beiden Kollegen. Dort lag eine hellblaue Mappe. Sie glich denen, welche die anderen bereits aufgeschlagen vor sich zu liegen hatten. Ich setzte mich und fand mich im Blickfeld der grauen Augen von Axel Lange wieder.
Er tat, als hätte er mich erst in diesem Moment bemerkt. „Na da sind Sie ja endlich, Herr Hintersinn! Wir dachten schon, Sie kommen nicht mehr. Sie haben sich wohl beim Joggen mit der Zeit vertan?“
Torben Tüsselhover, der links von mir saß, begann zu prusten. Er hörte erst damit auf, als Thomas Sündermann sich vernehmlich räusperte. Doch es war nicht Tüsselhover, den er jetzt vorwurfsvoll ansah. „Schlagen Sie nun bitte Ihre Mappe auf, Herr Hintersinn. Da wir nun vollzählig sind, können wir beginnen. Es ist schon spät und die Zeit wird knapp, meine Herren. Alle anderen haben sich das Dossier bereits angesehen und kennen die wichtigsten Punkte. Ich weise nochmals auf das Gebot der Verschwiegenheit hin. Herr Hintersinn …“,
Sündermann deutete auf meine Mappe, die ich aufgeschlagen hatte. „Sündermann & Lange KG, AG Neue Märkte“, stand in dicken Lettern auf der ersten Seite, darunter der Zusatz streng vertraulich.
„… um es für Sie noch einmal zusammenzufassen, es geht hierbei um den internationalen Ausbau unserer Kapazitäten. Sündermann & Lange muss in neue Weltmärkte vorstoßen, bevor uns die Konkurrenz zuvorkommt.“
Ich nickte zu seinen Worten. Er sollte wissen, dass ich, wenn auch verspätet, aufmerksam bei der Sache war. Immerhin ließ er sich dazu herab, mich zum Sachstand persönlich zu briefen. Gerade wollte ich mich bedanken, da hob der beleibte Sündermann die Hand, um sich jede Unterbrechung zu verbitten. „Neue Märkte können nur dort erschlossen werden, wo zurzeit niemand anderes hingeht, aus Gründen die, sagen wir mal, vielfältig sein können.“
Wahrscheinlich wollte die Firma wieder an den russischen Markt anknüpfen, dachte ich. Gestern hatten sie in der Tagesschau berichtet, dass sich die Situation in der Ukraine entspannt hatte. Ich lächelte wissend und Sündermanns Blick ruhte auf mir, als hätte er meine Gedanken erraten. „Wahrscheinlich denken Sie sofort an Russland, aber da gibt es immer noch die EU-Sanktionen, um die wir leider auch nicht herumkommen. Aber uns …“
Er räusperte sich und zog ein weißes Seidentuch aus seiner Reverstasche. Nachdem er sich damit den Mund abgewischt hatte, fuhr er fort: „Aber uns schweben dabei ganz andere Partner vor.“
Er lehnte sich zurück, zog genüsslich an seiner Pfeife und gab Axel Lange mit einem Kopfnicken zu verstehen, den Faden aufzugreifen. Im Konferenzraum war es still, doch die von mir erwartete Spannung lag nicht in der Luft. War ich der Einzige unter den Anwesenden, der nicht wusste, was nun kam?
„Bei den Partnern handelt es sich um drei Länder, die wir ins Auge gefasst haben, nämlich Kuba, den Iran und Syrien.“ Axel Langes Worte waren kurz und abgehackt. Ich bekam das Gefühl, Zuschauer in einem Theaterstück zu sein, bei dem jeder seine Rolle genau kannte. Die Stille und die lächelnden Gesichter der Anderen bestätigten, dass sie längst Bescheid wussten und nur darauf warteten, dass Lange weitersprach.
„Kuba und der Iran sind kürzlich von der internationalen Sanktionsliste gestrichen worden. Beide Länder haben schon eine eigene pharmazeutische Industrie. Da müssen wir unbedingt rein. Syrien als Staat scheint nach dem Eingreifen der Russen wieder soweit stabilisiert zu sein, dass wir zu den Ersten in Damaskus gehören können. Eine heikle Mission, aber vergessen wir nicht den guten Ruf, den made in Germany in dieser Region immer noch hat.“
Thomas Sündermann hatte seine Pfeife aus dem Mund genommen. Er strahlte, als hätte Lange ihm gerade zum Geburtstag gratuliert. Sein Blick fiel auf Berger, dann auf Tüsselhover und blieb zuletzt bei mir hängen. „Nun, Herr Hintersinn? Was sagen Sie dazu?“ Sündermann hatte sich vorgebeugt und stützte seinen massigen Oberkörper auf den polierten Konferenztisch. Ich wusste, dass ich mit meiner Antwort nicht lange zögern durfte.
„Kuba“, entfuhr es mir. Allerdings eine Spur zu leise, als ich es beabsichtigt hatte. In meinem Kopf mischten sich Bilder aus Latino-Klängen, einem Strand in der Karibik und hübschen, dunkelhäutigen Frauen. Ohne Zweifel, Kuba war von den drei gebotenen Möglichkeiten bei weitem die Angenehmste.
„Habla español?“, klang wie durch einen Nebel die Stimme von Dr. Berger, der mir zur Rechten saß. Ich glaubte nicht recht gehört zu haben und starrte den Mediziner mit halboffenem Mund an. Ich wusste nicht, dass Berger Spanisch sprach, und schüttelte nur hilflos meinen Kopf.
„Wir freuen uns, dass Dr. Berger langjährige Berufserfahrungen aus Südamerika mitbringt und damit auch fundierte Kenntnisse in Spanisch. Es zeichnet sich damit ab, wer von Ihnen sich um den kubanischen Markt kümmern wird.“ Sündermann schaute wohlgefällig in die Runde und steckte sich seine Pfeife wieder in den Mund.
Also hatte Berger seine medizinischen Studien, die er damals so plötzlich abbrechen musste, in Südamerika durchgeführt. Das wusste ich nun, doch es brachte mir nichts. Der Verlauf der Sitzung ließ mir auch keine Zeit, darüber nachzudenken.
„Gibt es Fragen, Einwände dagegen?“
Axel Langes Stimme verklang. Seine Frage war ohnehin nur rhetorisch gemeint, denn er wandte sich gleich wieder an mich. „Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, Herr Hintersinn. Aber wie Sie sehen, ist Kuba bei Herrn Dr. Berger schon in guten Händen. In Anbetracht Ihrer langjährigen Berufserfahrung kann ich mir aber vorstellen, dass Sie bereit sind, jede Herausforderung unter den neuen Märkten anzunehmen?“
Ich nickte beklommen. Was meinte Lange damit? Den Iran oder Syrien? Das Tempo, mit dem sich die Geschehnisse abspulten, hatte mich so schnell überrollt, wie ich den schwarzen Hund mit meinem Auto. Die ganze Sache war längst abgesprochen gewesen. Axel Lange musste Sündermann dazu überredet haben, mich vor die Wahl zu stellen. Entweder ich übernahm die mir zugewiesene Aufgabe, oder man würde mich bei der nächsten Gelegenheit vor die Tür setzen.
„Herr Tüsselhover übernimmt das Irangate!“ Langes Stimme hallte durch den Raum. Es blieb still bis auf ein Geraune von Sündermann und Berger, denen das Irangate offenbar noch ein Begriff war. Wie ich später erfuhr, war damit ein Skandal aus der Zeit des US-Präsidenten Reagan gemeint. Es ging um Gelder aus illegalen Waffenverkäufen an den Iran, die den Rebellen in Nikaragua zur Verfügung gestellt worden waren.
Axel Lange spulte nur noch ab, was längst beschlossene Sache war: „Herr Dr. Foorozan, unser bewährter Mitarbeiter aus der Entwicklungsabteilung ist gebürtiger Iraner. Er wird Herrn Tüsselhover bei dieser Aufgabe zur Seite stehen. Ich bin sicher, im Team werden Sie das schaffen und gute Geschäftsbeziehungen zu unseren künftigen Partnern im Iran aufbauen.“
Damit war zwar noch nicht ausgesprochen, aber beschlossen, dass ich das Syrien-Projekt übernehmen musste. Irangate und Syrienconnection gingen mir durch den Kopf, als ich die gemurmelte Zustimmung zu Axel Langes Worten hörte. Syrien war die schlechteste Option überhaupt. Dort herrschte Bürgerkrieg. Mir fiel ein, was sie heute in den Frühnachrichten berichtet hatten. Es gab eine Möglichkeit, mich vor dieser Option zu bewahren. Ich hob meine Hand und suchte den Blickkontakt mit Thomas Sündermann.
„Ja? Bitte, Herr Hintersinn!“
Es kratzte in meinem Hals. Ich musste husten, bevor ich sprechen konnte: „Also, was Syrien betrifft, sehe ich ein grundsätzliches Problem. Soweit ich weiß, ist das Assad-Regime nicht als Verhandlungspartner von der EU anerkannt. Wie sollen wir mit denen denn Geschäftsbeziehungen anknüpfen?“
Axel Langes Blick schien wie durch mich hindurchzugehen. „Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht, Herr Hintersinn. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der syrischen Regierung bestehen weiterhin, selbst wenn sie zurzeit nicht die besten sind. Wenn andere EU-Staaten in dieser Hinsicht restriktiver handeln, soll uns das doch nur recht sein. Damit werden wir zu den Ersten in Syrien gehören, die den Markt dort wieder neu erschließen.“
Ich fühlte, wie sich etwas in meinem Hals zusammenzog. Kampflos wollte ich nicht aufgeben: „Aber man liest doch auch in den Verlautbarungen der Bundesregierung, um was für ein unmenschliches Regime es sich handelt. Sie setzen Chemiewaffen ein, darüber war heute gerade berichtet worden. Der Machthaber Assad wirft Fassbomben auf die eigene Bevölkerung!“
„Alle werfen dort Bomben, nicht nur Assad!“, tönte Tüsselhover links neben mir. Er setzte noch hinzu: „Für den, der getroffen wird, ist es doch egal, ob die Bombe wie ein Fass oder irgendwie anders aussieht, oder etwa nicht?“ Er sah sich in der Runde um, doch alle hielten ihre Augen auf die blauen Mappen gerichtet, die vor ihnen aufgeschlagen lagen.
Axel Lange strich sich nachdenklich über seinen Vollbart. „Sie können natürlich aus moralischen Gründen ablehnen, Herr Hintersinn ...“
Er fuhr fort und betonte dabei jedes einzelne seiner Worte. „Doch vergessen Sie nicht, Sie arbeiten in einer Firma, die pharmazeutische Produkte und Laborartikel verkauft, und nicht bei Amnesty International oder Human Rights Watch.“
„Herr Hintersinn, vergessen Sie auch nicht, dass Assad über viele Jahre ein geachteter Gesprächspartner der Bundesregierung war“, mischte sich nun auch noch Dr. Berger ein. „Wenn sich die politische Lage in Syrien wieder stabilisiert, wird der deutsche Außenminister ebenso schnell nach Damaskus fliegen, wie er es nach der Aufhebung der Iran-Sanktionen in Richtung Teheran getan hat.“
„Pecunia non olet, Herr Hintersinn!“ Thomas Sündermann legte seine Pfeife auf den Tisch. Er sah erst auf mich und dann auf das entgeisterte Gesicht von Torben Tüsselhover. „Geld stinkt nicht, Herr Tüsselhover! Eine zweitausend Jahre alte, römische Spruchweisheit! Ich vergesse immer wieder, dass Ihre Abiturjahrgänge kein Latein mehr hatten.“
Tüsselhover grinste. Auch wenn er in der Schule keinen Lateinunterricht gehabt hatte, war ihm diese Devise als Betriebswirt doch nicht fremd.
Mir brummte der Schädel, es war die Müdigkeit und der Schock. Ich war immer noch dabei begreifen zu wollen, was hier eigentlich ablief. Axel Langes Stimme klang wie durch Watte in mein Ohr. „Also, was ist mit Ihnen? Stimmen Sie unserem Vorschlag zu, Herr Hintersinn?“
Ich leistete mir noch zwei Sekunden, dann gab ich auf. „Ja. Natürlich! Ich wollte nur sichergehen, ob alle Eventualitäten bei diesem Vorhaben auch in Betracht gezogen worden sind.“
Axel Langes Mund verzog sich zu einem ironischen Lächeln. „Schön haben Sie das gesagt, Herr Hintersinn! Aber gewiss doch!“
Er wandte sich jetzt wieder an alle. „Die Einzelheiten zu Ihren Projekten finden Sie in der Mappe vor Ihnen. Machen Sie sich bitte in den nächsten Tagen damit vertraut. Wir treffen uns in einer Woche zu weiteren Planungen, den Termin gebe ich noch bekannt. Die Sitzung ist hiermit geschlossen.“
Dr. Berger war bereits an Tür und wedelte mit der Mappe in seiner Hand.
„Hasta luego, señores.“ Mit diesen Worten war er verschwunden.
„Der ist in Gedanken schon auf Kuba“, stieß Tüsselhover schlechtgelaunt hervor. Er sah dabei auf den Boden, als suchte er etwas und zog schnüffelnd die Luft ein.
„Irgendwie riecht es hier schon die ganze Zeit so, als hätte jemand ins Glück getreten.“ Er sah mich mit gerümpfter Nase an. „Haben Sie einen Hund?“
Ich sah ihn nur empört an.
„Vielleicht sollten Sie sich einen anschaffen, es ist gut für die Figur und so ein Hund ist zum Joggen doch ganz praktisch.“ Mit diesen Worten stand er auf und verließ den Raum.
Ich tat, als hätte ich nichts gehört. Was dieser aufgeblasene Kerl sich für Frechheiten herausnahm! Das erlaubte er sich nur, weil Lange ihn in jeder Hinsicht deckte. Ich stellte mir in diesem Moment vor, wie die beiden es im Doggy Style miteinander trieben. Doch als ich länger darüber nachdachte, empfand ich nur noch Ohnmacht und Eifersuchtsgefühle. Im Gegensatz zu Tüsselhover hatte ich niemanden in der Firma, der mich vor Schikanen in Schutz nahm.
Aus dem Augenwinkel schielte ich zu Thomas Sündermann, der in aller Ruhe seine Pfeife reinigte. Alle anderen waren inzwischen schon gegangen. Schließlich verließ auch er den Raum, ohne mich nur eines Blickes zu würdigen. Ich hatte gehofft, er würde mich vielleicht noch ansprechen, um mir in irgendeiner Weise entgegenzukommen.
Ich erhob mich und schlich lustlos in mein Büro. Es befand sich auf dem gleichen Stockwerk wie der Konferenzraum. Die Büros von Dr. Berger und Torben Tüsselhover lagen nur ein paar Schritte weiter von meinem entfernt. Der Adrenalinschub aus der Sitzung hatte meine Müdigkeit gegen eine dumpfe Anspannung eingetauscht. Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, ließ ich mich auf meinen Bürostuhl fallen. Mit der Syriengeschichte hatten sie mich kalt erwischt. Das Irangate hatten sie Tüsselhover doch nur pro forma übertragen. Die eigentliche Arbeit lag bei dem iranischen Entwicklungsingenieur Gholam Foorozan.
Ich versuchte den Gedanken daran zu verdrängen, doch die Sitzung hatte mir gezeigt, wie isoliert ich inzwischen in der Firma war. Berger war mit dem Kuba-Projekt fein raus. Von Thomas Sündermann konnte ich, so wie es aussah, keine Unterstützung mehr erwarten. Das alles musste ich erst einmal verdauen.
Nachdem ich eine Weile vor mich hingebrütet hatte, öffnete ich widerwillig die blaue Mappe und suchte nach Einzelheiten der geplanten Kooperation. Ich stieß auf den Namen Erkalaat Ltd., ein halbstaatlicher, pharmazeutischer Betrieb in Aleppo. Ausgerechnet mit einer vom syrischen Staat betriebenen Firma wollten Sündermann und Lange Geschäftsbeziehungen anknüpfen. Alles war noch schlimmer, als ich befürchtet hatte. Es galt als erwiesen, dass das syrische Regime Chemiewaffen hergestellt hatte. Ein Staatsbetrieb wie Erkalaat war vermutlich daran beteiligt gewesen. Zudem saß diese Firma in Aleppo. Eine Stadt, die unter Dauerbeschuss und zur Hälfte in Trümmern lag. Im Fernsehen hatten sie gezeigt, wie Assads Armee dort Fassbomben auf Zivilisten und Krankenhäuser abwarf. Erwarteten meine Chefs wirklich, dass ich mich auf dieses schmutzige Spiel einließ, womöglich noch dort hinfuhr? Das konnte man mir doch nicht ernsthaft zumuten!
Während ich noch in der Mappe blätterte, stieg mir ein fader Geruch in die Nase. Der Gestank kam unzweifelhaft von meinem Schuh, der immer noch die Hinterlassenschaft von Frau Steckenborns Hunden trug. Tüsselhovers feines Näschen hatte es schon in der Sitzung gerochen. Nachdem meine Anspannung jetzt nachgelassen hatte, merkte ich es auch. Ich zog meine Schuhe aus und stellte sie so weit weg wie möglich neben die Bürotür. Nachher musste ich sie auf der Toilette gründlich säubern. Ich ekelte mich schon allein bei dem Gedanken. Einen Chemiker sollte man nicht mit Gestank ärgern wollen, dachte ich. Mir war eine Idee gekommen, es Frau Steckenborn mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ich rief Herrn Schauhin aus dem Chemikalienlager an und fragte, ob wir Butanthiol vorrätig hatten. Er versprach, mir bis morgen etwas davon zu schicken.
Doch solche kleinen Gemeinheiten brachten mich bei meinem Problem nicht weiter. Ich überlegte, wie ich mich aus dem Syriengeschäft herausziehen konnte, ohne meine Anstellung zu gefährden. Doch mir fiel keine Lösung dazu ein. Ich wusste kaum etwas über die Hintergründe des syrischen Bürgerkrieges, noch über die unterschiedlichen Kräfte, die dort wirkten. Ein paar Tage blieben mir noch, bevor Axel Lange den Businessplan wieder auf dem Tisch haben wollte. Vorher musste ich mit jemand reden, der sich mit den Verhältnissen in diesem Land besser auskannte als ich selbst.
Zuerst dachte ich an Harry. Er war belesen, kannte sich mit Vielem aus und hatte manchmal originelle Ideen. Allerdings war er zu sehr Theoretiker, um mir bei meinem Problem weiterhelfen zu können. Was ich brauchte, war praktischer Rat. Mir fiel ein, dass Frank bei Facebook vor einiger Zeit etwas zu den syrischen Chemiewaffen gepostet hatte. Frank hatte politische Verbindungen, Beziehungen zu Leuten, Hintergrundwissen und Zugang zu Informationen, die der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Von ihm erhoffte ich mir Insidertipps zur Lage in Syrien und zur Rolle von Erkalaat im syrischen Chemiewaffenprogramm. Ich schickte ihm eine Mail mit dem Stichwort Pharmaunternehmen inSyrien mit der Bitte, mich möglichst bald anzurufen.
Die Müdigkeit aus der durchwachten Nacht hatte mich wieder im Griff. Ich gähnte und ging auf Strümpfen auf den Flur, um mir dort einen Kaffee aus dem Automaten zu holen. Zum Glück lief mir gerade niemand über den Weg. Tüsselhover hätte sofort gewusst, was Sache war. Ich kehrte mit dem Becher Kaffee in mein Büro zurück.
Die blaue Mappe legte ich einstweilen beiseite und nahm die Arbeit wieder auf, mit der ich mich schon in der letzten Woche beschäftigt hatte. Es ging dabei um eine Bedarfsstudie für Medikamente zur Therapie von Sexualstörungen. Der weltweite Umsatz von Potenzmitteln stagnierte seit Jahren um die zwei Milliarden Dollar, mit leicht rückläufiger Tendenz. Um den Umsatz wieder anzukurbeln, standen Frauen als neue Zielgruppe im Fokus. Sündermann & Lange erhoffte sich mit neuen Präparaten speziell für Frauen, in diesen Markt stärker vorzustoßen. Allerdings war es den meisten Frauen nicht bewusst, dass mit ihrer Sexualität etwas nicht stimmte. Zuerst musste daher der Therapiebedarf geweckt werden. Das sollte mit einer großen Kampagne geschehen, für die ich hauptverantwortlich war.
Mit dem Gesundheitsbedürfnis der Menschen und ihrem Bestreben nach Glück ließ sich eine Menge Geld verdienen. Um die dreißig Milliarden Euro gab man jedes Jahr in Deutschland für Medikamente aus. Neben der allgemeinen Gesundheit spielte dabei der Begriff des RichtigenLebens eine immer wichtigere Rolle. Aus diesem Grund erzielten Lifestyle-Medikamente immer höhere Umsätze. Die Menschen wollten beraten werden. Nicht nur wie man gesund, sondern vor allem, wie man richtig lebt.
Zu jedem Thema gab es Experten, die den richtigen Weg wiesen. Ähnlich wie bei der Einführung der Statine