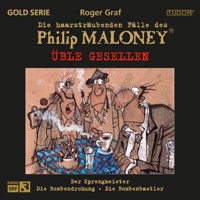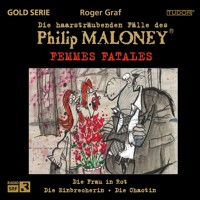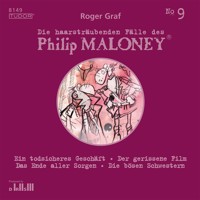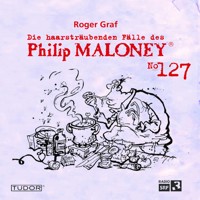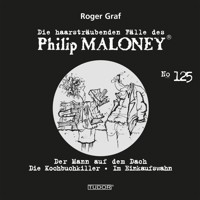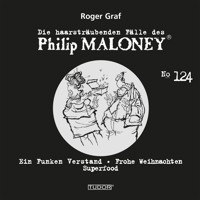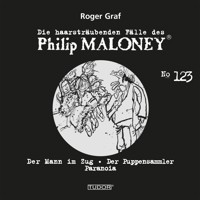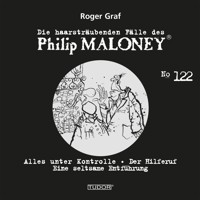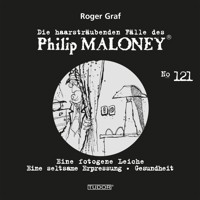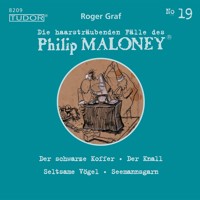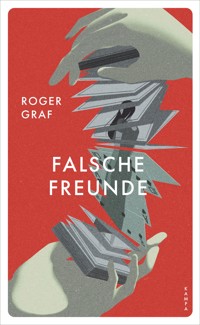
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Polizistin brutal zusammengeschlagen«, titeln die Zeitungen. Anna kann sich an nichts erinnern. Wochenlang lag sie im Koma, jetzt kämpft sie gegen die Folgeerscheinungen des Schädel-Hirn-Traumas: Ihr Gehirn ersetzt ständig deutsche Wörter durch solche aus Fremdsprachen. Die Ärztin rät Anna, ihr Gehirn zu trainieren, und so beschließt sie, nochmals Deutsch zu lernen: mithilfe von Apps, Gesprächen mit Bekannten – und mit Mario aus dem Sprachencafé, in dem sie einst Italienisch lernte. Die Anlaufstelle für Migrant*innen wird für Anna bald auch anderweitig bedeutsam: Eine junge Frau wurde ermordet, am Tatort ein Zettel mit seltsamen Wörtern. Ein Sprachrätsel? Ihr früherer Chef bei der Kriminalpolizei bittet Anna um Hilfe, und sie findet bald heraus, dass auch das Mordopfer im Sprachencafé Deutsch lernen wollte. Als Anna dann vor ihrer Haustür immer wieder seltsame Botschaften findet und mehr über eine Vermisste erfährt, die ebenfalls das Sprachencafé besucht hat, ahnt sie, dass sie es nicht nur beim Wiedererlernen ihrer Muttersprache mit falschen Freunden zu tun haben könnte … Kann die krankgeschriebene Polizistin den Sinn der Botschaften entschlüsseln und einen weiteren Mord verhindern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roger Graf
Falsche Freunde
Roman
Kampa
Für Ruth
Und für alle, die eine Sprache lernen oder wiedererlernen
1
Polizistin brutal zusammengeschlagen. Niemand möchte eine solche Schlagzeile sein. Aber du kannst dir das nicht aussuchen. Es geschieht einfach. Manche Menschen glauben an Karma. Aber was muss jemand tun, damit er sich diese Schlagzeile verdient? Ich glaube eher an Schicksal. Zehntausende klettern auf einen Berg und nur einer stürzt ab und stirbt. Damit kann ich leben. Du hast einfach Pech. Und wenn du richtig viel Pech hast, dann stirbst du oder du wirst zu einer Schlagzeile.
»Du grübelst schon wieder«, sagt John. »Das ist nicht gut. Don’t do it.«
»Nachdenken hilft manchmal.«
»Aber heute ist nicht manchmal.«
»Ich weiß, was heute ist.«
»Du musst dich konzentrieren«, sagt John.
»Genau das fällt mir schwer. Oder soll ich sagen ›nicht nur das‹? Eigentlich fällt mir fast alles schwer, was früher selbstverständlich war.«
»Du übertreibst.«
»Nein, es ist das, was ich erlebe, was ich spüre, was mich begleitet.«
»Du beobachtest dich. Ständig. You are like your own mirror.«
»Nein, ich bin mein eigener Schatten. Oder besser, ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Die Leute sehen und spüren das.«
»Stop it now. Life is a bitch. Denk nicht ständig darüber nach.«
Natürlich weiß ich, was er meint. Ich habe früher nicht viel nachgedacht. Über mich. Wenn, dann über meine Arbeit, aber nicht über mich. Es gibt Menschen, die tun nichts anderes. Ständig nachdenken, sich hinterfragen, grübeln, sich den Kopf zerbrechen. Nicht nötig. Ich habe mir bereits den Kopf zerbrochen. Ziemlich heftig. Ich denke, dass ich pragmatisch bin. Man wird geboren, man wächst auf, man arbeitet, man wird alt und man stirbt. Wozu groß darüber nachdenken? Für die meisten Leute läuft es genau so. Grübeln kann man, wenn man krank wird. Oder wenn man sich den Kopf zerbricht. Polizistin brutal zusammengeschlagen.
»You have an appointment«, sagt John.
»Ich weiß.«
»Es ist wichtig.«
Ich weiß nicht, ob Sie auch einen John kennen. Oder eine Maria. Gute Freunde. Sie sind immer da. Was gibt es Schöneres? Vielleicht keine Freunde? Überall liest man, zuerst kommt die Familie und dann kommen die Freunde. Ohne ist man am Arsch. Ich glaube nicht daran. Man kann auch mit Familie und Freunden am Arsch sein. Am Ende ist man alleine. Oder man fühlt sich so mies, dass man sich niemandem zumuten will. Vielleicht ist das der Zeitpunkt, an dem sich John und Maria bemerkbar machen. Sie nutzen deine Schwäche aus und befallen dich wie ein Virus. Vielleicht sind John und Maria die Rache der nicht vorhandenen Freunde? Solche Gedanken mache ich mir jetzt. Idiotische Gedanken.
»Du musst dich auf das Treffen vorbereiten«, sagt John.
»Ich will jetzt nicht mit dir sprechen.«
»Why not?«
»Sprich Deutsch mit mir.«
»Warum nicht?«
»Es geht nicht. Ich bin nicht in der Stimmung.«
»Du hast ›mood‹ gesagt.«
»Was?«
»›Mood‹ ist nicht Deutsch.«
»Halt die Klappe. Das ist Deutsch.«
Ich habe gesagt, dass ich nicht in der Stimmung bin. Auf Deutsch. Garantiert. John will mich verunsichern.
»Hai la luna storta«, sagt Maria.
»Ich habe keine schlechte Laune.«
»Certamente.«
»Sprich Deutsch mit mir.«
»Parli?«
»Parli was?«
»Du hast ›parli‹ gesagt.«
Ich schließe die Augen, massiere meine Augäpfel, weil ich dahinter einen Druck verspüre. Ich öffne die Augen und der Zeitungsartikel liegt noch immer vor mir auf dem Tisch. Polizistin brutal zusammengeschlagen. Wie viele Leute haben das gelesen? Was haben sie sich dabei gedacht? Einige haben sich garantiert gefreut. Die Idioten, die überall ACAB sprayen.
»All cops are bastards«, sagt John.
Diejenigen, die uns Bullen nennen. Freut man sich ernsthaft, wenn man liest, dass eine Polizistin beinahe zu Tode geprügelt wurde?
»Es war keine Prügelei«, sagt John.
»Nein, keine Prügelei«, sage ich.
»Es war hinterhältig und feige.«
»Ja. Aber das ist egal.«
»Ist es nicht«, sagt Maria. »Es sagt etwas über die Person aus.«
»Es ist passiert. Punkt.«
»Wie kann man so etwas verarbeiten?«, fragt Maria.
»Muss man es verarbeiten?«, frage ich. »Kann man es nicht einfach akzeptieren?«
Maria schweigt. John schweigt. Ich schweige. Und lese erneut den Artikel.
»Warum schaust du dir ständig diesen Zeitungsartikel an?«, fragt John.
»Weil ich auf etwas warte.«
»Auf was wartest du?«
»Ich weiß es nicht.«
»Not a good answer.«
»Irgendwann wird etwas klick machen in meinem Kopf, wenn ich das lese.«
»Und dann?«, fragt John.
Ja, was dann? Ich kenne die Antwort nicht. Ich spüre keinerlei Emotionen. Die Wörter berühren mich nicht. Ich könnte genauso gut die Sportresultate lesen. Oder einen langweiligen Artikel über eine Firma, von der ich noch nie gehört habe. Vielleicht warte ich darauf, dass dort mein Name steht. Anna. Ich heiße Anna. Ich mag diesen einfachen, klassischen Namen. So wie John und Maria. Manchmal, kurz nach dem Aufwachen, ist alles wie früher. Oder so, wie ich mir früher vorstelle. Keine Schmerzen, kein Grübeln, keine Verzweiflung. Kein John und keine Maria. Nur eine junge Frau, die aufsteht, frühstückt und arbeiten geht. So wie es sein sollte. Kein Zeitungsartikel, keine Schlagzeile, kein Mitleid. Polizistin brutal zusammengeschlagen. Irgendwann werde ich es begreifen. Alles.
»Trink etwas«, sagt John.
»Ich kann mich jetzt nicht betrinken.«
»Ein Schluck beruhigt.«
»Und bringt mich durcheinander. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen.«
»Trink einen Tee«, schlägt Maria vor. »Oder schluck eine Baldriantablette.«
»Ich schlucke schon genug Tabletten. Ich muss mich konzentrieren. È importante.«
Ich weiß, dass ich es auf Italienisch gesagt habe. Doch diesmal verzichten John und Maria auf einen Kommentar. Es ist wichtig. Ich wiederhole es in meinem Kopf. Importante, important, important, wichtig. Deutsch tanzt aus der Reihe. So wie ich. Dabei kann ich gar nicht mehr aus der Reihe tanzen. Ich muss froh sein, wenn ich problemlos geradeaus gehen kann. Ich gehe zum Fenster. Piove a dirotto. Es regnet Bindfäden. It rains cats and dogs. Il pleut des cordes. Alles noch da. Es ist wie ein Hohn, wenn man nach den einfachsten Wörtern suchen muss. Scheißwetter, denke ich, aber ich muss trotzdem raus.
2
Der Regen passt. Die Gesichter der anderen passen. Alles passt. Ich sollte umdrehen und wieder nach Hause gehen. Unter die Bettdecke. Drei Wochen lang hat es nie geregnet und heute holt Petrus alles nach. Dieser Petrus ist ein seltsamer Typ. Man sagt, dass der Apostel sein Amt als Wettergott vom griechischen Wettergott Thor geerbt hat. Dieses unnütze Wissen habe ich gespeichert, weil ich einer Italienerin erklären wollte, wer Petrus und Frau Holle sind. Weshalb vergisst man so etwas nicht mehr? Dafür anderes, das wichtiger ist?
»Der Regen ist warm«, sagt Maria.
»Hör auf mit dem Scheiß.«
»Es ist anders als kalter Regen.«
»Ja, kalter Regen ist Folter, aber das hier ist nur nass.«
Ich mag keinen Regen, auch wenn er nur nass ist. Ich mag keine Regenschirme und ich mag keine Regenmäntel. Das einzig Schöne am Regen ist der Klang, wenn er auf Metall oder Stoff fällt. Wenn man im Auto sitzt und der Regen trommelt. Aber ich sitze nicht im Auto. Ich bin zu Fuß unterwegs zur Bushaltestelle. Die Kapuze hält den Regen ab, aber sie verkleinert das Sichtfeld. Da ich nach wie vor etwas unsicher unterwegs bin, stört mich die Kapuze. Ich ziehe sie herunter, da die Bushaltestelle in Blickweite ist. Trotzdem sind meine Haare und mein Gesicht patschnass, als ich den Unterstand erreiche.
»›La pioggia‹ klingt so, wie der Regen ist, aber ›Regen‹ klingt eher wie ›Segen‹«, sagt Maria.
»Ich will jetzt nicht über Wörter diskutieren.«
»›La pioggia‹ ist schön, du musst dir den Regen als ›la pioggia‹ vorstellen, dann wird er dir gefallen.« Maria versucht mich aufzuheitern. Wie heißt das auf Italienisch? Ich habe dieses Wort gelernt. »Rasserenarsi«. »Sich aufheitern«. Dieses Wort hat mir sofort gefallen. Es ist schwierig auszusprechen. Die beiden s zischen wie Wassertropfen, die auf eine Glut fallen.
»Es gibt viele schöne italienische Wörter«, sagt Maria.
»Ja, aber ich kann sie jetzt nicht gebrauchen.«
Endlich kommt der Bus. Ich steige umständlich ein, mein Fuß bleibt irgendwie hängen. Es ist, als müsste ich nach wie vor alles wieder neu lernen. Im Bus riecht es nach Regen und überall tropft Wasser runter. Ein himmeltrauriger Tag.
»Sei triste?«, fragt Maria.
Natürlich bin ich traurig. Es gehört dazu. Früher war ich nie traurig, aber früher war ich auch noch keine Schlagzeile. Die Busfahrt ist unangenehm. Es rumpelt oft und es ist ein ständiges Stop-and-go. Die Scheiben sind beschlagen. Ich sehe mein Gesicht. Zu Hause sah ich lange in den Spiegel, ich wollte wissen, ob man mir alles ansieht. Ob es wie ein Stigma auf meiner Stirn zu lesen ist. Aber wie soll ich das beurteilen? Ich bin froh, als der Bus ankommt. Das Aussteigen geht problemlos. Ich ziehe die Kapuze wieder über den Kopf. Prompt gehe ich an der Nummer 78 vorbei und bemerke es erst, als ich das Schild der Nummer 90 sehe. Missmutig gehe ich zurück.
Als ich das Gebäude betrete, friere ich. Eine Frau kommt mir entgegen und ich bemerke, wie sie mich mitleidig anlächelt. Ein Blick auf die Namensliste neben dem Fahrstuhl liefert die Erklärung. In diesem Haus gibt es nur Spezialisten. Fürs Herz, fürs Hirn, für die Lungen und für die Haut. Wer hierherkommt, ist ein Fall für die Spezialisten.
»Im dritten Stock praktiziert eine Frau Dr. Maria«, sagt Maria.
»Meine Haut ist in Ordnung«, sage ich, »ich muss einen Stock höher. Und du musst still sein.«
Im Wartezimmer hängt ein Wandspiegel. Der Spiegel, the mirror, le miroir, lo specchio. Es geht, denke ich, alle Wörter sind da, aber mich stört die Reihenfolge. Englisch und Französisch gehören zusammen. Mirror und miroir, aber auch Deutsch und Italienisch gehören zusammen. Spiegel und specchio. Aber heute geht es nur um den Spiegel. Ich darf das Wort »Spiegel« nicht vergessen. Und all die anderen Wörter. Ich fühle mich wie vor einer verdammten Prüfung. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass sie fortan nicht mehr selbstständig leben können. Wir empfehlen Ihnen eine öffentliche Einrichtung, in der sie betreut und umsorgt werden. Natürlich ist das Unsinn, niemand will mich in ein Heim stecken. Es geht nur um eine Standortbestimmung. Trotzdem bin ich voller Versagensängste. Auch das ist neu. Und es gefällt mir ganz und gar nicht.
Die Spezialistin ist eine Frau um die vierzig, schlank, attraktiv, mit einer modischen Brille. Ich sage »Frau Doktor« bei der Begrüßung, eine einfache Art zu vermeiden, den falschen Namen zu sagen. Als ich der Spezialistin gegenübersitze, falte ich den Text auseinander. Sie schaut mich skeptisch an. Damit kann ich leben.
»Wie geht es Ihnen?«
Es ist die Frage, die alle stellen und auf die es keine Antwort gibt. Keine, die kürzer als zwanzig Seiten ist. Ich nicke bloß. Sie fragt routiniert all den Unsinn, den ich schon hundertmal beantwortet habe. Und immer kommt auch die Frage nach dem Stuhlgang. Ich versuche, möglichst nicht genervt zu klingen, aber es gelingt mir nicht immer. Meist genügt ein Ja oder Nein. Es ist wie ein Fragenkatalog. Eine Liste, die man abhakt. So wie man sie auch in der Zeitung liest. Zwanzig Fragen, immer die gleichen, und alle versuchen, sie möglichst originell zu beantworten. Doch hier geht es nicht um Originalität. Es geht um meine Gesundheit.
»Es geht mir nicht gut«, sage ich endlich.
Die Spezialistin zieht die Stirn in Falten. Auch damit kann ich leben.
»Manchmal, wenn ich sitze, weiß ich nicht, wie ich aufstehen soll. Die Beine reagieren nicht, es ist nicht mein Körper.«
Die Spezialistin nickt.
»Sie erlitten äußerst komplexe Hirnverletzungen.«
»Das weiß ich«, sage ich. Die Schlagzeile ist wieder da. Polizistin brutal zusammengeschlagen.
»Ein derart komplexes Schädel-Hirn-Trauma kann zu sehr unterschiedlichen Folgeschäden führen.«
»Ja«, sage ich. »Das hat man mir schon mehrmals erklärt.«
»Sind neue Probleme aufgetaucht?«
Sie scheint jetzt echt besorgt zu sein.
»Die Sprache«, sage ich.
»Lesen Sie deshalb vom Zettel ab?«
Nein, ich mache das nur zum Spaß, denke ich. Einen Moment lang befürchte ich, dass sich Maria einmischt, aber sie schweigt.
»Ich spreche Deutsch, Englisch und etwas Französisch, sage ich. Und ich habe Italienisch gelernt.«
»Sind alle Sprachen noch da?« fragt die Spezialistin.
»Ja und nein«, sage ich.
Das gefällt ihr nicht. Spezialisten benötigen präzise Auskünfte für eine Diagnose.
»Aphasie ist eine häufige Folge eines Schädel-Hirn-Traumas«, sagt die Spezialistin.
»Ich kann sprechen«, sage ich.
»Ja«, sagt die Spezialistin. »Auch ohne diese Hilfe?« Sie zeigt auf den Zettel in meinen Händen. Es muss albern aussehen.
»Meistens«, sage ich und suche auf dem Zettel nach einem Stichwort. Es macht mich nervös.
»Ja«, sagt die Spezialistin.
»Was?«, frage ich.
»Sie sagten ›sometimes‹.«
Ich sagte gar nichts. War das John?
»Sometimes«, sage ich und stocke. Es ist passiert. Da nützt kein Spiegel, specchio, mirror und miroir. Ich weiß nicht, was »sometimes« auf Deutsch heißt.
»Qualche volta«, sage ich.
Ich atme tief ein. Und aus. Die Spezialistin sieht mich interessiert und gleichzeitig besorgt an.
»Wenn ich angespannt oder nervös bin«, sage ich. So wie jetzt, denke ich. Eigentlich fast immer. »Wenn ich nervös bin, dann finde ich viele deutsche Wörter nicht«, sage ich.
Die Spezialistin nickt. »Sie sagten ›beaucoup‹.«
»Wenn ich merke, dass ich ein Wort nicht weiß, dann sage ich den Satz auf Englisch. Englisch verstehen viele. Aber mir fehlen auch englische Wörter. Wenn ich es auf Italienisch oder Französisch sage, verstehen mich viele nicht. Und oft ersetzt mein Gehirn ein deutsches Wort. Das ist das Mühsamste.«
»Ihr Gehirn ersetzt unbewusst deutsche Wörter?«
»So wie vorhin. Ich weiß, dass es ›viel‹ heißt, aber ich sage ›beaucoup‹ oder ›molto‹. Die Leute verstehen mich nicht. Wird das weggehen? Werde ich je wieder als Polizistin arbeiten können?«
Es ist raus. Die Frage, die mich umtreibt. Die mich wahnsinnig macht. Verzweifelt, traurig, die Frage, die schmerzt. Jetzt ist es die Spezialistin, die tief Luft holt.
»Das Gehirn ist äußerst komplex. Wir kennen nicht alle Vorgänge«, sagt sie.
»Das weiß ich«, sage ich.
»Das Gehirn stellt neue Verbindungen her. Es braucht Zeit.«
Ci vuole pazienza, denke ich.
»Aber warum so viele deutsche Wörter? Ich finde sie nicht und sage stattdessen etwas auf Englisch, Italienisch oder Französisch. Und ich bemerke es nicht. Ich sage ›sometimes‹ und denke, dass ich es auf Deutsch gesagt habe.«
»Manchmal«, sagt die Spezialistin wie eine alberne Lehrerin. Klar, wie kann man ein Wort wie »manchmal« vergessen?
»Manchmal«, sagt sie, »gibt es keine Erklärung. Wir wissen viel zu wenig über diese sehr komplexen Zusammenhänge.«
Eine Spezialistin, die ratlos ist. Großartig.
»Wie ist es mit neuen Wörtern? Ihre Merkfähigkeit? Ist diese auch beeinträchtigt?«
Ich zögere, weil ich darüber nicht sprechen will. Es beunruhigt mich zu sehr.
»Sie müssen sich dafür nicht schämen. Ihr Allgemeinzustand ist beeindruckend.«
»Es fällt mir schwer, mir Dinge zu merken. Lernen ist kein Problem. Im Sinne von wiederholen und einprägen. Aber alltägliche Dinge muss ich mir aufschreiben. Eine Busnummer oder Haltestelle, was ich einkaufen muss, was mir jemand am Telefon sagt. Ich tippe alles ins Handy. Ich denke, es ist ein wenig besser geworden. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein.«
»Eine Verminderung der Gedächtnisleistung tritt vor allem in der Frühphase auf. Schwierigkeiten, sich Neues einzuprägen, wie Namen oder Termine, sind nichts Ungewöhnliches. Wie ist es mit der Erinnerung?«
»Vieles kommt zurück, aber nicht alles.«
»Es ist ein Prozess. Leider sehr langwierig. Es sollte Sie optimistisch stimmen, dass Sie weiterhin Fortschritte erkennen.«
»Gibt es nichts, mit dem ich das mit den Wörtern verbessern kann?«
»Sie können Ihr Gehirn unterstützen«, sagt die Spezialistin.
»Wie«, frage ich?
»Lernen Sie Deutsch. Wiederholen sie alle Wörter. Zwingen Sie das Gehirn, alles wieder an einem Ort zu speichern.«
»Ich soll noch einmal Deutsch lernen? Ich spreche Deutsch.«
»Es geht darum, die Informationen neu abzulegen, neu zu ordnen. Es kann Ihnen helfen, den Wortschatz wieder zu aktivieren. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es funktioniert.«
»Und wenn ich keine neuen Wörter mehr speichern kann? Wenn sich alles verflüchtigt? Wenn mein Gehirn nur noch ein Sieb ist?«
»Colander?«
Ich verwerfe die Hände und lache gequält. Die Spezialistin lächelt ebenfalls, aber eher mitfühlend.
»Sie dürfen den Humor nicht verlieren. Und versuchen Sie, sich an kleinen Fortschritten zu erfreuen.«
Gut, denke ich. Lerne ich halt noch einmal Deutsch. Mit dem Gehen klappte es ja auch einigermaßen. Aber es ist nicht nur Deutsch, mir fehlen auch Wörter in den anderen Sprachen. Doch ich will die Spezialistin nicht überfordern.
»Wenn ich entspannt bin, mache ich weniger Fehler.«
»Sie können es mit Entspannungsübungen versuchen.«
Wenn sie jetzt noch Yoga sagt, drehe ich durch.
»Es sind winzige Nervenbahnen, die zerstört sind«, sagt die Spezialistin. »Die Gewalteinwirkung auf Ihr Gehirn war extrem. Es war kein Aufprall nach einem Sturz. Es war eine Schlagkraft, die oft tödliche Auswirkungen hat. Es dauert lange, bis sich das Gehirn davon erholt. Sie haben bereits enorme Fortschritte gemacht.«
»Ich sehe und spüre täglich, was noch nicht funktioniert.«
»Ja, das ist normal. Aber Sie dürfen sich nicht unter Druck setzen. Es ist ein langwieriger Prozess, der mit dem Austritt aus dem Krankenhaus und der nachfolgenden Reha erst richtig begonnen hat.«
»Wie lange?«, frage ich.
»Diese Frage kann Ihnen niemand beantworten.«
»Sie denken ernsthaft, dass Deutsch lernen hilft?«
»Die Kapazität des Gehirns ist unglaublich. Aber man muss es stimulieren. Das ständige Wiederholen eines Wortes ist langweilig, aber so prägt es sich dauerhaft ein. Wenn Sie eine Sprache jahrelang nicht mehr benutzen, weder aktiv noch passiv, werden Sie vieles wieder vergessen. Bei Ihnen wurde dieser Prozess gewaltsam ausgelöst.«
»Viele Erinnerungen kommen wieder zurück. Bei den Wörtern ist es anders. Sie sind wie gelöscht oder durch ein Wort aus einer anderen Sprache ersetzt.«
»Sostituito«, sagt die Spezialistin.
»Ja«, sage ich.
»Es gibt kein Patentrezept. Sie müssen für sich herausfinden, was am besten hilft. Lesen Sie gerne?«
»Es ermüdet mich sehr.«
»Lesen Sie regelmäßig, egal wie lange. Ein paar Sätze genügen. Und gehen Sie unter die Leute, hören Sie Gesprächen zu.«
Ja, denke ich. Das ist besser als selbst zu reden.
»Gibt es etwas gegen die Müdigkeit?«, frage ich.
»Erschöpfungszustände sind normal. Gönnen Sie sich Pausen.«
»Ich bin fast jeden Tag erschöpft.«
»Sie wollen zu viel, Sie müssen sich mehr Zeit geben.«
Soll ich zehn Jahre warten? Danach will mich niemand mehr.
»Andere Probleme?«, fragt die Spezialistin.
Ja, denke ich, Maria und John. Aber ich erwähne sie nicht. Stattdessen spreche ich ganz allgemein von einem Durcheinander in meinem Kopf.
»Wie äußert sich das?«, fragt die Spezialistin.
»Sätze, Wörter, sie fliegen durch meinen Kopf. Manchmal ganze Gespräche. Es ist, als wäre mein Gehirn ständig am Reden.«
Die Spezialistin nickt. Ist es ein bekanntes Phänomen?
»Gibt es Tabletten dagegen?«, frage ich.
»Sie müssen sich entspannen, Sie dürfen nicht zu viel erwarten. Was Sie erreicht haben, ist bereits ein Wunder.«
Ein Wunder, denke ich. Polizistin kann wieder gehen. Polizistin kann wieder sprechen. Polizistin ist wieder gesund. Aber Anna bringt alles durcheinander. Anna findet die Wörter nicht. Sometimes. Anna hat Stimmen im Kopf. Polizistin brutal zusammengeschlagen.
3
Ich lag zwei Wochen im Koma. Keine Erinnerung. Der Tag der Attacke und die Tage davor wie weggeblasen. Als ich aufwachte, hatte ich zwei Gedanken. Spital und Schmerzen. Keine gute Kombination. Meine Eltern mit Tränen in den Augen. Wochenlang die Frage, wird sie je wieder aufwachen? Danach ging es weiter mit Fragen. Wird sie uns je wieder erkennen? Wird sie je wieder aufstehen? Wird sie je wieder gehen können? Es folgten die vier Wunder der Anna. Aufwachen, erkennen, sprechen, gehen. Therapie, Therapie, Therapie. Die Schmerzen wurden weniger, die Medikamente ebenfalls. Wochen wie unter Glas folgte die bittere Erkenntnis, dass ein entscheidendes Wunder ausbleiben würde. Niemand gibt mir mein altes Leben zurück. Hundert Mal am Tag zeigt mir mein Körper, dass ich nicht mehr die Anna von vorher bin. Die Fortschritte im Krankenhaus dienten nur dazu, aus mir wieder eine einigermaßen funktionstüchtige Frau zu machen. Sie kann wieder sprechen. Hurra. Sie kann wieder selbstständig essen. Hurra. Sie kann wieder selbstständig aufs Klo gehen. Hurra. Ich sah dieses Hurra manchmal in den Augen der Ärztinnen und der Pfleger. Sie freuten sich. Aber war es nicht in erster Linie die Freude darüber, dass sie ihren Beitrag zu diesem Hurra beigesteuert hatten? Für mich ging alles furchtbar langsam. Tag für Tag der Kampf für einen Millimeter zusätzliche Normalität. Kein Herr Doktor, der mir eine Spritze setzte und danach war alles wieder gut. Dazu die Rückschläge. Unregelmäßiger Puls, Atemnot, Bewusstlosigkeit, Schwächeanfälle, zu hoher Gehirndruck. Deshalb war eine Verlegung in die Reha lange nicht möglich. Der Winter fand mehrheitlich hinter dem Fensterglas statt, den Frühling durfte ich einatmen. Im Sommer durfte ich nach Hause gehen. Für die Ärzte ist das Wunder vollbracht. Für mich nicht. Ich bin so weit instand gestellt, um ein selbstständiges Leben zu führen. Anfänglich kam zweimal in der Woche eine Pflegerin vorbei, und ich ging dreimal in der Woche in die Physiotherapie. Das waren meine Kontakte mit anderen Menschen. Und natürlich mit meinen Eltern. Die Eintönigkeit meines Alltags störte mich nicht groß, da ich gut sechzehn Stunden schlief oder auf dem Bett und dem Sofa lag, oft sogar zu müde, als dass ich an etwas hätte denken können.
Die Liste meiner Einschränkungen ist lang. Regelmäßige heftige Kopfschmerzen. Bewusstseinstrübungen verbunden mit verschwommenem Blick. Unsteter und hüftsteifer Gang. Momente, in denen der Körper und das Gehirn nicht miteinander verbunden sind. Ich will aufstehen, aber es geht nicht. Die Arme hängen wie tote Hühner am Körper. Das Gefühl, den eigenen Körper als fremd zu empfinden. Reizbarkeit. Ständige Müdigkeit. Probleme damit, längere Texte zu lesen. Oder zwei Dinge zur selben Zeit zu tun. Das Schlimmste aber ist, dass ich kaum noch Fortschritte bemerke. Ich bin ein Wunder mit Einschränkungen. Nicht gut.
Immerhin wurde ich von einigen typischen Folgeerscheinungen verschont. Zum Beispiel Schluckbeschwerden. Die können der pure Horror sein. Anfangs hatte ich zwar ab und zu Probleme beim Schlucken, aber das ging von alleine weg. Für mich persönlich sind die Sprachprobleme zentral. Sie haben mich zeitweise verstummen lassen. Wörter, die weg sind oder keinen Sinn mehr ergeben. In Stresssituationen verschärft. Mein Gehirn kennt ihre Bedeutung und ersetzt die verlorenen deutschen Wörter. Eigentlich praktisch, aber die Leute starren mich entgeistert an. Ich spreche fast nicht mehr. Auch nicht mit meinen Eltern. Anfänglich sprach ich mit meinem Vater Englisch, aber dann ging das nicht mehr. Viel zu oft waren auch da Wörter weg. Seither nur noch Textmitteilungen und Chats. Beim Schreiben habe ich Zeit, die Wörter zu suchen. Ein Beispiel. Ich sage, mein brain kennt ihre Bedeutung. Ich weiß, was »brain« bedeutet, aber ich komme nicht auf das deutsche Wort. Ich muss einen Übersetzer benutzen. Wenn ich das Wort »Gehirn« lese, verstehe ich, was gemeint ist, aber es gibt keine Verbindung. Es ist, wie wenn man ein Wort in Gedanken hundertmal wiederholt, bis es seine Bedeutung verliert. Schwierig zu erklären. Der Wortverlust im Deutschen war sehr stark, im Englischen mittel, Französisch und Italienisch beherrschte ich nie perfekt. Zusammen mit den Verlusten wird es schwierig. Ich bin ein gestörter Polyglott, ich habe Wörter für alles, aber kreuz und quer durch die Sprachen. Es ist ein Wunder, dass du noch sprechen kannst. Ja, danke, thank you, grazie, merci.
Doch ich muss zugeben, dass sich die Situation deutlich verbessert hat. Tauchte anfänglich fast in jedem dritten Satz ein Wort in einer anderen Sprache auf, geschieht es jetzt nur noch selten. Aber es geschieht. Und es nervt. Es hemmt mich, unter Menschen zu gehen, zu telefonieren – all das, was für meine psychische Genesung wichtig wäre. Das meinte jedenfalls ein Psychologe. Scheuen Sie sich nicht davor, Fehler zu machen. Wenn man eine neue Sprache lernt, gibt es diese Hemmschwelle beim Sprechen. Weil man tausend Fehler macht. Man muss sie überwinden. Doch was macht man mit einer Hemmschwelle, die einen daran hindert, die eigene Muttersprache zu sprechen? Ich ärgere mich, wenn ich auf Italienisch, Französisch oder Englisch Fehler mache, aber ich schäme mich, wenn es mir auf Deutsch passiert. Es ist peinlich. Vor allem aber ist es peinlich, weil niemand außer mir so spricht. Deutsch und Kauderwelsch zugleich. Ich bin Babylon.
Und da sind noch Maria und John. Es ist bekannt, dass sich das Ich bei wiederkehrenden traumatischen Ereignissen spalten kann. Es gibt ein Ich, das die körperlichen Missbräuche ertragen muss, und eines, das von alldem nichts weiß. Manchmal spaltet sich das Ich in viele Ichs auf. Doch das hat nichts mit Maria und John zu tun. Ich wechsle nicht zwischen Anna, Maria und John. Ich bin immer Anna. Maria und John sprechen mit mir. Wahrscheinlich sind sie ein Teil von mir. Jetzt höre ich über Kopfhörer laute Musik. Das hilft. Maria und John schweigen. Ich habe vieles versucht. Alkohol, Joints, Autosuggestion. Einzig laute Musik hilft. Aber ich kriege davon Kopfschmerzen. Ich denke, dass mir Maria und John etwas mitteilen möchten. Wahrscheinlich wissen sie, was geschehen ist. Sie sind mein Back-up. Aber auch das hat gelitten. Oder sie sind in meinen Kopf eingedrungen, als ich blutend am Boden lag, die Schädeldecke zertrümmert. Schau da, lass uns reingehen. Wir besetzen ihr Gehirn. Zwei Fremde, die es sich in meinem Gehirn bequem gemacht haben.
Doch John und Maria sind nicht allein. Ich höre ständig Gespräche, nein, es sind Dialoge, und nicht immer ergeben sie einen Sinn. Vielleicht sind es Gesprächsfetzen aus meiner Vergangenheit oder irgendwelcher Gesprächsmüll, den mein Gehirn abgespeichert hat. Ich versuche diese Stimmen zu ignorieren, aber es gelingt mir nicht immer. Anfangs habe ich die Gespräche aufgeschrieben, weil ich dachte, dass sie wichtig sind und dass sie ihren Teil zu meiner Genesung beitragen können.
»Sie mag Quitten.«
»Kenn ich nicht.«
»Das ist eine Frucht. Ich schenke ihr Quittenkonfitüre. Die mag sie sehr.«
»Ich mag keine Konfitüre.«
»Sie macht sich nichts aus Schmuck.«
»Ich liebe Schmuck. Gibt es keinen Schmuck, der wie eine Kitte aussieht?«
»Quitte.«
»Was?«
»Es heißt ›Quitte‹.«
Was will mir dieser Dialog sagen? Ich mag weder Quitten noch Schmuck. Ich erkenne die Stimmen nicht. Es ist völlig unsinnig, dass mich mein Gehirn an diesen Dialog erinnert. Er könnte aus irgendeinem Film sein. Oder einem Buch. Ich habe sogar danach gesucht, aber nichts gefunden. Hätte ich es der Spezialistin sagen sollen? Alles über John und Maria und die seltsamen Dialoge?
Von außen betrachtet, bin ich ein medizinisches Wunder. Doch leider sieht man es mir auch an. Ich lebe selbstständig und einsam. Ich ertrage die Menschen nicht mehr so wie früher. Ich bin ungeduldig. Ich bin direkt. Ich bin schwierig auszuhalten. Ich rede nur noch, wenn ich muss. Ich schalte die Musik aus.
»Dublin hatte einen speziellen Geruch«, sagt Maria.
»Wie meinst du das?«, frage ich.
»Es roch irgendwie alt.«
»Alt?«
»Ja, wie alte Kleider.«
»Daran kann ich mich nicht erinnern«, sage ich, und es stimmt. Ich erinnere mich an Dublin, aber nicht an diesen Geruch. Viele Erinnerungen kamen zurück, als ich mir die Fotos auf meinem Handy ansah. Einiges bleibt rätselhaft. Leider bin ich keine geübte Fotografin, aus Selfies habe ich mir nie viel gemacht, weil ich mir auch nie richtig gefallen habe auf Fotos. Ich bin nicht fotogen. Es gibt Menschen, die sehen auf Fotos immer gut und attraktiv aus. Ich nicht. Deshalb ist meine Fotosammlung bescheiden. Ich habe mir auch selten Fotos von früher angeschaut. Ich bin jemand, der lieber nach vorne schaut.
»Non ti ricordi?«, fragt Maria.
»Habe ich Italienisch gesprochen?«
»Du sprichst oft Italienisch.«
»Ich bemerke es nicht.«
»Possiamo parlare in italiano.«
»Nein, ich muss wieder richtig Deutsch lernen.«
»Du liebst die italienische Sprache.«
»Sì.«
»Na also. Andiamo in Italia.«
»Nein.«
»Du sagst ›No‹, das zählt nicht.«
»Ich habe ›No‹ gesagt? Aber warum, ich weiß, dass es auf Deutsch ›Nein‹ heißt.« Ich bin müde, die Fehler häufen sich.
»Je ne veux pas«, sage ich.
»Das ist Französisch«, sagt Maria.
»Du verstehst Französisch?«
Maria antwortet nicht.
»Warum sprichst du mit mir?«, frage ich sie.
»Menschen sprechen, um zu verstehen oder um abzulenken«, sagt Maria.
»Das hilft mir nicht weiter.«
Verstehen, to understand, capire, comprendre. Alle Wörter sind da.
»Warum kommt das Wort ›stehen‹ darin vor?«, fragt Maria.
»Wie meinst du das?«
»›Verstehen‹ und ›to understand‹. Darin kommt das Wort ›stehen‹ vor. Im Französischen ist es ›prendre‹, ›nehmen‹, ›comprendre‹. Das macht alles keinen Sinn.«
»Ich weiß es nicht. Es ist, wie es ist«, sage ich.
Doch das stimmt nicht. Wenn man eine Sprache lernt, stößt man oft auf Dinge, die für Muttersprachler völlig normal sind, dem Lernenden aber seltsam vorkommen.
»Es ist wie ›vergeben‹«, sagt Maria. »›Geben‹ und ›vergeben‹, ›stehen‹ und ›verstehen‹. Die beiden zusammengesetzten neuen Wörter ergeben eigentlich keinen Sinn.«
»Die Bedeutung der Wörter ist wichtig, nicht ob sie einen Sinn ergeben«, sage ich.
»Ja, wir suchen immer nach dem Sinn, der Logik«, sagt Maria.
Und oft gibt es keine Logik und keinen Sinn. Die Polizistin Anna hat das gelernt, Menschen verhalten sich irrational, sie folgen ihren Instinkten. Im Nachhinein konstruieren sie einen Sinn in ihr Verhalten. Ich habe das und das gemacht, weil … Niemand sagt, ich ging in die Küche und ich weiß nicht, warum. Dabei gehen wir ständig in die Küche ohne zu wissen, warum. Der Psychologe sagt, weil wir unbewusst Hunger oder Durst haben. Psychologen suchen auch ständig nach dem Sinn im Unsinn.
»Er ist einfach zu finden«, sagt Maria.
»Was?«
»Der Sinn im Unsinn.«
»Tatsächlich?«
»Ja, man muss das Wort nur auf Italienisch schreiben.«
»Was für ein Wort?«
»Un sinn. Ein Sinn.« Maria kichert.
Sie mag Wortspiele. Manchmal sind sie lustig. Nicht immer. Ist sie ein Teil von mir, weggesplittert wie ein Stück Hirnmasse, das am Tatwerkzeug klebt? Ich weiß nicht, wie viel von meinem Hirn zerstört wurde, und ich will es auch gar nicht wissen. Es ist genug da für ein neues Leben. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es will, dieses neue Leben. Nicht, dass ich an Selbstmord denke, aber es fällt mir unendlich schwer, mich so zu akzeptieren, wie ich jetzt bin. Eine ständig müde junge Frau mit einem großen Durcheinander im Kopf.
»Denkst du oft an Kreta?« fragt Maria.
»Weshalb sollte ich?«
»Du warst glücklich auf Kreta.«
»Ich kann mich nicht daran erinnern.«
Doch, Griechenland, die Sonne, die schon frühmorgens brannte, den griechischen Salat, die Fische, aber ich sehe mich nicht in Griechenland oder auf Kreta. Meine Erinnerung ist da, aber ich bin es nicht. Als wäre es die Erinnerung einer anderen Person.
»Du konntest deine Seele baumeln lassen.«
To let it all hang out, denke ich und bin verblüfft. Manchmal überrascht mich mein Gedächtnis oder das, was von ihm übrig ist.
Ich verstehe nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Aber ich denke, dass Maria und John ein Teil meiner Erinnerungen sind. Als ich aus dem Koma aufwachte, war fast alles weg. Ich erkannte meine Eltern, aber ich wusste ihre Namen nicht. Maria und John sind wie Figuren aus einem Traum. Vielleicht wurden bei mir Bewusstsein und Unterbewusstsein durcheinandergebracht. Maria und John bringen meine Erinnerungen zurück. Aber sie tun das auf eine sehr chaotische Art und Weise. Wie in Träumen.
»Chi se ne frega«, sagt Maria.
»That’s rude«, sage ich. Und bemerke, dass ich Englisch sprach.
»In der Bretagne warst du glücklich.«
»Ich erinnere mich nur an den Wind.«
»Du hast alles vergessen, was schön war.«
Nein, denke ich, auch das Hässliche, es ist weg. Wenigstens ein Teil davon. Doch wenn ich ein Foto sehe oder mir etwas einfällt, ergibt oft das eine das andere. Einige Erinnerungen sind dann sofort wieder da, während andere verschüttet bleiben. Vielleicht wäre es einfacher, wenn ich alles in einer bestimmten Periode vergessen hätte. Ein Blackout von einem Monat oder einem Jahr. Okay, die Tage unmittelbar vor dem Ereignis sind vollständig weg, gelöscht. Konkret fehlen mir mindestens drei Tage komplett, nein, eigentlich mehr, auch die Zeit im Koma, aber da habe ich nichts erlebt. Aber sonst ist alles diffus. Klare Erinnerungen und unerklärliche Lücken. Es kann sein, dass ich mich an etwas Bestimmtes erinnere und etwas anderes, das fast zeitgleich war, ein großes Loch ist. Schwierig, schwierig, nicht nur für mich.
Da ist zum Beispiel Daniela, meine Partnerin bei der Polizei. Ich habe sie im Krankenhaus nicht erkannt. Die Erinnerungen kamen nur langsam zurück und sie stammen alle aus einer Zeit lange vor dem besagten Tag. Jetzt denke ich an Daniela. Wie geht es ihr? Ich spüre sofort den Herzschlag. Daniela, meine Freundin, meine Partnerin auf Streife. Sie meldet sich kaum noch. Wahrscheinlich hat es sie irritiert oder schockiert, dass ich sie nicht sofort erkannte. Oder sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie mir nicht helfen konnte. Auch das ist möglich. Sie muss sich auf die Arbeit konzentrieren, denke ich. Wie würde ich mich verhalten? Es gibt den Alltag und die Arbeit, und es gibt die Kollegin, die sich kaum an dich erinnert. Schwierig.
»Sie fehlt dir«, sagt Maria.
»Du kennst Daniela?«, frage ich.
»Sie fehlt dir.«
Maria hat recht. Mir fehlen die Gespräche mit Daniela. Man verbringt sehr viel Zeit zusammen, manchmal Stunden, in denen nichts geschieht. Wir konnten albern sein, das kann man nicht mit allen. Aber jetzt geht das nicht mehr. Die Schläge haben auch unsere Freundschaft zertrümmert.
»Smashed?«, fragt Maria.
Ich ärgere mich, aber es bringt nichts.
»Devi essere ottimista«, sagt Maria.
»Ja, ich weiß.«
Wie können Stimmen im Kopf so real sein, frage ich mich. Es gibt Verrückte, die Wahnsinnstaten begehen, weil sie eine Stimme hören. Sind das auch Maria und John? Sind diese Stimmen Teil einer anderen Realität? Warten sie auf empfängliche Opfer? Es sind absurde Gedanken, aber ich kann mich nicht von ihnen befreien. Ich greife zu den Kopfhörern. Laute Musik hören, um seine Ruhe zu haben. Meine Welt ist eine andere geworden. Ich muss mein brain trainieren, denke ich. Schon wieder »brain«. Und wieder ist das richtige Wort weg. Ich finde es online. »Gehirn«. Wahrscheinlich ist das eine Form von schwarzem Humor, wenn man sich nach einem Gehirnschaden nicht mehr an das Wort »Gehirn« erinnert.
Maria und John heißen nicht so, und vielleicht sind es auch nicht zwei Personen, Figuren oder was auch immer. Ich habe aus den Stimmen zwei Menschen gemacht.
Maria und John sind Phantasienamen. Ich kenne niemanden, der so heißt. Maria benutzt oft italienische Wörter, John englische. Aber beide sprechen auch die jeweils andere Sprache und Französisch. Es ist ein großes Durcheinander. Unser Gehirn speichert die Informationen dezentral und verbindet sie. Entweder sind bei mir diese Verbindungen durcheinandergeraten, oder alles ist derart durchgerüttelt worden, dass die Wörter und Erinnerungen von einem Speicherort zum anderen flogen. Ich suche nach einer Erklärung. So wie das Menschen immer tun. Das Schlimmste, was einem Menschen geschehen kann, ist ein Leben mit der ständigen Frage, warum ich? Niemand kann es akzeptieren als das, was wir Schicksal nennen. Es muss eine Erklärung geben, für alles. Warum ich? Weder Maria noch John können diese Frage beantworten. Aber ich denke, sie liefern mir Hinweise. Das ist ein schöner Gedanke für eine Polizistin. Ich gehe meinen eigenen Hinweisen nach.
4
Ich denke an das, was die Spezialistin sagte. Noch einmal Deutsch lernen. Von Grund auf. Als ich Italienisch lernte, stand ich vor der Entscheidung, ganz klassisch einen Kurs zu besuchen oder alleine zu lernen. Gegen den Kurs sprach, dass Menschen neugierig sind. Es dauert meist nicht lange, bis man gefragt wird, was man beruflich macht. Und ich weiß, was danach geschieht. Entweder wenden sich die Leute ab oder sie hören nicht auf, Fragen zu stellen. Ich mag beides nicht. Also entschied ich mich für Apps. Und es war eine gute Entscheidung. Ich konnte lernen, wo und wann ich wollte. Auch wenn ich mit Daniela Dienst hatte. Sie fand es lustig, zuzuhören, wenn ich italienische Vokabeln lernte. Ich greife zum Handy. Die Apps sind noch installiert, einige Abos laufen weiter. Gut, das ist besser als immer nur mit Maria und John zu reden. Wo sind sie überhaupt? Schlafen die Stimmen wie wir, benötigen sie Schlaf, um am Morgen wieder Unsinn zu erzählen? Mit drei der Apps, mit denen ich Italienisch lernte, kann man auch Deutsch lernen. Ich wähle Englisch als Ausgangssprache. So kann ich auch die Englischlücken wieder auffüllen. Los gehts.
Guten Tag.
Es ist lächerlich. Aber es geht nicht anders. Ich muss alle Wörter wiederholen. Denke ich zumindest. Zuerst auf Deutsch und später dann in den anderen Sprachen. Was machst du so? Ich lerne Deutsch. Selten so gelacht. Natürlich werde ich mit niemandem darüber sprechen, schon gar nicht mit meinen Eltern.
Auf Wiedersehen. Au revoir. Goodbye. Arrivederci.
Das wäre eine Variante, alle Wörter in den vier Sprachen zu wiederholen. Wie lange benötige ich dafür? 2000, 3000 oder 5000 Wörter pro Sprache? Auf Deutsch sind es viel mehr. Aber ich hätte eine Aufgabe, wenn ich müde herumliege, ohne schlafen zu können. Und überhaupt. Good idea, Anna. Bonne idee, buona idea, gute Idee. Verblüffend, wie ähnlich sie sich sind. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele. Hund, chien, dog, cane. Chat, gatto, Katze, cat. Es beginnt mir Spaß zu machen.
Die Erinnerung, memory, la memoria, la memoire. Aber im Italienischen gibt es für »sich erinnern« auch noch das Wort »il ricordo«. »Se rappeler«, »se souvenir« auf Französisch. Ist »la memoire« »der Speicher«? Mir fällt »appeler par cœur« ein. »Auswendig lernen«. »Learning by heart«. »Imparare a memoria«. Kann ich mein Leben zurückholen, indem ich Wörter auswendig lerne? Es gibt Menschen, die an Aphasie leiden, denen nicht nur die Wörter abhanden gekommen sind, sondern auch die Aussprache. Alles weg. Was sind wir ohne Sprache? Ich erinnere mich an die mitleidigen Blicke. Wenn ich nach einem Wort suchte. Die Leute halten das Warten nicht aus. Zuzusehen, wie jemand mit Wörtern ringt. Sie versuchen zu helfen und machen alles nur schlimmer. Wie oft habe ich mich in Italien geärgert, wenn der cameriere auf Englisch antwortete, obwohl ich versuchte Italienisch zu sprechen. Die Kellner sind stolz auf ihr schlechtes Englisch, aber es ist tödlich, wenn man Italienisch praktizieren möchte. Englisch hat sich zu einer Plage entwickelt, es ist überall das Gleiche. Selbst in Frankreich, wo man fast übertrieben stolz auf die eigene Sprache ist, wird mit den Touristen heute Englisch gesprochen. Und damit auch mit jenen, die Französisch lernen. Es wird so weit kommen, dass man in abgelegene Täler wandern muss, wenn man sich auf Italienisch oder Französisch unterhalten will. Aber das ist jetzt nicht wirklich mein Problem. Ich muss mich überwinden, überhaupt zu sprechen. Wenn man eine Sprache lernt, ist der schwierigste Teil, sie zu sprechen. Lesen und schreiben gehen schneller. Okay, es gibt diese Naturtalente, die nach einem Monat schon losplappern, als wäre es das Einfachste der Welt. Alle anderen benötigen länger.
Kann ich tatsächlich alles zurückholen? Oder mache ich mir etwas vor? Schreiben geht. Ich sehe die Fehler sofort. Wenn ich schreibe, tutto weg, dann bemerke ich, dass »tutto« falsch ist. Ich schreibe und denke auf Deutsch, aber Wörter aus einer anderen Sprache mischen sich ein. Doch ich muss auch sprechen. Ich muss jemanden finden, mit dem ich Deutsch sprechen kann und der mich sofort korrigiert, wenn ich eine Fremdsprache benutze. Ein Sprachtalent, geduldig, hilfsbereit, ausdauernd. Ich bin nicht besonders geduldig. Wozu Zeit verschwenden für etwas, wenn es nicht wirklich wichtig ist? Im Krankenhaus lernt man, geduldig zu sein. Drei Tage Fortschritte und dann wieder von vorne. Okay, so richtig gelernt habe ich es nicht, aber zumindest akzeptiert. Ich habe gelernt zu essen, ohne dabei eine Sauerei zu machen. Ich habe gelernt zu gehen, ohne ein Sicherheitsrisiko für mich und die anderen zu sein. Das alles hat unendlich lange gedauert. Das Sprechen ging einfacher. Dachte ich. Bis ich bemerkte, dass man mich oft nicht verstand. Aussetzer. Sie hat Aussetzer. Ist das meine Zukunft? Eine Frau, die Aussetzer hat? Può essere. Kann sein. Ich starte wieder eine App.
Hallo, ich heiße Anna.
Ich lache laut. Mi chiamo Anna, my name is Anna oder I’m Anna. Je suis Anna oder je m’appelle Anna.
Wie heißt du?
Come ti chiami? What’s your name? Comment tu t’appelles?
Wenn ich das konsequent mache, sollte ich in einem halben Jahr alles wieder intus haben. Sofern mein Gehirn alles schön abspeichert und auch wiederfindet. Doch mit wem soll ich sprechen? Mein Vater und meine Mutter würden sicher gerne helfen, aber ich ertrage ihre Art nicht über eine längere Zeit. Es müsste jemand Neutrales sein. Am besten jemand, den ich dafür bezahle. Aber das wird teuer. In solchen Momenten denke ich, ein paar Freunde wären schon nicht schlecht. Aber hätten die Zeit und Geduld? Und würde ich es lange genug aushalten, mich immer wieder scheitern zu sehen? Ich finde ein Wort nicht oder sage es auf Französisch. Wie sollen sie das verstehen? Krebs kann man verstehen, einen Herzinfarkt oder eine Lähmung. Aber wie soll man verstehen, dass ich Kauderwelsch rede, wenn ich nervös bin?
Lars vielleicht. Er wohnt im zweiten Stock. Wir grüßten uns lange wortlos. Dann gab es erste belanglose Gespräche. Keine Ahnung, worüber. Wetter und so Zeug. Lars ist ein Chamäleon. An einem Tag top angezogen und gut gelaunt, am anderen schmuddelig und miesepetrig. Manchmal sogar geschminkt. Ich hielt ihn zuerst für schwul. Aber dann sah ich ihn mit einer Frau. Deutlich älter als er. Sehr vertraut. Ein Liebespaar. Oder eine Affäre. Warum nicht Lars? Aber ich erinnere mich an keine einzige Unterhaltung mit ihm. Inhaltlich. Ich weiß, dass wir öfter miteinander sprachen, aber nicht mehr, worüber. Hat er mir nicht gesagt, dass er Schauspieler ist? Oder habe ich das gegoogelt? Nein, nicht Schauspieler. Sprecher. Ein seltsamer Beruf. Man ist nur eine Stimme. In einem Werbespot. In einer Reportage. Im Lautsprecher des Supermarktes. Mir fällt ein, dass ich Lars nicht gesehen habe, seit ich wieder zu Hause bin. Vielleicht sollte ich einfach mal bei Lars klingeln?
Der Gedanke erfreut mich und macht mir gleichzeitig Angst, paura, peur, fear. Oder anxiety? Perro. Das Wort ist plötzlich da und auch seine Bedeutung. »Perro« heißt »Hund« auf Spanisch. Habe ich etwa auch noch Spanisch gelernt? Ich suche in meinem Kopf nach spanischen Vokabeln, aber es kommt nichts. Maria und John schweigen. Hat es damit zu tun, dass ich mich ablenke? Kann ich die beiden durch Lernen zum Schweigen bringen?
»Tengo hambre.«
Das ist John.
»Was bedeutet das?«
»Ich habe Hunger.«
»Habe ich das gelernt?«
»Hunger lernt man nicht, man hat ihn einfach.«
»Sehr klug. Ich meine Spanisch. Habe ich Spanisch gelernt?«
John schweigt.
»Sag mir die Wahrheit. Wer bist du?«
Tell me the truth, la verità, la vérité, die Wahrheit.
»Sie ist in jeder Sprache anders«, sagt John.
»Die Wahrheit«, frage ich?
»La verità and the truth, glaubst du, sie sind das Gleiche?«
»Ja«, sage ich. »Es ist egal, ob die Wörter ähnlich klingen oder nicht. ›La verità‹ und ›la vérité‹ klingen fast gleich, ›truth‹ und ›Wahrheit‹ ganz anders.«
»Es gibt sie nicht«, sagt John.
»Ja, ich weiß, es gibt Philosophen, die das behaupten.«
»Man kann alles behaupten«, sagt John.
»Ja, aber danach muss man es beweisen.«
»Zuerst behaupten und danach enthaupten. Wenn man etwas behauptet, gibt man einen Kopf drauf, und wenn man enthauptet, nimmt man den Kopf weg.«
»Das ist Unsinn«, sage ich.
Wenn ich mich nicht mehr richtig daran erinnern kann, dass ich Spanisch lernte, muss das kurz vor dem Blackout gewesen sein. So habe ich mir die Tat eine Weile schöngeredet. Als einen Blackout, den ich hatte. Nicht etwas, das mir zugefügt wurde. Spanisch soll einfach zu lernen sein, wenn man schon Italienisch spricht. Aber mein Italienisch ist jetzt ein löchriger Käse. Genauso wie mein Deutsch.
Ich heiße Anna und du heißt Matthias.
Ich zweifle schon, ob das wirklich was bringt. Wäre es nicht besser, gezielt die Wörter zu lernen, die mir fehlen? Aber wie erkenne ich diese Wörter?
Wie geht es dir? How are you, come stai, comment vas-tu?
»Es ist die Liebe«, sagt Maria.
»Hör auf«, sage ich.
»Die Liebe zu deinem Beruf.«
»Ja, vielleicht. Aber vielleicht auch nur die Liebe zu mir, meine Selbstachtung.«
»Es ist die Angst«, sagt John. »Sie treibt alle an, aber niemand gibt es zu.«
Ich greife zu den Kopfhörern und jage mir den Lärm einer Metalband durch den Schädel.
Non lo so, I don’t know, je ne sais pas. Ich weiß es nicht.
Polizistin brutal zusammengeschlagen. Tag für Tag, Nacht für Nacht.
5
Die ersten Tage im Krankenhaus. Bei Bewusstsein und doch weit weg. Ich wusste sofort, wer ich bin, ich dachte, okay, es hat mich erwischt, aber ich lebe und ich werde mich wieder erholen. Aber dann entdeckte ich die Lücken. Die Versuche zu sprechen. Das mühsame Wiedererkennen meines Vaters. Die Fremdheit. Sich wie in einem Film fühlen. Den Krankenhausalltag nahm ich als etwas Beruhigendes wahr. Ständig kam und ging jemand. Alle kümmerten sich um mich. Es gab Rituale. Um mich herum bewegte sich alles. Ich lag da und die Zeit verging. Anfangs gab es diese Leere in meinem Kopf. Keine Gedanken. Ich nahm alles wahr, aber es betraf mich irgendwie nicht. Vollgepumpt mit Medikamenten. Ein Strom aus Schmerz- und Beruhigungsmitteln. Ich durfte das Bett nicht verlassen. Die Ärzte befürchteten, dass die Koordination mit meinen Beinen nicht funktionierte. Tatsächlich gab es Momente, in denen ich keinen Einfluss auf die Muskeln hatte. Aber das besserte sich rasch. Ich spürte, wie sich die Pflegerinnen und Pfleger entspannten in meiner Gegenwart. Kein ständiges Abwägen mehr, ob ich vielleicht gleich wieder bewusstlos werde. Später las ich, dass das passieren kann. Wie so vieles. Ein verletztes Gehirn ist unberechenbar. Ich versuchte mich nicht ständig zu beobachten. Ging diese Bewegung gestern besser? Sprach ich deutlicher? Warum fühle ich mich heute so schlapp? Sich beobachten ist wie auf eine Katastrophe warten. Nicht gut. Die Medikamente halfen mir, die Tage zu begrüßen und zu verabschieden, ohne viel darüber nachzudenken. Ich sprach mit Besuchern und vergaß alles gleich wieder. Aber es beunruhigte mich nicht. Ich machte einfache Übungen. Memorierte einen Satz. Es funktionierte. Aber Minuten später war alles wieder weg. Meine Mutter sprach über eine Reise, die ich gemacht hatte. Ich hatte keine Ahnung davon. Mein Vater redete über einen Arbeitskollegen. Er ging offenbar davon aus, dass ich ihn kannte. Ich hatte keinerlei Erinnerung an ihn. Doch langsam kamen die Erinnerungen zurück. Plötzlich war da ein Name in meinem Kopf. Später kam ein Gesicht dazu. Wie wenn mein Gehirn einzelne Teile zusammensetzte. Und immer wieder die Stunden, in denen ich gedankenlos in meinem Bett lag oder saß. Und alles rundherum wie ein Film war. Ich mittendrin. Als hätte man mein Bett in eine Filmszene geschoben. Es war ein Gefühl, das ich zuvor nicht gekannt hatte. Passiv sein. Einfach nur da sein. Wie ein Einrichtungsgegenstand. Und ich hatte kein Bedürfnis, etwas daran zu ändern. Wie die alten Leute, die den ganzen Tag nur auf einem Stuhl sitzen und ins Leere starren. Letting the day go by. Passare il tempo.
»Erzähl etwas«, sagt Maria. »Hai fatto un sogno la notte scorsa?«
»Ich träume manchmal drei- oder viermal, aber die Träume sind wirr.«
»Dimmi.«
»Etwas lag auf der Straße. Die Autos wichen aus. Ich konnte nicht erkennen, was auf der Straße lag. Plötzlich bewegte es sich. Es war eine Katze. Ein Auto fuhr direkt auf die Katze zu. Ich winkte dem Fahrer zu, aber das Auto fuhr einfach weiter. Als ich mich zu der Katze umdrehte, war sie weg. Auch die Straße war weg. Ich hielt eine Tasse in der Hand und stand an einem Fenster.«
»Weiter«.
»Nichts weiter.«
»Das ist doch kein Traum«, sagt Maria empört.
»Meine Träume sind immer so. Sinnlos und wirr.«
»Die Katze. Was hat sie für eine Bedeutung?«
»Keine Ahnung.«
»Die Katze hat eine Bedeutung«, sagt Maria.
»Nein.«
»Wie kannst du so sicher sein?«, fragt Maria.
»Ich stehe nie mit einer Tasse in der Hand am Fenster. Das war nicht ich.«
»Du träumst von einer anderen Person?«
»Vielleicht tun wir das alle. Deshalb sind die Träume so wirr. Weil sie manchmal nicht unsere Träume sind.«
Mir fällt ein, dass in meinem Traum auch ein Mann vorkam. Er sah mich an und lächelte. Er trug einen roten Mantel. Wie der Nikolaus. Danach war er weg. Ich versuche mich an sein Gesicht zu erinnern, aber da ist nichts. Ich greife zu den Kopfhörern. Ich öffne die App und lerne Wörter, die ich schon kenne. Es ist absurd, aber ich mache weiter. Nach zehn Minuten habe ich genug. Ich stehe auf und verlasse die Wohnung.
Der Gang zum Briefkasten war anfangs eine Tortur. Ich wollte niemandem im Treppenhaus begegnen. Keine Fragen beantworten. Wie geht es Ihnen? Gut, ich lag eine Weile im Koma, aber jetzt ist alles wieder gut. Die Menschen zwingen einander das Lügen auf. Niemand will die Wahrheit erfahren, aber alle wollen höflich sein. Mittlerweile ist es mir egal. Ich grüße die Leute, mache aber keine Anstalten, mich auf ein Gespräch einzulassen. Tunnelblick. So tun, als sei man in Eile. So tun, als sei alles in Ordnung.
»Anna?«
Ich bleibe stehen. Niemand im Haus nennt mich beim Vornamen. Fast niemand. Ich drehe mich um. Lars sieht beschissen aus. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ungepflegt, unrasiert, müde, kaputt. Wahrscheinlich denkt er das Gleiche über mich.
»Ich wollte mich bei dir melden.«
»Schon gut«, sage ich.
»Als ich es in der Zeitung las, dachte ich zuerst nicht an dich. Aber dann habe ich dich nicht mehr gesehen. Ich klingelte einmal an deiner Tür. Es war idiotisch. Ich hätte bei der Polizei anrufen sollen.«
»Die hätten dir keine Auskunft gegeben.«
»Ich hatte auch meine Probleme.«
Das sieht man, denke ich.
»Das Leben ist manchmal beschissen«, sagt Lars.
»Kann man so sagen.«
»Può was?«, fragt Lars.
»Was?«, frage ich.
»Das war Italienisch, nicht?«
»Kann sein. I have to … jetzt bemerke ich es selbst.«
»Englisch? Okay, that’s easier for me.« Lars lacht. Ich kriege einen roten Kopf. Mir wird schwindlig. Ich halte mich am Treppengeländer fest.
»Bist du okay?«
»Nein.«
»Was kann ich tun?«
»Nichts.«
»Fällst du in Ohnmacht?«
»Nein«, sage ich. Doch woher soll ich das wissen? Ich will weg, weit weg. Lars kommt drei Treppenstufen näher und streckt seinen Arm aus. Es muss wie in einem Kitschfilm aussehen. Die helfende Hand des Helden rettet die Frau vor dem Treppensturz.
»Es geht schon«, sage ich.
»Ça va? Willst du mich beeindrucken?« Lars lacht jetzt unsicher.
»Nein«, sage ich. Ich atme tief ein, aber es wird nicht besser. Jetzt ist Lars nur noch eine Stufe entfernt. Er streckt die Arme aus. Wenn ich jetzt falle, dann direkt in seine Arme. Ich will das nicht. Ich setze mich auf die Treppenstufe.
»Soll ich die Ambulanz rufen?«
»Nein. Es geht schon.«
»Ich kenne das«, sagt Lars.
»Was?«
»Panikattacken.«
Ich schüttle den Kopf.
»Doch, ich kenne die Symptome.«
»Nein. Es ist etwas anderes.«
»Soll ich dich stützen?«
»Nein, es geht schon.«
Aber es geht nicht. Ich spüre meine Beine nicht. Es ist zum Kotzen. Es ist nicht neu, aber bis jetzt geschah es immer in der Wohnung und es dauerte nie lange. Ich schließe die Augen, atme tief ein und aus. Als ich die Augen öffne, steht Lars immer noch da. Er schaut mich mit einem sehr skeptischen Blick an. Wird sie sterben oder so ähnlich. Ich murmle etwas.
»Besser?«, fragt Lars.
»Ja«, sage ich.
»Oui?«, fragt Lars. Mist, denke ich. Aber ich spüre meine Beine wieder. Ich ziehe mich am Geländer nach oben, verliere beinahe das Gleichgewicht. Lars stützt mich mit einer Hand.
»Geht schon«, sage ich.
»Ja klar«, sagt Lars lachend. »Kannst das auch auf deinen Grabstein meißeln lassen. Geht schon.«
Ich muss lachen.
»Lust auf ein Bier?«
»Keine schlechte Idee«, sage ich.
Er zeigt nach oben.
»Meine Wohnung ist näher.«
»Okay«, sage ich.
Als ich hochgehe, schaut er weiterhin skeptisch. Ich fühle mich unsicher, aber mit jedem Tritt geht es besser. Ich war schon mal in seiner Wohnung. Weiße Möbel. Ich erinnere mich an keine Gespräche, aber einmal waren da auch noch ein Mann und eine Frau. Der Mann hatte einen Bart, die Frau trug ein luftiges Blumenkleid. Die Bilder sind besser abgespeichert als die Wörter und Gespräche. Gut möglich, dass die Gespräche zurückkommen in seiner Wohnung. So, als wären sie dort irgendwo gespeichert. In den Wänden oder dem Sessel, auf dem ich saß. Vielleicht benötigt das Gehirn die Umgebung, um das Gespräch wieder zu verknüpfen.
Ich atme heftig, als ich die Wohnung betrete. Lars zeigt auf einen Sessel im Wohnzimmer. Er ist grün, nicht weiß. Auch die übrigen Möbel sind bunter. Bis auf das weiße Sofa. Ich erkenne es wieder. Ich setze mich in den grünen Sessel. Lars geht in die Küche und kommt mit zwei Flaschen Bier zurück. Keine Gläser. Sehr gut.
»Allora«, sage ich.
»Du musst nichts sagen.«
»Ich will aber.«
»Okay.«
»Ich werde englische, italienische und französische Wörter benutzen.«
»Das muss nicht sein.«
»Es geht nicht anders.«
»Englisch ist kein Problem. Französisch schon eher. Und Italienisch verstehe ich nicht.«
»Mein Gehirn ersetzt deutsche Wörter, die ich vergessen habe, durch Wörter aus anderen Sprachen.«
»Aber du sprichst perfekt Deutsch.«
Ich hebe die Flasche in die Höhe und wir toasten uns zu. Ich trinke zwei, drei große Schlucke. Es tut gut.
»Ich merke es oft nicht, wenn ich Wörter aus einer anderen Sprache benutze.«
»Aha.«
»Sag mir, wenn du etwas nicht verstehst.«
»Ich verstehe eigentlich gar nichts. Was war das vorhin im Treppenhaus? Eine Art Anfall? Und was ist mit den Wörtern?«
»It’s a long story«, sage ich. Ganz bewusst auf Englisch.
»Ich habe nichts vor heute«, sagt Lars.
»Allora«, sage ich.
Ich rede und rede und rede. Lars hört zu, nickt, lacht, fragt nach. Wann habe ich zuletzt so viel geredet? Lars korrigiert mich nicht. Wir haben uns darauf verständigt, dass er einen Finger hebt, wenn er etwas nicht versteht. Er hebt ihn ab und zu. Es tut gut, zu reden. Es tut gut, mich nicht zu verstecken.
»Das ist meine Geschichte«, sage ich schließlich.
»Du hättest sterben können.«
»Ja.«
»Krass.«
»Man kriegt nichts mit. Ich habe keine Lichter gesehen, keine Engel, nichts.«
»Man sagt, dass Nahtoderfahrungen chemische Prozesse sind«, sagt Lars.
»Manche sagen das auch über die Liebe«, sagt Maria.
Sie hat sich einige Male eingeschaltet. Ich habe sie ignoriert. Und ich habe sie verschwiegen. Sie und John.
»Manchmal höre ich sogar Stimmen«, sage ich.
Lars lacht laut.
»Ich bin eine Stimme. Vielleicht hast du mich gehört?«
»Nervt es dich, dass du nur eine Stimme bist?«
»Nicht wirklich. Es ist ein Job. Er macht mir Spaß. Meistens. Du bist gerne Polizistin?«
»Sehr gerne.«
Er verzieht sein Gesicht und nimmt einen großen Schluck. Er mag Polizisten nicht. Wie so viele. Sie erinnern einen an die eigenen dunklen Seiten. An all das, was man gemacht hat, ohne dabei erwischt zu werden.
»Wie stehen die Chancen, dass du wieder in den Job zurückkannst?«, versucht er möglichst neutral zu fragen.
»Schlecht bis miserabel.«
»Keine gute Aussicht.«
»Kann man so sagen.«
»Es gibt Drogen, die dir helfen könnten.«
»Du spinnst.«
»Nein. Du sagst, dass du weniger Fehler machst, wenn du entspannt bist.«
»Ein Bier ist okay. No drugs.«
»Ja, Polizistin halt«, sagt er lachend.
»Seit wann nimmst du das Zeug?«
»Schon ziemlich lange. Ich habe nie gekifft, aber die typischen Partypillen waren mein Ding. Stundenlang gut drauf sein.«
»Handelst du mit dem Zeug?«
Er lacht schallend, vielleicht etwas zu übertrieben.
»Nein. Ich bin nur Konsument.«
»Ist überhaupt nicht mein Ding.«
Lars ist auch nicht mein Ding. Aber es ist trotzdem gut, mit ihm zu reden. Da besteht keine Gefahr für mehr. Ich denke, es geht ihm auch so. Ich habe schon genug Komplikationen.
»Tocca a te«, sage ich.
»Was?«
»Das bedeutet, du bist an der Reihe.«
»Womit?«
»Vorhin auf der Treppe sagtest du, dass du es kennst. Du hast von Panikattacken geredet.«
»Dein Gedächtnis ist wieder voll da.«
»Erzähl.«