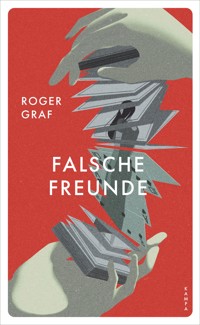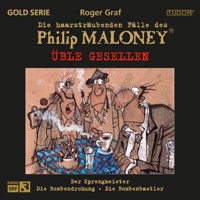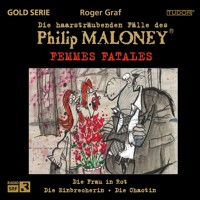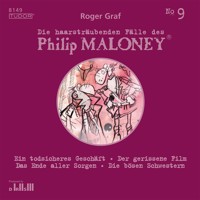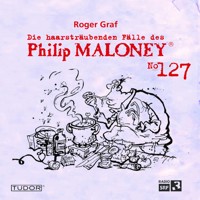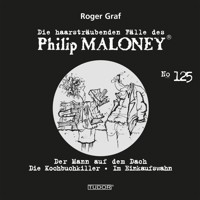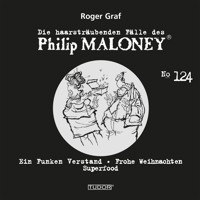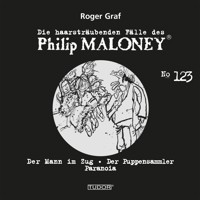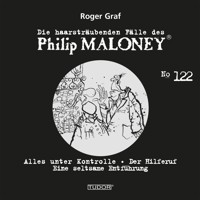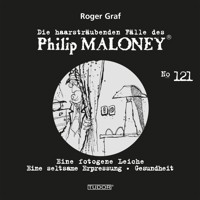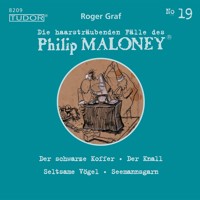Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Philip Maloney hat eine neue Nachbarin, auch sie ist Detektivin, spezialisiert auf vermisste Personen. Während seine Geldreserven gerade noch für zwei Monate reichen und er sich nicht mal das Inserat leisten kann, mit dem er neue Klienten anwerben könnte, hat sie gleich zwei Fälle auf dem Schreibtisch: eine junge Frau, die seltsame Postkarten erhält und vermutet, dass diese von ihrem Vater stammen, den sie nie kennengelernt hat, und einen Journalisten, der vor vier Wochen mit seiner Freundin vor dem Kino verabredet war, dort aber nie aufgetaucht und seitdem spurlos verschwunden ist. Philip Maloney behauptet zwar noch, nicht darauf angewiesen zu sein, Klienten von der Konkurrenz vermittelt zu bekommen, geht der Sache aber trotzdem nach, hangelt sich von Leiche zu Leiche und löst seinen bisher verquersten Fall.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roger Graf
Ticket für die Ewigkeit
Ein Fall für Philip Maloney
Kriminalroman
atlantis
Für Ruth
»Now Mary Lou loved Johnny with a love mean and true
She said baby I’ll work for you everyday
and bring my money home to you
One day he up and left her and ever since that
she waits down at the end of that dirt road
for young Johnny to come back
Struck me kinda funny funny yea indeed
how at the end of every hard earned day
you can find some reason to believe.«
Bruce Springsteen, »Reason to believe«
1
Die dritte Leiche hatten sie aus dem Hudson-River gezogen. Sie stank nach Fisch und sah aus wie eine Makrele, die zu lange in der Sonne gelegen hatte. Spätestens da begriff ich, dass ich dieses Buch schon einmal gelesen hatte. Ich schmiss es in den Papierkorb und machte mir einen Kaffee. Seit einer Woche hatte niemand außer mir mein Büro betreten. Ich hatte noch Reserven für zwei Monate, aber was waren schon zwei Monate? Ich wünschte mir einen dicken fetten Klienten mit einer dicken fetten Brieftasche. Doch seit die Rezession die Teller der Leute leer gefegt hatte, gab es immer weniger dicke fette Klienten, und die paar wenigen, die es noch gab, beschäftigten ein Heer von Anwälten und waren nicht auf die Dienste eines Privatdetektivs angewiesen. Ich stellte mich ans Fenster und schaute den Leuten zu, die auf dem Trottoir gingen und so taten, als sei alles in Ordnung. Vermutlich war es das auch für die meisten. Die ältere Frau von der anderen Straßenseite starrte aus dem halb geöffneten Fenster zu mir herüber. Vor zwei Monaten war ihr Mann gestorben. Einen Tag lang war sie nicht zu sehen. Doch schon am nächsten Tag war sie wieder da und starrte aus dem Fenster. Was auch immer sie da sah, es musste gerade gut genug sein, noch eine Weile am Leben zu bleiben. Während ich mir so meine Gedanken machte, klopfte es an der Tür. Ich drehte mich um, atmete tief durch, dachte an den dicken fetten Mann und setzte jenes Lächeln auf, das in meiner Kindheit meine nächsten Angehörigen davon überzeugen konnte, mich doch nicht an die Nachbarn zu verschenken.
Der dicke fette Mann war weder dick noch fett noch war er ein Mann. Ich schätzte sie um die Dreißig. Sie hatte die Haare zurückgebunden und ihr helles T-Shirt war voll grauer Flecken. Sie war klein, trug Turnschuhe und auf ihrem Gesicht glänzte ein Film aus Schweiß. In ihrer rechten Hand trug sie ein Mobiltelefon. Ich überlegte mir, ob ich in den letzten Tagen Handwerker bestellt hatte. Ich hatte nicht.
»Ich heiße Jasmin Weber. Ich bin hier neu eingezogen …«
»Tatsächlich? Da wird sich der Vermieter aber freuen. Ich habe mit ihm eine Wette abgeschlossen, dass er niemanden finden wird, der neu in diese Bruchbude einzieht, ehe er nicht einige Reparaturen gemacht hat.«
»Meinen Sie die defekten Stromleitungen im Treppenhaus?«
»Unter anderem. Wissen Sie, es treiben sich ab und zu Lebensmüde in der Gegend herum. Die haben vermutlich herausgefunden, dass man in diesem Haus leicht befördert werden kann.«
»Ohne Lift?«
»Ganz nach oben. Das geht auch ohne Lift.«
»Ich habe die Stromleitungen repariert. Sie können also ruhig wieder nachts durch die Gänge torkeln.«
»Wer sagt, dass ich nachts torkle?«
»Na ja, man hört so einiges.«
»Sind Sie Handwerkerin?«
»Nein. Kollegin.«
»Kollegin? Kann man davon leben?«
»Berufskollegin. Zumindest beinahe.«
»Was denn? Hier im Haus? Eine zweite Detektivin?«
»Ich habe mich auf vermisste Personen spezialisiert.«
Ich schluckte einmal leer und schaute ratlos auf die kleine drahtige Frau vor mir. Dieser Schweinehund von einem Hausverwalter hatte mir eine zweite Detektei untergejubelt und das in einer wirtschaftlich mehr als schwierigen Zeit. Ich überlegte mir, ob ich dem Kerl eine runterhauen sollte, wenn ich ihn das nächste Mal zu Gesicht bekommen würde, ließ aber von dem Gedanken ab, da ich mir keine Klage wegen Körperverletzung leisten konnte. Stattdessen ließ ich Jasmin Weber zu mir ins Büro kommen und bot ihr jenen Stuhl an, den ich gekauft hatte, um all die dicken fetten Hintern dicker fetter Männer mit dicken fetten Brieftaschen zu stützen. Ich bot ihr einen Kaffee an und sie lächelte, als ich die zweite Tasse aus dem Schrank holte und spülte.
»Mein Freund hat eine Schwester, die vor ein paar Jahren verschwunden ist. Er hat schon alles Mögliche unternommen, um sie wiederzufinden. Er hat mittlerweile geerbt und ihr gehört die Hälfte davon.«
»Und dann haben Sie sie gesucht und auch prompt gefunden?«
»Nicht ganz. Es dauerte über drei Monate. Ich fand sie schließlich in Spanien. Sie ist mit einem Piloten verheiratet, hat drei Kinder und ist ganz glücklich.«
»Und seither suchen Sie berufsmäßig nach vermissten Leuten?«
»Ja. Zuerst habe ich Germanistik studiert. Danach ein Informatikstudium begonnen und wieder abgebrochen. Später arbeitete ich eine Weile alles Mögliche. Das ging vor ein paar Jahren noch.«
»Ich hoffe nur, dass nicht alle arbeitslosen Akademiker auf die Idee kommen, Privatdetektiv zu werden.«
»Keine Angst. Dazu sind die meisten zu dämlich.«
»Danke.«
»Sie sind ja kein Unbekannter auf Ihrem Gebiet, Maloney. Ich staune, dass Sie noch immer in dieser Absteige hausen.«
»An die Mäuse und Ratten gewöhnt man sich.«
»Ratten? Ich kann die Viecher nicht ausstehen.«
»Keine echten.«
»Ach so.«
»Laufen Sie immer mit so einem Ding herum?«
»Das Funktelefon? Kommen Sie ohne aus? Du meine Güte … Ist das jetzt alte Schule oder Altersstarrsinn?«
»Ich fühle mich jung genug, Ihnen eine runterzuhauen, wenn es sein muss.«
»Ich bin in mehreren asiatischen Kampfsportarten ausgebildet.«
»Toll. Vermutlich besitzen Sie auch ein Skateboard für Verfolgungsjagden?«
Sie stand auf, machte einen Schritt in Richtung Fenster und blieb stehen. Ich mag keinen Small talk. Dafür muss man entweder ausgebildet oder geboren sein. Es gibt Leute, die werden als Apéro-Snack geboren. Ich gehöre nicht dazu. Ich tat so, als würde ich angestrengt über etwas nachdenken, doch Jasmin Weber beachtete mich nicht. Wir schwiegen uns eine Weile an, bis sie sich langsam umdrehte und mit ihrer Zungenspitze über die Unterlippe strich.
»An was für einem Fall arbeiten Sie gerade, Maloney?«
»Noch nie was von Berufsethos gehört, junge Frau?«
»Doch. Aber das beantwortet meine Frage nicht.«
»Du meine Güte. Wenn Sie jetzt auch noch penetrant werden, öffne ich das Fenster und schreie laut nach meiner Mutter.«
»In den vergangenen Tagen ist nie jemand zu Ihnen hochgekommen.«
»Tatsächlich? Ist mir gar nicht aufgefallen.«
»Ich hätte vielleicht etwas für Sie.«
»Glauben Sie ernsthaft, dass ich darauf angewiesen bin, Fälle einer Kollegin zu übernehmen? Wenn es so weitergeht, bieten Sie mir noch an, Ihr Assistent zu werden.«
»Wäre das so schlimm?«
»Ich bin nicht für Teamarbeit geboren. Wenn es so wäre, würde ich heute Fußball spielen oder der Ortsgruppe der anonymen Alkoholiker vorstehen.«
»Sind Sie trocken, Maloney?«
»Nur vor dem Duschen. Langsam ödet mich diese Konversation an.«
»Sie sind also an keinem Fall interessiert?«
»Na, rücken Sie schon raus damit. Was möchten Sie mir andrehen?«
»Ich habe zurzeit auch nur zwei Klienten. Aber der ganze Umzug war stressig und ich hätte nichts dagegen, etwas entlastet zu werden.«
Es war kaum zu glauben. Die Frau hatte tatsächlich zwei Klienten mehr als ich. Musste wohl an der besseren Werbung liegen, oder an ihrem Bekanntenkreis. Ich hatte mir schon überlegt, ein riesiges Inserat in einer der großen Tageszeitungen zu schalten, ließ es aber bleiben, als mir eine nette Dame am Telefon die Tarife durchgab. Alles hatte mit der Teuerung Schritt gehalten, nur nicht mein Bankkonto. Ich beschloss, noch eine Weile nett zu meiner neuen Nachbarin zu sein.
Sie erzählte mir von ihren Klienten. Fall eins war eine junge, etwas verstörte Frau, die seltsame Postkarten erhielt und vermutete, dass diese von ihrem Vater, den sie nie gekannt hat, stammten. Mir krausten sich die Nackenhaare bei dem Gedanken an einen solch abstrusen Fall. Fall zwei klang wesentlich interessanter. Ein Journalist war seit einem Monat spurlos verschwunden.
Jasmin Weber setzte sich auf die Kante meines Schreibtisches und legte ihr Funktelefon einen Moment lang aus der Hand.
»Die Sache mit dem Journalisten klingt doch interessant, nicht wahr, Maloney?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht hatte er persönliche Probleme. Wollte nochmals von vorn anfangen oder er hat sich in eine reiche Unternehmerin verknallt und die mag es nicht, dass er kritische Artikel schreibt. Und jetzt wandelt er, als liberaler Knutschfleck verkleidet, von einer Vorstandssitzung zur nächsten.«
»Es deutet aber nichts darauf hin, dass er wegen persönlichen Problemen abgetaucht ist.«
»Wer kann schon in das Gehirn eines Journalisten schauen? Muss noch übler aussehen als all die Zeitungen, die diese Leute vollklecksen.«
»Wie ist Ihr Tarif?«
»500 am Tag. Plus Spesen.«
»Ich schlage vor, Sie kümmern sich bis morgen um den Journalisten. Dann sehen wir weiter.«
»Vermisste zu suchen kann Monate dauern. Das haben Sie selbst gesagt.«
»Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie was herausgefunden haben.«
»Moment mal. Ein bisschen dürftig die Informationen, die Sie mir da vorsetzen. Ich weiß noch nicht mal, wie der Kerl heißt.«
Sie glitt vom Schreibtisch und verschwand aus meinem Büro. Zwanzig Minuten später war sie wieder da. Frisch geduscht in einem engen blauen Kleid. Ich lächelte anerkennend und bot ihr an, wieder auf meinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Sie grinste und knallte ein dünnes Dossier auf den Tisch.
»Das ist alles, was ich habe.«
»Nun untertreiben Sie nicht. Eine Frau, die sich in so kurzer Zeit frisch machen kann, muss doch noch mehr zu bieten haben.«
»Lassen Sie das Gesülze. Das hier ist die Adresse der Freundin des Vermissten.«
»Ist sie die Klientin?«
»Ja. Ich habe sie angerufen. Sie weiß Bescheid, dass Sie sich um den Fall kümmern.«
»Das ist aber rührend.«
»Ich schaue morgen wieder bei Ihnen vorbei.«
Sie stand auf, ging zur Tür und war draußen, ohne sich noch einmal umzusehen. Ich mag Leute, die gut abgehen.
Ich schaute mir das Dossier an. Der Journalist war 32 und hatte schon so ziemlich alles hinter sich, was dieser Beruf zu bieten hat: Lokalnachrichten, Reportagen, Boulevard, eine Korrespondentenstelle in Rom, ein bisschen Radio und nicht zuletzt Reporter für eine linke Wochenzeitung und ein buntes Wochenendmagazin. Auf dem Foto sah er aus wie ein hungriger Geist auf Diät. Seine Augen waren wach und voller Tatendrang. Um seinen Mund hing etwas Trotzig-Resigniertes. Zuletzt gesehen wurde er von einem Bekannten in einer Bar in der Innenstadt.
Die Freundin hatte sich mit ihm vor einem Kino verabredet. Doch der Journalist tauchte nicht auf. Er hatte ihr auf dem Telefonbeantworter eine Mitteilung hinterlassen: Er könne nicht ins Kino kommen. Er rufe später noch einmal an. Das war vor vier Wochen. Seither wartete die Freundin. Die Geschichte klang nicht übel. Dennoch hatte ich ein flaues Gefühl im Magen. Solche Geschichten klären sich meist von selbst oder gar nicht auf. Ich legte mich eine Weile unter den Schreibtisch und entspannte mich. Mein Rücken bedankte sich mit einem angenehmen Ziehen. Als ich wieder aufstand, fühlte ich mich besser. Ich machte mich auf den Weg.
2
Das Haus lag in einem kleinen Hinterhof, der mit Fahrrädern vollgestopft war. Auf einem Balkon saß ein junger Mann und las Zeitung. Er beachtete mich nicht. Es war schwül und aus den Küchenfenstern roch es nach Mittagessen und Spülmittel. Ich stieg die knarrenden Holztreppen hoch und klingelte bei meiner neuen Klientin. Sie hieß Karin Blattmann. Es dauerte. Ich starrte in der Zwischenzeit auf den Verputz im Treppenhaus. Er war löchrig und hing in hässlichen Fetzen herunter. Das Haus war so unansehnlich, dass selbst die Spekulanten die Finger davonließen. Als mir Frau Blattmann öffnete, staunte ich nicht schlecht. Die Wände waren frisch gestrichen, und das Parkett sah um Klassen besser aus, als die durchgetretenen Holzdielen im Treppenhaus vermuten ließen. Frau Blattmann schaute mich ein wenig unsicher an. Als sie sah, dass ich keinen Aktenkoffer bei mir trug, atmete sie auf.
»Ich bin Philip Maloney. Privatdetektiv.«
Sie schaute nach links und rechts, als stünde sie vor einem Zebrastreifen, lauschte nach oben und nach unten und deutete mit der Hand an, dass ich ihre Wohnung betreten solle. Es roch nach Kaffee. Sie holte eine zweite Tasse und füllte beide, ohne zu fragen. Das Wohnzimmer war spärlich eingerichtet. Die Kargheit betonte die Größe des Raumes zusätzlich. Ich schätzte, dass mein Büro zwei- bis dreimal darin Platz gefunden hätte.
»Haben Sie schon etwas herausgefunden, Herr Maloney?«
»Ehrlich gesagt, habe ich mit den Ermittlungen noch gar nicht begonnen.«
»Frau Weber sagte mir, dass Sie einer der besten Detektive der Stadt seien.«
»Dann will ich dem mal nicht widersprechen.«
»Wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass Sie meinen Freund finden?«
»Schwierig zu sagen. Kommt auf seine Motivation an.«
»Was für eine Motivation?«
»Nun, ob er sich zum Beispiel versteckt oder ob ihm daran gelegen ist, dass man ihn findet.«
»Wenn er nicht weggelaufen ist … Was könnte dann mit ihm passiert sein?«
»Da bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten. Unfall, Mord, Selbstmord oder Entführung.«
»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er abgehauen ist. Weshalb auch und wovor?«
»Ach, wissen Sie, die nächsten Bekannten können das in der Regel schlecht abschätzen. Sie übersehen meist kleine Zeichen, die in diese Richtung deuten. Häufig braucht es nur einen Auslöser, einen günstigen Moment. Vielleicht kam er mit einer Geschichte nicht klar, die er schreiben wollte.«
»Und wenn ein Verbrechen geschehen ist?«
Sie blickte über den Rand ihrer Kaffeetasse auf den hellen Holzboden. Vermutlich hatte sie sich diese Frage seit vier Wochen täglich immer wieder gestellt. Ich wusste, dass sie drauf und dran war, das bisschen Beherrschung zu verlieren, das einen daran hindert, in solchen Situationen der Verzweiflung freien Lauf zu lassen. Ich stand auf und ging langsam im Wohnzimmer umher. Als ich sprach, vermied ich es, sie anzuschauen. Tränen machten den Kaffee auch nicht besser.
»Wie lange leben Sie schon zusammen?«
»Etwas weniger als ein Jahr. Heinz war oft mehrere Tage weg, wenn er recherchierte. Manchmal rief er an, aber nicht oft.«
»Wäre es also denkbar, dass es eine andere Frau gibt?«
»Ich habe das nie ganz ausgeschlossen. Wir haben nie darüber geredet. Mir war es lieber so.«
»Woran hat er gearbeitet, als er verschwand?«
»Ich weiß es nicht. Er hat selten mit mir darüber gesprochen. Er sagte immer, dass er froh sei, mit mir nicht dauernd über die Arbeit sprechen zu müssen. Dabei hätte ich das zu gerne. Ich kenne alle seine Artikel. Er ist ein guter Journalist. Sehr engagiert.«
»Könnte es sein, dass er ein bisschen zu engagiert war?«
»Ich weiß es nicht. Fragen Sie in der Redaktion.«
»Haben Sie die Polizei über sein Verschwinden informiert?«
»Nein. Die Eltern von Heinz haben das gemacht. Es war auch einmal ein Polizeibeamter bei mir. Aber die haben noch nichts herausgefunden.«
»Darf ich mir sein Arbeitszimmer anschauen?«
»Klar. Können Sie einen Computer bedienen?«
»Ja. Aber nicht immer so, dass er das macht, was ich gerne von ihm möchte.«
Sie ging voran. Die Wände des Arbeitszimmers waren vollgeklebt mit Notizzetteln und einzelnen Seiten aus Zeitungen und Zeitschriften. Frau Blattmann stellte den Computer an. Sie zeigte mir den Ordner, in dem der Journalist seine Texte abgelegt hatte. Ich bat sie, mir die zuletzt verfassten Texte auszudrucken und mir den Ordner auf Diskette zu kopieren. Gemeinsam durchsuchten wir seine Notizen, stießen aber auf keinen brauchbaren Hinweis. Ich schaute mich routinemäßig noch ein wenig um. Das Arbeitszimmer gab nichts her.
»Wie steht es mit seinen Freunden? Hatte er welche?«
»Nicht viele. Sie können sich sein Verschwinden auch nicht erklären.«
»Hatte er ein bevorzugtes Reiseziel? Vielleicht ein Land, das er schon immer mal bereisen wollte?«
»Nein. Heinz reist nicht gerne. Er sagt, er sei schon beruflich genug unterwegs.«
»Hatte er Träume? Von einem anderen Leben?«
»Vielleicht. Er hat mir nie von seinen Träumen erzählt.«
Sie sah traurig auf Heinz Imbodens Arbeitsstuhl. Ihr war wohl erst in den vergangenen Wochen klar geworden, wie wenig sie von ihrem Lebenspartner wusste. Da lebt man tagein, tagaus zusammen, redet, streitet, freut und liebt sich, und doch bleibt immer ein unerreichbarer Rest an Fremdheit. In meinem Beruf wird man ständig mit Leuten konfrontiert, die sich nicht erklären können, weshalb der Mensch an ihrer Seite, den sie so gut zu kennen vermeinen, plötzlich Dinge tut, die ihnen die Haare zu Berge stehen lässt. Frau Blattmanns nachdenkliches Gesicht verriet mir, dass sie einiges ahnte oder befürchtete. Doch sie wollte nicht darüber reden. Plötzlich erwachte sie aus ihrer Apathie und eilte ins Nebenzimmer. Sie kam mit einer Visitenkarte in der Hand zurück.
»Das ist die Redakteurin, für die Heinz regelmäßig gearbeitet hat.«
Ich bedankte mich und verließ Frau Blattmann. Ehe sie die Tür zumachte, horchte sie im Treppenhaus wieder auf irgendwelche Geräusche. Es war ruhig.
Ich suchte eine Bar in der Nähe ihrer Wohnung und fand einen düsteren Schuppen, der den stolzen Namen Majesty trug. Außer mir war nur noch ein junger Bursche in Anzug und Krawatte in der Bar. Er nippte an einem dänischen Bier und las Zeitung. Ich bestellte mir einen Kaffee und war froh, den üblen Geschmack von Frau Blattmanns aufgebrühten Kaffee-Ersatz runterspülen zu können. Ich schaute mir die Artikel an, die der Journalist vor seinem Verschwinden auf dem PC geschrieben hatte. Es waren ziemlich abenteuerliche Texte. Offenbar war er mehreren Geschichten gleichzeitig nachgegangen. Auf über fünf Seiten hatte er lauter Fragen und Spekulationen notiert. Da stand unter anderem:
B. mehrfach in Italien. Zahlungen auf geheimes Konto in Z. Kontakte zu F. Schmiergeld? W. geht keiner geregelten Arbeit nach. Behauptet, von ein paar konservativen alten Herren unterstützt zu werden. Geheimloge? P. bei Prozess mit verbaler Kraftmeierei aufgefallen. Beschimpfte FK. Morddrohungen? Ist P. gefährlich oder bloß ein »Schnurri«?
Im gleichen Stil ging es weiter. Mich erstaunte, dass der Kerl den Überblick behalten konnte in diesem abstrusen Durcheinander von Ps, Ws, Fs und As. Es schien, als gehörte er zu der Sorte von Journalisten, die ständig davon träumen, den großen Skandal ans Tageslicht zu bringen. Ich schaute mir auch einige der Texte an, die er veröffentlicht hatte. Sie waren alle nach dem gleichen Muster gestrickt: Ein kleinerer Skandal bietet Anlass, ein paar unangenehme Fragen zu stellen und darüber zu spekulieren, ob eventuell eine noch viel größere Schweinerei hinter allem steckt. Damit kann man Auflage und sich selbst einen Namen machen. Vermutlich war er für die Menschheit kein großer Verlust. Ich dachte an Frau Blattmann in ihrer riesigen Wohnung. Sie tat mir leid. Sie wirkte darin wie eine kleine Pflanze, die in einem zu großen Blumentopf zu wenig Sonne abbekam. Ich bezahlte und machte mich auf den Weg zu der Wochenzeitung, für die Imboden gearbeitet hatte. Die zuständige Redakteurin hüpfte barfuß auf mich zu. Ihre Wangen waren gerötet wie Kinderwangen auf einer Packung Vitaminbonbons. Sie wusste weder wohin mit ihrem Blick noch gelang es ihr, einigermaßen locker dazustehen. Es gibt eine Unsicherheit bei anderen Menschen, die einen selbst verunsichert. Ich knurrte etwas vor mich hin und setzte mich auf einen alten Bürostuhl, während die Redakteurin an ihren Haaren zupfte.
»Ja. Heinz war einer Story auf der Spur.«
»Und was für einer Story?«
»Genaueres wollte er mir nicht sagen. Er war auf alle Fälle hinter einem Fascho her. Ich glaube, er wollte ihn porträtieren.«
»Die alte Leier. Ihr gebt den Leuten eine Plattform, und wenn diese dann ausgenutzt wird, beklagt ihr euch darüber, dass diese Idioten immer lauter das Maul aufmachen.«
»Man kann das nicht einfach totschweigen.«
»Nein. Aber man braucht auch nicht ständig laut darüber zu reden.«
»Wir diskutieren in der Redaktion immer wieder über solche medienpolitischen Dinge. Gerade letzte Woche hatten wir ein Seminar, in dem wir uns mit dem Rassismus in uns allen befasst haben.«
»Das glaube ich Ihnen gerne. Wie heißt der Kerl, hinter dem Heinz her war?«
»Mischler. Josef Mischler. Ein unsäglicher Typ.«
»Ist er gefährlich?«
»Schwer zu sagen. Diese Leute sind doch als Individuen nichts wert. Die werden erst in der Gruppe zu Monstern.«
Sie begann über Rechtsradikale zu reden und ich wusste schon nach den ersten beiden Sätzen, dass die gute Frau zu der Sorte von Redakteurinnen gehörte, die den lieben langen Tag am Schreibtisch sitzen, telefonieren und sich darüber beklagen, dass ihnen die Zeit fehlt, um vor Ort zu recherchieren. Doch wenn sie Zeit dazu haben, telefonieren diese Leute mit der halben Welt, nur um beispielsweise herauszufinden, dass das Wetter in New York auch nicht so toll ist. Ich hörte ihr eine Weile zu und ärgerte mich darüber, dass ich zu müde war, um ruckartig aufzustehen und ihr mit einer alten Schreibmaschine, die herumstand, den Mund zu stopfen. Sie hätte am nächsten Tag garantiert eine Gefahrenzulage bei ihrem Personalchef verlangt. Zu allem Überdruss erschien ein männlicher Kollege der Redakteurin, der diese offenbar anhimmelte. Er fragte sie irgendeinen Schwachsinn, der nur dazu diente, ihre Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Sie gab brav Auskunft und stellte mich vor. Der Kerl wollte von mir wissen, wie es in meinem Beruf laufe angesichts der Rezession. Schon die Formulierung »angesichts der Rezession« trieb mich zur Weißglut. Der Kerl sah aus, als würde er täglich eine Rolex verspeisen und mit Flüssiggold nachspülen. Ich sagte ihm, dass es wunderbar laufe, und drehte meinen Oberkörper demonstrativ weg. Der Kerl ließ nicht locker. Er wollte wissen, ob mein Job gefährlich sei. Ich grinste und zeigte ihm eine Narbe auf meinem Bauch. Ich verschwieg ihm, dass darunter einmal mein Blinddarm war. Er zeigte sich beeindruckt, doch auch das hielt ihn nicht davon ab, weitere dämliche Fragen zu stellen. Seine Kollegin machte große Augen, und langsam begriff ich, dass ich hier in eine Zweierkiste geraten war, die sich vermutlich schon eine Ewigkeit hinschleppte, ohne dass einer der beiden die entscheidende Einladung ausgesprochen hatte. Ich fand, dass die beiden in ihrer fürsorglichen Beschränktheit gut zusammenpassten, und drückte dem Mann ein Kondom in die Hand, das ich für dringende Fälle in meiner Jackentasche aufbewahrte. Er schaute mich verdutzt an.
»Ist das ein Gag?«
»Nein. Eine kleine Aufmerksamkeit. Ich finde, ihr solltet euch zusammentun und ein wenig Spaß haben. Angesichts unser aller Zukunft fände ich es allerdings ratsamer, ihr würdet darauf acht geben, dass ihr eure Gene nicht weitergebt. Da kommt kaum etwas Gescheites dabei heraus.«
»Das ist ein Gag! Hast du gesehen? Der Kerl ist toll!«
Er begriff nichts, und seine Kollegin wurde knallrot. Ich verließ die Redaktionsräume. Draußen atmete ich tief durch.
3
Josef Mischler lebte außerhalb der Stadt in einer hässlichen Reihensiedlung mit winzigen Häusern, in denen jeweils zwei Familien gehalten werden. Er war eine massige Erscheinung mit einem wilden, ungepflegten Bart und Augen, die sich tief in die Höhlen zurückgezogen hatten. Er begrüßte mich missmutig mit einer tiefen und viel zu lauten Bassstimme. Sie passte vorzüglich zu der Gattung von Hauswarten, vor denen sich die Kinder am meisten fürchten. Er wollte mich nicht in die Wohnung lassen. Ich fragte ihn nach dem Journalisten. Seine Halsschlagader schwoll an und sein Unterkiefer schob sich nach vorne.
»Dieser Kerl will mich fertigmachen.«
»Das dürfte gar nicht so leicht sein, angesichts der Polster, die Sie mit sich herumschleppen.«
»Sind Sie auch einer dieser linken Journalisten?«
»Ich glaube, man braucht kein linker Journalist zu sein, um Leute wie Sie ekelhaft zu finden. Ich bin Privatdetektiv und suche eine vermisste Person.«
»Ich bin ein Patriot. Mehr nicht. Ich habe mich immer für dieses Land eingesetzt. Ich möchte, dass dieses Land auch in Zukunft noch so ist, wie ich es gerne habe: meine Heimat. Unsere Heimat.«
»Dagegen ist nichts einzuwenden.«
»Sie haben doch tagtäglich mit Verbrechen zu tun. Ist das alles nicht viel schlimmer geworden, seit diese Ausländer ungehemmt in unser Land kommen können? Gibt es nicht unter den Ausländern viel mehr Kriminelle? Sitzt bei denen das Messer nicht lockerer in der Hand?«
»Ein bisschen viele Fragen auf einmal. Ich unterscheide grundsätzlich zuerst einmal zwischen Klienten und Nichtklienten und dann unter Idioten und Nichtidioten. Mir ist es ziemlich egal, was für ein Pass ein Idiot besitzt. Ich bin schließlich kein Zollbeamter.«
»Wissen Sie, ich habe geschworen, dass kein Ausländerfreund die Schwelle zu meiner Wohnung übertritt.«
»Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein erstrebenswertes Privileg ist. Aber lassen wir das.«
»Sie sagten, Sie suchen eine vermisste Person. Ist es dieser Journalist?«
»Genau.«
»Er wollte mit mir reden. Stundenlang. Er sagte, er wolle meine Motivation kennenlernen, meine Vergangenheit. Ich mag das nicht, wenn man in meiner Seele bohrt.«
»Sie billigen sich immerhin eine Seele zu. Das ist doch ein guter Ansatz zur Besserung.«
»Ich bin vielleicht nicht so schlagfertig wie Sie und diese Journalisten, aber ich hatte es auch nicht leicht in meiner Jugend. Ich musste meinen Eltern helfen. Da hatte ich nicht viel Zeit für die Schule. Und dann kam dieser Unfall. Ich habe jede Nacht Schmerzen. Können Sie sich das vorstellen?«
»Sie hadern mit Ihrem Schicksal. Das ist Ihr gutes Recht. Ich ziehe es allerdings vor, mir Ihre Krankengeschichte nicht weiter anzuhören. Sie wissen also nicht, wo sich der Journalist zurzeit aufhält?«
»Keine Ahnung. Vielleicht hat ihn einer seiner Ausländerfreunde abgestochen. Oder er ist mit einer dieser asiatischen Nutten durchgebrannt.«
Der Kerl war durch und durch unsympathisch. Der Prototyp eines Fremdenhassers. Vermutlich war sein Name in den Adressenkarteien aller Talk-Shows zu finden. Gefundenes Medienfutter.
Ich ging zurück in mein Büro und schaute die Notizen des Journalisten noch einmal durch. Ein M war gut ein Dutzend Mal darin zu finden. Ich schrieb mir alle Bemerkungen zu M heraus. Es waren nicht allzu viele:
Ms Jugend düster. Will nicht darüber reden. Wurde er als Kind missbraucht? Eventuell unehelich? M als Chef einer Nazipartei? Ab und zu Reisen nach Deutschland. Kaum Besuche. Einzelgänger. Frau verließ ihn vor fünfzehn Jahren. Will nicht über M sprechen. Hat M sie vergewaltigt? M behauptet, über Geheimpläne des Bundesrates informiert zu sein. Man wolle Leute wie ihn abservieren. Alle echten Patrioten. M wirkt manchmal verstört. Schizophrenie? Muss Ms Vertrauen gewinnen, ekle mich gleichzeitig davor. Bin ich von M fasziniert? Erinnert mich M an meinen Vater, der gerne so sein möchte wie M, sich aber nicht getraut, den Mund aufzumachen? Hat M etwas mit C zu tun? C bei M gesehen. Seltsam.
Ich wusste nicht, was die letzten Sätze zu bedeuten hatten. Der Journalist hatte sie vier Tage vor seinem Verschwinden in den Computer getippt. Wer war C? Offenbar kannte der Journalist C und war darüber erstaunt, ihn bei Mischler zu finden. Ich nahm aus der linken Schublade meines Schreibtisches eine Flasche Whisky. Ich trank einen Schluck und suchte dann in der Schublade nach einem alten Notizblock, den ich vor über zwei Jahren mit einem anderen Fall vollgekritzelt hatte. Damals spielte ebenfalls ein Journalist eine wichtige Rolle. Mir fiel der Name einer jungen Frau ein, die damals in dem Fall recherchierte. Wir hatten uns noch einige Male getroffen, aber es wurde nichts aus uns, obwohl sie mich mächtig beeindruckt hatte, und das will etwas heißen. Ich rief sie an und war erstaunt, dass ich schon nach dem ersten Tuten ihre Stimme im Ohr hatte. Das Telefon kann nicht nur Kilometer, sondern auch Jahre überbrücken und hat den Vorteil, dass man nicht sieht, wie sich jemand verändert hat. Vielleicht waren Marisa, so heißt sie, inzwischen die Haare ergraut oder sie hatte sich das Gesicht mit schlechtem Make-up verstümmelt.
»Philip? Kaum zu glauben, dass ich noch einmal etwas von dir höre.«
»Das klingt, als hättest du schon lange mit meinem Ableben gerechnet.«
»Na ja, so schlimm wird es wohl nicht sein. Ich habe gelesen, dass selbst saufende Detektive locker sechzig werden können.«
»Gut zu wissen.«
»Was möchtest du von mir wissen?«
»Alles über einen Kollegen von dir. Heinz Imboden.«
»Was ist mit ihm?«
»Verschwunden seit vier Wochen. Spurlos.«
»Das gibt es doch nicht!«
»Doch, doch, so etwas gibt es, schöne Frau. Kennst du ihn?«
»Ich habe ihn … warte mal, das muss wenige Tage vor seinem Verschwinden gewesen sein. Ich habe ihn zufällig in der Stadt getroffen. Er sagte, dass er hinter einer Geschichte her sei. Klang ziemlich spannend.«
»Komm schon, raus damit. Alte Männer werden immer ungeduldiger.«
»Ich weiß nichts Genaues. Er sagte nur, dass es eine Erpressungsgeschichte sei.«
Es mag ein wenig merkwürdig klingen, aber diese Worte summten wie der schönste gregorianische Choral in meinen Ohren. Ich bedankte mich überschwänglich für die Auskunft und las die Notizen des Journalisten noch einmal durch. Nichts von Erpressung, keine Anhaltspunkte. Aber jetzt gab es zumindest einen Hinweis darauf, weshalb der Journalist vielleicht doch nicht ganz freiwillig verschwunden war. Ich rief den Mann an, der den Journalisten zuletzt gesehen hatte. Es war ein durch und durch unnützes Gespräch. Der Mann war geschwätzig und offenbar überaus stolz, in einem Kriminalfall, wie er es nannte, eine so wichtige Rolle zu spielen. Der Journalist hatte sich mit ihm über Politik unterhalten, nichts Konkretes; Tagesgeschehen. Der Zeuge laberte mir die Ohren voll, indem er minutenlang beschrieb, wie auffallend nervös der Journalist gewesen sei, angespannt. Ich hörte zu und dachte an etwas anderes.
4
Ich besuchte meine Kollegin im unteren Stockwerk. Sie saß vor einem tragbaren Computer und tippte wild darauf herum. Ich setzte mich auf einen Stuhl und schaute ihr ein wenig dabei zu.
»Ich bin gleich so weit.«
»Lassen Sie sich Zeit. Sie bezahlen.«
»Haben Sie schon etwas?«
»Es könnte sein, dass der Journalist in eine Erpressungsgeschichte verwickelt war.«
Sie hörte auf zu tippen und lachte laut vor sich hin. Ich verzog meinen Mund und klatschte Beifall. Sie hörte auf zu lachen.
»Tut mir leid. Aber mir fiel gerade ein, was eine Freundin von mir einmal gesagt hat: Willst du dir eine ganz spezielle Krankheit holen, dann gehe zu einem Spezialisten.«
»Tolle Sprüche hat Ihre Freundin drauf. Sie sollte es einmal in der Werbung versuchen. Als lila Kuh oder etwas Ähnlichem.«
»Wissen Sie, meine Freundin hatte lange Zeit Probleme mit der Atmung. Sie ging zu zwei verschiedenen Spezialisten. Der eine diagnostizierte Hyperventilation, der andere eine Stauballergie. Spezialist Nummer eins hatte eine Doktorarbeit über Hyperventilation geschrieben, und der andere …«
»Toll. Und was hat das mit der Erpressergeschichte zu tun?«
»Na ja. Jeder Fall eines Verschwundenen wird bei einem Privatdetektiv zum Verbrechen. Das haben Fachidioten so an sich.«
Die Frau war nicht übel. Sie tippte wieder auf dem Computer, murmelte etwas von »speichern« und schaltete dann das Ding ab. Sie trug ihre Haare jetzt offen. Eine Locke fiel ihr bis über die linke Augenbraue. Sie stand auf und gab mir ein paar Papiere, auf denen Diagramme zu sehen waren, sonst nichts. Ich konnte nicht viel damit anfangen.
»Ich habe die Schrift des anonymen Postkartenschreibers analysieren lassen. Scheint tatsächlich ein alter Mann zu sein.«
»Was denn? All diese Diagramme dienen nur der Feststellung, dass der Schreiber ein alter Mann ist? Das hätte ich Ihnen auch ohne Diagramm sagen können.«
»Aber jetzt ist es bewiesen.«
»Und wie steht es mit dem Poststempel?«
»18 Postkarten, 18 mal ein anderer Poststempel.«
»Wunderbar. Da haben Sie die Lösung ja schon vor sich.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Glauben Sie, dass der Mann ein gewisses Maß an Intelligenz hat?«
»Ja, allerdings. Sein Sprachstil deutet darauf hin, dass er gebildet ist.«
»Wetten, dass einer der Poststempel der richtige ist?«
»Und wieso sollte er dieses Risiko eingehen?«
»Er verschickt 18 Postkarten. Vermutlich gedenkt er auch weiterhin Postkarten zu verschicken. Er möchte nicht, dass man ihm auf die Schliche kommt. Doch er weiß, mit jeder Postkarte wird das Risiko größer. Denn er kann natürlich immer wieder neue Orte wählen, um die Karten einzuwerfen. Doch wie soll er vorgehen? Logisch? Also zum Beispiel jede Ortschaft nur einmal vorkommen lassen und immer wieder in andere Kantone wechseln? Oder chaotisch? Nach Zufallsprinzip eine Ortschaft auswählen? Ein Problem bleibt, egal, wie er vorgeht: der Ort, in dem er lebt. Wenn er ihn ganz weglässt, kommt irgendwann der Gedanke in ihm auf, dass er sich verrät, gerade weil er diesen Ort systematisch auslässt, also kommt er auf die Idee, schon relativ früh eine Karte aus diesem Ort zu schicken.«
»Nicht schlecht. Aber wenn er tatsächlich so intelligent ist, wie wir annehmen, müsste er doch genau diesen Gedankengang von Ihnen vorausahnen. Nicht wahr, Maloney? Einmal davon abgesehen, dass er zwischen über 4600 Ortschaften wählen könnte.«
»Trotzdem mache ich jede Wette, dass es einer der 18 Orte ist, aus denen er schon geschrieben hat. Je intelligenter jemand ist, umso mehr Mühe hat er, sich dem Zufall hinzugeben. Intelligente Menschen mögen den Gedanken nicht, dass das Prinzip der Wahrscheinlichkeit so gut funktioniert. Sie sind ständig auf der Suche nach einem sicheren System. Und übersehen dabei, dass zum Beispiel das sicherste System für ein Verbrechen häufig der pure Zufall ist. Alles, was durchdacht ist, kann von anderen nachvollzogen werden. Nur Idioten und Verrückte sind schwer zu durchschauen. Wenn Ihr Mann intelligent ist, stammt eine der Karten aus dem Ort, in dem er lebt.«
»Aber wonach soll ich suchen? Nach einem alten Mann? Davon gibt es eine ganze Menge in der Schweiz.«
»Es deutet alles darauf hin, dass er eigentlich möchte, dass diese junge Frau ihn entdeckt. Vielleicht ist er ja tatsächlich ihr Vater. Vielleicht ist er aber auch ein alter Narr, der sich romantischen Phantasien hingibt.«
Ich drückte ihr die Diagramme wieder in die Hand. Sie öffnete eine Schublade und nahm eine Packung Gummibärchen hervor. Sie hielt sie mir hin. Ich lehnte angewidert ab. Sie verschlang mehrere davon. Ich erzählte ihr von meinem Besuch bei der Freundin des Journalisten und bei Josef Mischler. Dann erzählte ich ihr von der Erpressungsgeschichte. Jasmin Weber hörte aufmerksam zu, verzog manchmal ihr Gesicht und kippte noch mehr Gummibärchen in ihren kleinen Mund.
»Vielleicht ist er einer dieser Angeber, die den Mund allzu voll nehmen.«
»Apropos: Sind nicht schon Leute an den Dingern erstickt, Jasmin?«
»Wenn allerdings was dran ist an der Erpressungsgeschichte, dann könnte ihm etwas zugestoßen sein. Haben Sie Frau Blattmann schon informiert?«
»Nein.«
»Dieser Mischler. Ist er gefährlich?«
»Möglich. Er lässt ganz schön Dampf ab. Vielleicht hindert ihn das daran, einmal richtig zuzuschlagen. Aber bei den Typen weiß man nie. Man müsste ihn im Auge behalten. Es ist durchaus möglich, dass er in die Erpressungsgeschichte verwickelt ist.«
»Das klingt alles ziemlich vage.«
Sie kaute noch eine Weile auf ihren Gummibärchen herum, während ich ihr Arsenal an moderner Elektronik bewunderte. Ich versprach ihr, mich weiter um den Fall zu kümmern, und ging nach oben in mein Büro. Unterwegs begegnete ich auf der Treppe einem jungen Mann, der sich verstohlen umsah und mit gebeugtem Kopf die Namen auf den Türschildern las. Offenbar war ihm der Gang durch das Haus peinlich. Ich überholte ihn; er gab keinen Ton von sich.
In meinem Büro stank es nach Teppichleim. Mein Nachbar hatte über Nacht einen neuen Spannteppich verlegt. Der Mann war um die vierzig und hatte eine hässliche Brandnarbe auf der Stirn. Er verließ seine Wohnung nur ganz selten, und in all den Jahren, in denen er schon neben meinem Büro wohnte, hatte ich nie herausgefunden, ob er arbeitete. Ich hatte auch nie jemanden gesehen, der ihn besuchte. Er grüßte immer freundlich, aber es war nie eine Aufforderung, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Nur ein einziges Mal hatte ich ihn fröhlich erlebt. Er war betrunken und hangelte sich die Treppenstufen hoch. Dabei sang er ein uraltes Seemannslied von der Sorte »Meine Braut ist die See«. Er öffnete versehentlich die Tür zu meinem Büro und entschuldigte sich überschwänglich. Ich erfuhr später, dass an diesem Tag das Begräbnis seiner Mutter gewesen war. Seither sah ich ihn nie mehr betrunken; er lachte auch nicht mehr.
Ich öffnete das Fenster und atmete tief durch. Ein Flugzeug donnerte viel zu tief über die Stadt. Von weit her hörte man quietschende Bremsen, gegenüber drehte sich ein Kran beinahe lautlos in einem Halbkreis. Die Stadt dampfte träge in die Nachmittagshitze. Als ich mich umdrehte, stand der junge Mann, den ich im Treppenhaus überholt hatte, in meinem Büro. Er schaute verlegen auf den Boden, so als würde er eine giftige Spinne beobachten, die uns beide jederzeit hätte angreifen können. Ich begrüßte ihn und zeigte auf den Stuhl, der neben dem Mann stand. Er nickte, setzte sich aber nicht.
»Sind Sie Philip Maloney?«
»Allerdings.«
»Ich heiße Bauer. Carlo Bauer.«
»Sind Sie angemeldet?«
»Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass …«
»Schon gut. Kleiner Scherz. Ist Ihnen Ihre Freundin davongelaufen?«
»Nein. Ich habe keine Freundin.«
»Macht nichts. Kaufen Sie sich einen schönen großen Fernseher und eine dieser Satellitenschüsseln. Da werden Ihnen täglich Hunderte von Freundinnen ins Haus geliefert.«
»Die Richtige wird schon noch kommen.«
»Ob richtig oder falsch, kommen wird sie auf alle Fälle. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein?«
»Ja. Ein Freund von mir ist gestorben.«
»Bedauerlich.«
»Er hatte einen Unfall. Ein Stromschlag.«
»Tja, die Elektrizität hat auch ihre Nachteile.«
»Die Polizei sagt, dass es ein Unfall war.«
Er schaute wieder zu Boden. Schweißperlen hatten sich auf seiner Stirn gesammelt. Er drückte mit der einen Hand den Zeigefinger der anderen gefährlich weit nach hinten. Das Sprechen schien ihm schwerzufallen. Ich ging um meinen Schreibtisch herum und holte eine Packung Kleenex aus einem Gestell. Er nahm sich eines und tupfte sich die Stirn ab. Der Mann war Mitte Zwanzig. Sein Körper hatte ziemlich alberne Proportionen, nichts passte richtig zusammen. Seine Beine waren zu kurz, sein Oberkörper lang und schmal, und über all dem thronte ein rundlicher Kopf mit zu großen Augen. Die Gesichtszüge waren kindlich, passten nicht zu der strengen Frisur, die nur dazu diente, die Haare möglichst kurz zu halten und sie mit Gel an die Kopfhaut zu pappen. Ich machte uns einen Kaffee. Carlo Bauer entspannte sich ein wenig.