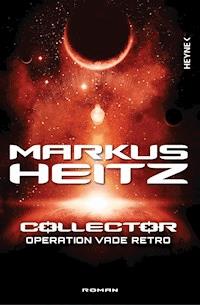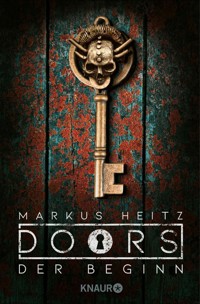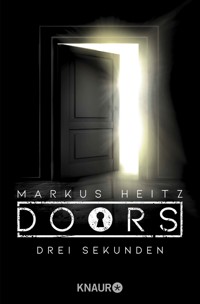0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fantastische Aussichten
- Sprache: Deutsch
Möchten Sie fantastische Romane lesen, die Sie in fremde Welten entführen? Haben Sie Lust mit Markus Heitz einen Pakt der Dunkelheit einzugehen und den Auftakt seiner Urban-Fantasy Reihe zu entdecken? Was genau hat es mit den Wundern der Familie Soria aus dem neuen Roman von Maggie Stiefvater auf sich? Wollen Sie mit Leigh Bardugo in magische Winternachtgeschichten aus der Welt der »Krähen« eintauchen und damit die Wartezeit bis zum Erscheinen von »Das Gold der Krähen« verkürzen? Fiebern Sie gern mit Außenseitern mit, die trotz aller Widerstände ihren Weg gehen? Gibt es Wartezeiten zu überbrücken, bis der neue Roman ihres Lieblingsautors erscheint? Oder ist es einfach mal wieder Zeit für eine Auszeit vom Alltag und damit für ein magisches Buch? Dann sind die Fantastischen Aussichten, die Leseproben-Sammlung zu den Fantasy- und Science Fiction-Titeln des Knaur Verlages, genau das Richtige für Sie. Das kostenlose eBook enthält Leseproben zu: - Markus Heitz »Ritus« - Diana Wynne Jones »Fauler Zauber« - Maggie Stiefvater »Wie Eulen in der Nacht« - Leigh Bardugo »Die Sprache der Dornen« - Daniel H. Wilson »Die Dynastie der Maschinen« - Patrick S. Tomlinson »The Colony – Ein neuer Anfang«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Markus Heitz / Diana Wynne Jones / Maggie Stiefvater / Leigh Bardugo / Patrick S. Tomlinson / Daniel H. Wilson
Fantastische Aussichten:Fantasy & Science Fiction bei Knaur
Ausgewählte Leseproben vonMaggie Stiefvater, Markus Heitz, Leigh Bardugo, Diana Wynne-Jones, uvm.
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Möchten Sie sich in fremde Welten entführen lassen? Wollen Sie weitere Geschichten von Leigh Bardugo aus der Welt der sechs Krähen erleben? Sind Sie mutig genug, sich von Markus Heitz in eine düstere Welt entführen zu lassen? Sind Sie auf der Suche nach einem märchenhaften Wunder in einem düsteren Dorf?
Warten Sie darauf, dass der neue Roman Ihres Lieblingsautors erscheint? Oder möchten Sie einen Blick in unser Herbstprogramm 2018 erhaschen? Dann ist diese Leseproben-Sammlung genau das Richtige.
Vorableseproben zu den Fantasy-Titeln des Knaur-Verlages, die im Herbst 2018 erscheinen.
Das kostenlose eBook enthält Leseproben zu:
- Leigh Bardugo »Die Sprache der Dornen«
- Markus Heitz »Ritus«
- Dianna Wynne Jones »Fauler Zauber«
- Maggie Stiefvater »Wie Eulen in der Nacht«
- Daniel H. Wilson »Die Dynastie der Maschinen«
- Patrick S. Tomlinson »The Colony – ein neuer Anfang«
Inhaltsübersicht
Markus Heitz
Ritus
Diana Wynne Jones
Fauler Zauber
Maggie Stiefvater
Wie Eulen in der Nacht
Leigh Bardugo
Die Sprache der Dornen
Daniel H. Wilson
Die Dynastie der Maschinen
Patrick S. Tomlinson
The Colony – Ein neuer Anfang
Markus Heitz
Ritus
24. Dezember 1764, das Dorf Chaulhac, Südfrankreich
Die Gipfel der drei Berge, des Montmouchet, des Montgrand und des Montchauvet, zierten eisige Kronen. Schnee hatte sich über die einsamen, bergigen Grasebenen des Gévaudan gelegt. Auch die dichten Birken- und Buchenwälder wurden von dem Weiß bedeckt, das nach einem kurzen Herbst unerbittlich aus den Wolken fiel. Brutale Stürme peitschten die Flocken mit solcher Wucht umher, dass es wehtat, wenn sie ins Gesicht trafen. Die Bewohner der Region wurden in den Schutz ihrer Häuser getrieben. Die robusten Gebäude aus grauen Granitsteinen ertrugen die schwere Last und gewährten Schutz in doppeltem Sinne. Denn auch ohne Schnee hätte sich kaum einer weit aus dem Dorf gewagt. Der Tod ging um. Er schlich auf vier Pfoten durch das Gévaudan, nahm sich auf bestialische Weise Frauen und Kinder. Niemand hatte ihm bislang Einhalt bieten können. Nur die Gemeinschaft vieler oder eine stabile Tür hielten ihn auf.
Jean Chastel saß in der Nähe der Tür des kleinen Gasthofs. Vor ihm stand eine Holzschüssel mit heißer Suppe, die so dünn war, dass er an den zähen Hammelstücken vorbei auf den Grund des Gefäßes schauen konnte. Dazu trank er einen heißen Gewürzwein, um sich die Kälte aus dem Leib zu treiben, die ihm nach einem Marsch von vier Stunden in den Knochen steckte. Seinen dicken Kutschermantel, den Schal und den Dreispitz hatte er neben die Feuerstelle gehängt, damit sie trockneten.
Obwohl die Stube fast bis auf den letzten Platz besetzt war, gesellte sich keiner zu dem Wildhüter, an dessen Tisch die beiden letzten freien Stühle standen. Er war ein Chastel, der Älteste der Familie, die einst einen guten Ruf besessen hatte. Das war schon lange nicht mehr so. Er galt als Sonderling, weil er zurückgezogen im Dorf La Besseyre-Saint-Mary lebte und keinen Hehl daraus machte, dass er mit anderen wenig zu schaffen haben wollte.
Über Antoine, der sich tief im Wald in seiner Hütte verkroch, grassierten schlimme Gerüchte. Jean konnte nicht verleugnen, dass sich sein jüngerer Sohn seit seinem Aufenthalt in Tunesien verändert hatte. Er sprach nicht darüber, weder über die Erlebnisse noch über die Umstände seiner Rückkehr. Jean hatte vom Moment des ersten Wiedersehens an gespürt, dass sich sein Sohn verändert hatte. Er war ein verschlossener, geheimnisvoller Mann geworden, der bei den Dorfbewohnern im Ruf stand, mit Tieren sprechen zu können.
Pierre hatte im Vergleich dazu Glück. Er lebte in Besset, von wo aus er mit Antoine das Amt des Wildhüters teilte, und galt als umgänglich. Wenigstens einer aus der Familie.
Die Tür wurde aufgestoßen. Der eisige Wind zwang zwei Dragoner in das Wirtshaus, die unter der dicken Schneeschicht kaum als Soldaten zu erkennen waren. Sofort wurde es leiser in der Schankstube.
Den Winter verfluchend, kamen sie direkt zu Jeans Tisch und warfen dem herbeieilenden Wirt ihre Umhänge zu. Darunter kamen die blauen, aufwendig gearbeiteten Uniformröcke zum Vorschein, deren Verzierungen, Abzeichen und Knöpfe schimmerten. Sie trugen jeder einen Säbel, ihre Pistolen steckten im Gürtel; die sperrigen Musketen trugen sie in der Hand. Auf den einfachen Bauern oder das eine oder andere Mädchen machten sie gewiss Eindruck.
Sie setzten sich unaufgefordert, zogen die Hüte ab, lehnten die Musketen an die Wand und verlangten laut nach einem Mahl. Es waren derbe, kräftige Kerle, gerade mal zwanzig Jahre auf dem Buckel, unrasiert, und sie rochen nach Branntwein, obwohl sie in dem Gasthof noch keinen Schluck getrunken hatten.
»Frohe Weihnachten. Ihr könnt gerne Platz nehmen«, sagte der Wildhüter, ohne sie genauer zu betrachten. »Doch sobald meine beiden Söhne erscheinen, darf ich euch bitten, einen anderen Tisch zu suchen.«
Die Dragoner wechselten einen amüsierten Blick. »Wir unterstehen Capitaine Duhamel. Wenn er uns befiehlt aufzustehen, tun wir das«, antwortete ihm einer herablassend. »Sonst nicht.«
»Hat euch der König nicht den Befehl gegeben, den Wolf zu erlegen?«, erwiderte Jean unbeeindruckt und löffelte weiter seine Suppe. »Da ihr hier seelenruhig sitzt, scheint ihr ihn gefunden und getötet zu haben.«
Der Soldat zu seiner Rechten lehnte sich vor und blickte sich verschwörerisch um. »Das ist kein Wolf. Selbst der Capitaine denkt inzwischen …« Ein Stoß seines Kameraden in die Rippen brachte ihn zum Verstummen.
»Was soll es sonst sein? Glaubt ihr die Geschichten von einer Bestie?«, erkundigte sich Jean. Nun fiel es ihm schwer, ruhig zu bleiben.
»Ich schon, Monsieur Chastel!« Ein Mann am Nachbartisch mischte sich ein; seiner ungewöhnlich bunten Kleidung nach gehörte er zur Entourage eines hiesigen Adligen. »Sie hat seit dem Sommer elf Menschen und zahlloses Vieh gerissen. Und ich kenne keinen Wolf, welcher dem Äußeren der Bestie auch nur annähernd ähnelt. Ich stand ihr im Oktober gegenüber, knappe zehn Schritte entfernt tauchte sie vor mir und meinem Freund auf. Groß wie ein Kalb, ein rötliches Fell, Klauen und Fänge, dass es einem Bären bange würde. Wir trugen unsere Gewehre mit uns und wollten für den Marquis d’Apcher jagen. Wir legten auf sie an, die Bestie fiel nach dem Schuss, stand aber wieder auf! Wir feuerten ein zweites Mal, und wieder erhob sie sich und rannte in den Wald.«
»Dann werdet Ihr sie nicht richtig getroffen haben«, meinte Jean und nahm einen Schluck vom Gewürzwein. Es passte ihm nicht, dass so viel über die Bestie gesprochen wurde.
»Ich bin Jäger und ein guter Schütze! Wir haben ihr alles in allem sechs Kugeln verpasst, Monsieur Chastel. Sechs!« Der Mann war gekränkt. »Die Blutspur war kaum zu übersehen. Und dennoch, als wir die Verfolgung aufnahmen, war die Bestie schneller als wir.« Er holte Luft und schaute in die gebannten Gesichter seiner Nachbarn. »Sie hat überlebt.«
»Ein verwundeter Wolf ist schlimm«, lautete Jeans Erklärung. »Er reißt alles …«
Der Mann schlug mit der Faust auf den Tisch, die Augen funkelten zornig. »Es war kein Wolf!«
»Habt ihr das von dem kleinen Mädchen in Rieutort gehört, Messieurs?«, fragte der Wirt, als er den Dragonern das Essen brachte. »Es kam allein von den Viehweiden, und seine Mutter sah es schon vom Dorfrand aus. Keine zweihundert Schritte hätte es mehr gebraucht, doch dann schlug die Bestie zu. Vor den Augen der Mutter und zwei Brüdern wurde es zerfleischt. Seine Reste waren kaum noch erkennbar.« Er deutete auf seinen Bauch. »Aufgeschlitzt, von oben bis unten. Die Kopfhaut war abgerissen und über das Gesicht gezogen. Schrecklich, schrecklich! Kein Wunder, dass dreitausendachthundert Livres Belohnung ausgesetzt wurden.«
»Still jetzt! Solch ein Geschwätz ist der wahre Grund für die Macht des Tiers«, herrschte ihn Jean an. »Die Leute haben vor diesem Wolf schon Angst genug. Bring mir lieber noch einen Gewürzwein.«
Nun stieg dem Wirt ein triumphierendes Lächeln ins Gesicht. »Ein Wolf? Nein, Chastel. Du als Wildhüter, sag mir: Man fand die Spuren der Bestie am Ufer eines nahen Bachs. Die Spuren erinnerten an die eines Wolfs, und doch waren sie anders. Die Ferse war eigentümlich hervorstehend und flach. Und man sah eindeutige Spuren von Krallen. Wie passt das zusammen?«
Jean schaute in seinen Suppenrest. »Du hast vergessen, Geschmack hineinzugeben. Dein Essen ist nicht besser als heißes Wasser.«
»Du kannst mich nicht ablenken.« Der Wirt blieb stehen. »Was für eine Kreatur ist das, Chastel?« Er lächelte herausfordernd. »Du weißt die Antwort nicht? Also glaubst auch du nicht an den Wolf! Wir haben vierundsiebzig von den Graupelzen erlegt, und dennoch tötet die Bestie immer noch.« Er senkte die Stimme. »Du bist das Kind einer Hexe, sagt man. Hat dir deine Mutter beigebracht, welche Dämonen es gibt, die aussehen wie die Bestie?«
»Ich sage dir, was ich denke: Die Spurenleser haben sich getäuscht, und ihr habt den richtigen Wolf noch immer nicht gefunden. Er ist ein Einzelgänger, der von den Rudeln gemieden wird. Wahrscheinlich ist er ein ehemaliger Leitwolf, der sich dem neuen Herrn der Sippe nicht unterwerfen wollte. Er wurde ausgestoßen, und seine Wut darüber lässt er an uns aus«, antwortete Jean und wandte sich dann an die beiden Dragoner. »Seid ihr zuvor jemals auf Wolfsjagd gegangen?« Sie schüttelten die Köpfe. »Capitaine Duhamel ist mit siebzehn Reitern und vierzig Fußsoldaten hier, und damit will er unsere Wälder, Ebenen und Berge absuchen? Das ist ein Gebiet von Hunderten Quadratmeilen. Das Gévaudan wird ihn auslachen! Es wird ihn mit seinen Nebeln verwirren, in den Wäldern mit falschen Wegen narren, in Sumpflöcher führen, zwischen den Ginsterbüschen und Gestrüppen im Kreis gehen lassen, aber niemals wird es euch gelingen, diesen Wolf zu fangen. Nicht auf diese Weise.« Aufgebracht erhob er sich, ging zum Kamin und warf sich seine Sachen über. »Ihr mögt Kriege führen, aber das hier ist keine Aufgabe für eine Handvoll Branntwein saufender Soldaten. Ihr und eure Treiber, die ihr aus dem Umland zusammentrommelt, werdet die Felder zertrampeln und die dürftige Ernte der Menschen in Gefahr bringen, mehr nicht.« Er warf ein paar Münzen auf den Tisch.
»Dann fang du die Bestie, Chastel«, rief der Wirt höhnisch. »Oder frag deinen Sohn. Der lebt doch wie ein Wilder. Er wird sie sicherlich verstehen. Vielleicht hat sie was zu ihm oder seinen verdammten Hunden gesagt?«
»Halt dein Maul«, erwiderte Jean drohend und hilflos zugleich.
Die Gäste steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. Unvermittelt war ein neues Gerücht geboren worden. »Oder hast du etwas mit ihr zu schaffen?«, rief einer. »Du reist in letzter Zeit viel durch die Gegend, erzählt man sich, Chastel.«
»Erzählt euch, was ihr wollt.« Jean hängte sich die Muskete um, schritt zu Tür und öffnete sie. »Wir werden sehen, wer sie erlegt.« Er wickelte sich den Schal um und zog ihn hoch ins Gesicht, stellte den Lederkragen seines Mantels hoch und stülpte den Dreispitz auf den weißen Schopf, dann ging er hinaus. Der Disput hatte eine zu gefährliche Wendung genommen.
Der Schneesturm hatte nachgelassen, aber die nächtliche Straße Chaulhacs blieb wie ausgestorben. Jean überquerte sie und lehnte sich gegen die raue Granitmauer eines Hauses, um auf seine Söhne zu warten. Zweifel nagten an ihm, und sein Gewissen machte ihm das Leben seit Juni zur Hölle. Denn im Juni war die Bestie in seiner Heimat aufgetaucht.
In der Nähe von Langogne war eine junge Kuhhirtin von diesem Wesen angefallen worden, aber die Bullen der Herde stellten sich schützend vor sie; die langen Hörner bewahrten die Frau vor einer zweiten, tödlichen Attacke der Bestie, und sie konnte entkommen. Ihre Kleidung war zerrissen, und sie trug einige Kratzer davon, aber sie behielt ihr Leben.
Nach ihrer Beschreibung der Bestie war Jean fest davon überzeugt, dass er und seine Söhne die Kreatur ins Gévaudan gelockt hatten. Es war ein Weibchen, so viel stand fest. Als sie sich – mit Pierre in ihrer Klaue – vor ihm aufgerichtet hatte, gab es nichts zu sehen, was auf ein Männchen schließen ließ. Für Jean war klar: Sie rächte den Tod ihres Gefährten, indem sie die Region heimsuchte, in der die Mörder lebten. Und sie rächte sich fürchterlich.
Er hatte Angst, dass die Wahrheit durch einen Zufall ans Licht käme: Er und seine Söhne trugen die Schuld an den Toten. Einen ersten Vorgeschmack hatte er eben im Gasthof bekommen. Um Schlimmeres zu verhindern und vor allem nicht den Hass der Menschen auf sich und seine unbeliebten Söhne zu ziehen, blieb ihm nur eins: Jean leugnete den Leuten gegenüber die Existenz des Biests und beeilte sich zugleich insgeheim, es zur Strecke zu bringen. Deshalb reisten er und seine Söhne umher, immer auf der fieberhaften Suche nach dem Wesen. Sicherlich, er mied die Menschen, doch er wünschte ihnen, bis auf einige Ausnahmen, nicht den Tod. Nicht diesen grausamen Tod.
An diesem Tag hatte er die Wolfsangeln in der Nähe des Dorfs kontrolliert und darin nichts weiter als einen zappelnden Fuchs gefunden, dem er mit seinem Jagddolch die Kehle aufschlitzte und das Fell abzog. Das Fleisch, die Innereien, das Blut hatte er rund um den Köder verteilt, um die Bestie anzulocken. Antoine und Pierre überprüften die weiteren Fallen in der Umgebung und sollten in Chaulhac zu ihm stoßen.
Zwei Gestalten kamen im Licht des Mondes die Straße herab auf ihn zugelaufen. Die größere der beiden trug ein Bündel auf den Armen; ihre Musketen hatten sie auf den Rücken geschnallt.
»Pierre, Antoine? Seid ihr das?« Er erkannte die Gesichter hinter den aufgestellten Kragen erst, als sie vor ihm standen. Dafür sah er das Blut, das als schwarze Flecken und Spritzer an ihren Kleidern haftete, sofort. Das Bündel, das der nach Atem ringende Pierre trug, ließ Jean die Suppe in der Kehle hinaufsteigen.
»Die Bestie hat Chaulhac ein Weihnachtsgeschenk gemacht«, sagte Antoine kaum berührt und drehte die Überreste des Knaben so, dass sein Vater sie besser sah. Die Bauchdecke war aufgerissen, es dampfte warm und feucht daraus hervor. Die Organe waren angefressen, von der Kehle fehlte ein großes Stück, und das Gesicht des Jungen bestand nur noch aus blutigen Fetzen. Arme und Beine wiesen dagegen keine Bissspuren auf. Offenbar hatte die Bestie den Knaben so gründlich überrascht, dass er keine Gegenwehr mehr leisten konnte.
Jean übergab sich, sein Mahl ergoss sich auf die verschneite Straße.
»Wir kamen zu spät«, berichtete Antoine mit ruhiger Stimme. »Ich habe ihn keine halbe Meile von hier auf offenem Feld gefunden. Um ihn herum lag Reisig, das er wohl gesammelt hatte. Bald darauf kam Pierre, und wir sind zurück ins Dorf, um dich zu holen und ihn seinen Eltern zu bringen.«
»Habt ihr den Verstand verloren?« Jean schaute sich eilends um; die Andeutungen aus dem Gespräch von eben hafteten noch zu gut in seinem Gedächtnis. Noch war niemand auf die drei Chastels aufmerksam geworden. »Was denkt ihr, was die Chaulhaciens sagen, wenn sie uns so auf der Straße sehen? Mit dem toten Jungen?«
»Was wohl? Dass die Bestie zugeschlagen hat.« Antoine blieb immer noch ruhig, die grünen Augen schauten fasziniert auf die Leiche.
Jean packte Pierre am Arm und zerrte ihn um die Ecke ins Dunkel. »Vielleicht. Aber vielleicht werden sie in ihrer Verzweiflung mir die Schuld geben. Da drin sitzen ein paar Idioten und zwei Dragoner Duhamels, denen es gefallen würde, ihrem Capitaine einen mutmaßlichen Mörder vorzuführen.« Er dachte angestrengt nach. »Wir bringen den Jungen wieder dorthin, wo ihr ihn gefunden habt«, entschied er. Es war besser, weit von Chaulhac entfernt zu sein, wenn sie den Knaben fanden. »Und dann folgen wir den Spuren der Bestie. Sie kann noch nicht allzu weit sein.«
Plötzlich gaben Pierres Knie nach; er sank gegen die Mauer und rutschte in den Schnee. Erst jetzt schien ihn der Schock des abscheulichen Anblicks zu treffen. Immer wieder starrte er den zerfleischten Leib des Jungen an – und seine blutigen Handschuhe und den Ledermantel, an dem die miteinander vermischten Körperflüssigkeiten herabliefen und in den reinen Schnee tröpfelten.
Sein Bruder Antoine zeigte nach wie vor keinerlei Regung. »Steh auf, Weiberherz.« Als Pierre nicht reagierte, riss er ihm die Leiche aus den Händen. »Hoch mit dir. Du hast gehört, was Vater sagte.«
Jean half Pierre auf die Beine und rieb ihm das blasse Gesicht mit eiskaltem Schnee ab, damit sein Verstand sich vom Schrecken losriss. »Du schaffst es«, sagte er eindringlich zu ihm. »Reiß dich zusammen.« Seine braunen Augen wanderten zu seinem Jüngeren, den er dabei ertappte, wie er an dem verstümmelten Körper schnupperte.
Antoine lächelte entschuldigend. »Dass ein Mensch kaum anders riecht wie ein geschlachtetes Schwein, hätte ich nicht gedacht«, versuchte er sein Verhalten zu erklären und drehte sich rasch zur Seite. »Seht nach, ob die Luft rein ist.«
Der Wildhüter ging voran und fragte sich beunruhigt, wo das abnorme Interesse seines Sohnes an der Leiche herrührte. Sicher, Antoine legte seit dem Aufenthalt in der Fremde ein seltsames Benehmen an den Tag. Aber das Schnüffeln an Leichen gehörte bislang nicht dazu.
Jean wusste, dass Antoine Kinder mehr mochte, als es erlaubt war. Er stellte den Mädchen nach, manchmal sogar den Jungen, und beobachtete sie heimlich; auch junge Frauen mussten sich seiner Zudringlichkeiten erwehren. Die kleine Marie Denty, ein junges Mädchen aus Septsol, das Jean wegen ihrer freundlichen Art ins Herz geschlossen hatte, fürchtete sich vor Antoine. Sie kam gerne zu Jean, in sein Haus in Besseyre, und schaute ihm beim Schnitzen zu oder begleitete ihn auf seinen Rundgängen durch den Wald. Er genoss das Zusammensein mit dem Mädchen, das ihn als Großvater betrachtete, und freute sich über das Vertrauen, das ihm Maries Eltern entgegenbrachten. Ein Lichtblick. Doch wenn sie Antoine begegneten, versteckte sich das Mädchen stets vor ihm und seinen Hunden.
Was hatte seinen Sohn werden lassen, wie er war? Der Dorfpfarrer hatte Jean auf die Frage nach dem Warum geantwortet, dass es eine Prüfung Gottes sei, aus der er und seine Familie gestärkt hervorgehen würden. Seitdem wollte Jean nichts mehr von einem Gott wissen, der ihn immer wieder ohne Grund leiden ließ. Seine Abkehr vom Kreuz machte ihn bei den Menschen nicht beliebter, was ihm im Gasthof erneut vor Augen geführt worden war.
Er verdrängte die Gedanken. »Kommt«, sagte er leise und eilte die Straße hinab, die sie aus Chaulhac hinausführte, während es erneut zu schneien begann.
Sie rannten, so schnell es eben ging. Erst als sie die wenigen Lichter des Dorfs hinter sich gelassen hatten, atmete Jean auf. Nun konnte nicht mehr allzu viel geschehen. Niemand hatte sie zusammen mit dem toten Knaben gesehen.
»Wir müssen hier entlang.« Antoine überholte seinen Vater und führte ihn zu der Stelle auf dem Feld, wo er und Pierre den grausigen Fund gemacht hatten. Er schaute unterwegs nicht ein einziges Mal auf den Boden, um nach den Spuren zu suchen. Anscheinend hatte er sich den Weg genau eingeprägt.
Als sie dort anlangten, legte er die Leiche des Jungen in die Kuhle und betrachtete versonnen, wie die Flocken auf dem inzwischen abgekühlten Körper liegen blieben und ihn mit einer feinen Decke versahen. In weniger als einer Stunde würde er nicht mehr als ein kleiner Hügel auf dem Feld sein. Glücklicherweise wären auch ihre eigenen Fußspuren und das Blut bald nicht mehr zu erkennen.
»Kommt. Wir haben keine Zeit zu verlieren.« Der Schnee zwang die Jäger zur Eile. Jean erkannte die Abdrücke der Bestie gerade noch gut genug, um ihnen in den nahe liegenden Wald zu folgen. Seine Söhne flankierten ihn mit gespannten Musketenhähnen und hielten sich bereit, auf die Bestie zu feuern. Doch es wurde dem erfahrenen Wildhüter alsbald klar, dass er sich die Suche sparen konnte. Die Flocken fielen viel zu dicht und verwischten die Fährte.
»Kehren wir nach Chaulhac zurück?«, fragte Antoine gähnend. »Es ist sehr spät, ich friere erbärmlich, und die Bestie bekommen wir nicht zu Gesicht. Ich kann ihre Spuren nicht mehr sehen. Wir hätten Surtout mitnehmen sollen. Er könnte sie aufspüren.«
»Der Hund bleibt in Ténazeyre, bei der übrigen Meute«, erwiderte Jean schroff. »Die Menschen reden schon genügend über uns.«
Pierre wirkte nicht weniger erschöpft, aber seine braunen Augen blickten entschlossen hinter dem eisüberzogenen Schal hervor. »Wir sind ihr dicht auf den Fersen«, wandte er sich an seinen Vater. »Lass nicht zu, dass wir morgen oder übermorgen von neuen Opfern hören. Es ist der Tag der Geburt des Herrn. Wir können ihn mit dem Tod eines Teufels feiern!«
Jean klopfte ihm auf die Schulter. »Lass es gut sein, Pierre. Dein Bruder hat recht, es bringt nichts. Und wer weiß, wohin uns die Morde der Kreatur morgen führen.« Er ging auf den Waldrand zu, um sich nach Lichtern umzusehen, die durch das fallende Weiß schimmerten; sie würden ihnen den Weg zu einem Gehöft weisen, in dem man ihnen bei diesem Wetter sicher zu übernachten erlauben sollte. Zurück in das kleine Dorf wollte er nicht mehr.
Pierre stapfte eilends durch den Schnee und stellte sich ihm in den Weg. »Vater, es ist unsere Pflicht!«, rief er energisch und riss den Schal herab. »Wir tragen die Verantwortung dafür, dass sie unter den Menschen wütet. Der Heiland wird uns am Tag des Jüngsten Gerichts noch härter strafen, wenn wir nicht alles tun, um unsere Schuld zu tilgen.«
Jean entgegnete nichts. Stattdessen deutete er auf ein helles Leuchten zwischen dem rieselnden Schnee und setzte sich an die Spitze des Zuges. Es würde keine weitere Diskussion geben. Antoine seufzte erleichtert, entspannte vorsichtig den Hahn seiner Muskete, schritt an seinem Bruder vorbei und folgte dem Vater.
Wütend trat Pierre in den Schnee. »Frohe Weihnachten, Bestie«, murmelte er, den Kopf in Richtung des dichten Unterholzes gewandt. »Mein Vater hat dir soeben das Leben geschenkt.« Er trottete hinter den beiden Männern her und glaubte zu fühlen, wie sich die leuchtend roten Augen ihres Feindes aus dem Schutz des Gebüsches in seinen Rücken bohrten. Pierre schauderte und sah sich ein letztes Mal um, konnte aber im Schneegestöber nichts erkennen.
München, 11. November 2004, 10:59 Uhr
Eric betrachtete das Bild an der Wand neben der mit schwerem Stoff bespannten Tür. Es war ein Kunstdruck von Caravaggios Falschspielern: Drei Gecken spielten Karten, zwei betrogen, um den dritten auszunehmen. Er fand es merkwürdig, dass ein Nachlassverwalter ausgerechnet dieses Werk eines der einflussreichsten Maler des italienischen Barocks in seinem Büro aufhängte. Sollte es eine Mahnung an die Erben sein?
Er versank tiefer in dem Sessel, den er mit dem Rücken zu einem großen Bücherregal geschoben hatte. Auf diese Weise behielt er beide Türen und das Fenster im Auge. Den weißen Lackledermantel hatte er trauergerecht gegen einen schwarzen Gehrock ausgetauscht. Lederhose, Stiefel und schwarzer Pulli machten ihn auf dem dunklen Polster beinahe unsichtbar.
In den gleichen Sachen hatte er vor einer Woche am Grab gestanden. Johann von Kastell war seit sieben Tagen unter der Erde. Seine Asche ruhte auf dem Münchner Waldfriedhof, die Beisetzung hatte im kleinsten Kreis stattgefunden. Im Grunde hatte Eric nicht ausgereicht, einen Kreis zu bilden, aber so lautete nun mal die Umschreibung für einsames Leben und einsames Begrabenwerden.
Sicher, einige Menschen wären gekommen. Er hatte aber darauf verzichtet, eine Todesanzeige zu schalten oder Einladungen zu verschicken. Infolgedessen kamen weder die entfernten Bekannten, die man nie vermeiden konnte, noch die Verwandtschaft mütterlicherseit, um an der Familiengruft pro forma um einen Menschen zu weinen, den sie niemals richtig gekannt hatte. Johann von Kastell hatte sie gelegentlich mit Geld unterstützt und an Feiertagen Päckchen geschickt. Mehr nicht. Er hatte seine Frau geliebt, nicht aber deren Eltern, Tanten, Onkel und Cousinen.
Aus der Familie von Kastell gab es niemanden mehr. Eric war seit der Nacht nach Allerheiligen der Letzte im gefährlichen Geschäft, das akut von der Auflösung bedroht war. Seinem Erbe. Oder zumindest dem bedeutenderen Teil davon. Um über den Rest informiert zu werden, saß er jetzt im Büro des Nachlassverwalters.
Am liebsten wäre er wieder gegangen, denn das Warten war nicht gut. Es erlaubte zu vielen Gedanken, durch die Mauer zu dringen, die er um sich errichtet hatte. Der Schmerz über den Verlust seines Vaters, die Ungewissheit, wer das Anwesen gesprengt hatte, die Frage, wie es nun weitergehen sollte.
Alles lag in Trümmern: das Haus, das Labor, sein Leben. Für ihn bestand kein Zweifel, dass die Beute zum ersten Mal den Spieß umgedreht und ihn tief in die Eingeweide der Jäger gerammt hatte. Noch fühlte sich Eric wie gelähmt, aber er wusste, dass die Jagd bald von Neuem beginnen musste.
Er fragte sich immer wieder, weswegen sein Vater allein zu Upuaut gegangen war. Seine Zeit als Kämpfer hatte er schon lange hinter sich gelassen, er war zum Denker des Teams geworden und konzentrierte sich auf die Nachforschungen – und die Wissenschaft. Der Gedanke an ein Heilmittel für die Seuche begann immer stärker, sein Leben zu beherrschen. Eric hingegen übernahm die weltweiten Einsätze. Er teilte die Begeisterung für Reagenzgläser und Medizin nicht, hatte sich aber dennoch damit beschäftigen müssen. So lautete die Forderung seines Vaters. Leider hatte er sich nicht genug damit beschäftigt – und stand nun hilflos da.