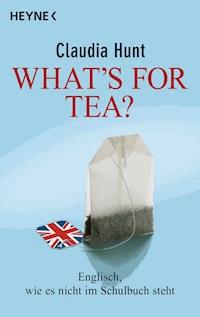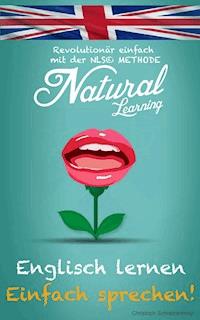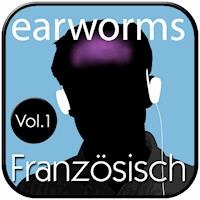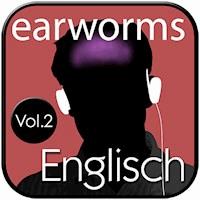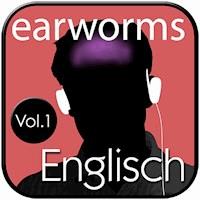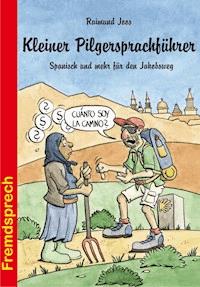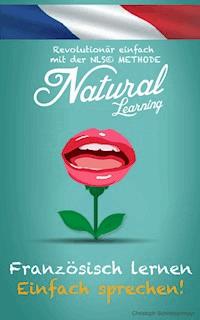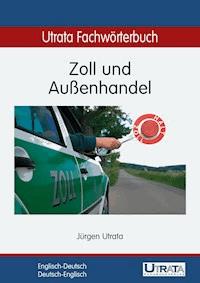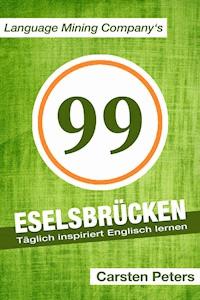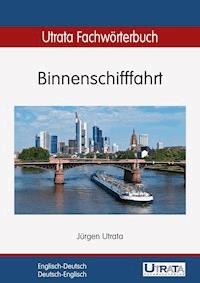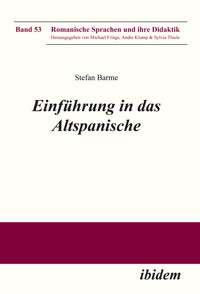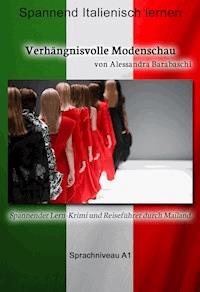Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fremdsprachen
- Sprache: Deutsch
FASTIGIA ist ein hervorragendes Übungsbuch für jeden, welcher sich bestmöglich auf die Latinums- oder Abiturprüfung in Latein vorbereiten und daher an originalen Prüfungstexten üben will. Demjenigen, welcher den Stoff noch nicht sicher beherrscht, bietet dieses Buch verschiedene Hilfsmittel: Jedem Prüfungstext ist eine möglichst wörtliche Musterübersetzung beigegeben, welche das Original deutlich durchschimmern läßt, die lateinischen Sätze und Formulierungen nachvollziehbar macht. Ein Kommentar bietet Erläuterungen zu Grammatik, Stilmitteln und Inhalt der einzelnen Texte. Besonders schwere oder ausgefallene grammatikalische Phänomene werden in einem Anhang genau erklärt, auf welchen in den Fußnoten jeweils verwiesen wird. Die Texte dieser Sammlung stammen von verschiedenen Prüfungsautoren wie insbesondere Cicero, Seneca, Livius oder Plinius und decken das gesamte Spektrum relevanter Formen und Stile ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FASTIGIA ist ein hervorragendes Übungsbuch für jeden, welcher sich bestmöglich auf die Latinums- oder Abiturprüfung in Latein vorbereiten und daher an originalen Prüfungstexten üben will. Demjenigen, welcher den Stoff noch nicht sicher beherrscht, bietet dieses Buch verschiedene Hilfsmittel: Jedem Prüfungstext ist eine möglichst wörtliche Musterübersetzung beigegeben, welche das Original deutlich durchschimmern läßt, die lateinischen Sätze und Formulierungen nachvollziehbar macht. Ein Kommentar bietet Erläuterungen zu Grammatik, Stilmitteln und Inhalt der einzelnen Texte. Besonders schwere oder ausgefallene grammatikalische Phänomene werden in einem Anhang genau erklärt, auf welchen in den Fußnoten jeweils verwiesen wird. Die Texte dieser Sammlung stammen von verschiedenen Prüfungsautoren wie insbesondere Cicero, Seneca, Livius oder Plinius und decken das gesamte Spektrum relevanter Formen und Stile ab.
Lucius Annaeus Senecio, geboren 1973 in Landshut/Bayern, studierte Altertumswissenschaften und Kunstgeschichte an der Universität Salzburg sowie Musikpädagogik am Salzburger Mozarteum. Er unterrichtet Latein, Altgriechisch, deutsche Grammatik und antike Philosophie an dem von ihm gegründeten Sprachinstitut Ad Fontes in Berlin. Seinen Schülern ist Senecio als klassischer Humanist unter den Sprachlehrern bekannt geworden, indem er nicht nur solide und fundierte philologische Kenntnisse mit Humanität und Witz vermittelt, sprachliche Phänomene eingängig enträtselt, sondern insbesondere auch an den kulturhistorischen Schätzen sowie der philosophischen Weisheit der antiken Geister als lebendigem Erbe des Altertums teilhaben läßt. Auf diesem Wege hat er bereits zahlreiche Schüler zum Latinum und Graecum geführt. In seiner Eigenschaft als Übersetzer hat Senecio unter anderem die Fabulae des Hyginus sowie die Epistulae Morales des Seneca ins Deutsche übertragen.
Inhalt
PROOEMIUM
PRÜFUNGSTEXTE
CICERO - Summum ius summa iniuria
SENECA - Quod licet bovi non licet Iovi
ERASMUS - Affekte als Teile des menschlichen Wesens
SENECA - Die Philosophie führt zur Glückseligkeit
LIVIUS - Hannibals Rede vor Scipio
CICERO - Das höchste Gut wird um seiner selbst willen erstrebt
LAKTANZ - Sämtliche Dinge sind auf einen Zweck hin ausgerichtet
SENECA - Nicht anderswo, sondern anders muß man sein
CICERO - Marc Anton präsentiert sich der Öffentlichkeit
CICERO - Cicero gegen Antonius und für die Tugend
QUINTILIAN - Ist Rhetorik eine Kunst?
SENECA - Von der Kürze des Lebens
CICERO - Über die Redekunst
SENECA - Über die Vorsehung
CICERO - Ausflug in Epikurs Garten
CICERO - Cicero befeuert die Römer ein letztes Mal zur Freiheit
TACITUS - Tiberius äußert sich zur Verschwendungssucht der Reichen
TACITUS - Germanen und Gallier vor den Toren Kölns
LAKTANZ - Die Geschichte Roms in Lebensaltern
QUINTILIAN - Hausunterricht oder Schulunterricht
SENECA - Die Ziele des Lebens
TACITUS - Verteidigung und Lob der Dichtkunst
PLINIUS - Titus Catius
OVID - Jupiter spricht zu den Olympiern über der Menschen Laster
OVID - Thisbe trauert über Pyramus‘ Leichnam
OVID - Fleischliche Liebe und Ehrbarkeit
OVID - Ratschläge
VERGIL - Jupiter beauftragt Merkur und sendet ihn zu Aeneas
VERGIL - Aeneas hemmt die Seinen und rüstet sich zum Kampf
VERGIL - Jupiter spricht zu den Göttern
APPENDIX GRAMMATICA
Prooemium
Betrachtet man die Bildungslandschaft in Magna Germania, stellt sie sich dem Betrachter dar als ein Urwald, in dem vieles wuchert, wenig fruchtet. Insbesondere durch die jüngeren und jüngsten Veränderungen, die nun auch in Bayern ein verkürztes Gymnasium hervorgebracht haben, sieht sich unsere Gegenwart einer Schülergeneration konfrontiert, die in einem längst schon maßlos überfrachteten Bildungssystem einen keineswegs kleineren Berg in deutlich kürzerer Zeit abzutragen hat. Auch ungeachtet der Tatsache, daß die neben den Alten Sprachen bei weitem wichtigsten Fächer, nämlich Religionslehre, Musik und Kunst, schon seit Jahrzehnten selbst dem Überflüssigsten nachgeordnet werden, muß man von einem Bildungswahnsinn sprechen, der schöngeistig und überhaupt menschlich vollkommen unterernährte Wesen zeugt, um die Frucht ihrer Humanität ganz und gar betrogen.
„Nicht der, welcher viele Wissenschaften geübt hat, ist achtbar, sondern der, welcher menschlich nützliche“, lehrt trefflich Aristippos von Kyrene. Seneca aber fragt: „Das soll ich wissen? Und was werde ich dann nicht wissen?“ An anderer Stelle spricht er das erst heute gänzlich wahre Wort: „Wie in allen Dingen, so auch in der Wissenschaft leiden wir an Maßlosigkeit: Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir!“
Der gegenwärtige Abiturient oder Maturant ist ein Margites, der viele Dinge nicht einmal schlecht versteht, da Ziel der Ausbildung nicht ist, etwas zu verstehen, sondern komplett fragmentiertes Achtelwissen, fluktuierend wie die Gebilde eines Kaleidoskops, im Kurzzeitgedächtnis abzuspeichern. Welcher Abiturient oder Maturant, mag er auch von den Früchten des Lateinischen und Altgriechischen genossen haben, ist sich dessen bewußt, daß sein „Gymnasium“ nach jenem Orte benannt ist, da des Altertumes Jugend sich nackt ertüchtigen ließ (γυμνάζειν), „Abitur“ sich zusammensetzt aus „ab“ sowie dem Partizipialstamm von „ire“ und einen Menschen betrifft, der im Begriffe sowohl als auch im Stande abzugehen?
Es kann unmöglich geleugnet werden, daß der heutige gymnasiale Unterricht dem Schüler höchste Leistungen abverlangt, ihm allerdings nicht annähernd entsprechende menschliche Bildung zurückgibt. Könnte man die theologischen, philosophischen, historischen, literarischen, sprachlichen, künstlerischen Kenntnisse und Fähigkeiten der Abiturienten und Maturanten unserer Gegenwart auf eine Waagschale legen, würde sich deren Gewicht als geradezu lächerlich im Vergleich mit der Elitebildung jeder beliebigen Epoche erweisen. Daher wollen nun nicht auch wir noch nehmen, von wo kaum mehr etwas ist, sondern geben, was immer wir zu geben vermögen. Wer auch immer nach dem Latinum strebt, sei es das sogenannte KMK-Latinum1 (Latinum), sei es das Große Latinum, sich in einem „Leistungskurs“ befindet, Latein auf „Erhöhtem Anforderungsniveau“ studiert oder das „Langlatein“ dem „Kurzlatein“ vorgezogen hat und gelegentlich der Latinums- oder Abiturprüfung seine Fähigkeiten in der lateinischen Sprache unter Beweis wird stellen müssen, hat in diesem Buch, welches auch im Rahmen meiner Latinum-Kurse bei Ad Fontes2 herangezogen wird, einen echten Commilito und an geistigen wie moralischen Gütern reichen Contubernalis gefunden, zugleich einen kundigen Führer zum Erfolg.
Latinum und Abitur
Legt man die Latinums- und Abiturprüfungstexte einzelner Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Bundesländer nebeneinander, zeigt sich, daß nicht leicht möglich ist, richtigerweise zu behaupten, hier müsse man dieses zusätzlich, dort jenes nicht wissen. Zwar gibt es gewisse graduelle Unterschiede, doch diese bestehen auf demselben Niveau. Wer immer sich der Latinums- oder Abiturprüfung in Latein unterziehen will, sollte sich von jeglichem Minimalismus verabschieden und Mut zur Lückenfüllung entwickeln, zumal es einerseits nichts Erbärmlicheres gibt als ihn, der stets nur nehmen, nie geben will, nichts Achtbareres andererseits als den, der alles gibt, um hinsichtlich einer Sache von Wert das Mögliche zu erreichen. Einerlei also, ob jemand in Berlin, in München, in Köln, in Salzburg, in Wien oder in Zürich sich auf seine Latinums- oder Abiturprüfung in Latein vorbereitet, die Texte in diesem Buche sind der beste Stoff seiner Übung.
Textauswahl
Sämtliche Texte in diesem Buche sind entweder ehemalige Latinums- und Abiturprüfungstexte oder ausgewiesene Übungstexte, welche einem Latinums- oder Abiturprüfungstext in Hinblick auf Länge, Schwierigkeitsgrad, Art und Wesen entsprechen. Die Originale aber waren Teile verschiedenster Latinums- und Abiturprüfungen, welche nicht weiter als vier Jahre zurückliegen.
Diese Sammlung bietet dem Übenden Texte sowohl der Goldenen als auch der Silbernen Latinität, und sogar der Begründer dieser Termini und Kategorisierung, der große, edle Erasmus von Rotterdam selbst, ist vertreten. Neben Ausschnitten aus Reden beinhaltet FASTIGIA Auszüge aus Werken über Rhetorik und Philosophie sowie Textpassagen aus philosophischen Schriften, historiographischen Opera, Briefen und Dichtungen. Auf Texte in Prosa folgen Passagen in gebundener Rede.
Freilich wird nicht jeder Lernende jeden Autor, jede Form, jedes Fach gleicherweise beherrschen müssen; dennoch wird dem Cicero nützlich sein, sich auch an Laktanz oder Seneca geübt, dem Vergil, auch Tacitus und Quintilian konsultiert, dem Ovid, auch Livius und Plinius aufgesucht zu haben.
Übersetzung
Jedem Übungstext ist eine Übersetzung beigegeben. Sämtliche Texte aber habe ich so wörtlich, wie es hilfreich ist, übertragen und die Satzstellung so weitgehend, wie es förderlich ist, beibehalten, umgangssprachlichere oder noch wörtlichere Varianten allerdings in runden, Ergänzungen jedoch in eckigen Klammern beigefügt. Demjenigen nämlich, der darum bemüht ist, lateinischen Sätzen und Formulierungen gewachsen zu werden, ist keineswegs mit umgangsdeutschen Paraphrasen gedient, welche selbst zwar eingängig und bestens verständlich sind, das Original aber nicht einmal mehr durchschimmern lassen, das Spezifische und dem modernen Übersetzer eben schwer Faßbare keineswegs nachvollziehbar machen. Es ist unbedingt hilfreich, sich den „römischen Ton“, die „römische Stimmung“ mit Hilfe der eigenen Muttersprache anzuverwandeln und so sich einen Zugang zu dem zu eröffnen, das sich andernfalls fortwährend versperren wird. Dem Übersetzer haben also allein die edle Sprache der Texte und ihre moralische oder künstlerische Botschaft geboten und diktiert. Insbesondere bei der Übertragung von Versen aus dem Werke Vergils wurde omissis nugis versucht, ohne den deutschen Logos auf entsprechende künstlerische Höhe führen zu wollen, was ja weder möglich noch unserem Zwecke überhaupt dienlich wäre, vermittelst rhythmischer Prosa, dem Versmaß angepaßt, die gewaltige epische Kraft in Metrum und gewichtiger Rede möglichst zu erhalten. Dabei diente als Vorbild die unerreichbare Sprache Vossens, der „raptis concurrunt undique telis indomiti agricolae“ (Äneide 7, 520 f.) so vollendet kongenial übertragen hat in die göttlichen Worte: „stürzt rings mit beschleunigten Waffen zum Angriff nervichtes Volk des Gefilds“.
Freilich fordert dieses mein Vorgehen zuerst vielleicht den anerzogenen „guten“ Geschmack heraus, der zu wissen glaubt, was „gutes“ Deutsch sei, doch erstens kann es bei den Übersetzungen in diesem Buch eben nicht um die Einhaltung sprachlicher Konventionen gehen, sondern um den didaktischen Nutzen, zweitens darf Geschmack nicht verwechselt werden mit Gewohnheit, derer Veränderung zuweilen überaus förderlich sein kann.
Kommentar
Jedem einzelnen Übungstext sind Fußnoten beigegeben. Diese bieten Angaben zu seltenen Vokabeln und Phrasen sowie Erläuterungen zu Grammatik, Personen, historischem Hintergrund, Stilmitteln und Verweise auf den grammatischen Appendix dieses Buches. Vokabeln freilich, die sich mit ein wenig Erfahrung besonders leicht und schnell im Wörterbuch nachschlagen lassen, sind nicht angegeben, da der Umgang mit dem Lexikon geübt, darüber hinaus auch auf diese Weise der Sensus für die Alte Sprache geschärft werden soll. Sinn und Zweck der Fußnoten ist, überdurchschnittlich Schwieriges zu erleichtern, zu bewußtem Herangehen an die Übersetzungsarbeit anzuregen und menschlich besonders Bildendes hervorzuheben. Freilich wird keineswegs jeder Kasus genau bestimmt, jeder Konjunktiv gedeutet, jeder rhetorische Kunstgriff benannt, sollte doch keine Textanalyse geliefert, sondern einerseits dem natürlicherweise lückenhaften Wissen dessen, der sich beim Übersetzen mehr als nötig quält, aufgeholfen, andererseits ihm von dem Mindesten in die Hand gereicht werden, welches ein wahrhaft akademischer und also gebildeter Mensch sein Eigen nennen können sollte.
Was immer jederzeit aus jedem Buch oder sogar aus dem Internet erfragt werden kann, wurde entweder gar nicht thematisiert oder lediglich benannt. So finden sich etwa keine Erläuterungen zu Phänomenen wie dem ablativus causae oder biographische Angaben zu höchst berühmten Männern wie Sokrates oder Platon.
Appendix grammatica
Den Abschluß dieses Buches bildet ein alphabetisch geordneter grammatischer Anhang, auf welchen die Pfeile (→) in den Fußnoten verweisen. In diesem werden Grammatica umfassend dargestellt, die in gewöhnlichen Lehrbüchern entweder gar keine oder nicht hinreichende Behandlung finden, jedoch zum Häufigsten gehören dessen, das in Texten der Latinums- oder Abiturprüfung begegnet, und daher unübergehbar sind. Freilich wird kein grammatisches Lehrwerk geboten, sondern lediglich ein knapper Glossar, der allerdings einiges Licht ins Dunkel zu bringen vermag. Zur Aneignung sämtlicher nötiger Grammatica muß vor Auseinandersetzung mit diesen Prüfungstexten freilich ein entsprechendes Lehrbuch wie Bayer-Lindauer, bestenfalls Rubenbauer-Hoffmann oder gar Menge herangezogen worden sein.
1 In den meisten deutschen Bundesländern gibt es seit vielen Jahren nur mehr das sog. KMK-Latinum (Latinum gemäß dem Beschlusse der Kultusministerkonferenz).
2 Informationen hierzu finden Sie auf der Website von Ad Fontes – Institut für Antike Sprachen: www.adfontes-sprachinstitut.de.
NON EST QUOD TIMEAS NE OPERAM PERDIDERIS SI TIBI DIDICISTI
Seneca, Epistulae morales 7, 9
Prüfungstexte
Summum ius summa iniuria
Cicero, De officiis 1, 33 – 35
Existunt etiam saepe iniuriae calumnia3 quadam et nimis callida, sed malitiosa iuris interpretatione. Ex quo illud „summum ius, summa iniuria“4 factum est iam tritum sermone proverbium. Quo in genere5 etiam in re publica multa peccantur, ut ille, qui, cum triginta dierum essent cum hoste indutiae6 factae, noctu populabatur agros, quod dierum essent pactae, non noctium indutiae. Ne noster Fabius quidem probandus, si verum est Q. Fabium Labeonem7, arbitrum Nolanis8 et Neapolitanis de finibus a senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum esse, ne cupide quid agerent, atque ut regredi quam progredi mallent. Id cum utrique9 fecissent, aliquantum agri in medio relictum est. Itaque illorum finis sic, ut ipsi dixerant, terminavit. In medio quod relictum erat, populo Romano adiudicavit. Decipere hoc quidem est, non iudicare. Quocirca in omni est re fugienda talis sollertia10. Atque in re publica maxime conservanda sunt iura belli. Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur. Parta autem victoria conservandi sunt ii, qui non crudeles in bello fuerunt.
(171 Wörter)
Übersetzung
Es treten sogar häufig Unrechtsfälle auf durch eine gewisse Rechtsverdrehung und überaus schlaue, doch hinterlistige Auslegung des Rechtes. Von daher ist jenes schon geflügelte Sprichwort entstanden: „Äußerstes Recht [ist] äußerstes Unrecht“. In dieser Hinsicht wird auch im Staate viel gesündigt, wie etwa jener, welcher, nachdem ein Waffenstillstand über dreißig Tage mit einem Feinde geschlossen worden war, des Nachts dessen Felder verwüstete, weil über Tage, nicht Nächte ein Waffenstillstandsvertrag geschlossen worden sei. Nicht unser Fabius einmal ist des Beifalls wert, wenn wahr ist, daß Quintus Fabius Labeo, als Anwalt den Nolanern und Neapolitanern betreffs ihrer Grenzen vom Senate gegeben, da er an Ort und Statt gekommen, mit beiden [Parteien] gesondert gesprochen habe, daß sie nicht gierig etwas verfolgen und [daß sie] lieber zurückgehen als vordringen wollen mögen. Nachdem dies beide getan hatten, blieb ziemlich viel Boden in der Mitte übrig. Daher bemaß er jener Grenzen so, wie sie selbst gesagt hatten. Was in der Mitte zurückgelassen war, erkannte er dem römischen Volke zu. Täuschen ist das freilich, nicht Recht Sprechen. Darum ist bei jeder Sache zu fliehen so verwerfliche Gerissenheit. Ferner sind im Staate vor allem die Rechte des Krieges zu wahren. Deshalb muß man Kriege freilich aus dem Grunde unternehmen, daß man ohne Unrecht in Frieden lebe. Ist aber der Sieg errungen, müssen jene gerettet werden, welche im Kriege nicht grausam gewesen sind.
3calumnia: Rechtsverdrehung.
4 Dieses Wort erscheint ähnlich zuerst in der Komödie Heautontimorumenos (796) des Publius Terentius Afer (185-159 v. Chr.): „Ius summum saepe summa est malitia“.
5 Hier finden sich statt „in eo genere“ Anastrophe und Relativer Satzanschluß.
6indutiae, -arum: Waffenstillstand.
7 Quintus Fabius Labeo, Konsul im Jahre 183 v. Chr., ist keine der bedeutenden Persönlichkeiten römischer Geschichte. Dennoch wirkte er im Nachfeld der Kämpfe gegen Antiochos III. den Großen (242-187 v. Chr.) und des Dritten Makedonischen Krieges (171-168 v. Chr.) gegen Perseus (212-165 v. Chr.), den letzten König von Makedonien, nicht ganz ohne Glanz. Jenes von Cicero erwähnte Ereignis zeigt ihn als Mann von erstaunlicher Klugheit. – Fabius blickte auf höchst bedeutende Ahnen zurück: Im heldenhaften Krieg gegen Veji an der Cremera (477 v. Chr.) fast ausgelöscht, brachte die Familie aus einer einzigen verbliebenen Wurzel Männer wie Quintus Fabius Maximus Rullianus oder Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator (275-203 v. Chr.), den Schild Roms, hervor.
8Nolani: Nolaner. – Nola war eine Stadt in Kampanien. Sie lag nicht weit von Neapel entfernt.
9 Gemeint sind beide Parteien.
10sollertia: Gerissenheit.
Quod licet bovi non licet Iovi
Seneca, De clementia 1, 8, 2 - 5