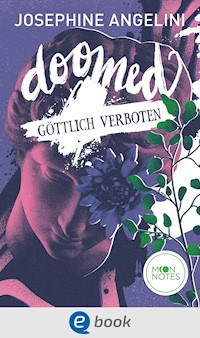9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Helen und Lucas — Besiegt ihre Liebe den Fluch der Götter? Glaubst du an die Macht des Schicksals? Und ist Liebe Schicksal – oder ein Fluch? Helens Drama in der Parallelwelt der Götter spitzt sich jedenfalls zu, denn ein zweiter Trojanischer Krieg steht unmittelbar bevor. Weil die Häuser Scions sich gegenseitig bekämpfen, liegt es allein an Helen, Lucas und Orion, neue Verbündete zu finden und zu verhindern, dass die sterbliche Welt in die Hände der zwölf unsterblichen Götter fällt. Helens Macht wächst, doch mit ihr auch das Misstrauen ihrer Freunde. Kann sie ihr Vertrauen zurückgewinnen und Zeus in letzter Minute bezwingen? Und was wird aus ihrem ganz persönlichem Kampf: dem um ihre Liebe zu Lucas? Du musst es herausfinden, du wirst es erfahren, hier und jetzt. Mehr noch: wie alles begann …. Gleich im Anschluss im neuen Prequel zu diesem hochdramatischen Göttlich-Finale. Ein Ende, das ein Anfang ist – sei gespannt. Entfesselte Gefühle: ein göttliches Finale und ein Neubeginn. - Der dritte Band der Neuausgabe von Josephine Angelinis Göttlich-Bestseller. - Gibt es ein Happy End für Todfeinde, die einander lieben? - Wieder sehr stylish in der wunderschönen neuen Optik. - Du wirst es lieben: Romantasy verknüpft mit Antike und Mythen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
DER NÄCHSTE TROJANISCHE KRIEG STEHT KURZ BEVOR.KANN IHRE LIEBE ÜBERLEBEN?
Helen schlang die Arme um seine Brust und ließ ihren Tränen freien Lauf. Sie weinte wegen Orion, wegen sich selbst und wegen Lucas. Sie konnte einige der größten Mächte der Erde beherrschen, aber über das Wichtigste von allem - ihr eigenes Herz - hatte sie keine Kontrolle.
1
Zu ihrer Linken sah Helen etwas, das vermutlich der Styx war, denn in dem reißenden Strom trieben Unmengen von scharfkantigen Eisstücken. Niemand würde versuchen, den Fluss zu durchqueren. Frustriert humpelte Helen weiter. Dabei sah sie sich hoffnungsvoll um, doch sie war ganz allein in dieser kargen Landschaft.
»So ein Mist«, fluchte sie mit rauer Stimme. Ihre Stimmbänder waren noch nicht vollständig geheilt. Vor knapp einer Stunde hatte Ares ihr die Kehle durchgeschnitten, und obwohl das Sprechen immer noch schmerzte, war es eine Wohltat, ihrem Ärger Luft zu machen. »Das ist wieder typisch.«
Sie hatte ihrem Freund Zach ein Versprechen gegeben. Er war in ihren Armen gestorben, und sie hatte geschworen, dass er in seinem Leben nach dem Tod aus dem Fluss der Freude trinken würde. Zach hatte sich geopfert, um ihr zu helfen, und ohne den entscheidenden Hinweis, den er ihr in den letzten Momenten seines Lebens gegeben hatte, hätte sie Automedon niemals töten und auch Lucas und Orion nicht retten können.
Helen war fest entschlossen, ihr Versprechen zu halten, auch wenn sie Zach eigenhändig auf die Elysischen Felder und an den Fluss der Freude tragen musste – obwohl sie sich selbst kaum auf den Beinen halten konnte. Doch aus irgendeinem Grund funktionierte ihre übliche Art, sich in der Unterwelt fortzubewegen, plötzlich nicht mehr. Bisher hatte sie immer nur laut aussprechen müssen, wohin sie wollte, und schon war sie wie durch Zauberhand an den gewünschten Ort befördert worden.
Sie war die Deszenderin und damit eine der ganz wenigen Scions, die auch körperlich in die Unterwelt hinabsteigen konnten – und nicht nur im Geiste wie alle anderen. Sie konnte sogar ihre Umgebung ein wenig kontrollieren, aber jetzt, wo sie diese Begabung am Dringendsten brauchte, war sie verschwunden. Typisch griechisch. Das war es, was Helen an ihrem Leben als Scion am meisten hasste: diese ständige, nervtötende Ironie des Schicksals.
Helen kniff frustriert die aufgeschlagenen Lippen zusammen und richtete ihre heisere Stimme in Richtung Himmel. »Ich sagte, ich will zu Zachs Geist!«
»Ich habe seine Seele, Nichte.«
Helen fuhr herum und musste feststellen, dass Hades, der Herrscher über die Unterwelt, nur wenige Schritte hinter ihr stand. Er war in Schatten gehüllt, die sich um ihn herum auflösten wie Nebelschwaden. Der Helm der Dunkelheit und die weiten Stoffbahnen seiner schwarzen Toga verdeckten einen Großteil seines Gesichts, aber Helen konnte zumindest seinen sinnlichen Mund und das markante Kinn sehen. Der Rest der Toga war stilvoll um seinen Körper drapiert. Dabei blieben die Hälfte seines Oberkörpers und seine muskulösen Arme und Beine nackt. Helen schluckte und konzentrierte sich darauf, ihn mit ihren zugeschwollenen Augen anzusehen.
»Bitte setz dich, bevor du umkippst«, sagte er sanft. Zwei einfache gepolsterte Klappstühle tauchten aus dem Nichts auf, und Helen ließ ihren geschundenen Körper auf den einen sinken, während Hades den anderen nahm. »Du bist immer noch verwundet. Warum bist du hergekommen, obwohl du eigentlich heilen solltest?«
»Ich muss meinen Freund ins Paradies führen. Wo er hingehört.« Helens Stimme zitterte vor Angst, obwohl Hades ihr nie etwas getan hatte. Anders als Ares, der Gott, der sie gerade gefoltert hatte, war Hades eigentlich bei jeder ihrer Begegnungen bisher recht freundlich gewesen. Aber er war immerhin der Herr über das Totenreich, und die Schatten, die ihn umgaben, waren erfüllt vom Gewisper der Geister.
»Wie kommst du darauf, dass du entscheidest, wohin seine Seele gehört?«, fragte er.
»Er war ein Held … Vielleicht nicht von Anfang an, als er noch ein richtiger Idiot war, aber am Ende schon, und das ist es doch, was zählt, oder? Und Helden dürfen auf die Elysischen Felder.«
»Ich hatte Zachs Heldenmut nicht infrage gestellt«, bemerkte Hades sanft. »Was ich gefragt habe, war: Was bringt dich auf die Idee, dass du über seine Seele urteilst?«
»Ich … was?«, stieß Helen verwirrt hervor. In ihrem Kopf hämmerte es immer noch so stark, dass ihr der Sinn nicht nach Wortklaubereien stand. »Ich bin nicht gekommen, um über irgendwen zu urteilen. Ich habe nur ein Versprechen gegeben und beabsichtige, es einzuhalten.«
»Und dennoch bin ich es, der hier die Entscheidungen trifft. Nicht du.«
Dem konnte Helen nicht widersprechen. Dies hier war sein Reich. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihn flehentlich anzusehen.
Hades’ sanfter Mund verzog sich zu einem leichten Lächeln. Er schien über das nachzudenken, was Helen gesagt hatte. »Wie du die Furien befreit hast, zeigt mir, dass du Mitgefühl besitzt. Das ist ein guter Anfang, aber ich fürchte, Mitgefühl allein reicht nicht, Helen. Dir mangelt es an Verständnis.«
»War etwa alles nur eine Prüfung? Das mit den Furien?« Helen konnte nicht vermeiden, dass sich ein anklagender Tonfall in ihre Stimme schlich, als sie daran dachte, was sie und Orion auf ihrer letzten Mission in der Unterwelt alles ertragen hatten. Noch wütender machte sie die Erinnerung an die Qualen, denen die Furien ausgesetzt gewesen waren. Wenn diese drei Mädchen viele tausend Jahre lang gelitten hatten, nur um zu beweisen, dass Helen ein mitfühlender Mensch war, dann stimmte etwas mit dem Universum nicht – ganz und gar nicht.
»Eine Prüfung.« Hades’ Lippen verzogen sich angewidert, als könnte er Helens Gedanken lesen und fände die Vorstellung genauso abstoßend. »Wenn das Leben eine Prüfung ist, was glaubst du, wer sie benotet?«
»Du?«, riet sie.
»Du verstehst es immer noch nicht«, seufzte er. »Du verstehst nicht einmal, was das hier ist.« Er deutete um sich herum auf die Unterwelt. »Oder was du bist. Man nennt dich die Deszenderin, weil du herkommen kannst, wann immer du willst, aber die Fähigkeit, die Unterwelt zu betreten, ist nur der kleinste Teil deiner Kraft. Du weißt noch nicht annähernd genug über dich selbst, um über andere zu urteilen.«
»Dann hilf mir.« Plötzlich wollte sie unbedingt seine Augen sehen. Sie beugte sich zu ihm und versuchte, unter den Stoff zu spähen, der sein Gesicht verdeckte. »Ich will es verstehen.«
Sofort umwirbelten ihn wieder die Schatten und verbargen ihn mit dem bedauernden Gemurmel der Toten. Helen fuhr zurück.
»Die Schattenmeister«, hauchte sie. »Bekommen sie ihre Dunkelheit von dir?«
»Vor langer Zeit hatte eine Frau namens Morgan La Fay aus dem Haus von Theben dieselbe Begabung wie du – auch sie konnte in die Unterwelt gehen. Sie schenkte mir einen Sohn mit Namen Mordred und seitdem verfolgen meine dunklen Schatten das Haus von Theben.« Er verstummte voller Bedauern, stand dann auf und hielt ihr die Hand hin. Helen ließ sich von ihm aufhelfen. »Du musst jetzt heimgehen. Komm zu mir, sooft du willst, Nichte, und ich werde mein Bestes tun, dir alles zu erklären.« Hades legte den Kopf ein wenig schief und lachte leise auf. Durch die leicht geöffneten Lippen konnte Helen seine Schneidezähne sehen, die geformt waren wie Diamanten. »Deswegen habe ich dir und deinen Vorgängern erlaubt, mein Reich zu betreten – damit ihr alles über euch selbst lernt. Aber im Moment bist du zu schwer verletzt, um hier zu sein.«
Die Welt schwankte, und Helen spürte, wie seine Riesenhand sie aus der Unterwelt hob und sanft in ein Bett legte.
»Warte! Was ist mit Zach?«, fragte sie. Als Hades sie losließ, hörte Helen sein Wispern in ihrem Ohr.
»Zach wird aus dem Fluss der Freude trinken, das schwöre ich. Und jetzt ruh dich aus, Nichte.«
Helen streckte die Hand aus, um die Schatten aus seinem Gesicht zu vertreiben, aber Hades war schon fort. Sie fiel in Morpheus’ Arme, und ihr zerschlagener Körper sog den Schlaf gierig ein, denn er war eine der Grundlagen für die Selbstheilung.
Nachdem Ares im Tartaros eingesperrt und die Kluft im Boden geschlossen war, hob Daphne ihre Tochter Helen auf. Castor trug den verletzten Lucas heim und Hector brachte Orion zum Anwesen.
Daphne war erst ein kurzes Stück neben ihnen hergerannt, als Helen in ihren Armen einschlief. Einen Moment lang hatte Daphne Angst um sie. Helens Verletzungen waren so schlimm, wie Daphne es bisher nur selten gesehen hatte. Aber dann überprüfte sie Helens Puls und stellte erleichtert fest, dass ihr Herz zwar langsam, aber stetig schlug.
Der Morgen brach gerade an, als sie von den Höhlen auf dem Festland von Massachusetts nach Nantucket zurückkehrten. Daphne trug Helen die Treppe im Delos-Haus hinauf und suchte im Obergeschoss nach dem ersten Raum, der nach einem Mädchenzimmer aussah. Bedauernd betrachtete sie den hübschen Bettbezug aus Seide, den ihre blutverschmierte Tochter schmutzig machen würde. Nicht, dass das eine Rolle spielte. Das Haus von Theben verfügte über nahezu unbegrenzte finanzielle Mittel und konnte alles ersetzen. Finanzielle Mittel, von denen ein Teil einst dem Haus von Daphne und Helen gehört hatte, dem Haus von Atreus.
Auch wenn Tantalus unentwegt »heiliger Krieg« geschrien und verkündet hatte, dass von jetzt an »die Scions herrschen« sollten, konnte er die Anführer der anderen Häuser damit nicht täuschen. Der Vernichtungsfeldzug vor rund zwanzig Jahren, der ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Unsterblichkeit sein sollte, hatte zugleich als Vorwand zum Ausplündern der anderen Häuser gedient.
Die Prophezeiung, die dieser Aktion vorausgegangen war, besagte, dass Atlantis wieder auftauchen würde, sobald ein blutiger Kampf die vier Häuser zu einem einzigen vereinte. Dem genauen Wortlaut zufolge, den Daphne sich eingeprägt hatte, würden die Scions im neuen Atlantis die Unsterblichkeit finden. Die Prophezeiung lautete nicht, dass die Scions unsterblich werden würden – es hieß nur, dass sie die Unsterblichkeit dort finden konnten. Daphne war nicht optimistisch genug, um die Unsterblichkeit für eine sichere Sache zu halten. Aber Tantalus war sich sicher und hatte diese Prophezeiung zum Vorwand genommen, die Hundert Cousins von Theben um sich zu scharen und sie auf die anderen Häuser zu hetzen.
Soweit es Daphne betraf, war das Ganze ohnehin Unsinn, angefeuert vom Gefasel des letzten Orakels – von dem alle wussten, dass es nach seiner ersten Prophezeiung verrückt geworden war. Aber es hatte trotzdem funktioniert.
Viele Scions überließen ihren immensen Reichtum der Plünderung durch das Haus von Theben und stellten sich tot, um dem Morden zu entgehen – unter ihnen auch Orions Eltern Daedalus und Leda. Und Daphne. Aber Daphne war nie an Geld interessiert gewesen. Allerdings hatte sie auch keine moralischen Bedenken, sich Geld zu nehmen, wenn sie welches brauchte. Andere Scions wie Orion und seine Eltern konnten sich nicht zum Stehlen durchringen und mussten sich die letzten zwei Jahrzehnte durchkämpfen, während das Haus von Theben im Luxus lebte. Die Erinnerung an jene Zeit veranlasste Daphne, Helen aufs Bett zu legen und den Ruin der feinen Seidenbezüge mit einem leisen Lächeln zur Kenntnis zu nehmen.
Bevor Daphne Wasser und Verbandmull zum Säubern der schnell heilenden Wunden holen konnte, verschwand Helen, und eine eisige Kälte nahm ihren Platz ein. Daphne vermutete, dass Helen in die Unterwelt gegangen war, und ihre Sorge wuchs mit jeder Minute. Eigentlich war sie überzeugt, dass keine Zeit verstrich, während Helen in der Unterwelt war. Aber jetzt war sie schon so lange fort, dass Daphne sich bereits fragte, ob sie nicht doch lieber alle anderen im Haus wecken sollte. Doch bevor sie eine Entscheidung treffen konnte, tauchte Helen wieder auf. Sie roch nach der sterilen Luft der Unterwelt.
Daphnes Zähne schlugen aufeinander, jedoch nicht vor Kälte, sondern wegen der schrecklichen Erinnerungen, die dieser Geruch in ihr wachrief. Sie war schon so oft fast gestorben, dass sie ahnte, welchen Teil der Unterwelt Helen besucht hatte. Der Geruch war nicht verbrannt genug, um aus dem Trockenen Land zu kommen, und an Helens Füßen klebte etwas getrockneter Schlamm. Das ließ Daphne vermuten, dass ihre Tochter am Ufer des Styx gewesen war.
»Helen?«, fragte sie sanft. Sie strich ihrer Tochter übers Haar und betrachtete ihr kaltes Gesicht.
Helen hatte bei ihrem Kampf mit Ares grauenvolle Verletzungen erlitten, aber wenn sie daran sterben würde, wäre sie bereits tot, das wusste Daphne genau. Helen musste also mit Absicht in die Unterwelt hinabgestiegen sein, vermutlich um nach ihrem gerade verstorbenen Freund zu sehen – dem Jungen, der das Pech gehabt hatte, von Automedon versklavt worden zu sein.
Daphne war mehr als einmal auf einer ähnlichen Suche nach Ajax gewesen, aber im Gegensatz zu ihrer Tochter konnte sie die Unterwelt nicht aufsuchen, wann immer es ihr beliebte. Sie musste dem Tode nahe sein, um hinabzusteigen. Nach dem Mord an Ajax hatte sie ihr Lebenswille verlassen, aber ein Selbstmord hätte sie nicht mit ihrem geliebten Mann vereinen können. Wie Ajax musste auch Daphne im Kampf fallen, weil sie nur so in denselben Teil der Unterwelt gelangen konnte, in dem er war. Nur Helden kamen auf die Elysischen Felder. Und Selbstmörder landeten wer weiß wo. Sie hatte sich in jeden ehrenvollen Kampf gestürzt, der sich ihr bot. Sie hatte andere Scions in ihren Verstecken aufgespürt und selbstlos die Schwachen und Kinder verteidigt – unter ihnen auch Orion, als er noch ein kleiner Junge war. Viele Male war Daphne in einer dieser Schlachten beinahe getötet worden, hatte die Reise in die Unterwelt unternommen und am Ufer des Styx nach ihrem Mann gesucht.
Aber der Einzige, den sie gefunden hatte, war Hades. Der unnachgiebige geheimnisvolle Hades, der sie an Ajax’ Stelle nehmen sollte. Doch Hades wollte Ajax sein Leben partout nicht zurückgeben, sosehr sie auch bettelte oder feilschte. Der Herr der Toten machte keine Geschäfte. Daphne hoffte nur, dass Helen nicht hinabgestiegen war, um ihren Freund wieder zum Leben erwecken zu lassen. Das war zum Scheitern verurteilt – zumindest jetzt noch. Aber Daphne arbeitete schon fast zwei Jahrzehnte daran, es zu ändern.
»Kann dich nicht sehen«, murmelte Helen, und ihre Finger bewegten sich, als wollte sie nach etwas greifen. Daphne erkannte sofort, was es war. Auch sie hatte Hades unbedingt sehen wollen und versucht, ihm den Helm der Dunkelheit abzunehmen. Und schließlich, nachdem Daphne oft genug beinahe gestorben war, um ihre Blutschuld zu bezahlen und sich vom Einfluss der Furien zu befreien, hatte Hades ihr sein Gesicht gezeigt.
Hades zu sehen, hatte sie veranlasst, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Einen Plan, der ihrer einzigen Tochter das Herz gebrochen hatte, weil er sie von dem einzigen Menschen trennte, den sie liebte.
»Oh. Tut mir leid«, sagte Matt von der Tür aus und riss Daphne damit aus ihren Gedanken. Sie fuhr sich übers Gesicht und musste feststellen, dass Matt Ariadne in den Armen hielt. Sie sah ganz grau aus und war kaum bei Bewusstsein, denn ihre Bemühungen, Jerry zu heilen, hatten ihr das Äußerste abverlangt. »Sie wollte in ihrem eigenen Zimmer schlafen.«
»Ich bin sicher, dass genug Platz für beide ist«, sagte Daphne und deutete auf das breite Bett. »Ich wusste nicht, wohin ich Helen sonst bringen sollte.«
»Allmählich kommt es mir vor, als läge in jedem Zimmer ein Verletzter«, versuchte Matt zu scherzen. Er trug Ariadne zum Bett und legte sie sanft neben Helen.
Kräftiger Junge, dachte Daphne und musterte Helens Freund.
»Es ist ohnehin einfacher, gleichzeitig über beide zu wachen«, sagte Daphne, die Matt immer noch unauffällig betrachtete.
Er war in Form gekommen und hatte Muskeln angesetzt, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Aber da war noch etwas. Ariadne war kein dünnes Persönchen wie Helen, und Matt, der sie den ganzen Flur entlanggetragen hatte, war nicht einmal außer Atem.
Ariadne murmelte Matt etwas Unverständliches zu und ihr Gesicht verzog sich protestierend, als sie merkte, dass er gehen wollte. Er zögerte und strich ihr übers Haar. Daphne konnte die Liebe, die er verströmte und die das Zimmer erfüllte, beinahe riechen, ähnlich etwas Süßem und Leckerem, das aus dem Backofen duftete.
»Ich komme bald wieder«, flüsterte er. Ariadnes Lider flatterten kurz und dann fiel sie in einen tiefen Schlaf. Er strich mit den Lippen über ihre Wange und gab ihr einen kleinen Kuss. Dann sah er Daphne an und ließ den Blick schließlich auf die schlafende Helen wandern. »Kann ich irgendwas tun?«
»Ich komme zurecht. Geh und tu, was du tun musst.« Er nickte dankbar. Sie sah ihm nach, als er das Zimmer verließ – hoch aufgerichtet im Licht des neuen Morgens.
Wie ein Krieger.
Helen betrachtete sich selbst, wie sie am Strand auf den größten Leuchtturm zurannte, den sie je gesehen hatte.
Das war merkwürdig. Wie konnte sie sich selbst beobachten, als würde sie einen Film sehen? Es fühlte sich eigentlich nicht nach einem Traum an. Kein Traum wäre so real oder so logisch. Obwohl sie nicht verstand, was gerade mit ihr passierte, wurde sie immer tiefer in diesen Schauplatz hineingezogen.
Die Traum-Helen trug ein langes, durchscheinendes weißes Kleid mit einem üppig bestickten Gürtel. Ihr zarter Schleier hatte sich gelöst und wehte beim Rennen hinter ihr her. Sie sah verängstigt aus. Als sie sich dem Riesenleuchtturm näherte, beobachtete Helen, wie ihr Traum-Ich jemanden entdeckte, der an einer der acht Ecken des Turmsockels stand. Sie sah Bronze aufblitzen, als die Person die Schnallen an Hals und Bauch löste und den Brustpanzer in den Sand fallen ließ. Sie hörte, wie sie selbst freudig aufschrie, und rannte immer schneller auf die Person zu.
Nach dem Ablegen der Rüstung wandte sich der hochgewachsene junge Mann dem Klang ihrer Stimme zu und rannte ebenfalls los, um sie auf halbem Weg zu treffen. Die beiden Liebenden fielen einander in die Arme. Er drückte sie an seine Brust und küsste sie. Helen beobachtete, wie sie die Arme um seinen Hals schlang, den Kuss erwiderte und dann sein ganzes Gesicht mit Küssen bedeckte, als wollte sie kein Stück von ihm ungeküsst lassen. Im Geiste rückte Helen noch näher an das Liebespaar heran, obwohl sie längst wusste, wen die andere Helen gerade küsste.
Lucas. Er hatte ein Schwert am Gürtel und war merkwürdig gekleidet. Er trug Sandalen, und seine Hände waren mit abgewetzten Lederstreifen umwickelt, über denen er Bronzehandschuhe trug. Doch es war eindeutig Lucas. Das bewies auch sein Lachen, als die andere Helen ihn mit Küssen überschüttete.
»Ich habe dich so vermisst!«, rief sie.
»Eine Woche ist viel zu lang«, bestätigte er verliebt.
Sie redeten in einer fremden Sprache, aber Helen verstand sie trotzdem ohne Probleme. Ihre Worte hallten ebenso in ihrem Kopf herum wie die Erleichterung, wieder mit ihrem Geliebten vereint zu sein – als wäre es ihr Körper, der in seinen Armen lag. Plötzlich erkannte Helen, dass es wirklich ihr Körper war oder dass er es einst gewesen war. Sie hatte diese fremde Sprache selbst gesprochen und diesen Kuss eindeutig gespürt. Dies war kein Traum. Es kam ihr eher wie eine Erinnerung vor.
»Dann kommst du also mit mir?«, fragte er eindringlich, umfasste ihr Gesicht mit beiden Händen und zwang sie, ihn anzusehen. Seine Augen waren voller Hoffnung. »Du kommst doch mit, oder?«
Das Gesicht der anderen Helen verdüsterte sich. »Wieso musst du immer von morgen sprechen? Können wir nicht einfach das Hier und Jetzt genießen?«
»Mein Schiff läuft morgen aus.« Er ließ sie los und zog sich enttäuscht zurück.
»Paris …«
»Du bist meine Frau!«, rief er, lief hektisch ein paar Schritte umher und fuhr sich auf dieselbe Weise mit der Hand durch die Haare, wie Lucas es auch immer tat, wenn er frustriert war. »Ich habe Aphrodite den goldenen Apfel gegeben. Ich habe Liebe gewählt – ich habe dich aus allen gewählt, die mir angepriesen wurden. Und du hast gesagt, dass auch du mich willst.«
»Das habe ich gesagt und es ist die Wahrheit. Aber meine Schwester hat kein Verständnis für Politik. Aphrodite fand es nicht erwähnenswert, dass du an jenem Tag zwar die Schafe gehütet hast, aber kein Schäfer bist, wie ich annahm, sondern ein trojanischer Prinz.« Die andere Helen seufzte über dieses Versäumnis ihrer Schwester und schüttelte entnervt den Kopf. »Goldene Äpfel und gestohlene Nachmittage sind ohne Bedeutung. Ich kann nicht mit dir nach Troja gehen.«
Sie streckte wieder die Arme nach ihm aus. Einen Moment lang schien es, als wollte er nicht darauf eingehen, brachte es dann aber doch nicht übers Herz. Er nahm ihre Hand und zog sie an sich. Er konnte sie nicht einmal dann zurückweisen, wenn er verärgert war.
»Dann lass uns weglaufen. Wir lassen alles hinter uns. Wir werden nicht mehr von königlichem Geblüt sein und von nun an Schafe hüten.«
»Es gibt nichts, was ich lieber täte«, sagte sie sehnsüchtig. »Aber wohin wir auch gingen, ich würde trotzdem noch eine Tochter des Zeus und du ein Sohn von Apoll sein.«
»Und wenn wir Kinder bekämen, würde sich in ihnen das Blut von zwei Olympiern vereinigen«, sagte er schroff. Anscheinend hatte er diese Argumentation schon sehr oft gehört. »Glaubst du wirklich, dass das ausreicht, um den Tyrannen hervorzubringen? In der Prophezeiung heißt es doch, es müsste sich das Blut der vier von den Göttern abstammenden Häuser vermischen. Was immer das bedeuten soll.«
»Ich verstehe keine von diesen Prophezeiungen, aber den Leuten macht jede Vermischung vom Blut der Götter Angst«, sagte sie und fügte bedrückt hinzu: »Die würden uns bis ans Ende der Welt jagen.«
Er strich mit beiden Händen über ihren Bauch. »Dir ist klar, dass du bereits schwanger sein könntest?«
Sie hielt seine Hände fest und sah ihn traurig und einen kurzen Augenblick auch verzweifelt an. »Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte.«
»Oder das Beste.«
»Paris, hör auf«, sagte Helen energisch. »Es tut mir schon weh, nur daran zu denken.«
Paris nickte und ließ seine Stirn gegen ihre sinken. »Und was, wenn dein Ziehvater, der König von Sparta, versucht, dich mit einem dieser griechischen Barbaren wie Menelaos zu verheiraten? Wie viele Könige haben bereits um deine Hand angehalten? Zehn oder zwanzig?«
»Das ist mir egal. Ich weise sie alle ab«, sagte die andere Helen. Dann musste sie lächeln. »Es ist ja nicht so, als könnte mich jemand dazu zwingen.«
Paris grinste und sah ihr in die Augen. »Nein. Allerdings würde ich zu gern sehen, wie es der eine oder andere versucht. Vielleicht riechen griechische Krieger sogar besser, nachdem sie vom Blitz getroffen wurden? Schlimmer stinken können sie nämlich auf keinen Fall.«
»Ich würde niemanden mit meinen Blitzen töten«, sagte sie schmunzelnd. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und schmiegte sich noch enger an ihn. »Ich würde sie nur ein bisschen anrösten.«
»Oh, dann lass es lieber! Angebratener Krieger klingt viel stinkiger als gut durchgebratener Krieger«, meinte Paris albern und lächelte sie an. Doch dann erlosch ihr Humor wieder und die Sorgen gewannen erneut die Oberhand. »Wie soll ich morgen ohne dich in See stechen?«
Darauf hatte die andere Helen keine Antwort. Er küsste sie und fuhr dabei sanft mit den Fingern durch ihre langen seidenen Haare. Genauso machte Lucas es auch immer.
Helen vermisste ihn so sehr, dass es wehtat – selbst im Schlaf. Es bereitete ihr solche Schmerzen, dass sie davon aufwachte. Als sie sich umdrehte, stöhnte sie auf, weil sie zu viel Druck auf ihren heilenden Körper ausübte.
»Helen?«, fragte Daphne sanft, und ihre Stimme war in der Dunkelheit nur Zentimeter von Helens Ohr entfernt. »Brauchst du etwas?«
»Nein«, murmelte Helen und ließ ihre geschwollenen Augenlider wieder zufallen. Doch der Traum, der dann folgte, ließ sie wünschen, dass sie trotz ihrer Verletzungen wach geblieben wäre.
Eine zu Tode verängstigte Frau kämpfte gegen eine riesige Klaue, die ihre Taille umklammerte. Gigantische Flügel, deren Federn größer waren als ein Mann, schlugen heftig, als der Riesenvogel sie in die Nacht davontrug. Während die Frau sich immer noch zu wehren versuchte, zog unter ihr die Skyline von New York vorbei.
Helen beobachtete, wie der Vogel seinen Hakenschnabel senkte, um auf die Frau hinunterzusehen, die er in seinen Krallen hielt. Einen kurzen Moment lang verwandelten sich die bösartigen Adleraugen in die bernsteinfarbenen Augen eines Mannes. Blaue Blitze durchzuckten die schwarze Mitte seiner Pupillen. Der Adler schrie, was Helen das Blut in den Adern gefrieren und ihren schlafenden Körper schaudern ließ.
Vor ihr tauchte das Empire State Building auf und dann wurde Helens Albtraum jäh unterbrochen.
Orion schrie wie ein Wahnsinniger.
Helen fuhr hoch, stieß ihre Mutter zur Seite und raste los. Sie stürmte den dunklen Flur entlang und hatte das Zimmer schon halb durchquert, als Lucas plötzlich wie der Blitz neben ihr auftauchte, was beide verdutzt innehalten ließ.
»Was zum Teufel ist hier los?«, brüllte Hector, der sein Klappbett direkt neben Orions Bett gestellt hatte. Er schaltete das Licht ein.
Orion stand auf der Matratze, nur in knappen Shorts, und zeigte voller Entsetzen auf eine kleine dunkle Person, die zwischen den beiden Betten auf dem Boden hockte. Es war Cassandra, die nur mit einem Kissen und einer dünnen Decke auf dem Parkettboden geschlafen hatte.
»Was machst du da?«, wurde sie gleich von mehreren Personen gefragt. Castor, Pallas und Daphne waren hinter Helen und Lucas in der Tür aufgetaucht.
»Du hast mich gebissen!«, schrie Orion, der immer noch vollkommen außer sich auf dem Bett herumsprang. Noel, Kate und Claire, die nur im normalen Menschentempo rennen konnten, tauchten nun auch auf und drängten ins Zimmer.
»Es tut mir leid!«, beteuerte Cassandra. »Aber du bist auf mich getreten!«
»Ich dachte, du wärst eine Katze, bis ich … Ich hätte dir fast den Kopf abgerissen! Ich hätte dich töten können«, wütete Orion, ohne auf die große Zuhörerschar zu achten. »Schleich dich nie wieder so an mich heran!«
Plötzlich griff sich Orion an die Brust und krümmte sich vor Schmerzen. Hector war sofort zur Stelle, um ihn aufzufangen, bevor er zusammenbrach – aber nicht schnell genug, um Orion vor den Blicken der anderen zu schützen. Orions Bauch und Brust waren von seinem Kampf gegen Automedon schwer verwundet. Die Blessuren waren tiefrot, heilten aber schnell und würden in ein paar Tagen spurlos verschwunden sein. Was alle Blicke auf sich zog, waren auch nicht die frischen Wunden, sondern die langen Narben, die seinen ansonsten makellosen Körper verunstalteten.
Eine der Narben verlief über seine Brust, eine andere über den linken Oberschenkel. Doch als Orion kraftlos gegen Hector sank, konnten alle die furchtbare Narbe sehen, die sich auf seinem Rücken befand. Helen starrte den grauenhaften knochenweißen Wulst an, der parallel zu Orions Wirbelsäule verlief. Es sah aus, als hätte jemand versucht, ihn in zwei Teile zu hacken. Sie spürte, wie Lucas nach ihrer Hand griff und sie fest drückte.
»Verzieht euch! Und zwar alle!«, befahl Hector, als ihm das geschockte Schweigen und die entsetzten Blicke auffielen. Er beugte sich vor und versuchte, Orion mit seinem Körper zu verdecken. »Du auch, kleine Nervensäge«, sagte er wesentlich freundlicher zu Cassandra, die immer noch auf dem Boden hockte.
»Nein«, protestierte sie stur. Der dicke schwarze Zopf, der ihr auf den Rücken hing, hatte sich gelöst, und ihr Gesicht mit der Alabasterhaut, den dunklen Augen und den leuchtend roten Lippen sah aus wie eine Maske. »Ich bleibe hier. Er könnte mich brauchen.«
Hector gab mit einem zögernden Nicken sein Einverständnis und legte den nahezu ohnmächtigen Orion wieder hin. »Geht raus«, sagte er über die Schulter, diesmal aber wesentlich ruhiger. Alle wandten sich sofort zum Gehen.
In der Tür mussten sich Helen und Lucas gegenseitig stützen, denn nachdem der Adrenalinstoß vorbei war, fühlten beide wieder ihre schweren Verletzungen. Doch statt den beiden zu erlauben, einander zu helfen, eilte Pallas zu Lucas, und Daphne war sofort an Helens Seite – als müssten sie die beiden so schnell wie möglich voneinander trennen.
»Wusstest du davon?«, fragte Lucas, bevor man sie in verschiedene Richtungen wegbrachte.
»Nein. Ich habe ihn nie nackt gesehen«, antwortete Helen unverblümt. Sie war immer noch zu schockiert, um irgendwelches Taktgefühl aufzubringen. Sie hatte zwar Morpheus als Orion halb nackt gesehen, erinnerte sie sich, aber nicht Orion selbst. Lucas nickte und die Besorgnis verdüsterte sein Gesicht.
»Zurück ins Bett, Helen«, befahl ihre Mutter streng und zwang sie, sich umzudrehen.
Helen ließ sich von ihrer Mutter neben die schlafende Ariadne legen. Doch als sie die Augen schloss und wieder einzuschlafen versuchte, hörte sie im Nebenzimmer Noel und Castor reden. Einen Moment lang bemühte sich Helen, ihre Stimmen auszublenden und nicht in ihre Privatsphäre einzudringen, aber ihre betroffenen Worte hätte nicht einmal ein Normalsterblicher überhören können.
»Woher hat er diese Narben, Castor?«, fragte Noel mit zittriger Stimme. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Und ich habe schon einiges zu sehen bekommen.«
»Solche Narben kann ein Scion nur in frühester Jugend davontragen«, erklärte Castor und versuchte, seine Stimme zu dämpfen.
»Aber unsere Jungs haben pausenlos gekämpft, als sie klein waren. Weißt du nicht mehr, wie Jasons Speer Lucas an der Decke festgenagelt hat? Und die drei haben nicht eine einzige Narbe davongetragen«, ereiferte sich Noel, ohne auf Castors Hinweis einzugehen, dass sie leiser sprechen sollten.
»Unsere Jungs hatten immer ausreichend Nahrung und einen sauberen Ort für ihre Heilung, nachdem sie aufeinander losgegangen waren.«
»Und Orion nicht? Willst du das damit sagen?« Noels Stimme brach.
»Nein. Wahrscheinlich hatte er das nicht.«
Helen hörte Castor tief seufzen.
»Diese Narben deuten darauf hin, dass Orion sehr jung war, als er so schwer verletzt wurde. Und danach muss er während seiner Heilung Hunger und Durst gelitten haben. Es war niemand da, der sich um ihn gekümmert hat. Dass du noch nie solche Narben bei einem Scion gesehen hast, liegt nur daran, dass die meisten eine solche Verletzung nicht überlebt hätten.«
Helen biss die Zähne zusammen und drehte ihr Gesicht ins Kissen, denn sie wusste genau, dass jeder im Obergeschoss das Gespräch von Noel und Castor gehört hatte. Ihr Gesicht glühte bei der Vorstellung, wie jetzt alle über Orion dachten – wie sie den gequälten und vernachlässigten kleinen Jungen bedauerten, der er einst gewesen war.
Er hatte etwas Besseres verdient. Er verdiente Liebe, nicht Mitleid. Helen spürte, dass ihre Mutter sie ansah, als sie versuchte, gegen die Tränen anzukämpfen. Sie zog sich die Bettdecke über den Kopf.
Daphne ließ ihre Tochter weinen, bis sie in einen tiefen Schlaf versunken war.
Helen sah, wie ihr anderes Ich von einer wütenden Menge zu Boden getreten wurde.
Das Kleid der anderen Helen war zerrissen und voller Flecken von den verdorbenen Früchten, die man auf sie geworfen hatte. Aus einer großen Schnittwunde am Kopf lief Blut, ebenso aus ihrem Mund, und auch die Schürfwunden an ihren Handflächen, die sie sich bei den Stürzen zugezogen hatte, bluteten. Die aufgebrachte Menschenmenge umkreiste sie. Die Leute hoben Steine auf.
Ein blonder Mann, doppelt so alt wie Helen und fast doppelt so groß, rannte auf sie zu und schlug mit den Fäusten auf sie ein. Es schien, als wäre er erst zufrieden, wenn er seinen eigenen Körper gegen sie einsetzte.
»Ich habe dich mehr geliebt als jeder andere! Dein Ziehvater hat dich mir versprochen!«, schrie er außer sich vor Wut, während er weiter auf sie einschlug. Die Augen quollen ihm fast aus dem Kopf und Spucke sprühte aus seinem Mund. »Ich werde dir das Kind aus dem Leib prügeln und dich dennoch lieben!«
Helen konnte hören, wie die aufgebrachte Menge ihn anfeuerte. »Töte sie, Menelaos!« und »Sie könnte den Tyrannen in sich tragen! Verschone sie nicht!«
Die andere Helen wehrte sich nicht und setzte auch ihre Blitze nicht ein, um sich gegen Menelaos zu verteidigen. Helen sah zu, wie ihr anderes Ich so oft niedergeschlagen wurde, dass sie irgendwann nicht mehr mitzählen konnte, aber die andere Helen stand immer wieder auf. Helen konnte die dumpfen Schläge hören und auch, wie der Mann vor Anstrengung schnaufte, aber die andere Helen weinte nicht und flehte ihn auch nicht an, endlich damit aufzuhören. Sie gab überhaupt keinen Laut von sich, abgesehen von den erstickten Schnaufern, wenn die Schläge des Mannes ihr die Luft aus der Lunge trieben.
Helen wusste genau, wie sich diese Fäuste anfühlten. Sie wusste sogar, wie Menelaos gerochen hatte, als er auf sie einschlug. Sie konnte sich daran erinnern.
Schließlich fiel Menelaos auf die Knie, nicht in der Lage, noch länger auf sie einzuprügeln. Die andere Helen war einfach zu stark, um durch seine Hand zu sterben, auch wenn Helen klar war, dass es genau das war, was ihr anderes Ich die ganze Zeit beabsichtigt hatte.
Als sie vom ersten Stein getroffen wurde, duckte sie sich nicht und versuchte auch nicht, sich zu schützen. Es folgten weitere Steine, die von allen Seiten auf sie einprasselten, bis die wütende Menge keine Steine mehr zum Werfen fand. Aber die andere Helen starb immer noch nicht. Das verunsicherte die aufgebrachte Menschenmenge so sehr, dass sie zurückwich.
Schockiertes Schweigen breitete sich aus, als sie das grausige Ergebnis ihrer Angriffe betrachtete. Die andere Helen, die immer noch lebte, lag schwer verwundet zwischen den Steinen, das Fleisch bis auf die gebrochenen Knochen aufgerissen. Sie begann, leise vor sich hin zu summen – in dem verzweifelten Bemühen, sich von den grauenvollen Schmerzen abzulenken. Sie wiegte sich vor und zurück, doch es gab keine Position, die ihr zumindest etwas Erleichterung verschaffte. Und so schwankte sie hin und her und summte weiter, um sich, so gut es ging, selbst zu beruhigen. Helen erinnerte sich an die Schmerzen, obwohl sie diese Qualen lieber aus ihrem Gedächtnis gestrichen hätte.
Die Umstehenden begannen zu flüstern. »Schlagt ihr den Kopf ab. Das ist die einzige Lösung. Sie wird erst sterben, wenn wir sie köpfen.«
»Ja, nehmt ein Schwert«, rief die andere Helen schwach. Durch die eingeschlagenen Zähne waren die Worte kaum zu verstehen.
»Zeig doch jemand Gnade und erlöse sie!«, schrie eine Frau verzweifelt, und die Menge stimmte ein. »Ein Schwert! Wir brauchen ein Schwert!«
Ein junger Mann trat vor. Beim Anblick der anderen Helen strömten ihm die Tränen übers Gesicht. Er zog sein Schwert, schwang es hoch über seinen Kopf und ließ es auf das blutüberströmte Mädchen niedersausen.
Ein schlanker Arm stieß die Klinge zur Seite, bevor sie zuschlagen konnte.
Eine Frau erschien. Sie war in goldenes Licht gehüllt und ihre Form wandelte sich ständig. Sie war jung und alt, dick und dünn, dunkelhäutig und hellblond. In diesen wenigen Augenblicken war sie jede Frau der Welt und alle waren wunderschön. Anscheinend mit Absicht nahm sie schließlich eine Form an, die Helen verblüffend ähnlich sah.
»Meine Schwester!«, schluchzte sie und hob das verletzte Mädchen aus dem Geröll. Weinend hielt Aphrodite die andere Helen in den Armen und wischte ihr mit ihrem schimmernden Schleier das Blut aus dem Gesicht.
Die Menge wich vor der weinenden Göttin zurück, deren Magie sich nun auch auf ihre Gefühle auswirkte. Helen konnte sehen, wie Aphrodite ihnen das Herz brach.
»Lass mich gehen«, flehte die andere Helen die Göttin an.
»Niemals«, gelobte die Göttin. »Lieber würde ich eine Stadt bis auf die Grundmauern niederbrennen sehen, als dich zu verlieren.« Die andere Helen wollte widersprechen, aber Aphrodite brachte sie zum Schweigen und richtete sich auf. Helen hielt sie dabei in den Armen wie ein Baby.
Die Göttin der Liebe funkelte die Menschenmenge an. Ihre Augen und ihr Mund glühten, als sie alle mit donnernder Stimme verfluchte:
»Ich verlasse diesen Ort. Von nun an soll kein Mann mehr Lust empfinden und keine Frau mehr fruchtbar sein. Ihr alle werdet ungeliebt und kinderlos sterben.«
Als sie sich mit der Göttin in die Lüfte erhob, konnte Helen das Flehen der Menschen hören. Anfangs kamen die Rufe nur zögerlich, denn die Leute waren verwirrt. Aber schon bald erklang lautes Jammern und Wehklagen, weil die Menschen begriffen, wie ein paar wütende Worte einer Göttin ihre Zukunft verdüstert hatten. Aphrodite flog, mit ihrer geliebten Schwester in den Armen, über das Wasser davon und ließ den verfluchten Ort für immer hinter sich.
Weit entfernt am Horizont ragte der Mast eines großen Schiffes auf – eines trojanischen Schiffes, wie Helen sich erinnerte. Die Göttin flog direkt darauf zu.
Matt starrte hinaus auf den dunklen Horizont. Der Wind vom Meer war kalt und der Himmel so voller Sterne, dass es aussah, als hinge eine Stadt kopfüber in der Nacht. Er hatte die beiden längsten Tage seines Lebens hinter sich, dennoch war er nicht müde. Jedenfalls nicht körperlich. Seine Muskeln taten nicht weh und auch seine Beine waren nicht schwer. Genau genommen hatte er sich nie besser gefühlt.
Matt betrachtete den Dolch in seiner Hand. Er war aus Bronze, und obwohl er unvorstellbar alt war, war die Klinge doch rasiermesserscharf und die Waffe vom Heft bis zur Spitze perfekt ausbalanciert. Matt legte sich den reich verzierten Dolch auf die Handfläche und beobachtete, wie sich der Griff an die Muskeln seiner Hand schmiegte, als wäre das eine für das andere gemacht. Fragt sich nur, was für wen, dachte er missmutig.
Zachs Blut war von der Klinge abgewaschen, aber Matt bildete sich ein, es immer noch sehen zu können. Jemand, den er sein ganzes Leben lang gekannt hatte, war mit diesem Dolch in seinem Herzen gestorben und hatte ihm die Waffe vererbt. Aber lange vorher hatte sie einen anderen, viel berühmteren Meister gehabt.
Die Griechen glaubten, dass die Seele eines Helden in seinen Waffen steckte. Die Ilias und die Odyssee berichteten von Kriegern, die tödliche Kämpfe um diese Waffen austrugen. Manche waren sogar so ehrlos, dass sie versuchten, sich die Schwerter und Brustpanzer der größten Helden anzueignen, um die Seele und die Fähigkeiten dieser Helden zu erlangen. Ajax, einer der am meisten bewunderten Krieger aufseiten der Griechen, hatte sogar einen Überfall auf seine Mitstreiter geplant, um Hektors Waffen an sich zu bringen. Doch als Ajax aus seinem Wahn erwachte, war er so entsetzt darüber, seinen guten Namen beschmutzt zu haben, dass er sich in sein eigenes Schwert stürzte. Diesen Teil der Ilias hatte Matt nie richtig verstanden. Er würde nie um die Waffen eines anderen kämpfen, nicht einmal, um der größte Krieger zu werden, den die Welt je gesehen hatte. Solcher Ruhm interessierte ihn nicht.
Matt warf den Dolch so weit er konnte hinaus in das schäumende Wasser. Er drehte sich in der Luft immer wieder um sich selbst und flog unendlich lange. Matt beobachtete, wie unfassbar weit und schnell der Dolch flog. Viele Sekunden später hörte Matt trotz des Rauschens der Wellen, wie er mit einem leisen Platschen im Wasser landete.
Kein normaler Mensch konnte so weit werfen und dann auch noch das Platschen hören. Bis jetzt hatte Matt sich immer auf die Logik verlassen, wenn es ein Problem zu lösen galt, aber diesmal sagte ihm seine Logik etwas so Unglaubliches, dass sie eigentlich gar nicht mehr anwendbar war.
Insgeheim hatte er auf so etwas gehofft. Aber nicht so. Nicht, wenn dies die Rolle war, die man ihm zugedacht hatte. Matt verstand es nicht … Wieso er? Er hatte kämpfen gelernt, weil er seinen Freunden helfen wollte, nicht aber, um anderen wehzutun. Matt hatte schon sein ganzes Leben lang die beschützt, die sich nicht selbst schützen konnten. Er war kein Killer. Er war ganz anders als der erste Mann, dem dieser Dolch gehört hatte.
Eine Welle schwappte bis an Matts Füße und ließ etwas Glänzendes auf dem Sand zurück. Er brauchte es nicht aufzuheben, um zu wissen, was es war. Er hatte den Dolch nun schon drei Mal ins Meer geworfen und das Meer hatte ihn drei Mal in einem nahezu unfassbaren Tempo zu ihm zurückgebracht.
Die Parzen hatten jetzt ein Auge auf Matt geworfen, und er hatte keine Chance, sich vor ihnen zu verstecken.
Das Schiff hatte quadratische weiße Segel. Am höchsten Mast über ihnen wehte ein dreieckiges rotes Banner mit einer goldenen Sonne. Aus den Seiten des Rumpfes ragte Reihe um Reihe langer Ruder. Schon aus der Luft konnte Helen die Paukenschläge hören, die den Ruderern den Takt vorgaben.
Das Wasser hatte nicht die dunkelblaue Farbe des Atlantiks, sondern war von einem klaren hellen Blau – demselben Juwelenblau wie die Augen von Lucas. Azurblau, dachte Helen. Die andere Helen, die darum kämpfte, nicht das Bewusstsein zu verlieren, stöhnte in Aphrodites Armen, als die Göttin mit ihr das Schiffsdeck ansteuerte.
Als Aphrodite landete, schrie die Besatzung vor Angst auf. Ein großer Mann trat hinter seinem Kommandoposten am Steuer hervor. Helen erkannte ihn sofort.
Hektor. Er sah ganz genauso aus wie der Hector, den Helen in Nantucket kannte, abgesehen von seinen Haaren und seiner Kleidung. Dieser Hektor hatte längere Haare und er trug ein kurzes Kleidungsstück aus Leinen mit einem breiten Ledergürtel. Seine Hände waren mit Lederstreifen umwickelt und ein schweres Schmuckstück aus Gold umgab seinen Hals. Er sah auch halb nackt noch königlich aus.
»Aeneas!«, rief Hektor über die Schulter und starrte das Mädchen in Aphrodites Armen fassungslos an. Das Ebenbild von Orion – allerdings ohne die entstellenden Narben auf der nackten Brust und dem Rücken – sprang herbei und stellte sich respektvoll neben Hektor auf. »Geh nach unten und wecke meine Brüder.«
»Beeil dich, mein Sohn«, wisperte Aphrodite Aeneas zu. »Und bring Honig.« Er nickte seiner Mutter gehorsam zu und eilte davon, doch sein Blick verweilte noch lange auf der anderen Helen. Seinem Gesicht war die Trauer deutlich anzusehen.
»Wasser!«, brüllte Hektor, und sofort setzten sich viele Füße in Bewegung, um seinem Befehl nachzukommen. Nur einen Moment später kam Paris aus dem Unterdeck gerannt, dicht gefolgt von Jason. Wie die anderen Versionen der Männer, die sie kannte, sah auch Jason ganz genauso aus wie sein heutiges Ebenbild – bis auf seine Kleidung.
Als Paris begriff, wen Aphrodite in ihren Armen hielt, stieß er einen Schrei aus und rannte mit weichen Knien auf die andere Helen zu. Seine Hände zitterten, als er sie Aphrodite aus den Armen nahm, und er wurde ganz bleich.
»Troilus«, sagte Hektor zu Jason und bedeutete seinem jüngsten Bruder mit einer Kopfbewegung, den Eimer Wasser zu übernehmen, der gerade gebracht worden war. Doch als Paris ihr den Becher an die Lippen halten wollte, versuchte die andere Helen schwächlich, ihn wegzustoßen.
»Was ist passiert, Herrin?«, fragte Troilus Aphrodite, als klar wurde, dass Paris nichts sagen wollte oder konnte.
»Menelaos und die ganze Stadt haben sich auf sie gestürzt, als sie von dem Baby erfuhren«, sagte die Göttin geradeheraus.
Paris fuhr hoch und starrte Aphrodite fassungslos an. Hektor und Aeneas tauschten einen kurzen verzweifelten Blick und sahen dann beide Paris an.
»Du wusstest es nicht, Bruder?«, fragte Hektor sanft.
»Ich hatte es gehofft«, gestand er mit gedämpfter Stimme. »Sie hat mich belogen.«
Die Umstehenden nickten, als könnten sie Helens Entscheidung verstehen.
»Der Tyrann.« Aeneas wisperte es nur, aber es war klar, dass alle anderen dasselbe dachten. »Mutter, wie hat Menelaos herausgefunden, dass Helen schwanger ist?«
Aphrodite fuhr zart mit den Fingerspitzen über die Schulter ihrer Halbschwester. »Helen hat gewartet, bis euer Schiff hinter dem Horizont verschwunden war, und es Menelaos dann selbst gesagt.«
Paris begann am ganzen Körper zu zittern. »Warum?«, fragte er die andere Helen, und man konnte ihm anhören, dass er den Tränen nahe war. Die andere Helen strich ihm beruhigend über die Brust.
»Es tut mir leid«, flüsterte sie und legte sich eine Hand auf den Bauch. »Ich habe es versucht, aber ich konnte es nicht. Ich konnte uns nicht selbst töten.«
Troilus lehnte sich gegen Paris und hielt seinen Bruder mit seinem Körper aufrecht, während alle anderen Helen mit einer Mischung aus Bewunderung und Verzweiflung ansahen.
»Trauere nicht, Paris. Dein Kind lebt«, sagte Aphrodite. »Deine Tochter wird genauso wunderschön werden wie Helen, und deine Enkeltochter wird ebenso schön aussehen – und so wird es weitergehen, bis diese Linie ausstirbt. Dafür habe ich gesorgt, damit ich auch dann noch in das Antlitz schauen kann, das ich auf dieser Welt am meisten liebe, wenn meine halb-sterbliche Schwester eines Tages nicht mehr da ist.«
Die goldene Aura der Göttin fing wieder an zu glühen. Sie sah die Männer von Troja einen nach dem anderen an und ihre Stimme klang plötzlich wie das Grollen von weit entferntem Donner.
»Ihr müsst mir alle schwören, dass ihr meine Schwester und ihr ungeborenes Kind schützen werdet. Wenn Helen und die Linie ihrer Töchter stürben, gäbe es auf der Erde nichts mehr, das ich lieben würde«, sagte sie und sah ihren Sohn Aeneas einen Moment lang entschuldigend an, bevor sie auch ihn mit einem finsteren Blick bedachte. Er ließ betrübt den Kopf hängen und Aphrodite wandte sich Hektor zu. »Solange meine Schwester lebt und die Linie ihrer Töchter weiter besteht, wird es Liebe auf der Welt geben. Das schwöre ich auf den Styx. Aber wenn du Helen sterben lässt, Hektor von Troja, Sohn des Apoll, werde ich diese Welt verlassen und die Liebe mitnehmen.«
Hektor schloss einen Moment lang die Augen, als ihm die Tragweite dieser Drohung bewusst wurde. Als er sie wieder öffnete, war klar, dass er sich geschlagen gab. Was für eine Wahl hatten sie denn auch? Er sah seine Brüder und Aeneas an, und sie kamen wortlos überein, dass sie nicht ablehnen konnten, auch wenn die Konsequenzen fürchterlich sein würden.
»Wir schwören es, Herrin«, sagte Hektor schließlich.
»Nein, Schwester. Tu das nicht. Menelaos und Agamemnon haben einen Pakt mit den anderen griechischen Königen geschlossen. Sie werden Troja mit geballter Stärke angreifen«, stöhnte die andere Helen eindringlich.
»Natürlich werden sie das. Und wir werden uns zur Wehr setzen«, versicherte Paris so düster, als könnte er die Kriegsschiffe bereits sehen, die zweifellos schon bald ihre Küste ansteuern würden. Er hob Helen hoch, obwohl sie kraftlos versuchte, sich zu wehren.
»Wirf mich über Bord und lass mich ertrinken«, flehte sie. »Bitte. Beende es, bevor es beginnt.«
Paris antwortete nicht. Er hielt sie an sich gedrückt und trug sie unter Deck und in seine Koje. Erst jetzt verlor die andere Helen das Bewusstsein, und Helens Besuch in diesem furchtbaren Traum oder der Vision oder was es sonst gewesen war, endete abrupt und sie fiel in einen tiefen Schlaf.
2
Andy starrte das Metronom auf der Orgel, an der sie gerade spielte, gereizt an und wünschte, das Ding würde explodieren. Was es nicht tat. Sie holte tief Luft, wartete ein paar Takte ab und versuchte es dann erneut mit Bach. Zehn Ausschläge des Metronom-Pendels später fluchte sie mit zusammengebissenen Zähnen vor sich hin und schüttelte die Fäuste in der Luft, um nicht auf die Tasten einzuschlagen. Ein Instrument zu misshandeln war für sie eine unverzeihliche Sünde. Ein Metronom dagegen …
»Du kannst froh sein, dass du eine Antiquität bist«, erklärte sie dem Gerät, nur damit es wusste, wie knapp es seiner Verwandlung in ein Häufchen Splitter entgangen war. Dann vertrieb sie alle Gedanken aus ihrem Kopf und unternahm einen neuen Versuch.
Diesmal ließ sie einfach Bach die ganze Arbeit machen und schaffte es tatsächlich etliche Minuten, im Takt zu bleiben.
Wundervoll. Zumindest, bis das Piepen einer Eieruhr sie aus ihrer Verklärung riss. Andys Finger glitten mit einem ohrenbetäubend lauten Misston von den Tasten, den nur eine riesige, hundert Jahre alte Orgel hervorbringen konnte.
»Jetzt schon?«, fragte Andy das himmlische Glühen des Buntglasfensters hoch über ihrem Kopf. Aber nicht einmal die Schönheit des Glases, das ihr Gesicht angenehm wärmte, reichte aus, um sie zu beruhigen. Gerade jetzt, wo sie das Stück endlich hingekriegt hatte, musste sie aufhören.
Sie unterdrückte das Verlangen, in der Kirche zu fluchen, und sah auf ihre Uhr. Schon acht. Mist. Ihre Probenzeit war vorbei, und um noch rechtzeitig zur ersten Stunde zu kommen, würde sie sich beeilen müssen.
Es war lausig kalt. Draußen spähte die Sonne gerade erst über das hinterste Schulgebäude. Andy verkroch sich in den unförmigen Wollschichten, unter denen sie wie immer ihre umwerfende Figur verbarg, und hastete auf ihrer üblichen Abkürzung durch die froststarren Büsche. Obwohl es, genau genommen, keine Abkürzung war, sondern ein Umweg. Wichtig war nur, dass sie den Hauptweg und die anderen Schüler mied. Andy suchte an ihrer Schule nicht nach Freunden. Sie war gern allein. Zumindest redete sie sich das ein. In Wirklichkeit hasste sie es, fühlte sich aber sicherer als in der Gesellschaft von anderen Menschen.
»Ich habe dich spielen sehen«, sagte ein junger Mann hinter ihr.
Andy kreischte vor Schreck auf und fuhr herum. Es war ein großer, gut aussehender Typ mit goldenen Locken. Seine Silhouette funkelte im schwachen Sonnenlicht dieses kalten Novembermorgens.
»Was machst du hier?«, fragte Andy betont gelassen. Die Sonne schien ihr in die Augen. Sie blinzelte und sah sich unauffällig nach anderen Leuten um. Das Wellesley College war eine reine Mädchenschule im blaublütigsten, hochnäsigsten und traditionellsten Teil von Massachusetts. Wenn dieser Typ kein Lehrer oder Wachmann war, hatte er ohne Besucherausweis auf dem Schulgelände nichts verloren.
»Du hast wirklich Talent«, sagte er und trat näher an sie heran.
»Du sagst, du hast mich gesehen?«, fragte Andy und wich einen Schritt zurück, denn die Nähe des Mannes wurde immer unerträglicher. »Wie konntest du mich in der Kirche sehen? Ich war allein dort.«
Er lachte und seine Stimme tanzte dabei nur so durch die Luft. »Ich war natürlich nicht in der Kirche. Ich habe dich durch das große Fenster gesehen.«
»Du hast mich durch das Buntglasfenster gesehen? Wie willst du das denn gemacht haben?«
»Jemanden, der so schön ist wie du, würde ich überall finden, egal, wo er sich versteckt. Du bist so strahlend schön – ich wette, dass du sogar im Dunkeln leuchtest.«
So, wie er die Worte sagte, klangen sie kein bisschen aufgesetzt. Er war nicht anzüglich, aber er kam immer näher auf sie zu, obwohl er doch merken musste, wie unangenehm ihr das war. Als er direkt vor ihr stand, sah Andy, dass mit seinen Augen etwas nicht stimmte. Sie hatten etwas von einem Tier und wirkten kein bisschen menschlich. Sie musste wieder an das Sonnenlicht denken, das durch das Buntglasfenster gefallen war, und erkannte, wie er sie beobachtet hatte. Sie wusste jetzt auch, mit wem oder vielmehr was sie es zu tun hatte. Andy wich hektisch zurück und Panik verwandelte ihr Atmen in ein angstvolles Keuchen.
»Wirst du vor mir weglaufen?«, fragte der junge Mann erwartungsvoll, als wäre ihm so etwas schon viele Male passiert.
»Würdest du mich denn jagen?«, fragte Andy in dem verführerischen, leicht hypnotischen Ton, der normalsterbliche Männer in den Tod treiben konnte. Sie musste Zeit schinden und ihn vielleicht dazu bringen, dass er ihr bis zum Hauptweg folgte. Dort würde sie bestimmt jemanden finden, der ihr helfen konnte.
»Natürlich würde ich das«, antwortete er halblaut und mit glühendem Blick. Er war zwar entbrannt, aber nicht hypnotisiert – Pech für Andy. »Nur die, die fliehen, sind es wert, dass man sie einfängt.«
Ist das nicht mal wieder typisch?, dachte sie mit dieser verzweifelten Heiterkeit, zu der man nur in ausweglosen Situationen fähig ist. Da habe ich mein Leben lang panische Angst, einen Jungen zu verführen, und ausgerechnet an einer Mädchenschule rückt mir einer auf die Pelle.
Wieder strahlte er ein Licht aus, das seine Silhouette betonte und ihn noch etwas echter als echt wirken ließ, als existierte er in 4-D.Andy war klar, dass nicht die aufgehende Sonne diesen Effekt verursachte. Sie wusste auch, dass dieser Typ kein normaler Verehrer war. Ihre Mutter hatte sie gewarnt, dass so etwas passieren konnte, aber Andy hatte nie damit gerechnet, dass es wirklich geschehen würde.
»Hey, Andy!«, rief ein nervig aufgewecktes Mädchen, das Andy vor über einem Monat bei einem Einführungsvortrag für die Erstsemester kennengelernt hatte und dem sie seither aus dem Weg gegangen war. Seine plappernden Freundinnen verstummten schlagartig, als sie sahen, dass Andy bei einem Jungen stand. »Kommst du mit in den Hörsaal?«
»Hi … Susan!«, rief Andy hektisch – zum Glück war ihr der Name des Mädchens gerade rechtzeitig wieder eingefallen. »Wartet auf mich! Ich komme!«
Als die schwatzende Mädchengruppe näher kam, lächelte der wunderschöne junge Mann Andy traurig an. Dann fuhr er herum und rannte in Richtung See davon.
»Wohin will denn dein Freund?«, fragte Susan verblüfft.
»Das ist nicht mein Freund«, sagte Andy und griff erleichtert nach Susans Hand, die in einem warmen Handschuh steckte. »Wir müssen zum Sicherheitsdienst, und zwar sofort.«
»Ich kann ihn beschreiben!«, rief ein Mädchen mit glänzenden schwarzen Haaren aufgeregt. »Der muss gefroren haben, denn er hatte nur Jeans und T-Shirt an!«, berichtete sie dem Wachmann.
»Er hatte lockige blonde Haare und war echt braun gebrannt. Wie einer von diesen Malibu-Surfer-Typen«, stieß ein molliges Mädchen mit spaghettiglatten blonden Haaren hervor und konnte seine Begeisterung kaum im Zaum halten.
»Er hatte auch total glatte Haut. Wie ein Delfin!«, erzählte die Dunkelhaarige der Blonden fasziniert, und beide fingen an zu gackern.
Andy ließ das Gesicht in ihre Hand sinken und rieb sich die Augen, während sie sich ähnliche Kommentare von den anderen Augenzeuginnen anhörte – oder »Fans«, wie sie sie insgeheim schon nannte. Sie musste sich wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Mädchen nichts für ihre Reaktionen konnten. Schließlich waren sie nur Menschen.
Nachdem sie die nächsten zwei Stunden im Büro des Sicherheitsdienstes verbracht und die ganze Geschichte erzählt hatte und dann noch mit einigen Wachleuten an die Stelle zurückgekehrt war, an der der Typ sie angesprochen hatte, nahm Andy dankbar einen neuen Schlüsselanhänger entgegen. Sie hatte jetzt offiziell einen Stalker, der das Schulgelände unbefugt und dazu noch ohne Ausweis betreten hatte, und das Wachpersonal würde sie ganz sicher nicht herumwandern lassen, ohne ein paar Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Der neue Anhänger an ihrem Schlüsselbund war ein Panikschalter, auf den die Wachleute sofort reagieren würden. Sie sollte gleich auf den Knopf drücken, wenn sie den Jungen wiedersah. Andy fragte sich, ob sie das wirklich tun und diese Leute in Gefahr bringen würde oder ob sie ihm lieber allein gegenübertreten sollte.
Susan und ihre Begleiterinnen hatten Andys Bericht zwar bestätigt, konnten die Aufregung aber nicht recht verstehen. Andy hatte Wort für Wort erzählt, was der Junge zu ihr gesagt hatte, und jede von ihnen hätte alles dafür gegeben, so etwas von einem dermaßen gut aussehenden Typen zu hören.
Andy konnte ihnen nicht erklären, dass es hier nicht um eine Romanze ging. Männer sagten dauernd solche Sachen zu ihr, aber das hatte mit Liebe nichts zu tun. Sie hatte ihre ganze Schulzeit an katholischen Mädchenschulen verbracht und war jedem männlichen Wesen ausgewichen, das hinter ihr her gewesen war, was die Kerle jedoch nicht daran hinderte, ihr weiter nachzulaufen. Sie war auch vor den vielen Mädchen geflüchtet, die sie verfolgt hatten. Nach diesem grässlichen Erlebnis in der siebten Klasse, als ihre beste Freundin versucht hatte, sie mitten in der Geschichtsstunde von Schwester Mary-Francis zu küssen, hatte sie jede weitere Mädchenfreundschaft gemieden.
Andy hielt sich grundsätzlich von anderen Menschen fern. Es war zu ihrem eigenen Besten. Leute wie sie waren für Normalsterbliche einfach zu gefährlich.
Irgendwie schaffte sie es mehrere Schulstunden später, Susan und ihre Freundinnen abzuschütteln. Als Andy keinen Zweifel daran ließ, dass sie sich zurückziehen würde, hatte Susan sie besorgt angesehen. Sie tat Andy ein wenig leid. Susan war hübsch und beliebt und schien ein wirklich guter Mensch zu sein. Genau aus diesem Grund musste Andy die Freundschaft bereits im Keim ersticken. Sie wollte nicht, dass eine so nette Person wie Susan zu Schaden kam, nur weil sie gern eine Freundin gehabt hätte. Susan hatte etwas Besseres verdient.
Es war schon nach neun Uhr abends, als Andys Astronomiekurs endete und sie am Teich vorbei zum Wohnheim ging. Weil ihre Nase juckte, nahm sie die Hand aus der Tasche und ließ den Alarmknopf nur einen ganz kurzen Augenblick los. Genau in diesem Moment umschlangen kräftige muskulöse Arme von hinten ihre Brust.
»Lauf«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Ich liebe die Jagd.«
Helen träumte von Delfinen, aber es war kein netter Traum vom Besuch in Sea World. Der Delfin, den Helen sah, führte keine Kunststücke vor. Der Delfin in ihrem Traum jagte ein Mädchen in ihrem Alter. Sie versuchte, vor ihm davonzuschwimmen, aber der Delfin drückte sie immer wieder unter Wasser und schlug mit den Flossen und dem Schwanz auf sie ein, bis sie blutete.
Das Mädchen schwamm auf eine Boje zu, die mitten im Nirgendwo herumdümpelte, und keuchte beim Kampf gegen die Wellen. Der Delfin griff erneut an, doch diesmal waren es keine Flossen, sondern die Arme eines Mannes, die das Mädchen packten und fest zudrückten.
Helen riss die Augen auf und schnappte nach Luft, denn es fühlte sich an, als steckte ihre Brust in einem Schraubstock. Draußen war es noch dunkel.
Wie viele Tage mochte sie so vor sich hingedämmert haben? Sie konnte sich erinnern, wie ihre Mutter mit einem feuchten Schwamm das Gröbste an Schmutz und Blut abgewaschen und Kate ihr löffelweise Suppe eingetrichtert hatte. Sie erinnerte sich auch an Orions Narben, und wieder ging ihr vor Mitleid das Herz über.
Helen erinnerte sich aber auch an andere Dinge – Dinge, die sie nie getan hatte, wie etwa eine Toga zu binden (einen Chiton, ermahnte sie sich; was bei den Römern die Toga war, hieß bei den Griechen Chiton) und Wolle zu spinnen. Helen Hamilton war allerdings absolut sicher, dass sie in ihrem ganzen Leben noch keinen Chiton gebunden oder Wolle gesponnen hatte, und doch erinnerte sie sich an beides.
Diese »Visionen« von Helena von Troja hatten sich immer wie Erinnerungen angefühlt, und jetzt, wo Helen richtig wach war, war sie überzeugt, dass es tatsächlich welche waren. Aber wie konnte sie sich an das Leben einer anderen Person erinnern? Das war unmöglich. Und wenn man dann noch bedachte, wie zermürbend diese Erinnerungen waren, wollte Helen eigentlich nur noch wissen, wie man sie abstellte.
»Lennie?«, flüsterte Claire irgendwo in der Nähe von Helens Füßen.
Helen sah Claire über die Rückenlehne der Couch spähen, die Ariadne am Fußende des Bettes stehen hatte. Gewöhnlich warf Ariadne dort ihre Klamotten hin und deshalb hatte Helen sie eher als eine Art Kleiderablage betrachtet und weniger als Sitzgelegenheit.
»Bist du richtig wach oder nur eine Sekunde zu Besuch unter den Lebenden?«, fragte Claire. Sogar in dem matten Sonnenaufgangslicht, das durchs Fenster fiel, konnte Helen sehen, wie besorgt Claire war.
»Ich bin wach, Gig.« Helen setzte sich mühsam auf. »Wie lange war ich weg?«
»Ungefähr zwei Tage.«
Das war alles? Helen kam es vor, als wären es Wochen gewesen. Sie sah hinüber zu Ariadne, die noch schlief. »Kommt sie wieder in Ordnung?«, fragte Helen.
»Klar«, sagte Claire. »Sie und Jason kommen wieder auf die Beine.«
»Und Orion? Lucas?«
»Die sind okay – noch etwas demoliert, aber es geht ihnen schon besser.« Claire schaute weg und runzelte die Stirn.
»Und mein Dad?«
»Er ist ein paarmal aufgewacht, aber immer nur für ein paar Sekunden. Ari und Jason tun ihr Bestes.«
Das war nicht die Antwort, auf die Helen gehofft hatte. Sie nickte und schluckte gegen den Kloß in ihrem Hals an. Ihr Vater war kein Scion und er war dem Tode näher gewesen als jeder von ihnen. Er würde viel länger brauchen, sich davon zu erholen. Helen verdrängte die Vorstellung, dass er sich womöglich nie ganz erholen würde, und sah Claire an.
»Und wie geht’s dir?«, fragte Helen, die die traurige Miene ihrer besten Freundin natürlich sofort bemerkt hatte.
»Todmüde. Und dir?«
»Halb verhungert.« Helen schwang die Beine aus dem Bett und Claire kam, um ihr zu helfen. Die Freundinnen wankten die Treppe hinunter und plünderten den Kühlschrank. Helen wusste natürlich, dass sie so viel essen musste, wie sie nur in sich hineinstopfen konnte, damit sich ihre heilenden Zellen schnell erneuerten, aber sie konnte den Blick nicht von Claire abwenden.
»Was ist los, Gig?«, fragte sie nach nur einem Löffel Hühnernudelsuppe einfühlsam. »Ist es wegen Jason?«
»Es ist wegen euch allen. Diesmal seid ihr alle verletzt worden. Und ich weiß, dass es damit nicht getan ist«, antwortete Claire, die immer noch ungewohnt traurig wirkte. »Uns steht ein Krieg bevor, stimmt’s?«
Helen legte den Löffel hin. »Ich weiß es nicht, aber die Götter können jetzt den Olymp verlassen und auf die Erde zurückkehren. Und das nur wegen mir.«
»Es ist nicht deine Schuld«, verteidigte Claire sie sofort. »Du bist ausgetrickst worden.«
»Und? Ausgetrickst oder nicht – ich habe versagt«, stellte Helen sachlich fest. »Ich habe mich von Ares in die Enge treiben lassen, obwohl ich gewarnt wurde, dass so etwas passieren könnte.«
Sie fühlte sich schrecklich, aber sie wusste auch, dass es keinen Sinn hatte, sich von ihren Schuldgefühlen überwältigen zu lassen, und verbannte deshalb jeden Anflug von Selbstmitleid aus ihrer Stimme. Die Unterwelt hatte sie gelehrt, dass Verzweiflung keine Probleme löste, auch wenn sie noch so gerechtfertigt schien. Sie behielt diese Erkenntnis für ihr nächstes Gespräch mit Hades im Hinterkopf und blieb beim Thema. »Sind die Götter schon irgendwo aufgetaucht? Haben sie schon irgendwas gemacht?«
Vor Helens innerem Auge tauchte plötzlich das Bild eines großen, wunderschönen Hengstes auf, der an einem Strand entlanggaloppierte. An seinen Vorderbeinen klebte Blut. Dieser widerliche Anblick ließ Helen schaudern.
»Wir haben noch nichts gehört«, sagte Claire mit einem Schulterzucken. »Jedenfalls nichts von diesem ›Zorn-der-Götter‹-Kram.«
»Was hat Cassandra vorhergesehen?«
»Nichts. Sie hat gar nichts prophezeit, seit ihr drei hergebracht wurdet.«
Helen presste nachdenklich die Lippen aufeinander. Ausgerechnet jetzt, wo die Scions ihr Orakel am Dringendsten brauchten, verstummte es. Aber das war bei griechischen Tragödien eben so. Trotzdem beunruhigte es Helen. Griechisch oder nicht, es musste einen Grund dafür geben, dass Cassandra die Zukunft nicht sehen konnte. »Weil das eben so ist«, ließ Helen als Antwort nicht mehr gelten.
»Len?«, murmelte Claire, und ihre Stimme war kaum mehr als ein verängstigtes Flüstern. »Kannst du die Götter aufhalten?«
»Ich weiß es nicht, Gig.« Helen musterte ihre beste Freundin.