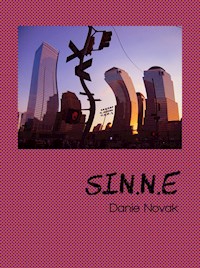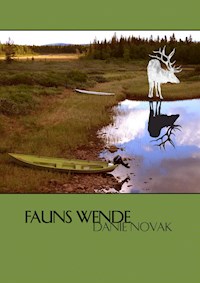
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die andere Welt war sein Alltag. Eine Welt hinter dem Vorhang der ersten Dimension. Bis heute. Und selbst heute war alles wie immer gewesen. Als könne sich nichts jemals dieser harmonischen Ordnung in den Weg stellen, als wären die Flügelschläge seiner Krähe eine in die Unendlichkeit reichende Institution. Dennoch hatte Pio diesen feinen Riss gespürt. Wie er die angestrebte Routine der feinfühligen Landschaft in ein seichtes Schwanken versetzt hatte. Es hatte ihn angespornt, die Fährte eines frischen Köders am Horizont. Keine Routine. War es nicht das, was er gesucht hatte? Das fehlende Glied in der Kette der schamanischen Tradition? Nachdenklich war Pio nach seinem Flug in die Wirklichkeit Italiens zurückgekehrt. Auch hier hatte sich das Echo der Veränderung draufgängerisch in der Luft gehalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fauns Wende
Danie Novak
Text und Cover Copyright © 2018 Danie Novak
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
1.Cornacchia
Pflichtgetreu schallten die Kirchenglocken über den Hauptplatz. Die Mittagshitze lag wie ein greller, schwerer Teppich auf den alten Marmorplatten, die sich eingerahmt von steinernen Fassaden in der brutalen Sonne aalten. Selbst die hartnäckigsten Brettspieler hatten sich in den Schatten der Arkaden zurückgezogen oder hielten ihre verdiente Siesta auf der Bank im Wohnzimmer.
Zwischen rostigen Müllcontainern, verborgen unter den tiefen Ästen der betagten Kastanie kauerte ein schmächtiger junger Mann auf einem Hinterhof. Die Haut in seinem Gesicht war von Pocken übersäht und winzige Schweißperlen glänzten darauf. Allein die Partie um Nase und Mund schimmerte in ihrer Festigkeit. Er atmete schwer.
So gut es ging, hatte er eine staubige Decke über seinen restlichen Körper gezogen und zählte die Minuten im Countdown hinunter. Zehn. Das war die Regel. Nicht immer hielt man sich daran.
Als er seine Finger zu fühlen begann, zog er die Hand sachte unter dem kratzigen Überwurf hervor und betrachtete das Bild, das sich ihm bot. Seine Fingerkuppen waren nur ansatzweise zu erkennen. Stattdessen trieben schwarze Fransen aus schmalen Spitzen und bildeten den Abschluss zu einem gleichfarbigen Federkleid, das sich bis weit über seinen Handrücken erstreckte. Behutsam strich er über das bläulich glänzende Schwarz, das sich langsam auszudünnen begann. Gesicht und Brust hatten längst ihre ursprüngliche Beschaffenheit angenommen. Es fehlten die Beine, die ledrig und viel zu schmal über den Boden wetzten.
Dem kleinen Zeh gehörte der Abschluss. Ihn zu spüren, bedeutete den Heimweg anzutreten. Vorsichtig tastete er sich mit den regenerierten Kuppen zu ihr vor und spähte um die Ecke des grauen Containers. Der Geruch von altem Fisch und der Zersetzung überlassener Milch stach überwältigend und erneut wandte er sich ab. Kehrte zurück zu dem süßlichen Duft, den die mannshohe Jasminhecke von der angrenzenden Hausmauer bis zu ihm hinüberschickte.
Es war niemand zu sehen gewesen. Bloß die gedämpften Laute eines Fernsehapparats drangen von irgendwoher zu ihm herab. In die muffige Decke gewickelt, huschte er an der Mauer entlang bis in die nächste Seitengasse. Die Schwärze der schattigen Hälfte verschluckte ihn und er eilte davon.
Er hatte nicht darauf geachtet und die Verwandlung hatte ihn schlichtweg im Flug überrascht. Hatte seine Pläne durchkreuzt und ihn seiner Kleider beraubt. In dem Schuppen bei der alten Mühle, hatte er sie wie immer vorsorglich deponiert gehabt. Ganz genauso wie sein Telefon und... Pio bereute es bereits. Es war ein Risiko gewesen, das es nicht wert gewesen war. Warum hatte er das alles nicht zuhause gelassen? Die erschwinglichen Stücke von der Stange hätte er sich irgendwann besorgen können.
Pio fluchte. Eine solche Fahrlässigkeit war ihm seit langem nicht mehr passiert. Er hatte die Warnsignale missachtet und zu spät reagiert. Viel zu spät. Es war allein den Eindrücken der letzten Stunden zu verdanken. Doch er hatte sich noch nicht entschieden, ob Dank auch das richtige Wort dafür war.
Am ganzen Körper zitternd stieg er die kalten Stufen in den zweiten Stock empor. Dort hielt er inne. Würde sie zuhause sein? Auch der Wohnungsschlüssel lag noch dort und nicht hier. In seiner Hosentasche, die er zu einem Knäuel gewickelt in der rostigen Blechtonne verstaut hatte.
Pio kniff die Augen zusammen und massierte die Stelle jenes Brillenabdrucks, der dort nicht war. Einen klaren Gedanken zu fassen, bedeutete momentan eine Höchstleistung, die er nicht zu erbringen vermochte. Erschöpft ließ er sich in die dunkle Ecke unter der letzten Treppe fallen. Die wenigen Holzstufen führten zum Dach des Hauses und waren ihm nicht unbekannt. Unmittelbar vor der schmalen Öffnung, die direkt auf die schadhaften Schindeln mündete, gab es einen etwa zwei Quadratmeter großen Raum. Der abgelegene Ort und der Ausgang nach Draußen waren es, die den beengten Platz zu einer idealen Startposition für seine Ausflüge machte. Jedenfalls, solange man es nicht dem Gott des Schicksals überließ.
Doch gerade heute hatte er sich für die Alternative im Schuppen entschieden und gerade heute war alles anders gekommen. Wirr drängten sich die Eindrücke der letzten drei Stunden in sein Gedächtnis zurück.
Der Wind, die Worte und der bedrohliche schwarze Punkt hoch oben am Himmel, so zielgenau über ihm. Pio kehrte zurück an den Anfang. Zu jener Szene, die sich so sicher wie das Amen im Gebet seiner Mutter für ihn wiederholen würde. Wie ein alternativloses Ritual zog es ihn mit sich dahin. Die winzige Scheibe in seiner Hand, bis er den geeigneten Startplatz gefunden hatte. Die Scheibe in seinem Mund, wo er behutsam mit der Zunge darüber streifte, bis sie sich merklich aufzulösen begann. Er verschluckte die bitteren Gedanken und wartete seelenruhig darauf, seine Reise anzutreten.
Ohne die rhythmischen Vibrationen der Lautsprecher spürte er die Nacktheit absolut. Ohne die grell flackernden Scheinwerfer. Die ekstatischen Tänzer. Er hatte allein auf seinem Querbalken im Schuppen gestanden und es war nur dieser zur Routine gewordenen Atmung zu verdanken, dass Pio sich nicht davon einschüchtern ließ. Und dass ihn der Wandels bald darauf überrollte, wie eine vierspurige Autobahn. Sein Bewusstsein hob ihn mit sich hinfort, bis es den Menschen mit seinem Namen dort nicht mehr gab. Vielleicht einen Abglanz, eine entmaterialisierte Brise seiner Erinnerung. Pio hätte es nicht sagen können, nur was man sich erzählte.
Wie eiskaltes Wasser überzog ihn dieses Anderssein und sog ihn hoch hinauf in die Lüfte. Es hatte keinen Zweck sich seinen Instinkten zu widersetzen. Es war die die Intuition der Krähe, die von nun an die Zügel schwang.
Die Fesseln der Ebene hielten sie beide nicht mehr. Allein der Wind war es, der nun Formen schuf. Seine Krähe erspürte die magnetischen Pfade und ließ sich von ihnen führen. Sie waren überall. Es gab Straßen, Wegweiser, Warnschilder. Gerüche, Geräusche und Ströme.
Doch die Krähe kannte ihren Weg. Es war der Weg nach Dort.
Als er es das erste Mal erreicht hatte, war es nicht mit Absicht passiert. Die Schwermut einer in die Brüche gegangenen Beziehung hatte ihn in eines seiner Outbacks flüchten lassen. Einsam und vom Leben isoliert, hatte er das Abseits gesucht und gefunden. Hatte zum Sound seiner Playlist getanzt und das Bewusstsein verloren. Bis ihn die Schwingen der Krähe gefunden hatten und mit ihnen ein neuer Horizont in sein Leben getreten war.
Wie ein heißkalter Schauer, überzog sie beide dieser Eintritt. Die Farben veränderten sich und blieben dennoch an ihrem Platz. Jedes Mal war er aufs Neue fasziniert von diesem Schauspiel. Das Vorhandensein und gleichzeitige nicht existieren einer Umwelt, vielleicht nur einer Perspektive. Der seinen.
Wie oft schon hatte er nach Antworten dafür gesucht und sie nicht erhalten. Die Kreaturen jener Welt waren wachsam, genau wie er selbst.
Auf einem sonnenverwöhnten Felsen im Wald war er auf eine edle Wildkatze getroffen. Ein Gepard. Selbst hier passte sie nicht in das Bild jener Landschaft. Mit einem einzigen Flügelschlag hatte sich seine Krähe auf dem ausladenden Ast einer Fichte niedergelassen und der eindrucksvoll traurige Blick hatte sein Gefieder fixiert. Eine klare Stimme war bis in Pios tiefstes Inneres gedrungen.
„Verdammt, Paolo! Was hast du hier zu suchen!“
Die dottergelbe Handtasche baumelte zwischen ihren rundlichen Fingern, während sie sich mit der anderen Hand herausfordernd am Türrahmen abstützte.
„Was ist das für ein widerlicher Fetzen?“ Es war schrill, viel zu schrill. „Wo sind deine Sachen?! Signore Gabattini hat mich letzte Woche nun schon zweimal deinetwegen angerufen!“
Pio stöhnte. Signore Gabattini war der Letzte auf seiner Liste der lebensrettenden Bekanntschaften. Signore Gabattini, nicht mehr als sein Chef.
„Na, was ist?! Sieh endlich zu, dass du aus diesem Loch kommst!“
Energisch bewegte sie sich auf ihn zu, doch Pio rührte sich nicht. Er hätte es nicht gekonnt. Mit ihrem kräftigen Griff beförderte sie ihn aus der Dunkelheit und hinein in ihre blendend polierte Küche.
„Sind es wieder diese Drogen? Sag schon? Hast du wieder diese vermaledeiten Pillen geschluckt, du Nichtsnutz!?“
Seine Mutter hatte diese aufbrausende Art, wie ein Sommersturm in den Bergen. Pio senkte den Blick zu den Fliesen. Taubengrau schillerten sie ihm entgegen. Es hatte keinen Sinn, seine Mutter in einer Situation wie dieser mit seinen Erklärungsversuchen zu überfordern. Früher oder später würde auch dieses Unwetter vorüberziehen und das Blut der Familie seine überlegene Rolle zurückerobern.
Ohne ein weiteres Wort, schleppte er sich in sein Zimmer, schloss die Tür hinter sich ab und suchte in seinem Schrank nach frischen Kleidern. Als er endlich das Passende gefunden hatte, hatte er Mühe sich den penetrant nach Weichspüler riechenden Stoff an seinem Körper vorzustellen. Das Shirt und die Jean fühlten sich rau an und starker Juckreiz ging von jenen Stellen aus, an denen sie seine Haut berührten. Irgendwann hatte er angefangen, dem Phänomen einen Namen zu geben. Theatralisch hatte er es seinen »Weltschmerz« getauft.
Der Drang, die textilen Konventionen sogleich wieder in einer Mülltonne zu entsorgen, war überwältigend. Doch nur halb so stark, wie sein Sturkopf der Vernunft. Pio würde nicht hierbleiben können. Er musste zurück zu der Mühle, bevor jemand anderes seine Sachen in die Hände bekam.
In der Einsamkeit der Straße atmete er mehrmals tief durch. Die Neuigkeiten aus dieser anderen Welt hatten ihn wie ein Pfeil getroffen. Hatten alles, was ihn bisher beschäftigt hatte, in den Hintergrund gedrängt. Das Mädchen, den Job, den Trip durch Europa.
Schnellen Schrittes steuerte er auf sein Auto zu. Wie jedes Jahr war die Fußgängerzone der Innenstadt in den Sommermonaten großzügig um die angrenzenden Geschäftsstraßen erweitert worden. Was zur Folge hatte, dass Parkplätze Goldwert besaßen und man das Hickhack der Anrainer auf ein Maximum trieb. Pio hasste den Sommer und diesen gottverdammten Stempel eines Weltkulturerbes. Wozu all die ganzen Eitelkeiten, wenn ein oder zwei Wohnblöcke den Unterschied machten?
Ohne darauf zu warten, dass sich die zwanzig Grad Temperaturunterschied von alleine aus dem Innenraum seines Wagens verabschiedeten, startete er den Motor. Der dunkelgraue Ford sprang sofort an und Pio hätte ihn dafür küssen können. Er liebte sein Auto, unbeeindruckt der stichelnden Kommentare seiner durch und durch italienischen Anverwandten.
Ein wenig zu ungestüm legte er den Weg zur Mühle in weniger als sechs Minuten zurück und parkte den Wagen auf dem Schotterstück direkt neben dem alten Schuppen. Drei Stunden zuvor hatte er den Weg hierher zu Fuß zurückgelegt, um mit seinem Auto in der Einöde keine allzu große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Jede Reise war riskant. Und es gab Dinge, bei denen er nichts zu riskieren gab.
Pio stieg aus und atmete die trockene Hitze eines trägen Nachmittags ein. Etwas stimmte nicht. Er hatte es sofort gespürt. Aufmerksam glitt sein Blick über das brüchige Bauwerk, dann über den angrenzenden Schuppen. Nur wenige Meter vom Wald entfernt, lag die ehemalige Mühle verlassen da. Spröde Holzplanken über dem ausgetrockneten Bachlauf boten ihr stets anderes Spiel von Licht und Schatten. Aber da war mehr. Es herrschte wieder diese tiefe Stille. Pio hatte nicht damit gerechnet, die Vögel singen zu hören, doch auch die im aufkommenden Wind tanzenden Blätter wirkten gedämpft. Ihr Schall erreichte ihn nicht. Es war nun bereits das zweite Mal, das ihn dieser Eindruck zu beunruhigen begann.
Gemächlich bewegte er sich auf die Rückseite des alten Schuppens zu. Die steinerne Mauer war an mehreren Stellen stark einbruchsgefährdet, dennoch drang nur wenig Licht in das geräumige Innere vor, das sich Jugendliche seit einiger Zeit als alternativen Partyraum einverleibt hatten. Den Haupteingang zu ihrem Reich bildete ein etwa quadratmetergroßes Loch versteckt hinter einer delogierten Schaufel jenes auf Grund gelaufenen Wasserrads.
Zwischen Glasscherben und benutzten Kondomen tastete sich Pio zum vorderen, von winzigen Sonnenstrahlen verwöhnten Bereich durch und hielt Ausschau nach der löchrigen Blechtonne. Sie war da. An exakt derselben Stelle wie zuvor. Pio ging neben ihr in die Hocke und hob sie etwas an, um nach dem Bündel darunter zu fassen. Seine Fingernägel schlugen in die hölzernen Planken des Bodens und fuhren hektisch durch den sandigen Belag darauf.
Hatte er sich geirrt? Benommen starrte Pio auf den leeren Fleck unter der Tonne.
„Verflucht!“
Mit dem irrwitzigen Flug seiner Faust beförderte er die hohle Tonne aus ihrem Gleichgewicht und sie verschwand polternd in einer der Ecken. Er musste sich einfach geirrt haben, anders war dieses Nichtvorhandensein von etwas Vorhandengewesenen nicht zu erklären. Bestimmt hatte er diesmal kurzfristig einen anderen Platz für seine Sachen gewählt.
Bestimmt. Hatte er das nicht. Das wusste er so sicher, wie dass die Stille an diesem Ort keine Laune eines stolzen Sommertags sein konnte.
Der Gedanke an den Verlust schnürte ihm die Kehle zu. Es war leichtsinnig gewesen, sie alle hierzulassen. Leichtsinnig, sie hier sicherer zu währen, als in den noch unentdeckten Verstecken seiner eigenen vier Wände.
Und es war leichtgläubig sich einzubilden, er benötigte den übertriebenen Vorrat an freundlich lächelnden Mondgesichtern nicht auch aus einem anderen Grund, im Wesentlichen ordinär. Mit dem Stoff auf seiner Schulter wischte er sich den Schweiß von der Stirn und machte sich auf die Suche. Womöglich hatte er Glück. Womöglich war die Bande hinterfotziger Scheunenwichser unvorsichtig genug gewesen, wenigsten einen Teil seiner Reserve zwischen den leeren Bierflaschen zu verstreuen.
Eingepfercht von alten Holzkisten und aus trockenem Gras geformten Sitzkissen, machte er sich an die Arbeit. Es war mühsam und genauso sinnlos. Nichts tauchte auf. Keine einzige, verdammt Socke hatte das minderjährige Diebespack zurückgelassen. Pio fluchte, bis ihm die Zunge trocken am Gaumen klebte. Es tat gut und es lenkte von der Erkenntnis ab, dass es schlichtweg ein riskanter Platz gewesen war.
Die Jugendlichen aus den umliegenden Ortschaften kamen immer häufiger hierher und Pio hatte bereits einige Male auf die versteckte Ruine im nahegelegenen Wald ausweichen müssen. Eine Entwicklung, die ihm nicht gefiel. Denn die Ruine war von seiner Wohnung aus ein gutes Stück weiter entfernt und mit dem Auto nicht direkt erreichbar. Zudem bot sie wenig Schutz an verregneten Tagen.
Ein Geräusch riss ihn aus seiner archäologischen Versenkung und er wirbelte herum. Schritte. Das waren eindeutig Schritte gewesen. Irgendwo da draußen marschierte jemand durch das hohe, dürre Gras. Pio hielt den Atem an. Sollte der Dieb am Ende immer noch hier sein?
Möglichst lautlos schlich er auf die verschlossene Holztür an der Vorderseite des Schuppens zu. Er legte ein Ohr an das abgesplitterte Holz und lauschte konzentriert. Die Schritte waren eindeutig um die Seitenwand herum Richtung Hintereingang unterwegs. Pio ging hinter der Holzkiste, die bestialisch nach billigem Alkohol stank, in Deckung und stierte an ihr vorbei dem Eindringling entgegen.
Für einen viel zu kurzen Moment war eine zierliche Silhouette in dem schmalen Lichtstreifen des provisorischen Eingangs zu erkennen gewesen. Doch gleich darauf war sie wieder von der trüben Dämmerung, wie sie im Schuppen herrschte, verschluckt worden. Pio bewegte sich nicht und brachte seine Atmung auf das Niveau eines Apnoe-Tauchers.
Die Person schien nach etwas zu suchen und scharrte abwechselnd mit Füssen und Händen im staubigen Untergrund. Bald darauf dürfte sie es entdeckt haben und ging kurzerhand in die Hocke.
Pio wagte einen nächsten Blick um den Rand der Kiste und sein Blick traf auf ein Funkeln, das von dem winzigen Gegenstand in ihrer Hand ausging. Blitzschnell zog er seinen Kopf zurück hinter die Kiste und versuchte sich das Bild zurück ins Gedächtnis zu holen. Eine Frau. Kein vergammelter Teenager. Eine blonde, junge Frau, in einem knappen Einteiler gekrönt von einer modischen Kurzhaarfrisur. Pio schätzte sie älter als sich selbst.
Er hörte, wie sie ein paar Schritte auf sein Versteck zumachte und dann ruckartig zum Stehen kam. Verhalten räusperte sie sich in die Stille hinein.
„Hey Kleiner, kannst rauskommen. Ich bin nicht von der Sitte und mit dem Drogendezernat habe ich auch nichts am Hut.“
Überrumpelt richtete sich Pio auf und beförderte den Staub aus den Tiefen seines Jeansstoffs wenig gefühlvoll zurück auf den Boden. Die schweißbedeckte Haut seiner Unterarme juckte unter einer Panier aus Sand.
„Hast du meine Sachen?“
Pio mochte es nicht, wenn er sein Gegenüber nicht einschätzen konnte und die schattige Umgebung ließ ihn alles nur schemenhaft wahrnehmen.
„Deine Sachen was? Gesehen? Mitgenommen?“
Ihre Stimme klang sachlich und weniger belustigt, als Pio es an ihrer Stelle wohl gewesen wäre.
„Hast du sie gesehen?“
„Gesehen ja. Mitgenommen hat sie jedoch jemand anderes.“
„Und wer? Das hier ist kein verdammter Bahnhof!“
Das stimmte nur teilweise, aber sein Geduldsfaden fing an, sich in seine Bestandteile zu zerlegen und die Stressprobe der letzten Minuten zehrte an ihm.
„Und was treibt dich eigentlich hierher?“, fragte er schroff.
Ihr Blick wurde augenblicklich unzugänglicher, kälter.
„Hey, mal langsam. Der Platz hier ist weder privat, noch abgeriegelt. Und was ich suche und finde geht niemanden was an.“
Pio verdrehte die Augen und machte einen Schritt auf sie zu. Er würde sich zusammenreißen müssen, um das sprunghafte Wohlwollen dieser felinen Person nicht zu überreizen.
„Hast du ihn nun gesehen? Mit meinen Sachen, meine ich.“
„Interessant, dass du sofort an einen Kerl denkst.“ Sie lächelte ihm kokett zu. „Aber nein, nicht direkt. Jedenfalls nicht aus der Nähe. ‚Er‘ ist mit seinem Motorrad geflüchtet, als er mich vor dem Schuppen entdeckt hatte. Deine Kleider kannst du dir allerdings auf der Wiese einsammeln.“
„Und der Rest?“
„Dein Handy wirst du wohl vergessen können. Neue Dinger bringen auch auf dem Schwarzmarkt noch genug.“
Mit einem halbherzigen Nicken quittierte er ihre Auskunft und sein Blick wanderte resigniert zu Boden. Natürlich konnte sie nicht wissen, auf welchen Rest er tatsächlich angespielt hatte. Er musste ins Freie, um seinem Drang nach einer weiteren Fluchtirade Luft zu machen. Im Vorbeigehen griff sie nach seiner Hand. Zu perplex, um sich aus dieser kleinkindlichen Geste zu befreien, sah er ihr in die Augen.
„Der Rest ist reine Zeitverschwendung, Kleiner. Sieh’s positiv und investier dein Geld in Dinge mit Zukunft!“
Pio starrte sie an. Seine Zukunft war so vage, wie eine Schüssel voll Teig. Er hatte keine Ahnung, ob er auch tatsächlich aufgehen würde.
Verstohlen drückte er sich an ihr vorbei ins Freie und schickte einen letzten lauwarmen Fluch gen Himmel, bevor er sich durch das hohe Gras den Hügel hinabkämpfte. In seiner Hose gewickelt hatte sich sein E-Vorrat für die nächsten drei Wochen befunden. Jetzt erinnerte er sich wieder daran, dass es der angedrohte Hausputz seiner Mutter gewesen war, der ihn dieses Ausweichversteck hatte wählen lassen. Die Dinger einfach im Wagen zu lassen, hätte keine Alternative dargestellt. Erst letzte Woche hatte sich jemand über die nagelneue mobile Hebebühne in seinem gut einsichtigen Kofferraum hergemacht.
Pio ließ seinen Blick über das tote Gras streifen und versuchte sich an die Farben seiner Kleidungsstücke zu erinnern. Er einigte sich auf ein gräuliches Weiß und das ausgewaschene Schwarz seiner Jean.
„Kann ich dir helfen?“
Unbemerkt war sie neben ihn getreten.
„Scheiße, nein! Hau endlich ab.“
Er konnte die Tussi hier nicht brauchen. Schmerzverzerrt verzog er sein Gesicht, als mit dem Schienbein gegen einen im Gras versteckten Stein knallte.
„Ganz ehrlich, Süßer. Da gibt es auch Alternativen.“
Er war nicht ihr Süßer und zum Wohle ihrer beider Seelen wäre es durchaus zuträglicher, wenn sie nun endlich verschwinden würde.
„Alternativen, hm? Ich bin kein Junkie, wenn du das denkst, »Süße«. Aber im Grunde geht dich auch das nichts an.“
Sie nickte und wanderte zielstrebig auf einen dunklen Fleck in der Wiese zu. Pio folgte ihr.
„Tanz, Adrenalin, Sauerstoffmangel, Meditation, Schmerz, Sex.“
Sie reicht ihm seine Hose und er drehte sich zu ihr um. Eine Sekunde lang machte er sich die Mühe sie einzuschätzen.
„Kein Bedarf. Danke.“
Mit einem freundlichen Lächeln streckte sie ihm ihre zierliche Fünferpackung Essstäbchen entgegen.
„Sabiona“
„Paolo“
Unwillig reichte er ihr ebenfalls die Hand. In der trockenen Hitze fühlten sich ihre schmalen Finger ungewöhnlich kühl an. Schnell beeilte er sich, seine Hand aus der ihren zu befreien.
„Schön. Dann hätten wir den Teil erledigt.“
Sie wanderte vor ihm zu der Schotterstraße zurück, die zu der Mühle führte.
„Wahnsinn. Wie man bei der Hitze auch nur einen klaren Gedanken fassen kann.“
„Du bist nicht von hier?“
Es war mehr eine Feststellung gewesen und Pio überraschte es, dass er sie laut ausgesprochen hatte. Resigniert stellte er sich auf den unweigerlich folgenden Smalltalk ein.
„Nein. Meine Mutter ist Italienerin, aber aufgewachsen bin ich in der Nähe von Salzburg, Österreich.“
„Dein Italienisch ist perfekt.“
„Danke.“
Sie kommentierte es nicht weiter und er dankte ihr dafür.
„Dein Shirt ist dort unten. Am Ende der Straße.“
Sabionas Hand wanderte zielgenau auf den grellen Ball der Sonne zu und Pio senkte rasch die Augen.
„Danke.“ Er stockte. „Es tut mir leid, wenn ich...“
„Wenn du vorhin wie ein richtiger Macho rübergekommen bist? Schon vergeben.“
Sie gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und drehte ihm auf der Schotterpiste den Rücken zu.
„Man sieht sich.“
Er nickte ihrem schlanken Rücken in dem perlmuttfarbenen Einteiler zu und schlenderte gemächlich auf das weiße Stück Stoff zu, das wie ein kindliches Segel in der sanften Brise flatterte. Als er sich wieder zu ihr umdrehte, war sie verschwunden.
2.Ren
Mit seinen breiten, gespreizten Hufen trabte das Rentier problemlos über das feuchte Gras und die sumpfige Erde. In dem lichten Birkenwald roch es nach Beeren und Moos. Yana liebte diese Morgenwanderungen. Die Sonne strahlte kraftvoll zwischen den spärlichen Ästen hindurch, während man nur etwa zweihundert Kilometer weiter südlich weiterhin auf ihr Erscheinen würde warten müssen. Sogar die Tautopfen der letzten Nacht waren längst ihrer Wärme zum Opfer gefallen und an ihrer Stelle fanden sich die Frühaufsteher unter den Insekten auf den Halmen und Blättern ein.
Yana hatte ihre Kamera mitgebracht und schoss zaghaft einige Fotos von einer Rentierherde. An Tagen wie diesen irritierte es sie, die Tiere bei ihren privaten Aktivitäten zu beobachten. Die Mutterkuh etwa, wie sie beflissen über das Fell ihres Kalbes schleckte oder das wilde Fluchtspiel zweier männlicher Jungtiere im hügeligen Grasland. Yana fühlte sich als Eindringling, ohne den Schutz jenes Fells, das sie als eine der ihren auswies.
Auch in diesem Sommer hatte sich Yana wieder in die abgelegene Obhut ihrer samischen Verwandten begeben. Hatte die wenigen Habseligkeiten, auf die sie auch hier nicht hatte verzichten können, in dem großen Zelt ihrer Tante verstaut und die sommerliche Betriebsamkeit der nordschwedischen Provinzstadt mit den Vorzügen der Einsamkeit getauscht. An Orten wie diesen, arbeiteten die Zeiger langsamer. So langsam, dass sie letztlich irgendwann den Eindruck erweckten, gänzlich zum Erliegen gekommen zu sein. Die Probleme des Alltags wirkten bodenständiger und realer, als es der Ärger über die ranzige Milch im Kühlschrank je hätte werden können.
Selbst der belastende Streit mit ihrer Mutter, der sich kurz vor ihrer Abreise so unweigerlich hatte entfalten müssen, rückte mehr und mehr in den genügsamen Bereich ihrer Erinnerung.
Yana streckte die Arme in ihrem Versteck nach hinten durch. Seit über einer Stunde war sie reglos hinter einer Mauer aus niedrigem Buschwerk gekauert und hatte die Herde studiert. Zuhause in Kiruna hätte sie keine zwanzig Minuten in dieser Stellung geschafft. Der erfrischende Luftzug hier draußen beflügelte sie.
So gut wie unbemerkt hatte er sich neben sie gesetzt. Allein der schwache Geruch nach Schnupftabak und dem Rauch des Lagerfeuers hatten seine Anwesenheit verraten. Mit einem herausfordernden Lächeln wandte sie sich dem »Noaidi« zu.
Seine glänzenden Augen konterten schwermütig und frech zugleich. Als hätten sich in dem Körper des Schamanen der alte Mann mit dem jugendlichen Lenz vereint.
Hegon hatte sein gesamtes Leben in den Wäldern des hohen Nordens zugebracht und dennoch war sein Blick über die Herde wachsam und konzentriert, bereit das Neue in jedem ihrer Atemzüge zu entdecken.
Schier endlos erstreckten sich die grauen Felle über die Ebene im Becken. Es war einer dieser gigantischen Verbände, die es nur im Sommer zu bewundern gab.
Yana seufzte. Sie hatten es bereits Mitte August und was man hier Sommer nannte, war so gut wie vorüber. Es schmerzte sie, an ihre Rückkehr nachhause zu denken. Und ebenso sehr schmerzte es, dies nicht zu tun. Die Arbeit in der Forschungsabteilung hatte ihr stets Freude bereitet. Allein es gab noch so Vieles, über das sie sich mit Hegon hätte unterhalten müssen.
Die letzte Zusammenkunft der Reisenden hatte sie verunsichert. Ohne Hegons spirituelle Unterstützung würde sie in ihrer überschaubaren Wohnung im Zentrum von Kiruna früher oder später den Verstand verlieren. Da war die zweckdienliche Moderne ihrer Möbel und das allesdurchfließende Internet. Da war kein hartnäckiger Geschmack von dem Harz in den Wäldern. Keine Feuchtigkeit, die durch die ersten Schritte drang.
Der Winter war die Zeit ihres theoretischen Zugangs zur Wissenschaft. Ein Blickwinkel, der ihr im letzten Jahr mehr und mehr fremd geworden war.
Hegon ließ seine Hand auf ihre Schulter sinken und brachte sein gegerbtes Gesicht in jene schräge Position, die nur eines verhieß. Es war Zeit den Rückweg anzutreten. Nachdenklich folgte ihm Yana den wenig ausgetretenen Rentierpfad entlang. Entfernt waren die Rauchschwaden über den dichter werdenden Wäldern zu erahnen. Statt ihre Schritte zu beschleunigen, blieb Yana abrupt stehen.
„Hegon, warte!“
Sie war noch nicht bereit in die Gemeinschaft der Sippe zurückzukehren. Etwas hinderte sie daran.
„Es ist etwas passiert, richtig? Bei deiner letzten Reise.“
Yana nickte knapp. Manchmal war sie sich nicht sicher, ob es tatsächlich nur seine spirituelle Kraft war, die Hegon als Noaidi auszeichnete. Vielmehr war es seine einfühlsame und gesellige Art mit dem Leben der Anderen umzugehen und die richtigen Worte niemals zu meiden. Im Stillen dankte sie ihm auch diesmal für seine Direktheit.
„Ja.“
Sie kämpfte um die Gestalt ihrer Worte. Selbst ihm gegenüber hatte sie das Gefühl, nicht offen reden zu können. Es stand zu viel auf dem Spiel. Sprachlos schüttelte Yana den Kopf und stützte eine Hand an dem leuchtend weißen Stamm einer Birke ab.
„Vielleicht,... vielleicht habe ich es auch nur falsch verstanden. Die Symbole falsch gedeutet. Du weißt doch, es ist immer eine Sache der Auslegung.“
„Natürlich ist es das. Was hast du gesehen?“
Yana rief sich den gestrigen Abend in Erinnerung. Hegon und sie hatten sich in seine Schamanenflughütte zurückgezogen. Er hatte mit seiner rituellen Räucherung begonnen, um sie beide auf eine gemeinsame Meditation einzustimmen. Yana liebte den Geruch der Harze, Nadeln und Zapfen, die er mit Beifuß vermengt, zur spirituellen Reinigung und Vorbereitung auf ihre Reise benutzte pflegte. Bereits an den aufsteigenden Rauchschwaden konnte ein geübter Schamane erkennen, wohin ihn seine Reise führen würde. Unablässig hatte Hegon in den beißenden Rauch gestarrt und seine Gievriej, eine kleine Rahmentrommel aus Rentierhaut, geschlagen.
Zumeist hatte Hegons Tiergeist ebenfalls die Gestalt eines Rentiers, manchmal auch die eines Wolfs oder einer Gans. Mit der Hilfe seiner Verbündeten reiste er an Orte außerhalb seiner Wahrnehmung, wie es die Schamanen seiner Vorfahren über Jahrtausende hinweg praktiziert hatten. Er lokalisierte Schadenszauber, Blockaden und andere Einflüsse auf unsere diesseitige Welt.
Insgeheim beneidete Yana ihn der Überschaubarkeit seiner Arbeit. Alles folgte einem klaren Ablauf und in den meisten Fällen kam es zu einem kalkulierbaren Ende, das dem Betroffenen jene Hilfe verschaffte, die er sich erhofft hatte.
Natürlich, auch Hegon hatte seine Fähigkeiten nicht in den Schoß gelegt bekommen. Jede einzelne seiner Tiergestalten hatte er sich durch einen starken Geist und unumgängliche Entbehrungen hart erarbeiten müssen. Es hatte seinen Preis, ein spirituelles Wesen zu einem tête-à-tête zu bewegen. Allerdings...
Allerdings blieb es für ihn bei dieser rein energetischen Form seiner Reisen. Für Yana hingegen bedeutete die Anderswelt mehr. Jedes Mal aufs Neue zerriss sie diese Reise und forderte ihr alles ab. Selbst nach Jahren der Übung, war sie sich noch nicht sicher, ob sie dieser Aufgabe auch tatsächlich gewachsen war. Yanas Tiergeist war buchstäblich zu Fleisch geworden.
Das rhythmische Trommeln in den Ohren, hatten sie auch gestern Abend ihre beiden Verbündeten durch den Nebel der Rauchschwaden begleitet. Wie eine ganze Herde, dann wieder wie ein einzelnes Tier führten sie die Klänge der Gievriej zielstrebig in eine tiefe Trance.
Als Hegon ein letztes Mal seinen Kopf gehoben und in Yanas Richtung geblickt hatte, war sie bereits nicht mehr zu sehen gewesen. Ihre Kleidung hatte sie vorsorglich in einer Ecke des Zeltes abgelegt. Genügsam schien sie dort auf ihre Rückkehr zu warten.
3.Onza
Carla Moreno León stand an der Kassa des größten Supermarkts von Avon Park im amerikanischen Bundesstaat Florida. Vor ihr reihten sich drei weitere vollbepackte Einkaufswagen und ein Grüppchen karibischer Punks vor dem stetig rumpelnden Förderband. Carla löste den Blick von einem verkrusteten Fleck auf dem Linoleum und wandte sich dem bedrohlichen Schauspiel hinter den Glasscheiben zu. Die dunklen Wolken bildeten einen skurrilen Kontrast zu der grellen Neonbeleuchtung, die sich von den Rändern der Fensterscheiben bis ins unerreichbare Innere des Supermarkts zogen, und kurz wurde ihr schwindlig.
Bald würde wieder Regen aufziehen und an eine Joggingtour war nicht mehr zu denken. Auch dieses Jahr hatten die Vorboten der Hurrikansaison nicht lange gefackelt und gewaltige Sturmböen ins Rennen geschickt. Der späte August gestaltete sich seither als himmlische Achterbahn.
Carla seufzte. Sie brauchte diese Ausflüge in die Natur. Sie brauchte das Laufen und ihre Musik.
Beinahe jeden Tag lief sie die lange Straße, an der das Haus ihres Vaters lag, bis zu ihrem Ende und bog dort, wo bereits Gras über den Asphalt gewachsen war, in einen kleinen Waldweg ein. Umgeben von fleischigem Buschwerk folgte sie den unscheinbaren Pfaden, die wie feine Adern zwischen den sumpfigen Stellen dahinmäandrierten. Carla kannte sie alle. Die Gefahr, die von dieser durchnässten Region ausging, störte sie nicht mehr. Auf seine eigene, unnahbare Weise war das moskitogeplagte Feuchtgebiet zu ihrem besten Freund geworden. Es hatte ihr geholfen zu vergessen, was sie verloren hatte und ihr gezeigt, dass es noch so vieles zu entdecken galt.
Kurz nachdem Carla ihren siebenten Geburtstag gefeiert hatte, hatte ihr Vater es ihr gebeichtet. Hatte sie an der Hand in seinen muffigen Schuppen geführt und ihr eröffnet, dass er nicht länger hier würde leben können. Dass es dort oben im Norden ein neues Leben für ihn gab, das sein Schicksal für ihn hatte vorherbestimmt. Carla hatte nichts verstanden. Nichts von dem heißen Sommer und dem Restaurant, in dem die junge Amerikanerin jeden Tag gesessen war. Und nichts von dem Kind, das sie nun erwartete.
Eine geschlagene Woche hatte Carla kein Wort mit ihm gewechselt. Sie war sich nicht sicher gewesen, wie sie ihn dafür würde hassen können und ob sie es tatsächlich tat. Die Vereinigten Staaten waren auch ihr ein Ort der Träume. Ein Ort, der die Macht besaß, ihre zankenden Geschwister aus dem schmalen Bett zu verbannen und ihr eine Zukunft schenkte, die nicht an jenem Ort in den venezolanischen Bergen lag.
Am achten Tag hatte Carla ihren cremefarbenen Koffer gepackt und ihn vor dem spiegelnden Lack seiner Schuhe abgestellt. Ihr Vater hatte gelächelt, so wie er es heute noch tat.
Als der mächtige Fischkutter den Hafen tags darauf verlassen hatte, waren die Szenen am Ufer in einen Schleier aus Tränen gehüllt gewesen. Es war ein Trugschluss gewesen, zu glauben, dass man nichts verlor, indem man doppelt gewann.
Die Regentropfen auf den Dächern der Autos erinnerten Carla an jenen Tag der Überfahrt. Zuerst war das Wetter gut gewesen. Die Sonne hatte vom Himmel gebrannt und der drohende Regen hatte sich noch hinter einer langgezogenen, karibischen Inselgruppe versteckt gehalten. Mit einem Mal war es blitzartig umgeschlagen. In der winzigen, benzinverseuchten Kajüte waren sie alle beisammengesessen und hatten mit flauem Magen dem strömenden Regen gelauscht.
Als Carla auf dem Parkplatz des Supermarktes in ihren Wagen stieg, hämmerten die Tropfen bereits wie Nägel gegen das Dach ihres Fahrzeugs und der Scheibenwischer kämpfte auf höchster Stufe nicht in den Wassermassen unterzugehen. Vorsichtig lenkte sie den Wagen zurück auf die Hauptstraße und steuerte ein nahegelegenes Internetcafé an. Der Parkplatz davor war so gut wie leer.
Mit dem Laptop unter der dünnen Jeansjacke sprintete sie über den schmierigen Asphalt auf den Eingangsbereich zu. Ein mickriges Glöckchen ertönte, als Carla die Eingangstür aufriss und Quetzalcoatls Zeitvertreib erneut den Rücken zuwandte. Unter der klatschnassen Mähne nickte sie dem Tassenjongleur hinter der Theke kurz zu und er quittierte es mit einem frühreifen Lächeln. Brian war ein alter Schulkollege, der jedoch nie sehr erpicht darauf gewesen war, in die Rubrik der Freundschaft aufzusteigen.
Carla beließ es bei diesem emotionalen Schwebezustand und verschwand in ihrer Koje am Ende des Ganges. Wäre da nicht dieser sich in die Endlosigkeit ausdehnende Cappuccino gewesen, hätte man für diesen Teil des Cafés von ihr im letzten halben Jahr wohl müssen Miete verlangen.
Mit einem unangenehmen Klatschgeräusch landete der Laptop auf der schuppig polierten Tischplatte und Carla tauchte in ihre weiß-blaue Welle ein. Irgendwann war der Sog zur Sucht geworden. Carla hatte sich von dem genauso ungreifbaren, wie gefräßigen Monster umgarnen lassen. Und nicht etwa damals, als es mit seinem unschuldigen Blick auf die Freundschaft das Licht der Welt erblickt hatte. Nein, Carla hatte Facebook und Co, wie der letzte Mensch betreten und war bis jetzt daran kleben geblieben.
Es war der Zweck, der wie immer die Mittel heiligte. Die wenigen guten Freunde, die ihr aus ihrer High-School geblieben waren, besuchten Colleges und Universitäten in anderen Bundesstaaten oder waren dem immerwährenden Ruf der Welt gefolgt. In ihre Vierecke gepfercht, blieben sie für Carla real.
Bloß Carla hatte Glück gehabt. Glück, sich nicht für etwas entscheiden zu müssen, das außerhalb allen Greifbaren lag. Bald nach der Schule hatte sie die Stelle in dem Graphikbüro angenommen, als ihr Vorgänger wegen versuchten Raubs für einige Monate in eine staatliche Anstalt gewandert war. Carla hatte nicht gezögert, die wenig abwechslungsreiche Arbeit der Assistenz anzutreten und hatte sich Millimeter für Millimeter jene wenig aussichtsreichen Karriereleiter emporgearbeitet, um endlich an jene Aufträge zu gelangen, die ihr ein Minimum an Kreativität abverlangten.
Letztendlich war es der Unabhängigkeit, die der monatliche Gehaltscheck mit sich brachte, zu verdanken, dass Carla nicht längst das Handtuch geworfen und dem Ruf ihrer Würde gefolgt war. Das und die so nebenbei ausgesprochene Bitte, sich um die Repräsentation ihrer Firma im Netz zu bemühen.
Unbemerkt vom Rest der Kollegen, war Carla ins Zentrum eines riesigen Strudels geraten, der gefüllt von Anfragen, Postings, verlockenden Fotos und keck untermalten Freundschaftseinladungen ein unwirkliches Dasein führte. Die Eintönigkeit ihres realen Lebens stand in keinem Verhältnis zu der Bühne, die sich ihr hier bot.
Doch auch damit wäre Carla fertig geworden. Früher oder später verloren alle Dinge ihren Glanz und reihten sich wie lose Erinnerungen auf einem imaginären Wandregal aneinander.
Dann hatte sie seine Nachricht erhalten.
Es war eine Nachricht aus Italien gewesen. Italien! Unweigerlich hatte sie an sonnige Weinberge und jahrhundertealte Dörfer denken müssen. Makellose Bilder einer geschichtsträchtigen Landschaft, wie sie in ihrem Buch über Europa mehrere Seiten füllten. Mit einem Trommeln in ihrer Brust hatte sie die Nachricht geöffnet und eine fiebrige Hitze war wie eine Dampflok durch ihren Körper gerollt.
„Dein Jaguar gefällt mir“, hatte er geschrieben.
Auf ihrem Platz in dem Café hatte sie sich umgedreht, nur um ein weiteres Mal zu akzeptieren, dass kein Interesse an ihr als handfeste Person bestand. Sie war allein und doch war sie es nicht.
Der Jaguar war ihre riskanteste Arbeit gewesen. In unbezahlten Stunden hatte sie aus vollem Herzen daran gearbeitet, ohne sich jemals wirklich einzugestehen, dass es keinen Glamour für ihn geben durfte. Dass er ein Wesen aus dem Verborgenen war und niemals von dort hätte herausgelassen werden dürfen. Gleich nach seiner Fertigstellung hatte sie das Bild in einem Facebook-Ordner für »Miscellaneous Products« verschwinden lassen. Ein Wald so gut wie jeder anderer, hatte sie sich gesagt.
Am Tag seiner Nachricht hatte Carla das Bild zum ersten Mal seit seiner Versenkung auf ihren Bildschirm zurückgeholt. Es war tatsächlich ein gelungenes Werk, eine Kombination aus einem sprintenden Jaguar und einer Läuferin. Carla hatte die beiden Fotos ineinanderlaufen lassen und den Hintergrund in ein plastisch wirkendes, blaugrünes Blattwerk verwandelt. Allein der Kopf des Jaguars stach messerscharf daraus hervor und gab dem Bild jene Dynamik, auf die sie so hart hingearbeitet hatte. Nie hatte sie auch nur irgendwer, innerhalb oder außerhalb der Firma, auf das Bild angesprochen, das unter Hunderten einen friedlichen Tiefschlaf gehalten hatte.
Dann hatte er geschrieben.
„und gratuliere zu seinem Namen.“
Carla hatte das Bild »Running into Trance« genannt und war damit ein zweites Risiko eingegangen. Unbemerkt hatte sie die Einsamkeit in ihrer Besonderheit in die Knie gezwungen. Ganz so, als ob etwas tief in ihr auf einmal wissen wollte, ob es andere gab und wer sie waren.
Zuerst hatte sie nicht daran gedacht, ihm zu antworten und der Cursor auf ihrem Bildschirm hatte sich gewissenhaft auf das winzige Kreuz in der Ecke zubewegt. »Delete Message« hatte er ihr zugeraunt, bis ihr jene zwei Buchstaben, die ein ganzes Land markierten, in den Augen zu stechen begonnen hatten. IT. Italien. War es tatsächlich so falsch?
Immer wieder hatte Carla Wörter und ganze Sätze in ihren Computer getippt, nur um sie nach Sekunden des bangen Wartens mit dem wilden Ritt ihres Fingers für nichtig zu erklären. Es waren nicht die richtigen Worte, die ihr fehlten, es war schlichtweg die Panik, die den instinktiven Jäger so plötzlich befallen hatte.
Um sich zu beruhigen, hatte sie der ungeschickten Wortwahl in der für ihn fremden Sprache die Schuld zugeschrieben. Ein Zufall hatte ihm das Bild in die Hände gespielt und seine Ausdrücke hatten der Bedeutung den Kopf verdreht.
Doppelsinnig, wie ihr die Worte am besten schmeckten, schickte sie ihm eine Antwort zurück.
„Danke. Mein Jaguar liebt den Wald und die Geschwindigkeit. Wovon träumst du?“
Carla hatte den Satz als unverfänglich empfunden. Dennoch hatte sie ihn von ihrer privaten Emailadresse aus gesendet. Nicht mehr als eine Stunde später, hatte sie seine Antwort erreicht.
„Ich fliege“, hatte da gestanden und lange Zeit hatte sie die wenigen Buchstaben nur ungläubig angestarrt, bis sie vor ihren Augen zu flimmern begonnen hatten und ein Geräusch, das wohl Brians Frage nach mehr Kaffee begleitet hatte, sie aus der Versenkung gerissen hatte. Sie hatte ihren Laptop zurück in die Tasche gepackt und war benommen an die frische Luft getaumelt.
Das alles war vor genau einer Woche passiert. Seither hatte sie wie besessen im Internet nach dem Phänomen recherchiert. Konnte es noch andere geben? Andere wie sie?
Die Geschichten der indigenen Dirne ihres venezolanischen Heimatorts waren ihr wieder eingefallen. Wie sie am Dorfplatz kauernd die Anekdoten aus einer fremden Welt zum Besten gegeben hatten. Einer Welt, die vielleicht so fremd nicht mehr war. Carla hatte ihren Theorien einer Schöpfungsgeschichte gelauscht und es stets auf die bewusstseinserweiternden Mittel geschoben, die sie in kleinen Säckchen bei sich zu tragen gepflegt hatte. Fast wehmütig hatte sie jene fantastischen Märchen in den Sack mit den schillernden Augen ihres beängstigenden Nachbarn gepackt. Drogen. Drogen entzogen die Kontrolle, machten das Bewusstsein zu Sklaven eines unbekannten Selbst. Adrenalin dagegen war anders. Sie selbst war sein Produzent. So oder so ähnlich hatte es für sie immer Sinn ergeben.
Unvermindert prasselten die Regentropfen gegen die Frontscheibe des Cafés und Carla griff nach der dünnen Jacke auf dem Stuhl neben ihr, um sie sich überzuziehen. Trotz der gigantischen Tasse, des zur Hälfte mit cremigem Schaum bedeckten Cappuccinos, fröstelte ihr und sie drückte sich tiefer in die weichen Kissen der klebrigen Kunstledercouch. Nichtssagend spiegelte ihr der schwarze Bildschirm ihres Laptops entgegen.
Carla klappte ihn zu und stand auf, um an einigen Jugendlichen vorbei Richtung Tresen zu schlendern. Brian, der auf seinem Handy gespielt hatte, schreckte ertappt hoch und schenkte ihr eines seiner entwaffnenden Lächeln.
„Sorry, kann ich dir helfen?“
Carla zögerte. Brian hatte ihr nie gefallen, aber er hatte diese autoritäre Art, die manche Frauen überaus anziehend fanden. Carla war keine von ihnen. Verunsicherung machte sich in ihr breit.
„Das kannst du.“, meinte sie schließlich. „Es geht um ein Projekt. Damals in der Schule...“
Auf einmal war sie sich nicht mehr sicher, das Richtige getan zu haben. Unnötig wie ein Pickel auf der Nase, fing ihr Herz plötzlich an bis zum Hals zu schlagen.
„…da hat uns dein Onkel aus dem Süden in der High School besucht. Erinnerst du dich? In meinem Projekt geht es um die Geschichte Floridas und wie heute damit umgegangen wird. Denkst du dein Onkel würde...?“
„Du sprichst von Billy Jump? Er ist nicht mein richtiger Onkel.“
„Lebt er noch in dem Reservat bei Tampa?“
„Soweit ich weiß. Hab lange nichts mehr von ihm gehört. Was ist das für ein Projekt?“
„Für die Firma. Ich könnte seine Nummer gebrauchen? Es gäbe da ein paar Fragen, die ich ihm gerne stellen würde.“
„Besorg ich dir. Aber gib mir eine Minute, ja?“
Brian wählte eine Nummer am Festnetz des kleinen Cafés und unterhielt sich für geschlagene acht Minuten mit der Person am anderen Ende der Leitung. Carla stieg von einem Bein auf das andere und überlegte zu ihrem Tisch zurückzukehren, als Brian endlich den Hörer zur Seite legte und ihr einen fettverschmierten Papieruntersetzer mit einer Telefonnummer überreichte.
„Hier. Ist die Nummer seines Shops. Mit Mobiltelefonen hat er’s nicht so.“
Carla bedankte sich und kehrte zu ihrem kalten Kaffee zurück. Es war leichter gewesen, als sie gedacht hatte.
4.Cornacchia
„Hört sich gut an. Womit fliegst du?“
Die Nachricht erschien auf dem Display, als sich Pio hinter das Steuer seines Wagens klemmte. Die Kleider auf der Rückbank waren vollzählig. Ihre Taschen leer. Sein Smartphone hatte er am Fuße des Hügels in einer kleinen Grube entdeckt, kurz bevor er den Rückweg antreten wollte. Vielleicht war es dem Dieb aus der Tasche gefallen, vielleicht hatte es keinen Wert für ihn besessen. Für Pio war der Fund ein Glückstreffer gewesen. Seine einzige Möglichkeit mit dem Hersteller seines überteuerten Hobbies in Kontakt zu treten.
Mit dem Finger vertreib er noch einmal den Sparmodus von seinem Display und las ihre Nachricht erneut. Es war die erste seit einer Woche.
Sollte er ihr tatsächlich beichten, womit er flog? Mit der Hand strich er sich über das verschwitzte Lächeln in seinem Gesicht. Sie lief. Das bedeutete, dass sie eventuell nichts von seiner Methode hielt. Wenige taten das. Soviel er verstanden hatte, galt es als schmutzig und vulgär, den einfachen Weg zu gehen. Pio jedoch liebte es unkompliziert. Eine kleine Tablette, die richtige Atmung. Keine Anstrengung. Keine spirituellen Verwicklungen. Pur.
Er steckte das Handy in seine Hosentasche zurück und raste die Schotterstraße auf den Wald zu. Es war zu viel passiert. Hinter seiner Stirn fochten die hitzigen Gedanken eine erbitterte Schlacht. Stimmen und Bilder überschlugen sich in Gedanken und das strenge Krächzen des Kondors hallte zwischen ihnen umher.
Der Verlust des Monatsvorrats, der sich in dem bauchigen Säckchen befunden hatte, schwappte erneut wie eine riesige Welle der Verzweiflung durch seinen Körper und Pio musste den Wagen anhalten, um nicht ungebremst im nächsten Graben zu landen. In Rage schlug er mit der Faust gegen das Lenkrad und stieg aus dem Wagen.
Sie lief.
Er schüttelte den Kopf. Das würde bei ihm nicht funktionieren. Pio ging in die Hocke und ließ seinen Kopf zwischen die Knie sinken. Die Pose hatte etwas vernichtend Demütigendes und er kam rasch in den Stand zurück. Sollte er es wagen?
Wieder in seinen Wagen zu steigen wog so unattraktiv wie je zuvor. Also schlüpfte er kurzerhand aus seinen Flipflops und fischte sich die Sportschuhe aus dem Kofferraum. Auf Socken würde der Läufer der ersten Stunde wohl diesmal verzichten müssen.
Ein letztes Mal sah er sich auf der staubigen Wiese um, bevor er in zügigem Tempo auf den Wald zulief. Die Nachmittagssonne hatte kaum an Intensität eingebüßt und stach so erbarmungslos wie zuvor vom Himmel herab. Jede Sekunde würde er den Wald erreicht haben und dann würde es besser werden, tröstete er sich. Es war reine Illusion. Auch hier stand die Hitze wie dichter Nebel zwischen den Bäumen und Pio hatte große Mühe seine Atmung unter Kontrolle zu bringen. Er lief langsamer. Seltsam intensiv legte sich der Wald um ihn herum.
Es störte ihn, dass die Wirkung des letzten Trips nun mehr als nur verflogen war. Seine Sinne fingen an ihn zu langweiligen. Auf seiner Suche nach Halt entdeckte er Moospolster an den Überresten eines Baches, zitronengelbe Falter im Spiel und die feinen Adern der vom Licht erfassten Blätter. Er atmete ihr Grün und den Dunst der warmen Erde. Zaghaft hatten die Farben zu leuchten begonnen.
Pio lief weiter und kam auf eine kleine Lichtung, auf der sich die Reste eines alten Steinhauses befanden. Im blendenden Bündel der Sonnenstrahlen glitzerte ihm das alte Mauerwerk entgegen und er wurde langsamer. Er stutze. Bisher hatte er bei seinem eiligen Vorhaben einer Sache keine nähere Beachtung geschenkt. Die Idee der Geschwindigkeit und des direkten Übergang besaßen etwas Verführerisches und Reines. Jedoch etwas gänzlich Alltägliches verhielt sich nun wie ein winziger Stock in den Speichen seines Vorhabens.
Was würde bei seinem Eintritt in die andere Welt mit seinen Kleidern passieren? Pio war sich sicher, dass die Amerikanerin das Problem für sich gelöst hatte. Sie jedoch jetzt danach zu fragen, kam nicht in Frage.
Sollte er es einfach darauf ankommen lassen? Pio entschied sich dafür. Das trockene Gras und die dünnen Ästchen des Waldbodens krachten laut unter seinen Füßen. Nicht über die zahlreichen Erdhügel oder Vertiefungen in dem unebenen Gelände zu stolpern, wurde mehr und mehr zur Herausforderung. Dennoch setzte er seinen Weg fort. Verbissen lief er geradeaus durch die dürre Waldlandschaft, ohne sich diesmal genauer nach seiner Umgebung umzusehen. Pio hatte beschlossen, alles auf die Geschwindigkeit zu setzen. Wie ein Kind das inständig hoffte, seine Seifenkiste würde irgendwann abheben, hatte sie nur die richtige Geschwindigkeit erreicht, drängte er vorwärts. Seine baren Fußsohlen schmerzten auf dem schmierigen Kunststoff und seine untrainierte Lunge schrie nach Luft.
Doch die Seifenkiste hob nicht ab. Abrupt endete der Wald unmittelbar vor ihm und Pio blieb keuchend und schweißgebadet im Schatten der letzten Bäume stehen. Eine Zeit lang verharrte er dort regungslos im Dunkeln und starrte in die grelle Landschaft hinter den letzten schwarzen Stämmen.
Es war bloß ein Versuch gewesen, mit einem winzig kleinen Ausblick auf Erfolg. Nichtsdestotrotz fühlte er sich als Versager. Übellaunig und orientierungslos trat er den Rückweg zu seinem Wagen an.
Im Inneren seines Wagens war es unerträglich heiß. Das Lenkrad glich einer glühenden Stange Metall und die Ledersitze erzeugten mehr Energie, als die höchste Stufe seiner Sitzheizung es jemals zustande gebracht hätte. Genervt schob sich Pio erneut aus dem Fahrersitz und öffnete alle Fenster und Türen. Warum hatte er vor seinem aberwitzigen Gewaltlauf nicht daran gedacht, den Wagen in den Schatten zu stellen? Er zog sein Handy aus der durchgeschwitzten Hosentasche und rief seine Emails ab. Es war nichts dabei, das seine Aufmerksamkeit wert gewesen wäre. Pio tippte eine unbesonnene Antwort auf die Frage der Amerikanerin in das angelaufene Kästchen und schickte sie auf die Reise. Durch den Rahmen des Seitenfensters warf er das Mobiltelefon zurück auf den Beifahrersitz und stieg ein.
„Hört sich gut an. Womit fliegst du?“
Pio bereute seine voreilige Antwort bereits, als er wieder auf die befestigte Straße einbog. Auf einmal interessierte ihn jene Lawine, die er selbst losgetreten hatte, nicht mehr.
Er hatte es einzig dieser verfluchten, einsamen Nacht zu verdanken. In der er vor über einer Woche im Internet wahllos nach Bildern zu Tierverwandlungen gesucht hatte. An Schlaf war nicht zu denken gewesen und das Fernsehprogramm hatte nur spaßverbrauchte Wiederholungen amerikanischer Serien gezeigt.
Ein bunter Mix aus kunstvollen Zeichnungen, Malereien und Fotomontagen hatte sich auf seinem Bildschirm gedrängt und Pio hatte langsam den Cursor an der Seite nach unten bewegt. Sämtliche Bilder waren auf ihre Art kraftvoll und einzigartig gewesen. Dennoch hatte ihn ihr Panther, oder was auch immer es war, das dort in den Dschungel tauchte, von Anfang an in den Bann gezogen. Mit einem belanglosen Klick war er auf die Facebook-Seite einer US-amerikanischen Grafikagentur gelangt.
Irgendjemand musste das Bild mit der Bezeichnung »human animal« getaggt und versehentlich in dem Ordner zurückgelassen haben. Es wirkte fehl am Platz zwischen all den Werken, die so offensichtlich nach ihren Käufern warben.
Pio hatte nicht lange nach der Urheberin suchen müssen. Rechts oben hatte sie ihre Initialen kunstvoll in einen der tropischen Äste graviert. Aus Langeweile war er die Mitarbeiterliste durchgegangen und schnell fündig geworden. CML. Moreno León, Carla.
Ohne darüber nachzudenken, hatte er eine Nachricht an sie verfasst. Übereilt und fantastisch, wie Luft jener Nacht. Danach hatte er sich eigenartig befreit gefühlt. Geradezu erleichtert. Wie das Lied seiner Mutter hatte ihn der Regen, der wie endlos auf die morschen Schindeln geprasselt war, in den Schlaf gewiegt.
Es roch verführerisch nach frischem Hefegebäck, als er nach der kurzen Fahrt die Treppe zur Wohnung seiner Mutter hinaufstieg. Einer der anderen Mieter hatte zur Jause geladen und Pio kämpfte gegen die unnachgiebigen Sticheleien, die seine vernachlässigte Körpermitte augenblicklich aussandte. Seit gestern Nacht hatte er nichts mehr zu sich genommen. Doch noch drastischer, als das Knurren seines Magens, hatte sich der Flüssigkeitsmangel bemerkbar gemacht. Mit einer Flasche siedenden Biers aus dem Handschuhfach seines Wagens hatte er ihn zu besänftigen versucht und dafür die restliche Fahrt mit Übelkeit bezahlt.
Seine Mutter stand in der Küche, als er die Tür zu ihrer Wohnung aufschloss. Kopfschüttelnd blickte sie von einer tischfüllenden Platte auf, auf der sich appetitliche Häppchen nebeneinanderreihten. Mit einer knappen Begrüßung schlüpfte Pio aus seinen erdigen Sportschuhen und schleppte sich an ihr vorbei ins Badezimmer. Er tauchte den Kopf unter den Wasserhahn und das Wasser sprudelte wild über seine Wangen und in seinen Mund hinein. Gierig sog er die ersehnten Happen Flüssigkeit in sich ein. Als er die gesäuberten Hände in dem altrosa Handtuch abtrocknete, traf es ihn wie ein Blitz.
Signore Gabattini! Erneut hatte er vergessen, sich bei ihm abzumelden. Pio lief eilig in sein Zimmer zurück und schloss die Tür hinter sich ab. Den Kopf zwischen den Schultern, machte er sich auf eine Tirade derber Beschimpfungen gefasst, die unweigerlich in einer fristlosen Entlassung enden würden.
Am anderen Ende der Leitung ließ die Welt auf sich warten.
„Autofficina Gabattini. Signora Barbieri, Buongiorno!“
Er hatte Glück. Seine Sekretärin antwortete und informierte ihn in ihrer rauen Bernhardinerstimme darüber, dass der Chef momentan außer Hauses sei. Dann hatte er weniger Glück. Außerdem ließ ihm der Signore ausrichten, »dass der werte Herr Neri sich sobald als möglich seine Sachen abholen und einen anderen alten Knacker suchen könne, dem das Freizeitverhalten seiner Mitarbeiter über alles ging«.
Pio seufzte. Viel gehalten hatte er von der Arbeit in der Werkstatt nicht unbedingt. Aber sie hatte ihn mit Geld versorgt und für einige Stunden am Tag seine Aufmerksamkeit beansprucht. Stunden, in denen er nicht an die nächsten Flüge gedacht hatte oder die schier unvorstellbaren Erfahrungen und Emotionen, die ihn von Drüben in seinen tristen Alltag hierher begleitet hatten.
Gerädert setzte er sich zu seiner Mutter an den Küchentisch und begann von dem angeschnittenen Brot zu naschen.
„Wirst du wohl damit aufhören!“, fuhr sie ihn an. „Du weißt doch, dass wir heute Claras Geburtstag mit der Familie feiern! Geh und besorg dir was aus dem Kühlschrank. Ihre Antipasti fasst du mir nicht an!“
Geschlagen schleppte sich Pio die wenigen Schritte bis zu dem heiligen Ort seiner Mutter und öffnete die Tür. Er hatte seine Schwester noch nie verstanden. Anstelle einer cremigen Schokoladentorte wünschte sie sich jedes Jahr diese salzigen Antipasti mit reichlich Knoblauchbrot. Selbst zum Kaffee danach, waren einzig und allein jene trockenen Amarettini in der vor Kitsch triefenden Kristallschale erlaubt.
Aber vielleicht lag es an der Exklusivität ihrer erwählten Umgebung, die eine ebenso exklusiv, wie hirnrissige Lebenseinstellung mit sich gebracht hatte. Seit Clara angefangen hatte an der Universität von Mailand Mikrobiologie zu studieren, hatte sie sich nicht nur diesen pompösen Neuadligen an Land gezogen, sondern war mit ihm und seiner Familie in den feudalen Erdkreis Mailands aufgestiegen. Ein okkulter Ort, gespickt von luxuriösen Fiktionen.
Nein, Pio hatte mit Sicherheit nicht vergessen, dass sie heute hier antanzen würde. Er hatte es aus vollem Herzen verdrängt.
Schnell stopfte er sich die restlichen Bissen Käse, die den Qualitätskriterien des heutigen Tages nicht entsprochen hatten, in den Mund und verschwand in sein Zimmer. Während sein Laptop langsam hochfuhr, beschloss er die Zeit für eine gründliche Dusche zu nutzen.
Doch daraus wurde nichts. Nur fünf Minuten später hatte ihn das nicht einmal lauwarme Wasser aus der engen Kabine verdrängt. Seine strähnigen, schwarzen Haare hingen ihm klatschnass ins Gesicht, als Pio zwischen den wilden Wogen seiner Schlaflandschaft Platz nahm und seine Aufmerksamkeit der digitalen Welt zuwandte.
Sein Posteingang zeigte eine Nachricht von ihr. Es verwirrte ihn, dass ihr Name dem seiner Schwester so ähnlich klang. Ungeachtet der winzigen Stimme, die ihn an die blamable Beantwortung ihrer ersten Frage erinnerte, öffnete Pio ihre Mail.
„Chemie also? Damit kenn ich mich nicht aus. Wie bist du gelaufen?“
Was meinte sie damit, wie er gelaufen sei? Gab es denn spezielle Techniken, die man erlernen musste? Pio zog an der Mineralwasserflasche, die schon seit Tagen auf seinem Schreibtisch ihr Dasein fristete. Dann kam eine zweite Nachricht.
Sie war online. War alles, was Pio denken konnte. Er klickte die neue Nachricht an.
„Es tut mir leid, ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Ich laufe mit Musik.“
Musik? Er musste lächeln. Unweigerlich hatte sich dieses Bild einer rundlichen Amerikanerin in pinkem Trainingsanzug in sein Bewusstsein gedrängt. Zwei gigantische Kopfhörer hingen ihr über beide Ohren und der Waldboden erbebte unter ihren Schritten. Rasch schüttelte er diese so erniedrigende Skizze von sich.
Mit zusammengekniffenen Augen starrte er auf die losen Sätze vor ihm. Wie einer dieser Sportfuzzis zu den aktuellen »Running Beats« durch das Unterholz zu hetzen, das war mit Sicherheit nicht sein Ding. Das würde er beim besten Willen nicht bringen.
Gedämpft drangen von draußen Stimmen durch seine Tür. Ein schriller Schrei ertönte und ein Orchester des Jubels brach in klirrend hohen Tönen in einem Nebenzimmer aus. Pio seufzte. Es war also wieder einmal soweit. Seine Verwandtschaft feierte ihre Wiedervereinigung und das ganz ohne Rücksicht auf ihre hellhörigen Nachbarn.
Lautlos öffnete er die Tür seines Zimmers und blieb im Türrahmen stehen. Großmutter Elisa stand mit dem Rücken zu ihm und hatte Tante Alesia in die kurzen Arme geschlossen. Wie zwei rundliche Törtchen klebten sie in familiärere Eintracht aneinander, bis sich seine Großmutter urplötzlich zu ihm umwandte und ihm ein aufmunterndes Lächeln schickte. Der Spiegel, kam es Pio so unnötig, wie spät.
„Paolo! Pio! Wie ich mich freue, dich zu sehen! Du siehst gut aus, so groß und schlank! Warum besuchst du deine Nonna nicht öfter in ihrer Villa, mh?“
Großmutter Elisa war immer Pios Lieblingsverwandte gewesen. Und nicht nur, weil sie ihm wie jedes Mal das Blaue vom Himmel log, nur um seiner Mutter eins auszuwischen.
Seit Pio denken konnte, hatte sie allein in ihrer Zweizimmervilla, wie sie sie nannte, am Rande der Stadt gewohnt. Auch noch, als ihr Mann, sein Großvater, eines Tages seine Koffer gepackt hatte und klammheimlich spurlos verschwunden war. Doch Großmutter hatte ihm nicht nachgetrauert. Im Gegenteil, als hätte er sie von einer beschwerlichen Bürde befreit, lebte sie ihr Leben seither in vollen Zügen.
Etwas abseits aalten sich seine Schwester und ihr Giacomo mit vollbeladenen Taschen in ihrer Würde. Pio nickte ihnen so vulgär wie möglich zu und umarmte seine Tante Alesia und Onkel Edoardo. Sein Onkel hatte sich Derartiges redlich verdient, saß er doch zumeist stumm wie ein Fisch an einer Ecke des Tisches und verwöhnte Pio mit der Abwesenheit jeglicher stichelnder Worte. Wenn er auch wenig sprach, so schmunzelte er stets bei jeder gelungenen Pointe und zog gleich darauf die Luft fest durch den schmalen Kanal seines Zigarillos ein.
Es war allein Pios Vater und Mutters Schwester Alesia vorbehalten, wie das Sprachrohr einer ganzen Nation über alles und jeden zu richten und dieses in Stein gemeißelte Wissen so sicher wie der Tod mit den übrigen zu teilen.
Mit hellseherischem Gespür blickte Pio dieser Entwicklung auch heute wieder lustlos entgegen. Als niemand mehr danach lechzte, ihn in den Arm zu nehmen, stahl er sich diskret an den Bäuchen der Verwandten vorbei in die angrenzende Küche, wo er auf seine zierliche Nonna traf.
Mit ihrem faltigen Arm nahm sie ihn sofort zur Seite und fixierte ihn mit diesem eindringlichen Blick, den Pio so nicht von ihr gekannt hatte. Ihre Stimme war ernst, als sie über die Antipasti-Platte gebeugt zu sprechen anfing.
„Paolo, tesoro, das war nicht bloß Gerede, du solltest mich wirklich bald besuchen kommen. Es gibt da einige Dinge, über die ich mich gerne mit dir unterhalten würde. Etwas, das ich dir zeigen möchte.“
Ihr spitzer Daumen testete die Beschaffenheit einer der Zutaten und dafür senkte sie für einen Moment den Kopf. Pio hasste es, seine Großmutter zu versetzen, aber nichts in der Welt hätte ihn in den nächsten Tagen in ihr kabinettgroßes Häuschen geführt. Es gab so Vieles, um das er sich würde kümmern müssen. Der abhanden gekommene Job war nur eines davon. In den Brotkrümeln auf dem Küchenbrett suchte er nach einer Ausrede.
„Nonna, ich... ich fürchte, im Moment passt es mir wirklich weniger gut...“
Verständnisvoll wandte sich ihr seltsam faltenfreies Gesicht ihm zu, ehe sie sich ganz nebensächlich ein erstes Stück Wurst in den Mund hineinschob.
„Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen.“
Unerwartet war ihr Ton schärfer geworden und Pio zog verwundert die Augenbrauen zusammen. Der Tonfall passte nicht zu ihr, selbst wenn sie bereits von dem Verlust seiner letzten Anstellung erfahren haben sollte. Wie ein milderndes Urteil zog sich gleich darauf ein feines Lächeln über ihr Gesicht und sie tätschelte ihm verspielt den Unterarm.
„Komm einfach vorbei. Du wirst es nicht bereuen, Pio.“
Er nickte und sie schlenderte in Richtung seines Onkels davon.
5.Ren
Yana hatte Hegon nicht sagen können, was sie in jener Nacht erlebt hatte. Stattdessen war sie übereilt nach Kiruna zurückgekehrt und hatte sich in ihrem Zimmer verschanzt. Der Computer lief und die schwarzen Buchstaben flimmerten an ihr vorüber.
Zu viele Fragen beunruhigten sie und hatten ihrem Geist in der Abgeschiedenheit keine Ruhe gelassen. Jetzt brauchte sie ihren PC. Sie sehnte sich nach den Antworten, die nur er ihr geben konnte. Auch wenn es bedeutete, dass es noch mehr Fragen aufwerfen würde.
Die Fragen kamen im Stakkato. Wonach suchte sie? Wo sollte sie damit beginnen? Wer konnte ihr weiterhelfen, um nicht in einen Sumpf aus Halbwissen unterzugehen. Wogen der Mutlosigkeit rissen sie von einer Seite zur anderen, ehe Yana einen ersten Entschluss fasste und mit jener Fragestellung begann, die sie sich selbst beantworten konnte.
Was wusste sie selbst über diese andere Welt?
Im Türkensitz auf ihrer Couch ging Yana alles durch. Sie hielt die Augen geschlossen und holte sich die Tiere aus ihren Reisen vor ihren pulsierenden Bildschirm. Sie kannte die meisten, kannte ihre Symbolkraft in der nordischen Welt. Kannte das Netzwerk, das sich daraus ergab. Auch die Völker der restlichen Welt verfügten über ihre Wahrzeichen und es würde ihr nicht schwer fallen, diese, wenn auch nur oberflächlich, im Netz aufzuspüren.
Yana surfte lange durch unzählige Foren, Homepages und wissenschaftlichen Magazine. Kreuzte halbwahre Berichte auf den Seiten einer Universität und war erstaunt über die Vielfalt, die ihre Recherchen mit sich brachten.
Beflissen fertigte sie auf einem A1-Bogen Packpapier, der ihr von einem Freundschaftsdienst übrig geblieben war, eine Karte an. So übersichtlich es ihr gelang, zeichnete sie alles, was sie dem digitalen Netz hatte entlocken können, auf Papier. Die Tiere, ihre parallelen Bedeutungen, Überkreuzungen, Kontraste und weltumspannenden Gemeinsamkeiten.
Als sie fertig war, kam sie in den Stand zurück und ließ ihren Blick behutsam über die bunten Markierungen gleiten. Wie ein überdimensionaler Bahnhof zogen sie sich über das schwach linierte Beige und der Wind, der durchs offene Fenster wehte, ließ die spärlichen Sonnenstrahlen darüber tanzen. Die Lebendigkeit in dieser skizzierten Schöpfung hielt Yana gefangen und es dauerte eine Weile, ehe sie in die Küche hinübermarschierte und mit ihrer von bunten Tupfern übersäten Hand einen tiefgekühlten Fisch aus dem Eisfach zog und auf der Abtropffläche ablegte.
Bis sich ihr Abendessen aus seiner Starre befreit haben würde, ging Yana die Emailnachrichten auf ihrem Computer durch. Der Löwenanteil gehörte der Konversation über ihre Arbeit an und sie klickte sich aufmerksam hindurch.
Vor etwas mehr als fünf Jahren hatte Yana ihr Studium der Geoökologie an der Universität von Umea abgeschlossen und war seither in einer wissenschaftlichen Abteilung in Kiruna beschäftigt. Tagtäglich untersuchte sie im engen Kreis ihrer Kollegen die Auswirkungen menschlicher Eingriffe auf die nordschwedische Landschaft. Es war ein Knochenjob und sie mochte ihn. Selbst abends traf sich der eingeschworene Trupp noch in den verwinkelten Bars der Stadt und lieferte sich im Rausch der Ergebnisse eine humorvolle Schlacht. Yana liebte diese Abende, liebte es der Natur nahe zu sein und das mit Menschen zu teilen, die es nicht anders sahen.
Nur eine Sache bereitete ihr Kopfzerbrechen. Und es hatte etwas mit der Thematik an sich zu tun. Selten schien irgendjemand von den Ergebnissen ihrer Arbeiten Notiz zu nehmen, waren sie einst in die Sackgassen hochtrabender, wissenschaftlicher Publikationen eingefahren.
Dabei ging es ihr bestimmt nicht um persönlichen Ruhm oder darum, ihrer Karriere den richtigen Spin zu verleihen. Es war das gehaltlose Wesen Prinzip, das sie wehmütig werden ließ, sobald einem anderen arktischen Thema jene Aufmerksamkeit geschenkt wurde, die es verdiente. Wenn von eindrucksvollen Weißschattierungen umrandete Hilferufe das Abkalben eines weiteren ‚Wales‘ an den Hängen der Antarktis bedauerten und sich in den schmalen Spalten der Tagespresse wiederfanden.