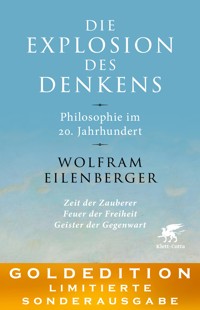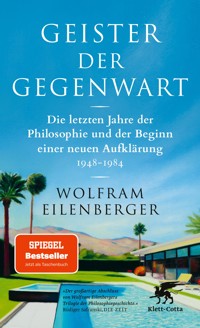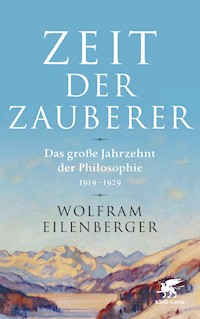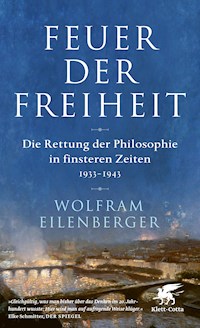
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das abenteuerliche Leben vier außergewöhnlicher Frauen, die in finsterer Zeit für unsere Freiheit kämpften Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand: Mit großer Erzählkunst schildert Wolfram Eilenberger die dramatischen Lebenswege der einflussreichsten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts. Inmitten der Wirren des Zweiten Weltkrieges legen sie als Flüchtlinge und Widerstandskämpferinnen, Verfemte und Erleuchtete das Fundament für eine wahrhaft freie, emanzipierte Gesellschaft. Die Jahre 1933 bis 1943 markieren das schwärzeste Kapitel der europäischen Moderne. Im Angesicht der Katastrophe entwickeln vier Philosophinnen, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Ayn Rand und Hannah Arendt, ihre visionären Ideen: zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, von Mann und Frau, von Sex und Gender, von Freiheit und Totalitarismus, von Gott und Mensch. Ihr abenteuerlicher Weg führt sie von Stalins Leningrad bis nach Hollywood, von Hitlers Berlin und dem besetzten Paris bis nach New York; vor allem aber zu revolutionären Gedanken, ohne die unsere Gegenwart – und Zukunft – nicht dieselbe wäre. Ihre Existenzen – als Geflüchtete, Aktivistinnen, Widerstandskämpferinnen – erweisen sich dabei als gelebte Philosophie und legen eindrucksvoll Zeugnis von der befreienden Kraft des Denkens ab. Ein grandioses Buch über vier globale Ikonen, die am Abgrund des 20. Jahrhunderts beispielhaft und mit bis heute weltweiter Wirkung verkörperten, was es heißt, ein wahrhaft freies Leben zu führen. »Ein Buch, das unter jeden Weihnachtsbaum gehört.« Denis Scheck, Druckfrisch, Dezember 2020 »Gleichgültig, was man bisher über das Denken im 20. Jahrhundert wusste: Hier wird man auf aufregende Weise klüger.« Elke Schmitter, Der Spiegel, Oktober 2020
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Wolfram Eilenberger
Feuer der Freiheit
Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933–1943
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
© 2020, 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Printed in Germany
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung eines Fotos von © Sotheby’s/akg-images, Gaston La Touche, Feu d’artifice sur Paris
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98512-2
E-Book ISBN 978-3-608-12037-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
I. Funken
1943
Das Projekt
Beste Jahre
Die Situation
Todsünden
Die Moral
Die Mission
Inspiriert
In Trance
Geistesschwach
Unverschämt
Kampfbereit
Nur logisch
Die Fremde
Ohne Geländer
Der Riss
Gegenwärtig
II. Exile
1933/1934
Raster
Rahels Fall
Aufgeklärt
Vielstimmig
Deutsche Wesen
Hintertür
Rasend
Revolutionär
Sorge
Dritte Wege
Heilsarmee
Testament
Bedroht
Die Andere
Eingekapselt
Zaubertrank
Mauern
Schreib-Maschine
Luftdicht
Ideale
Nietzsche und ich
Sokratische Spannung
III. Experimente
1934/1935
Angeklagt
Vor dem Urteil
Selbstisch
Second Hand
Filmreif
Sitten der Provinz
Das Prinzip Olga
Zauberer
Rollenverständnis
Blüten der Spiritualität
Ganz unten
Am Fließband
Erkenntnis und Interesse
Grenzen des Wachstums
Verkehrte Welt
Modern Times
Auslöschung
Vor dem Gesetz
Heimstätten
Widersprüche
Gestalt gewordene Frage
Neuland
Ausschlüsse
IV. Nächste
1936/1937
Wir, die Lebenden
Rückeroberung des Ich
Howard Roark
Sinnliche Egozentrik
Ehe in Connecticut
Frontal
Dunkle Prozesse
Stamm und Stups
Totale Nächstenliebe
Arendts Kehre
Paris is for lovers
Zweifel am Pakt
Freies Lieben
Wahlverwandtschaften
Melancholia
Kopfzerbrechen
Moralisches Hinterland
Spirale der Entmenschlichung
Leere Machtworte
Scheinoppositionen
Prophetisch
V. Ereignisse
1938/1939
In der Sackgasse
Gnadentöne
Das Reich Gottes
Unzurechnungsfähig
Das blinde Licht
Zurück zu den Quellen
Blockiert
Hymne
Arbeit am Mythos
Wolkenkratzer
Zündende Idee
Ecce Homo
Gift der Anerkennung
Morgenröte
Einbahnstraße
Elementarste Lügen
Gerettetes Vermögen
Stammes-Ethik
Anormale Abhängigkeit
Ohne Zukunft
Angriffslustig
Ebenbilder
Krieg der Welten
Die neue Situation
Im Angesicht der Angst
VI. Gewalt
1939/1940
Unablässig vor Augen
Erkenne dich selbst!
Geometrie des Zufalls
Tod und Zeit
Einzigartige Empfindsamkeit
Fallschirmspringer
Exodus
Grenzsituation
Nichts als Freiheit
Auf dem Vormarsch
Heimkehr
Projekt Hegel
Die Entschlossene
Abschaum der Erde
Lebendige Leichname
Transit
Engel der Geschichte
Fehlschläge
Das Prinzip Toohey
Falsche Gleichheit
Manhattan Transfer
Rands Verfassungspatriotismus
I want you!
VII. Freiheit
1941/1942
Wie befreit
Endlich emanzipiert
Positiv besetzt
Erntedank
Gespannte Erwartung
Ohne Ich
Ohne Wir
Ohne Opium
Ethik der Annahme
Höhere Gleichgültigkeit
Überfahrt
This means you!
Neues Entsetzen
Falsche Einheit
Weltbürgerliche Absichten
Kleine Kreise
Nietzsches Fluch
American Sprengmeister
Social Distancing
Roarks Verteidigung
Das Verdikt
VIII. Feuer
1943
Im Streik
Keine Fiktion
Deal!
Neuer Zug
Schöpferische Überschreitung
Offene Zukunft
Flaschenpost
Am Abgrund
Elemente und Ursprünge
Kein Schicksal
Verrückte Früchte
Unlösbar
Demission
Erdung
Schneisen
Dank
Werkregister
Hannah Arendt
Simone de Beauvoir
Ayn Rand
Simone Weil
Auswahlbibliographie
Anmerkungen
I
. Funken
II
. Exile
III
. Experimente
IV
. Nächste
V
. Ereignisse
VI
. Gewalt
VII
. Freiheit
VIII
. Feuer
Schneisen
Bildnachweis
Personenregister
Tafelteil
Für Venla und Kaisa,Frauen auf dem Weg
Wähntest du etwa,Ich sollte das Leben hassen,In Wüsten fliehen …
Johann Wolfgang von Goethe, »Prometheus(1)« (1789)
Fool me once, fool me twiceAre you death or paradise?
Billie Eilish, »No Time To Die« (2020)
I. Funken
1943
Beauvoir ist in Stimmung, Weil in Trance, Rand außer sich und Arendt im Alptraum
Das Projekt
»Warum überhaupt beginnen, wenn man doch wieder innehalten muß?«[1] Für einen Anfang nicht übel. Genau davon sollte der Essay handeln: von der Spannung zwischen der Endlichkeit des eigenen Daseins – und der offensichtlichen Unendlichkeit dieser Welt. Schließlich drohte dieser Abgrund bereits nach kurzem Nachdenken jeden Plan, jeden Entwurf, jedes selbst gesteckte Ziel dem Absurden preiszugeben. Und zwar ganz egal, ob es nun darin bestand, gleich den gesamten Erdball zu erobern oder nur den eigenen Vorgarten zu pflegen.[2] Letztlich lief es auf dasselbe hinaus. Wenn schon niemand anderes, so würde die Zeit selbst das erschaffene Werk dereinst nichten und für ewig vergessen machen. Gerade so, als ob es nie gewesen wäre. Ein Schicksal, so sicher wie der eigene Tod.
Warum also überhaupt etwas tun und nicht vielmehr nichts? Oder, besser gleich in Form einer klassischen Fragetriade: »Welches ist des Menschen Maß? Welche Ziele kann er sich setzen, und welche Hoffnung darf er hegen?«[3] Ja, das trug. Das war sie, die gesuchte Struktur!
Von ihrem Ecktisch im zweiten Stock des Café Flore sah Simone de Beauvoir den Passanten nach. Da liefen sie. Die anderen. Jeder und jede ein eigenes Bewusstsein. Unterwegs mit ihren ganz eigenen Ängsten und Sorgen, Plänen und Hoffnungen. Genauso wie sie auch. Als nur eine unter Milliarden. Ein Gedanke, der ihr jedes Mal wieder einen Schauer über den Rücken jagte.
Beauvoir hatte sich mit der Zusage nicht leichtgetan. Was nicht zuletzt an der von Jean Grenier(1) als Herausgeber gewünschten Thematik lag. Für einen Sammelband zu den bestimmenden geistigen Strömungen der Gegenwart wollte er von ihr einen Text über »den Existentialismus«.[4] Dabei hatten weder Sartre(1) noch sie diesen Begriff bislang für sich beansprucht. Er war eine jüngere Erfindung des Feuilletons, nichts weiter.
Die Ironie der Themenstellung war damit schwer zu überbieten. Denn wenn es überhaupt ein Leitmotiv gab, das ihren und Sartres(2) Weg in den vergangenen zehn Jahren bestimmt hatte, so lag dies in der konsequenten Weigerung, freiwillig in Schubladen zu kriechen, die andere bereits für sie entworfen hatten. Genau diese Art der Revolte war der Kern ihres Projekts gewesen – war es bis heute.
Beste Jahre
Sollten die anderen es ruhig »Existentialismus« nennen. Sie würde den Begriff bewusst vermeiden. Und stattdessen als Autorin einfach das tun, was sie seit den ersten Einträgen in ihre Jugend-Tagebücher am liebsten tat: sich möglichst konzentriert den Fragen widmen, die sie in ihrem Dasein umtrieben – und deren Antwort sie noch nicht kannte. Seltsamerweise waren es noch immer dieselben. Allen voran die Frage nach dem möglichen Sinn ihrer eigenen Existenz. Sowie die Frage nach der Wichtigkeit anderer Menschen für das eigene Leben.
Nie zuvor allerdings hatte Beauvoir sich in diesem Nachdenken so sicher und frei gefühlt wie jetzt, im Frühling des Jahres 1943. Auf dem Höhepunkt eines weiteren Weltkriegs. Inmitten ihrer besetzten Stadt. Trotz Essensmarken und Versorgungsengpässen, trotz chronischen Kaffee- und Tabakentzugs (Sartre(3) war mittlerweile so verzweifelt, dass er jeden Morgen auf dem Boden des Flore herumkroch, um Stummel des Vorabends einzusammeln), trotz täglicher Kontrollschikanen und Ausgangssperren, trotz der allgegenwärtigen Zensur und deutschen Soldaten, die sich selbst hier, im Montparnasse, mit immer größerer Schamlosigkeit in den Cafés tummelten. Solange sie nur genug Zeit und Ruhe zum Schreiben fände, war auch weiterhin alles andere zu ertragen.
Zum Herbst würde ihr erster Roman bei Gallimard erscheinen.[5] Ein zweiter lag fertig in der Schublade.[6] Auch ein Theaterstück[7] war gut im Werden. Nun sollte der erste philosophische Essay folgen. Sartres(4) 1000-seitiges Werk »Das Sein und das Nichts« lag ebenfalls zum Druck beim Verlag. Binnen Monatsfrist würde sein Drama »Die Fliegen« am Théâtre de la Cité Uraufführung feiern. Sein bisher politischstes Stück.
In Wahrheit war all dies die geistige Ernte eines gesamten Jahrzehnts, in dessen Verlauf sie und Sartre(5) miteinander tatsächlich einen neuen Stil des Philosophierens geschaffen hatten. Sowie – weil das eine nun einmal untrennbar mit dem anderen einherging – neue Arten und Weisen, ihr Leben zu führen: privat, beruflich, literarisch, erotisch.
Noch während ihres Philosophiestudiums an der École Normale Supérieure – Sartre(6) lud sie zu sich ein, um sich Leibniz(1) erklären zu lassen – hatten die beiden einen Liebespakt der besonderen Art geschlossen: Sie hatten einander unbedingte geistige Treue und Ehrlichkeit versprochen – bei gleichzeitiger Offenheit für weitere Anziehungen. Absolut notwendig füreinander würden sie sein, gern zufällig auch für andere. Eine dynamische Dyade, in der sich nach ihrem Willen die ganze weite Welt spiegeln sollte. Zu immer neuen Anfängen und Abenteuern hatte dieser Entwurf sie seither getragen: von Paris bis nach Berlin und Athen; von Husserl(1) über Heidegger(1) bis Hegel(1); von Traktaten über Romane zu Theaterstücken. Von Nikotin über Meskalin zu Amphetamin. Von der »kleinen Russin(1)« über den »kleinen Bost(1)« bis zur »ganz kleinen Russin(1)«. Von Nizan(1) über Merleau-Ponty(1) zu Camus(1). Er trug sie noch immer, ja trug sie fester und bestimmter denn je (»Eine Liebe zu leben bedeutet, sich durch sie auf neue Ziele hin zu entwerfen«).[8]
Ihr Wochendeputat (maximal 16 Stunden) als Philosophielehrende erledigten sie mittlerweile ohne größeres Engagement. Anstatt sich an den Lehrplan zu halten, ließen sie ihre Schüler nach kurzen Eingangsreferaten frei miteinander diskutieren – immer ein Erfolg. Es deckte die Rechnungen. Zumindest einen Teil davon. Schließlich hatten sie nicht nur für sich selbst aufzukommen, sondern noch immer für weite Teile ihrer »Familie«. Auch nach fünf Jahren in Paris stand Olga(2) mit ihrer Karriere als Schauspielerin erst in den Startlöchern. Der kleine Bost(2) schaffte es als freier Journalist ebenfalls kaum über die Runden, und Olgas jüngere Schwester, Wanda(2), suchte weiterhin verzweifelt nach etwas, das ganz und gar zu ihr passte. Allein Natalie Sorokin(1), als jüngster Neuzuwachs, stand fest auf eigenen Füßen: Gleich zu Kriegsbeginn hatte sie sich auf das Stehlen von Fahrrädern spezialisiert und betrieb seither einen gut organisierten – von den Nazis offenbar geduldeten – Schwarzmarkthandel immer breiteren Sortiments.
Die Situation
Die Erfahrungen des Krieges und der Okkupation hatte sie noch einmal enger zusammenwachsen lassen. Gerade in den vorangegangenen Monaten hatte ihr Zusammenleben, wie es Beauvoir als eigentlichem Familienoberhaupt schien, richtig zu sich gefunden. Ein jeder genoss seine Rolle, ohne auf diese reduziert zu bleiben. Jeder kannte seine Ansprüche und Rechte, ohne allzu starr darauf zu beharren. Sie waren jeder für sich glücklich, aber gemeinsam trotzdem nicht langweilig.
Die bevorstehende Urteilsverkündung beunruhigte Beauvoir deshalb nicht allein um ihrer selbst willen. Seit mehr als einem Jahr waren die Schnüffler der Vichy-Behörden mit ihrer Untersuchung zugange. Mehr zufällig hatte Sorokins(2) Mutter in einer Schublade eine intime Briefkorrespondenz ihrer Tochter mit deren damaliger Philosophielehrerin gefunden. Daraufhin hatte sie eigene Nachforschungen angestellt und war mit dem Material schließlich zu den Behörden gegangen. Das Vorgehen, so ihre Klage, sei offenbar immer das gleiche: Zunächst freunde sich Beauvoir mit den sie bewundernden Schülerinnen oder Ex-Schülerinnen privat an, verführe sie dann sexuell und leite sie nach einiger Zeit gar an ihren langjährigen Lebenspartner, den Philosophielehrer und Literaten Jean-Paul Sartre(7), weiter. Ins Zentrum der Ermittlungen rückte damit der Tatbestand »Ermunterung zu ausschweifendem Verhalten«[9], womit Beauvoir bei einer etwaigen Schuldigsprechung Konsequenzen drohten, von denen der bleibende Entzug ihrer Lehrerlaubnis noch die leichteste sein würde.
Fest stand bisher nur, dass Sorokin(3), Bost(3) und Sartre(8) bei ihren Vorladungen dichtgehalten hatten. Außer den besagten, nicht letztschlüssig inkriminierenden Briefen an Sorokin, gab es zudem wohl keine direkten Beweise. Dafür gewiss jede Menge Indizien, die den Schnüfflern des Pétain(1)-Regimes ein ausreichend präzises Bild davon vermittelten, auf welcher Seite des politischen Spektrums Beauvoir als Lehrkraft wohl einzuordnen war – und wofür sie mit ihrer gesamten Existenz einstand.
Anstatt in Wohnungen, lebten sie seit Jahren gemeinsam in Hotels des Montparnasse. Dort tanzten und lachten, kochten und tranken, stritten und schliefen sie miteinander. Ohne äußeren Zwang. Ohne letzte Regeln. Und vor allem auch – soweit es eben möglich war – ohne falsche Versprechen und Verzichte. Konnte nicht schon ein einfacher Blick, eine lose Berührung, eine gemeinsam durchwachte Nacht der mögliche Funke in das Feuer eines abermals erneuerten Lebens ein? Sie wollten es glauben. Ja, soweit es Beauvoir und Sartre(9) betraf, war der Mensch überhaupt nur als Anfänger wirklich bei sich.
Man kommt nie irgendwo an. Es gibt nur Ausgangspunkte, Anfänge. Mit jedem Menschen bricht die Menschheit von neuem auf. Und daher findet der junge Mensch, der seinen Platz in der Welt sucht, diesen zunächst nicht und fühlt sich deshalb verlassen …[10]
Das war eben auch eine Weise zu erklären, weshalb sie Olga(3), Wanda(3), den kleinen Bost(4) und Sorokin(4) einst unter ihre Fittiche, aus der Provinz zu sich nach Paris genommen, sie dort gestützt, gefördert und finanziert hatten. Um diese jungen Menschen von ihrer offenbaren Verlassenheit in die Freiheit zu führen. Sie zu ermuntern, sich ihren eigenen Platz in der Welt zu schaffen, anstatt einfach einen schon bereitgestellten einzunehmen. Dies geschah aus einem Akt der Liebe heraus, nicht der Unterwerfung, des lebendigen Eros, nicht der blinden Ausschweifung. Einem Akt, bei welchem die Menschlichkeit gewahrt blieb. Denn: »Der Mensch ist nur, indem er sich selbst erwählt; wenn er es ablehnt, sich zu erwählen, vernichtet er sich.«[11]
Todsünden
Sofern es gemäß ihrer neuen Philosophie überhaupt etwas gab, das den nach dem Tod Gottes frei gewordenen Platz der »Sünde« einnehmen konnte, war es die willentliche Verweigerung eben dieser Freiheit. Genau diese selbst verschuldete Vernichtung galt es um jeden Preis zu vermeiden. Sowohl für sich selbst wie für andere. Sowohl privat wie politisch. Und zwar im Hier und Jetzt, im Namen und als Feier des Lebens selbst. Und nicht etwa, wie es der mutmaßliche »Existentialist« Martin Heidegger(2) von der deutschen Provinz aus zu lehren schien, im Namen eines »Seins zum Tode«. »Das menschliche Sein existiert in der Gestalt von Entwürfen, die nicht Entwürfe auf den Tod sind, sondern auf bestimmte Ziele hin. … Man ist also nicht zum Tode.«[12]
Das einzige Sein, das demnach zählte, war das Sein dieser Welt. Die einzig tragenden Werte waren diesseitige Werte. Ihr einzig wirklich tragender Ursprung der Wille eines freien Subjekts zum Ergreifen seiner Freiheit. Das war es, was es eigentlich hieß, als Mensch zu existieren.
Exakt auf diese Form des Existierens, auf deren Vernichtung und Auslöschung, hatten es Hitler(1) und die Seinen abgesehen. Genau dies war ihr Ziel gewesen, als sie vor drei Jahren auch über Beauvoirs Land hergefallen waren – um nach ihrem Endsieg über die gesamte Welt noch dem letzten verbliebenen Menschen auf Erden genau vorzuschreiben und aufzuzwingen, wie er seinen Essay zu schreiben oder auch nur den Vorgarten zu pflegen habe.
Nein, sie hatte wahrlich Besseres zu tun, als sich um das Urteil dieser faschistischen Spießer zu kümmern. Sollten sie ihr die Lehrerlaubnis nur entziehen! Sie würde sich schon aus eigenen Stücken neu zu entwerfen wissen! Vor allem jetzt, wo sich viele Türen gleichzeitig zu öffnen schienen.
Die Moral
Beauvoir war voller Vorfreude auf die Diskussionen. Am Abend würde es zur Generalprobe von Sartres(10) jüngstem Stück gehen. Danach, wie immer, auf die Piste. Auch Camus(2) hatte sein Kommen angekündigt. War sie ihren Gedanken bislang richtig gefolgt, eröffneten diese gar die Möglichkeit einer neuen Bestimmung des Menschen als handelndes Wesen. Und zwar eine, die weder wie bei Sartre letztlich inhaltsleer war noch wie bei Camus(3) notwendig absurd bleiben musste. Mit ihrem Essay würde sie eine weitere Alternative aufzeigen. Einen eigenen, dritten Weg.
Soweit sie sah, wäre das Maß genuin menschlichen Handelns demnach durch zwei Extreme von innen heraus begrenzt: zum einen durch das Extrem totalitärer Übergriffigkeit, zum anderen durch dasjenige absolut asozialer Selbstbescheidung. Konkret gesprochen, fand es sich also zwischen dem notwendig einsamen Ziel nach Eroberung der gesamten Welt sowie dem ebenso einsamen Bestreben nach Kultivierung des nur eigenen Vorgartens. Schließlich gab es, man musste ja nur aus dem Fenster blicken, auch noch andere Menschen als einen selbst. Deshalb hatten sich auf dieser Basis auch die Ziele moralischen Engagements zwischen nur zwei Extremen zu halten: dem des selbstentleerten und notwendig ungerichteten Mitleids für alle anderen leidenden Menschen auf der einen und der ausschließlichen Sorge für rein private Belange auf der anderen Seite. Als Szene des wirklichen Lebens: »Eine junge Frau ärgert sich, weil ihre Schuhe Löcher haben, durch die das Wasser eindringt. Indessen weint vielleicht eine andere über die Greuel der chinesischen Hungersnot.«[13]
Beauvoir hatte diese Situation sogar einst selbst erlebt. Die junge Frau mit den Löchern in den Schuhen war sie selbst gewesen (besser gesagt: eine frühere Version ihrer selbst). Die weinende andere aber ihre damalige Kommilitonin Simone Weil. Nie wieder hatte sie seither einen Menschen getroffen, der spontan in Tränen ausbricht, weil sich irgendwo in fernen Weiten eine Katastrophe ereignet, die rein gar nichts mit dem eigenen Leben zu tun zu haben schien. Diese andere Simone in ihrem Leben, sie war ihr noch immer ein Mysterium.
Beauvoir hielt inne, sah auf die Uhr. Es war Zeit. Schon morgen früh würde sie ins Café Flore zurückkehren, um von neuem über ihr Rätsel nachzudenken.
Die Mission
Genau wie Simone de Beauvoir ist auch besagte Simone Weil zu Beginn des Jahres 1943 fest entschlossen, radikal neue Wege einzuschlagen. Der Ernst der Situation lässt ihr keine andere Wahl. Schließlich ist sich die 34-jährige Französin in diesem Frühling gewisser denn je, einem Feind gegenüberzustehen, der selbst das größte zu erbringende Opfer rechtfertigt. Für einen tief religiös durchdrungenen Menschen wie Weil besteht dieses Opfer nicht etwa darin, das eigene Leben zu geben, sondern ein anderes zu nehmen.
»Wenn ich bereit bin«, notiert sie in ihr Denktagebuch dieses Frühlings, »im Falle strategischer Notwendigkeit Deutsche zu töten, dann nicht, weil ich ihretwegen gelitten habe. Nicht weil sie Gott und Christus(1) hassen. Sondern weil sie die Feinde aller Nationen der Erde sind, einschließlich meiner Heimat, und weil man sie unglücklicherweise, zu meinem größten Schmerz, zu meinem äußersten Bedauern, nicht daran hindern kann, Böses zu tun, ohne eine gewisse Anzahl von ihnen zu töten.«[14]
Von New York aus, wohin sie ihre Eltern auf der Flucht ins Exil begleitet hat, besteigt sie Ende Oktober 1942 einen Frachter nach Liverpool, um sich in England den Streitkräften des Freien Frankreich unter Leitung von General Charles de Gaulle(1) anzuschließen.[15] Nichts ist Weil in diesen kriegsentscheidenden Wochen und Monaten schmerzhafter als der Gedanke, sich fern der Heimat, fern ihres Volkes zu finden. Direkt nach ihrer Ankunft im Londoner Hauptquartier setzt sie die dortigen Entscheidungsträger deshalb von ihrem brennenden Wunsch in Kenntnis, eine Mission auf französischem Boden zu erhalten, um dort, wenn nötig, für ihr Vaterland den Märtyrertod zu sterben. Gerne als Fallschirmspringerin – die betreffenden Handbücher habe sie eingehend studiert. Oder auch als Verbindungsagentin zu den Kameraden vor Ort, von denen sie einige persönlich kenne, da sie die Jahre zuvor in Marseille für die katholische Widerstandsgruppe der Christlichen Zeugen aktiv war. Am liebsten aber an der Spitze einer von ihr eigens ersonnenen Spezialmission, die sich ihrer festen Überzeugung nach als kriegsentscheidend erweisen könnte. Weils Plan besteht in der Aufstellung eines Sonderverbands französischer Frontkrankenschwestern, die ausschließlich an gefährlichsten Orten eingesetzt werden, um direkt in der Schlacht Erste Hilfe zu leisten. Die dafür notwendigen medizinischen Kenntnisse habe sie sich über entsprechende Rot-Kreuz-Kurse in New York angeeignet. An vorderster Front könne dieses Spezialkommando viele wertvolle Leben retten, erklärt Weil, und legt den anwesenden Mitgliedern des Leitungsstabs zur Unterstützung ihrer Einschätzung eine Liste ausgewählter chirurgischer Fachpublikationen vor.
Der eigentliche Wert des Kommandos aber bestünde in dessen Symbolkraft, in dessen spirituellem Wert. Wie jeder Krieg, fährt sie wie beseelt fort, sei auch dieser zunächst ein Krieg der Geisteshaltungen – und damit einer des propagandistischen Geschicks. Gerade in diesem Bereich aber erweise sich der Feind den eigenen Kräften bislang in bösartigster Weise überlegen. Man denke nur an Hitlers(2)SS und den Ruf, der ihr mittlerweile europaweit vorauseile:
»Die SS-Leute bringen perfekt den Geist Hitlers(3) zum Ausdruck. An der Front verfügen sie … über den Heroismus der Brutalität … Wir können und müssen aber beweisen, dass wir eine andere Art von Mut besitzen. Der ihre ist brutal und niedrig, er geht aus dem Willen zur Macht und Zerstörung hervor. Da wir andere Ziele haben, geht unser Mut auch aus einem ganz anderen Geist hervor. Kein Symbol kann unseren Geist besser zum Ausdruck bringen als der hier vorgeschlagene Frauenverband. Das bloße Beharren gewisser Dienste der Menschlichkeit inmitten der Schlacht, auf dem Kulminationspunkt der Barbarei, wäre für diese Barbarei, zu der sich der Feind entschieden hat und zu der er auch uns zwingt, eine eklatante Herausforderung. Die Herausforderung wäre umso schlagender, als diese Dienste der Menschlichkeit von Frauen erfüllt würden und von mütterlicher Zuwendung umhüllt wären. Die Frauen wären zwar nur eine Handvoll und die Zahl der Soldaten, um die sie sich kümmern könnten, wäre verhältnismäßig klein, aber die moralische Wirksamkeit eines Symbols bemisst sich nicht nach deren Quantität … Es wäre die schlagendste Darstellung der beiden Richtungen, zwischen denen die Menschheit sich heute entscheiden muss.«[16] Wieder einmal in der Geschichte des Landes, erklärt Weil, also gelte es dem Geist der Idolatrie eine authentische Form des Glaubens rettend entgegenzusetzen. Kurz und gut, was ihr vorschwebe, sei eine Art weibliche Anti-SS im Geiste der Jungfrau von Orléans: Der Plan liege bereits schriftlich ausgearbeitet vor. Als Simone Weil ihn Maurice Schumann(1) persönlich überreicht, verspricht er seiner einstigen Kommilitonin in die Hand, ihn de Gaulle(2) zum Entscheid vorzulegen. Und geleitet sie persönlich hinaus zu ihrer Kasernenunterkunft.
Wie von Schumann(2) erwartet, benötigt de Gaulle(3) keine drei Sekunden, um »Kommando Krankenschwester« abschließend zu bewerten. »Aber, sie ist verrückt!«[17] Weshalb auch jede andere Art von Einsatz auf französischem Boden, kommt man überein, in Weils Fall absolut ausgeschlossen sei. Viel zu gefährlich. Man müsse sie ja nur einmal ansehen. Abgemagert bis auf die Knochen, ohne Brille faktisch blind. Schon rein körperlich würde sie den Belastungen nicht gewachsen sein. Von den geistigen gar nicht zu reden.
Bei aller Eigenwilligkeit des Auftritts, gibt Schumann(3) zu bedenken, sei Weil ein Mensch von höchster Integrität und vor allem einzigartigem Intellekt: Abschluss in Philosophie an der Pariser Eliteuniversität École Normale Supérieure, fließend mehrsprachig, mathematisch hochbegabt, mit langjähriger Erfahrung im Journalismus und der Gewerkschaftsarbeit. Diese Fähigkeiten gelte es zu nutzen.
Anstatt direkt an der Front für ihre Ideale sterben zu dürfen, wird Weil von ihren Oberen deshalb mit einer Spezialmission ganz anderer Art versehen: Für die Phase nach dem Sieg über Hitler(4) sowie der folgenden Machtübernahme durch die Exilregierung soll sie Pläne und Szenarien für den politischen Wiederaufbau Frankreichs entwerfen.
Tief enttäuscht, indes ohne offene Widerrede, nimmt sie die Aufgabe an, verschanzt sich in einem eigens für sie zur Schreibstube umfunktionierten Hotelzimmer in der Hill Street 19 – und macht sich an die Denkarbeit.
Inspiriert
Es dürfte in der Geschichte der Menschheit wenige Individuen gegeben haben, die in der Spanne von knapp vier Monaten geistig produktiver waren als die philosophische Widerstandskämpferin Simone Weil in diesem Londoner Winter des Jahres 1943: Sie schreibt Traktate zur Verfassungslehre und Revolutionstheorie, zu einer politischen Neuordnung Europas, eine Untersuchung zu den erkenntnistheoretischen Wurzeln des Marxismus, zur Funktion der Parteien in einer Demokratie. Sie übersetzt Teile der »Upanischaden« aus dem Sanskrit ins Französische, verfasst Abhandlungen zur Religionsgeschichte Griechenlands und Indiens, zur Theorie der Sakramente und der Heiligkeit der Person im Christentum sowie, unter dem Titel »Die Verwurzelung«[18], einen 300-seitigen Neuentwurf der kulturellen Existenz des Menschen in der Moderne.
Wie auch ihr »Plan für einen Verbund von Frontkrankenschwestern« durchschimmern lässt, macht Weil die eigentliche Not der Stunde im Bereich des Ideellen und Inspirativen aus. Als Ursprungskontinent gleich zweier Weltkriege binnen nur zweier Jahrzehnte, so ihre Analyse, leide Europa bereits seit längerem unter einer verheerenden Aushöhlung seiner kulturell wie politisch einst tragenden Werte und Ideale. In Wahrheit, lässt sie den militärischen Leitungsstab der französischen Résistance zum Februar in einer gleichnamigen Eingabe wissen, ist dieser Krieg »ein Krieg der Religionen«.[19]
Europa bleibt im Zentrum des Dramas. Von dem Feuer, das Christus(2) zur Erde warf und das vielleicht das des Prometheus(2) war, sind einige glühende Kohlen in England geblieben. Das hat das Schlimmste verhindert … Wir sind verloren, wenn nicht aus diesen Kohlen und Funken, die auf dem Kontinent glimmen, eine Flamme hervorgeht, die Europa erleuchten kann. Wenn wir nur durch Amerikas Gelder und Fabriken befreit werden, fallen wir auf die eine oder andere Weise in eine Form der Knechtschaft zurück, die der heutigen gleicht. Vergessen wir nicht, dass Europa nicht von Horden unterjocht wurde, die von einem anderen Kontinent oder vom Mars kamen, und dass es nicht ausreichen würde, sie zu verjagen. Europa leidet an einer inneren Krankheit. Es bedarf der Heilung … Die unterjochten Länder können dem Sieger nur eine Religion entgegensetzen … Die feindlichen Verbindungslinien … brächen zusammen, wenn sich das Feuer eines wirklichen Glaubens auf diesem gesamten Gebiet ausbreiten würde.[20]
Um diesen Heilungsprozess zunächst militärisch, dann auch politisch wie kulturell auf den Weg zu bringen, müsse dem Kontinent deshalb eine neue »Inspiration eingehaucht«[21] werden – nach Weil insbesondere aus den Textens Platons(1) sowie des Neuen Testaments. Denn wer wahre Heilung wolle, habe sich gerade in finsterster Zeit an Quellen zu halten, die nicht nur von dieser Welt seien.
Allen voran gelte dies für ihr Heimatland Frankreich, das als Ursprungsland des Freiheitsschubs von 1789 unter allen Krieg führenden Nationen geistig am tiefsten gefallen sei. Im Sommer 1940, binnen nur weniger Wochen annähernd kampflos von Hitlers(5) Truppen unterworfen, bleibe es zu seiner Befreiung nun auf fremde Hilfe angewiesen und habe als Volk jeden tragenden Glauben an sich verloren. Es zeige sich derzeit mit anderen Worten denkbar tief in dem wichtigsten und tiefsten aller menschlichen Seelenbedürfnisse erschüttert: eben dem nach »Verwurzelung«.
Die Verwurzelung ist wohl das wichtigste und am meisten verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele. Es zählt zu denen, die sich nur sehr schwer definieren lassen. Der Mensch hat eine Wurzel durch seinen wirklichen, aktiven und natürlichen Anteil am Dasein eines Gemeinwesens, in dem gewisse Schätze der Vergangenheit und gewisse Vorahnungen der Zukunft am Leben erhalten werden. Natürlicher Anteil heißt: automatisch gegeben durch den Ort, die Geburt, den Beruf, die Umgebung. Fast sein gesamtes moralisches, intellektuelles und spirituelles Leben muss er durch jene Lebensräume vermittelt bekommen, zu denen er von Natur aus gehört. … Eine militärische Eroberung bringt jedes Mal eine Entwurzelung mit sich … Wenn aber der Eroberer in dem Territorium, das er in Besitz genommen hat, ein Fremder bleibt, wird die Entwurzelung für die unterworfene Bevölkerung zu einer beinahe tödlichen Krankheit. Sie erreicht die höchste Stufe bei Massendeportationen, wie in dem von Deutschland besetzten Europa …[22]
So weit die Lageeinschätzung Simone Weils als eigens eingesetzter philosophischer Vordenkerin des Schattenkabinetts von General de Gaulle(4) im Frühjahr 1943. Als Jüdin geboren, indes seit Jahren tief christlich gestimmt, dient ihr diese Analyse eines spirituellen Defizits am eigentlichen Grund des mörderischen Geschehens als Quelle ihrer geradezu übermenschlich anmutenden Gedankenproduktion.
In Trance
Wie in Trance lässt sie in diesen Monaten die gesamte Breite ihres einzigartigen Geistes aufs Blatt fließen. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Ohne ausreichend zu schlafen. Und vor allem auch, wie bereits die Jahre zuvor, ohne ausreichend Nahrung zu sich zu nehmen. In ihr Londoner Denktagebuch notiert sie: »Aber so wie die allgemeine und dauernde Lage der Menschheit in dieser Welt aussieht, ist es vielleicht immer Betrug, sich satt zu essen. (Ich habe ihn oft begangen)«.[23]
Am 15. April 1943 findet der Rausch ein abruptes Ende. Weil kollabiert in ihrem Zimmer und verliert das Bewusstsein. Erst nach Stunden wird sie von einer Kameradin entdeckt. Wieder bei sich, verbietet Weil ihr indes kategorisch, einen Arzt zu rufen. Noch immer hat sie die Hoffnung auf einen Kampfeinsatz nicht ganz aufgegeben. Stattdessen ruft sie direkt bei Schumann(4) an, der ihr auf Nachfrage mehrmals versichert, noch sei über einen Einsatz in Frankreich nicht endgültig entschieden – somit im Prinzip noch alles möglich. Vor allem bei gewiss zügiger Genesung. Erst darauf lässt sich Weil ins Krankenhaus abholen.
Geistesschwach
Hätte sich die New Yorker Schriftstellerin und Philosophin Ayn Rand eine weitere Verkörperung all jener Werte ausdenken wollen, die ihrer Überzeugung nach verantwortlich für die Katastrophen des Weltkriegs waren, keine Kandidatin wäre geeigneter gewesen als die real existierende Simone Weil in London. Tatsächlich scheint Rand in diesem Frühling 1943 politisch nichts verheerender zu sein als die Bereitschaft, das eigene Leben im Namen einer Nation zu opfern. Moralisch nichts fataler als der Wille, zunächst und vor allem den anderen beizustehen. Philosophisch nichts abwegiger als blindes Gottvertrauen. Metaphysisch nichts verwirrter als das Streben, handlungsleitende Werte in einem Reich jenseitiger Transzendenz zu verankern. Existentiell nichts verrückter als persönliche Askese zur Rettung der Welt.
Exakt diese Haltung und die sie leitende Ethik sind der eigentliche Feind. Sie gilt es zu überwinden und bedingungslos zu bekämpfen, wo immer sie sich zeigen. Keinen Schritt weit durfte diesem Irrationalismus nachgegeben werden. Auch nicht, schon gar nicht in Fragen des eigenen Überlebens.
Wie Rand in zehn Jahren freier Autorenexistenz schmerzhaft gelernt hatte, waren dies gerade in den USA letztlich geschäftlichen Fragen. Weshalb sie in einem Brief vom 6. Mai 1943 an ihren Lektor Archibald Ogden(1) auch wie nie zuvor in deren Korrespondenz schäumt: »Vertrauen … Vertrauen, ich weiß nicht einmal, was dieses Wort bedeutet. Wenn Du damit Vertrauen (faith) im religiösen Sinne meinst, also im Sinne eines blinden Akzeptierens und Annehmens, dann vertraue ich tatsächlich in nichts und niemanden. Habe es niemals getan und werde es niemals tun. Das Einzige, woran ich mich halte, sind mein Verstand und Fakten«, legt Rand die eigentlichen Grundlagen ihres Weltzugangs frei. Und wendet sie Ogden(2) gegenüber sogleich auf ihre ureigensten Interessen an: »Welche objektiven Anhaltspunkte bestehen derzeit hinsichtlich der Befähigung des Verlagshauses Bobbs-Merrill, mein Buch erfolgreich zu vermarkten? Wem genau sollte ich da vertrauen? Und auf welcher Grundlage?«[24]
Sieben Jahre hat sie an diesem Roman gearbeitet. Ihre gesamte Lebensenergie und Kreativität, vor allem aber ihre Philosophie in dieses Werk gelegt. Und nun soll »The Fountainhead« (dt. »Die Quelle«/»Der Ursprung«) vom Verlag in den ohnehin allzu spärlichen Anzeigen als Liebesgeschichte im Architektenmilieu beworben werden. Nicht einmal die Tatsache, dass die Autorin des Buches eine Frau und kein Mann ist, vermag dessen Presseabteilung bislang erfolgreich zu kommunizieren: »Bei dem Vertrauen, das man solchen Mitarbeitern entgegenbringen soll, kann es sich ganz offensichtlich nur um das Vertrauen eines Geistesschwachen handeln. … Ist das wirklich die Art von Vertrauen, die Du von mir erwartest?«[25]
Eine rhetorische Frage, ganz offenbar. Rand war in ihrem Leben bereits für fast alles gehalten worden. Nie aber für geistesschwach. Vielmehr war jedem, mit dem sie sprach, bereits nach wenigen Minuten klar, es mit einem Intellekt von einzigartiger Klarheit und nicht zuletzt Kompromisslosigkeit zu tun zu haben. Das grundlegend zu lösende Problem in dieser Welt stellte für sie demgemäß auch nicht ihre eigene Existenz dar, sondern diejenige all der anderen. Nicht, was ihre Mitmenschen so dachten und taten, war für Rand dabei das eigentlich Rätselhafte, sondern weshalb sie es taten: Warum konnten sie nicht einfach stringent denken und vor allem handeln? Was genau hinderte all die Menschen daran, stets ihrem je eigenen, rein faktenbasierten Urteil zu folgen? Ihr gelang es doch auch.
Unverschämt
Warum rückte ihr Lektor nicht wenigstens jetzt, einen Tag vor dem offiziellen Erscheinungstermin des Buches, mit dem Offensichtlichen heraus: Die zwei, drei zu schaltenden Anzeigen waren reine Staffage. Faktisch würde das Werk vom Verlag durchgewunken. Wenn überhaupt, müsste »The Fountainhead« nach Beschluss der Marketingabteilung aus eigener Kraft seinen eigenen Weg in die Läden oder gar Bestsellerlisten finden. Schließlich konnte niemandem, der auch nur eine Seite darin las, entgehen, dass dieses über 700 Seiten starke Werk mit dem übermenschlich anmutenden Architekten Howard Roark(1) als Hauptfigur in Wahrheit ein Roman gewordenes philosophisches Manifest war. Ein wuchtiges Ideenmonument voll seitenlanger Monologe, das darüber hinaus die schwer zu vermarktende Eigenschaft besaß, sämtliche moralischen Intuitionen herauszufordern, auf denen das sittliche Empfinden des amerikanischen Mainstream-Publikums mutmaßlich beruhte.
Soweit es Rand betraf, lag exakt darin das einzigartige Versprechen ihres Werkes. Genauso sollte es auch präsentiert und beworben werden: als ein transformatives literarisches Leseereignis, das seinen Lesern eine fundamental andere Weltsicht eröffnet, sie von der Höhle ins Licht führt, um sich selbst und ihre Welt zum ersten Mal klar zu sehen! 100 000 verkaufte Exemplare[26], zeigt die Autorin sich im engsten Freundeskreis überzeugt, sollten deshalb ein Minimum des Erwartbaren sein – sowie eine baldige Hollywood-Verfilmung des Stoffes mit ihrem Lieblingsschauspieler Gary Cooper in der Rolle des Howard Roark(2).
Was sprach, rein rational, dagegen? Gewiss nicht die Qualität ihres Werkes. Ganz gewiss nicht die Aktualität seiner Botschaft! War es denn nicht offensichtlich, wie es um diese Welt und selbst Amerika mittlerweile stand? Erspürte nicht jeder einzelne Bürger des Landes, dass da etwas ganz grundlegend aus dem Lot geraten war? Dass es dringender denn je galt, einen gesamten Kulturkreis vor seinem selbst verschuldeten Untergang zu bewahren? Ihn mit der Macht der freien Rede, der Bündigkeit des Arguments und nicht zuletzt der weltverwandelnden Kraft des Erzählens von der tiefen Verwirrung zu therapieren, an dem er nun, im Frühjahr 1943, in einer weltweiten Orgie der Gewalt unterzugehen drohte?
Kampfbereit
Das Ziel, das Rand sich mit ihrem Roman gesetzt hatte, bestand vor allem darin, »den Kampf zwischen Individualismus und Kollektivismus nicht in der Politik, sondern der menschlichen Seele«[27] auszuleuchten. Das war sein eigentliches Thema: also der Kampf zwischen Autonomie und Fremdbestimmung, zwischen Denken und Gehorchen, zwischen Mut und Demut, zwischen Schöpfen und Kopieren, zwischen Integrität und Korruption, zwischen Fortschritt und Verfall, zwischen Ich und all den anderen – zwischen Freiheit und Unterdrückung.
Auf dem Weg zur wahren Befreiung des Individuums vom Joch der altruistischen Sklavenmoral hatten die Werke Max Stirners(1) und Friedrich Nietzsches(1) nur rhapsodische Anfänge bedeutet. Erst mit ihrer, mit Ayn Rands Philosophie würde dem aufgeklärten Egoismus ein objektiv begründbares Fundament gegeben werden! In exakt diesem Geiste ließ die Autorin auch ihren Helden Howard Roark(3) – als Erlöser von sämtlichen Übeln der Gegenwart – während der alles entscheidenden Gerichtsverhandlung am Ende ihres Romans in den Verteidigungsstand treten. Als wegweisende Verkörperung eines freiheitsliebenden Daseins der reinen, schöpferischen Vernunft. Roarks(4) Credo war auch Rands eigenes:
Der Schöpfer lebt für sein Werk. Er braucht niemand anderes. Sein primäres Ziel liegt in ihm selbst. … Altruismus ist die Lehre, die verlangt, dass man für andere lebt und andere über sich selbst stellt … Was ihr in der Realität am nächsten kommt – der Mensch, der lebt, um anderen zu dienen –, ist der Sklave. Wenn körperliche Sklaverei widerwärtig ist, wie viel widerwärtiger ist dann das Konzept geistiger Unterwürfigkeit? Der besiegte Sklave besitzt noch eine Spur von Ehre. Er hat sich gewehrt und empfindet seinen Zustand als schmachvoll. Doch der Mensch, der sich im Namen der Liebe freiwillig für andere versklavt, ist das niedrigste aller Geschöpfe. Er setzt die Menschenwürde und den Begriff der Liebe herab. Aber genau das ist das Wesen des Altruismus.[28]
Rand wusste, wovon sie ihren Helden warnend sprechen ließ. Sie hatte am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlte, in einer Gesellschaft staatlich erzeugter Sklaven zu leben. Wie so viele einst wohlhabende jüdische Familien waren auch die in Sankt Petersburg ansässigen Rosenbaums im Verlauf der russischen Oktoberrevolution enteignet worden. Nach der Plünderung und Zerstörung der von ihrem Vater geführten Apotheke (Lenin(1): »Plündert die Plünderer!«) war Ayn, die damals noch Alissa gerufen wurde, Ende 1918 mit ihren Eltern und den beiden Schwestern an die Krim geflüchtet. Tausende Kilometer, zunächst per Zug, schon bald über Fußmärsche. Zwar konnte die Familie 1921 wieder nach Sankt Petersburg (Petrograd, ab 1924 Leningrad) zurückehren. Seine Geschäfte als Apotheker durfte der nunmehr weitgehend mittellose Vater als einstiger Vertreter der »Bourgeoisie« allerdings nicht weiterführen.[29]
Im Herbst dieses Jahres schreibt Rand sich an der Universität für Geschichte und Philosophie ein und wechselt nach ihrem Abschluss 1924 schließlich an die Hochschule für angewandte Künste, um Film zu studieren. Doch ist ihr wahres Ziel zu dieser Zeit schon ein anderes: Die 19-jährige Überfliegerin will nichts wie raus aus dieser Sowjetunion, will nichts zu tun haben mit deren Utopie »vom neuen Menschen«, sondern aus eigenen Stücken und Antrieben die werden, die sie ist: eine Schöpferin eigener Welten. Sie will in die Freiheit, in das Land ihrer bevorzugten Filmstars und Regisseure – nach Amerika!
Über ein Urlaubsvisum gelingt es den Eltern Anfang 1926, sie zu Verwandten nach Chicago ausreisen zu lassen. Sechs abenteuerliche Wochen später (Riga, Berlin, Le Havre, New York) ist sie mit dem Bus auf dem Weg nach Hollywood, um dort als Schriftstellerin und Drehbuchautorin zu leben. Alissa Rosenbaum ist damals 21 Jahre alt, spricht so gut wie kein Wort Englisch und will fortan nur noch »Ayn Rand« genannt werden. Wenn schon die alte Welt nicht zu retten war, konnte Alissa doch in der neuen zu einer anderen werden. Sie schwört sich, lieber zu sterben, als je wieder in ihre Heimat zurückzukehren.
Nur logisch
17 Jahre hat sie seither jeden Tag für ihren amerikanischen Traum gekämpft. Während sich Rand mit der Veröffentlichung des »Fountainhead« ihrem Lebensziel so nah wie nie wähnt, drohen die Eltern sowie ihre beiden jüngeren Schwestern in dem seit mehr als zwei Jahren von Hitlers(6) Wehrmacht belagerten Leningrad den Hungertod zu sterben. Wenn sie denn überhaupt noch lebten. Es gibt für Rand nicht die geringste Möglichkeit, dies herauszufinden. Die wenigen Berichte, die vom nackten Überlebenskampf der Belagerten gerüchteweise über den Atlantik dringen, gehen über die Grenzen des Menschlichen hinaus. An die eine Million Einwohner sollen dort bis zum Frühjahr 1943 umgekommen sein. Lange schon seien sämtliche Hunde und Katzen zum Verzehr getötet worden. Gar von systematischem Kannibalismus ist die Rede.[30] Nein, ihr brauchte man nichts weiter zu erzählen. Sie hatte es ja bereits damals alles erlebt. Den Hunger. Den Typhus. Die Toten. Seither waren ihre Augen geöffnet. Und mittlerweile auch philosophisch weiter geschärft.
Nach Rands Sicht der Dinge folgte sowohl Hitlers(7) wie Stalins(1) Mordlust letztlich ein und derselben Logik, und zwar der Logik einer gewaltsamen staatlichen Unterjochung jedes einzelnen Menschen im Namen eines ideell überhöhten Kollektivs. Ob dieses Kollektiv nun als »Klasse« oder »Volk«, »Nation« oder »Rasse« angerufen wird, bedeutet nur auf den ersten Blick einen Unterschied. Denn in ihren Antrieben, Methoden und vor allem ihren letztlich menschenverachtenden Wirkungen sind diese »Totalitarismen«[31] – wie Rand die politischen Bedrohungen seit Beginn der vierziger Jahre für sich auf einen gemeinsamen Begriff bringt – im Ergebnis wirkungsgleich. Zuerst hatte der Totalitarismus in Russland gesiegt, dann in Italien und schließlich in Deutschland. Kein Land war also vor ihm gefeit. Auch nicht, schon gar nicht die USA. Bestand das eigentliche Erfolgsgeheimnis totalitärer Kräfte doch gerade darin, in dem Prozess ihrer systematischen Unterjochung keineswegs auf die ausdrückliche Unterstützung der breiten Massen zu setzen, sondern allein auf deren dumpfe Gleichgültigkeit.
Mit dem erfolgten Kriegseintritt der USA unter dem New-Deal-Präsidenten Roosevelt(1) drohte deshalb für Rand die gesamte Welt an einer einzigen falschen Idee, einem fundamentalen philosophischen Missverständnis zugrunde zu gehen: der Nobilitierung der Selbstaufopferung zugunsten anderer, zugunsten eines propagandistisch geheiligten Kollektivs. Genau diese altruistische Denkblockade war es, die es eigentlich zu durchbrechen galt. Dieser Krieg, er war ein Krieg der Ideen!
Alle diese Grauen wurden ausschließlich von Menschen möglich gemacht, die jeden Respekt für das einzelne, individuelle menschliche Wesen verloren haben; Menschen, die der Idee anhängen, dass Klassen, Rassen und Nationen das sind, was zählt, nicht aber einzelne Personen; dass die Mehrheit heilig ist, die Minderheit aber Dreck, dass Herden zählen, nicht aber der einzelne Mensch. Wie stehen Sie dazu? Es gibt hier keinen Mittelweg.[32]
Bereits 1941 hatte Rand diese Zeilen für ein politisches Manifest zu Papier gebracht. Im Angesicht der weltpolitischen Lage dachte sie nun darüber nach, diesen Text möglichst zügig zu einem Sachbuch auszubauen. Fester denn je fühlt sie sich im Frühjahr 1943 entschlossen, sich mit aller denkerischen Kraft in diesen Krieg der Ideen zu werfen. Und zwar aus purem Eigeninteresse. Für ihre eigene bedrohte Freiheit und Integrität. Für alles, was ihr auf dieser und keiner anderen Welt lieb und teuer ist. Für wen oder was auch sonst?
Die Fremde
Nur einen Steinwurf von Ayn Rands Apartment in Manhattan entfernt, sieht auch Hannah Arendt die Zeit für eine denkbar grundsätzliche Neubestimmung gekommen. Allerdings in weitaus weniger kämpferischem Geiste. »Nur sehr wenige Individuen«, schreibt die 36-jährige Philosophin in einem Artikel des Januars 1943, »bringen die Kraft auf, ihre eigene Integrität zu wahren, wenn ihr sozialer, politischer und juristischer Status völlig verworren ist.«[33] Exakt zehn Jahre nach ihrer Vertreibung aus Hitler(8)-Deutschland ist Arendt beim Blick in den Spiegel nicht sicher, auch weiterhin die dafür nötige Energie in sich zu finden. Nie zuvor in ihrem Leben hat sie sich so isoliert, so durch und durch leer und sinnlos gefühlt wie in den vorangegangenen Wochen: »Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Wir haben unsere Verwandten in den polnischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten Freunde sind in den Konzentrationslagern umgebracht worden, und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt. … Wenn wir gerettet werden, fühlen wir uns gedemütigt, und wenn man uns hilft, fühlen wir uns erniedrigt. Wie Verrückte kämpfen wir um eine private Existenz mit individuellem Geschick.«[34]
Tatsächlich taugt Arendts Beschreibung ihrer Gestimmtheit als eindrückliches Beispiel für eben jene Leiden der Seele, die Simone Weil als notwendige Folge existentieller »Entwurzelung« beschreibt. Nur eben, dass Arendt zum besagten Zeitpunkt weder in einem dauerhaft besetzten Land lebt noch selbst Opfer von Massendeportation geworden ist. Vielmehr beschreibt diese Passage ihres Essays »Wir Flüchtlinge« den umfassenden Verlust, von dem sich deutsch-jüdische Flüchtlinge in neuer Welt zum Jahreswechsel 1942/1943 besonders hart getroffen zeigen. Für Wochen brachten sie und ihr Mann ihre Tage damit zu, gemeinsam in das graue Nichts des New Yorker Winterhimmels zu starren. Rauchend. Schweigend. Wie die letzten Menschen auf Erden.
Ohne Geländer
Vom Naturell an sich eine chronische Frohnatur, hatte Arendt ihre Situation die vorangegangenen zehn Jahre mit ebenso viel Zähigkeit wie Einfallsreichtum angenommen. Kam es darauf an, hatte sie stets genug Feuer in sich gefunden, den Weg in ein abermals neues Leben zu bahnen. Von Berlin nach Paris, von Paris nach Marseille, schließlich hierher nach New York. Stets mit dem Ziel, »ohne alle faulen Tricks der Anpassung und Assimilation ihren Weg zu machen«.[35]
Was sie indes mit dem Frühjahr 1943 vom Gerüst ihres privaten Daseins gerettet sah, war einzig ihr »Monsieur« Heinrich(1), mit dem sie sich in einem schäbigen Apartmentblock in der 95th Avenue ein möbliertes Zimmer teilte – sowie auf derselben Etage ihre in der neuen Welt ebenso hilflose wie kränkelnde Mutter Martha Beerwald(1), verwitwete Arendt. Gewiss, das war mehr als viele andere »displaced persons« auf der Flucht hatten retten können. Aber ein selbstbestimmtes Geschick, das diesen Namen verdiente, war es deshalb noch lange nicht.
Einst Meisterschülerin von Karl Jaspers(1) und Martin Heidegger(3), hatte sie ihr besonderes Gespür, sich zielgenau zwischen allen Stühlen zu platzieren, auch über die Jahre des Exils nicht verlassen. Tatsächlich ließ sich die Anzahl von Menschen, auf deren Wohlwollen sie sich wirklich verlassen konnte, weltweit mittlerweile an einer Hand abzählen: Arendts Mentor Kurt Blumenfeld(1) in New York sowie der Judaist Gershom Scholem(1) in Jerusalem. Ihr Ex-Gatte Günther Stern(1) in Kalifornien, der Theologe Paul Tillich(1), ebenfalls in New York. Ob die Jaspers(2)’ noch lebten und wenn ja, wo – es war nicht zu ermitteln. Der letzte Brief lag bald ein Jahrzehnt zurück. Sie wusste selbst nicht, weshalb der Kontakt so früh abgebrochen war. Jaspers(3) – rückblickend ist er der einzige wahre Lehrer, denn sie je hatte. Ihre einst stürmische Bindung mit Heidegger(4) aber war 1933 aus ganz anderen Gründen erloschen, als dieser der NSDAP beitrat und in einem Beiblatt zu seiner Freiburger Rektoratsrede dieses Jahres den Studenten unter anderem verkündete: »Der Führer selbst und er allein ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz.«[36] Noch immer hatte sie nicht den Mut gefunden, bei Ernst Cassirer(1) anzuklopfen, der nun in Yale unterrichtete und über gemeinsame Freunde von Arendt wusste.
Der Riss
Seit dem Kriegseintritt der USA war es noch einmal schwerer geworden, sich über das Schicksal der in Europa zurückgebliebenen Bekannten und Verwandten zu informieren – geschweige denn, ihnen bei der Flucht behilflich zu sein. So trifft es Arendt besonders hart, als am 18. Dezember 1942 in der deutschsprachigen Exilzeitung »Der Aufbau«, für die sie selbst gut ein Jahr lang als Kolumnistin tätig gewesen war, ein Bericht über den Deportationstag im südfranzösischen Internierungslager Gurs veröffentlicht wird, dem lange Namenslisten der Deportierten folgten.[37] Auch Arendt war 1940 dort interniert – und erkannte manchen Namen wieder.
Der Artikel im »Aufbau« war in diesem Winter indes nur eine von mehreren Veröffentlichungen, die vom Beginn einer neuen Phase im Umgang mit den von den Nazis mittlerweile zu Millionen in Konzentrationslagern gefangenen Juden Europas berichtete. Offenbar war man im Sinne der von Hitler(9) wie Goebbels(1) angekündigten »Endlösung der Judenfrage« dazu übergegangen, diese Menschen in eigens dafür geschaffenen Vernichtungslagern fabrikartig zu ermorden – sie zu vergasen. Weder Arendt noch ihr Mann hatten jemals Zweifel an der unbedingten Judenfeindschaft der Nazis gehegt – noch an deren rückhaltloser Brutalität im Verfolgen verlautbarter Ziele. Doch selbst ihnen fällt zunächst schwer, diesen Berichten Glauben zu schenken. Zu monströs das geschilderte Vorgehen, zu sinnlos als Maßnahme. Nicht zuletzt aus logistischer und strategischer Sicht. Gerade jetzt, wo Hitlers(10) Armee einen Rückschlag nach dem anderen einstecken musste. Allein in der Sowjetunion hatte sie, wie es hieß, in diesem Winter eine Million Soldaten verloren.
Dennoch, offenbar traf es zu, war der Fall. Zu zahlreich die Berichte, zu divers die Quellen. Der Weltverlust, den Arendt in den folgenden Wochen verspürte, ging über jedes ihr bisher bekannte Maß hinaus. Es betraf keine bestimmte Gruppe oder Gemeinschaft, keinen konkreten Ort oder Zeitraum, allenfalls ihr Menschsein überhaupt. Ein geradezu metaphysisches Befremden hatte sie erfasst. Als ob sich mitten in dieser Welt, mitten in ihrem Selbst ein Abgrund aufgetan hätte, der durch nichts und niemanden mehr überbrückbar schien.
Woran genau hatten sie eigentlich nicht glauben wollen? Was genau für unmöglich gehalten? Dass man ein gesamtes Volk – und sei es über die ganze Welt verstreut – zum Todfeind erklärte, war ja an sich nichts Menschenfremdes. Nicht einmal dieser Krieg und seine bestialischen Schlachten waren es. Die Geschichte kannte dergleichen, ja bestand in Wahrheit aus kaum etwas anderem. Aber das … Nichts ließ Arendt die eigene Ohnmacht deutlicher erfahren als ihr nachhaltiges Unvermögen, das Geschehen in eigene Worte zu fassen.[38]
Gegenwärtig
Am liebsten hätte sie ihr altes Selbst einfach vergessen. So getan, als wäre sie ganz frei zu entscheiden, wer sie ist und wie sie fortan in dieser Welt leben wollte: Es gab ja Menschen, sogar Philosophen, die so etwas aus dem Stand für möglich erklärten. Doch für solche Illusionen war sie nie jung genug gewesen. In Wahrheit, sie wusste es, blieb die Erschaffung »einer neuen Persönlichkeit so schwierig und hoffnungslos wie eine Neuerschaffung der Welt«.[39] Kein Mensch fing jemals ganz von neuem an. Niemand war so frei oder haltlos. Sosehr er oder sie sich dies – sei es aus Größenwahn oder tiefster Verzweiflung – auch wünschen oder einbilden mochte.
Bedachte man es recht, war diese eine Weise zu erhellen, wie es überhaupt zu dem ganzen Höllenspektakel gekommen war. In seinem Ursprung lag die Wahnidee Einzelner, nach eigenem Willen tatsächlich der gesamten Welt eine neue Gestalt zu geben, sie buchstäblich neu schaffen zu wollen: aus einem einzigen und einheitlichen Guss. Es war die Wahnvision von einer Welt, die fortan nur noch von einem einzigen Antlitz bestimmt wurde. Einer Welt also, die zu ihrer fortwährenden Neuschöpfung keiner anderen Menschen, keiner leibhaftigen Widerstände mehr bedurfte: der politische Alptraum totaler Herrschaft.
Doch wenn etwas ein Alptraum ist, so viel blieb selbst in dieser finsteren Zeit wahr, bedeutet es auch, dass man aus ihm erwachen kann. Man musste nur den Mut in sich finden, die Augen zu öffnen – offen zu halten –, um wachen Geistes die Abgründe der je eigenen Gegenwart zu gewahren. Die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie anstößig ist.«[40] Um so zu bezeugen, aus welchen Untiefen sie in die Welt getreten waren. Also weder dem Vergangenen noch dem Zukünftigen anheimzufallen. Weder dem eigenen Urteil noch dem der anderen je blind zu folgen. Den Mut finden, sich ihres eigenes Verstandes zu bedienen. Sich im Denken frei zu orientieren.
Gerade jetzt, in diesem Moment – Arendt sammelte neue Kräfte – mochte es darauf ankommen, »ganz und gar gegenwärtig zu sein«.[41] Oder mit anderen Worten: zu philosophieren.
II. Exile
1933/1934
Arendt verlässt ihr Land, Weil ihre Partei, Beauvoir ihre Skepsis und Rand ihr Skript
Raster
»Gewöhnlich habe ich doch da immer jemand vor mir sitzen, da sehe ich bloß nach, dann weiß ich schon, was das ist. Aber, was tue ich mit Ihnen?«[1] Offenbar war ihr Name noch in keiner Gestapo-Kartei erfasst. Und selbst wenn sie dem jungen Kommissar auf die Sprünge hätte helfen wollen, ganz genau vermochte auch Hannah Arendt nicht einzuschätzen, weshalb sie und ihre Mutter an diesem Maimorgen während des Frühstücks in einem Café nahe dem Berliner Alexanderplatz in einen Wagen gezerrt und zum Verhör gebracht worden waren.
Gründe gäbe es genug. Den ganzen Frühling über hatte ihre Wohnung in der Opitzstraße als Versteck für politisch Verfolgte gedient. Und dann war da ja noch die Bitte ihres um eine Generation älteren Freundes Kurt Blumenfeld(2), für den nahenden Zionistenkongress in Prag »eine Sammlung aller antisemitischen Äußerungen auf unterer Ebene« anzulegen, die sie Tag für Tag in die Zeitungsarchive der Preußischen Staatsbibliothek führte. Auch derartige Materialien zu sammeln, war mittlerweile illegal.
Womöglich arbeitet man zur Abschreckung aber auch einfach nur Namenslisten ab – sowie Listen, die auf solchen Listen beruhten. Wie etwa dem Adressbuch Bertolt Brechts(1). Bereits wenige Tage nach Hitlers(11) Machtübernahme hatte es die Gestapo aus dessen Wohnung konfisziert. Ein Who’s who der kommunistisch gesinnten Intelligenzija Berlins, zu der auch Arendts Ehemann Günther Stern(2) gehörte.
Aus Furcht, der frisch gegründeten preußischen Hilfspolizei in die Hände zu fallen, war er bereits Anfang Februar aus Berlin nach Paris geflohen. Und tatsächlich, nur zwei Wochen später, als hätte der Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 das lang vereinbarte Startsignal gegeben, begannen die Wellen: willkürliche Verhaftungen, Verschleppungen in provisorische Konzentrationslager im Umland, selbst städtische Turnhallen wurden zu Folterkammern umfunktioniert. Allein in Berlin gab es mit diesem Sommer mehr als 200 solcher Orte. Der Naziterror hatte den Alltag erreicht. Die Zahl der Opfer ging bereits in die Tausenden.
Mehr als wahrscheinlich, dass eine Einheit der Gestapo just in diesem Moment ihre Wohnung durchsuchte. Aber was würden die Tölpel dort schon finden – außer Dutzende Notizbücher mit transkribierten griechischen Originalzitaten, die Gedichte Heines(1) und Hölderlins(1) sowie unzählige Werke zum Berliner Geistesleben des frühen 19. Jahrhunderts?
Soweit es die öffentlichen Register betraf, war sie eine unbescholtene Doktorin der Philosophie mit einem erst im Vorjahr ausgelaufenen Stipendium der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Die klassische Berliner Existenz: Akademikerin ohne Einkünfte, Publizistin ohne Abnehmer. Natürlich verbringe sie jeden Tag in der Bibliothek. Was denn sonst? Schließlich ruhe die Forschung nie.
Selbst aus Arendts Mutter war, wie sich erweisen sollte, nichts Verwertbares herauszubekommen. Befragt auf die Aktivitäten ihrer Tochter, gab Martha Beerwald(2) (verwitwete Arendt) während ihres Verhörs vielmehr einen Elternsatz von schönster Solidarisierung zu Protokoll: »Nein, ich weiß nicht, was sie tut, aber was sie auch getan haben mag, es war richtig, und ich hätte es auch gemacht.«[2]
Noch am Tag der Festnahme[3] kommen beide wieder frei. Nicht einmal einen Anwalt hatten sie einschalten müssen. Glück gehabt. Für dieses Mal. Dennoch, auch Arendts Entschluss ist nun getroffen. Es gab in diesem Land keine Zukunft mehr. Jedenfalls nicht für Menschen wie sie.
Rahels(1) Fall
Dass es keineswegs nur an einem selbst lag zu entscheiden, wer und was man sei, wenige dürften in diesem ersten Sommer nach Adolf Hitlers(12) Machtübernahme dafür ein klareres Bewusstsein besessen haben als Hannah Arendt. Am Beispiel der Berlinerin Rahel(2) Varnhagen ging sie seit drei Jahren den komplexen Identitätsdynamiken einer deutschen Jüdin und Intellektuellen zur Wende des 18. zum 19. Jahrhundert nach. Entstanden war so das Psychogramm einer Frau, in deren Existenz sich die spannungsreiche Geschichte des gebildeten deutschen Judentums beispielhaft verdichtete – vor allem in Bezug auf die Frage der Assimilation. In weiten Teilen collagenhaft als Zitatsammlung angelegt, zeichnet Arendt in diesem Buch den Bewusstseinsprozess einer Frau nach, der es durch die offensive Verneinung ihrer jüdischen Herkunft lange unmöglich bleibt, überhaupt ein stabiles Selbst- und Weltverhältnis aufzubauen. Als Mensch ihres Zeitraums, wie Arendt ja auch, in eine Situation dreifacher Marginalisierung geworfen – Frau, Jüdin, Intellektuelle –, führt Rahels(3) Weigerung, sich sozial als das anzuerkennen, was sie in den Augen der anderen unweigerlich ist und bleiben muss, zu einer Situation leidvoll erfahrener Selbstlosigkeit: »Rahels(4) Kampf gegen die Fakten, vor allem gegen das Faktum, als Jude geboren zu sein, wird sehr schnell zum Kampf gegen sich selbst. Sich selbst muß sie den Konsens verweigern, sich selbst, die Benachteiligte, verleugnen, verändern, umlügen, da sie ja nicht sich selbst einfach die Existenz bestreiten kann. … Es gibt – hat man erst einmal nein zu sich gesagt – keine Wahl. Es gibt nur eins: immer gerade und im Augenblick anders zu sein, als man ist.«[4]
Exemplarisch für ein gesamtes Zeitalter ist Rahels(5) Fall für Arendt auch insofern, als in ihrer Lebenssituation zwei Formen erforderten Mutes miteinander kollidieren: der aufklärerische Mut, sich des eigenen Verstands zu bedienen und sich in diesem Sinne als Vernunftwesen autonom zu bestimmen, sowie der Mut anzuerkennen, dass die Freiheit dieses Selbstentwurfs stets von geschichtlichen wie kulturellen Verhältnissen bedingt bleibt, von denen sich kein Individuum völlig distanzieren kann. In Rahels(6) eigenem Zeitraum drückt sich dies im Spannungsfeld zwischen aufklärerischen und romantischen Selbstwerdungsidealen aus: zwischen Vernunft und Geschichte, Stolz und Vorurteil, Denken und Gehorchen, zwischen dem Traum von der vollkommenen Selbstbestimmung des Ich und der letztlich unhintergehbaren Fremdbestimmung durch die anderen.
Nach Arendt kann die aufklärerische Vernunft zwar »von den Vorurteilen der Vergangenheit befreien, und sie kann die Zukunft des Menschen leiten. Nur leider genügt das offensichtlich nicht: sie kann nur individuell befreien, und nur die Zukunft von Robinsonen liegt in ihrer Hand. Das solchermaßen befreite Individuum stößt doch immer wieder auf eine Welt, eine Gesellschaft, deren Vergangenheit in Gestalt von ›Vorurteilen‹ Macht hat, in der ihm bewiesen wird, daß gewesene Wirklichkeit auch Wirklichkeit ist. Als Jüdin geboren zu sein, das mag für Rahel(7) nur auf längst Vergangenes hindeuten, mag im Denken ganz und gar ausgelöscht sein; als Vorurteil in den Köpfen anderer wird es doch zur leidigsten Gegenwart.«[5]
Kein Mensch entkommt der Geworfenheit in diese Spannung – und sollte nicht einmal vernünftig wünschen, es zu können. Wäre der Preis dafür doch in Wahrheit kein geringerer als der Verlust dessen, was überhaupt Welt und Wirklichkeit genannt zu werden verdient.
Aufgeklärt
Das Risiko des Weltverlusts im Namen einer sich als allzu rational gebärdenden Selbstbestimmung, mit dieser Mahnung an Rahel(8) stellt sich Arendt ganz bewusst in die philosophische Spur ihrer beiden prägenden akademischen Lehrer: Martin Heidegger(5) und Karl Jaspers(4). Bereits als Studentin in Marburg wurde Arendt durch Heidegger, mit dem sie ab 1925 auch ein über mehrere Jahre andauerndes Liebesverhältnis verband, für die blinden Flecken des modernen Welt- und Menschenbilds sensibilisiert. Denn der Mensch, wie Heidegger(6) ihn in seinem epochalen Werk »Sein und Zeit« beschrieb, war mitnichten ein vorrangig vernunftbegabtes »Subjekt«, sondern vielmehr ein grundlos in die Welt geworfenes »Da-Sein«. Er lebte als denkendes und vor allem handelndes Wesen auch nicht in einer stummen »Realität«, die er erst mit Sinngehalt zu versehen hatte, sondern in einer »Umwelt«, die für ihn schon immer bedeutungsvoll war. Wie auch wahre menschliche Autonomie für Heidegger fast nichts mit rein rationalen Entscheidungen, Berechnungen oder auch nur Regelvorgaben zu tun hatte, sondern mit dem Mut, sich in existentiell ausgezeichneten Grenz- und Sondersituationen selbst zu ergreifen.
All diese Motive trieben in den zwanziger Jahren auch Heideggers(7) damals engsten Denkvertrauten Karl Jaspers(5) um, als sich Arendt 1926 in Heidelberg bei diesem zur Promotion vorstellte. Im Gegensatz zu Heidegger allerdings betonte Jaspers’ »Existenzphilosophie« weniger die Macht dunkler und stark vereinzelnder Gestimmtheiten, wie der Angst oder Todesnähe, als vielmehr die Möglichkeiten des Menschen, gerade durch die Kommunikation und Zuwendung zu anderen den Weg in ein helleres, freieres Leben zu finden. Diese Zuwendung war im Idealfall immer als dialogische zu denken und betonte somit die Notwendigkeit eines tatsächlichen Gegenübers, womit sie zugleich dessen gesichtslose Adressierung im Sinne des anonymen »man«, »der Öffentlichkeit« oder gar »der Menschheit« ausschloss.
Vollgesogen mit diesen Impulsen, erschließt sich Arendt ab Ende der zwanziger Jahre ein eigenes Deutungsfundament der menschlichen Situation, das ihr in Form und Inhalt eine äußert eigenständige Annäherung an den Fall der Rahel Varnhagen ermöglicht: War Rahels(9) Situation nicht wie geschaffen, beispielhaft eben jene Druckverhältnisse freizulegen, die in Wahrheit jedes moderne Dasein bedingen?
Vielstimmig
Sich mit Rahel(10) als Mensch selbst zu erkennen – für Arendt als Philosophin bedeutet dies die Zurückweisung jeder weltlosen und damit auch ahistorischen Vernunftkonzeption. Es bedeutet die Anerkennung, dass wahre Selbstfindung nur im Zeichen anderer Menschen zu erreichen ist, bedeutete ebenfalls den Verzicht auf jede abstrakte Rede von einem »Menschen an sich«. Nur konsequent also, dass Arendt konkrete Fallstudien rein abstrakten Analysen und Abhandlungen vorzog: Existenzphilosophie als vielstimmige Daseinsreportage.
Gleich mit den ersten Sätzen ihres Rahel(11)-Buches legt Arendt eindrücklich Beispiel von dieser Herangehensweise ab und begreift sich als Autorin des Jahres 1933 – exakt hundert Jahre nach Rahels(12) Ableben – an einem wiederum entscheidenden Wendepunkt der deutsch-jüdischen Geschichte.
Einem Quijote gleich, der, sein Leben lang in falschen Beschreibungen gefangen, auf der Suche nach sich selbst idealistisch durch die Welt irrte, kommt es auch bei der Romantikerin Rahel(13) Varnhagen auf dem Sterbebett zum Moment wahrer Erkenntnis und Selbstfindung: »›Welche Geschichte! – Eine aus Ägypten und Palästina Geflüchtete bin ich hier und finde Hilfe, Liebe und Pflege von Euch! … Mit erhabenem Entzücken denk’ ich an diesen meinen Ursprung und diesen ganzen Zusammenhang des Geschicks, durch welches die ältesten Erinnerungen des Menschengeschlechts mit der neuesten Lage der Dinge, die weitesten Zeit- und Raumfernen verbunden sind. Was so lange Zeit meines Lebens mir die größte Schmach, das herbste Leid und Unglück war, als eine Jüdin geboren zu sein, um keinen Preis möcht’ ich das jetzt missen‹.«[6]
Als Arendt diese Zeilen zu Papier bringt, steht auch sie vor einem tief greifenden Einschnitt ihres Lebens. Denn genau so, wie der wohlbehüteten Bürgerstochter Rahel(14) Varnhagen einst erst durch das Ereignis Napoleon(1) bewusst wurde, dass »auch ihre Existenz allgemeinen politischen Bedingungen unterstand«[7], wurde Arendt als Denkerin durch das Ereignis Hitler(13)