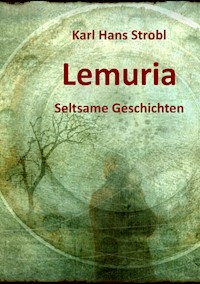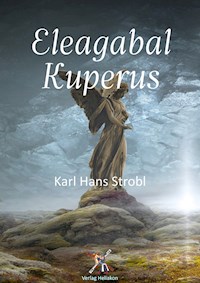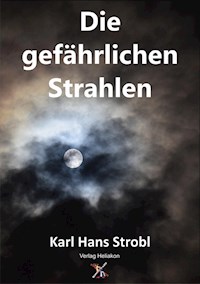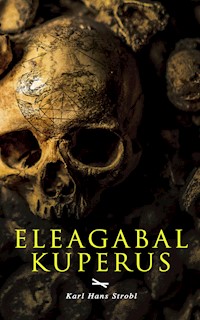Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Verblüfft starrt Heinz auf den Vorhang, der die Leute aus dem Gang ausschließt. Wenn dies jemandes Abteil ist, dann sicher nicht das Heinz Haberlands und wenn jemand dafür gezahlt hat, so ist es gewiss nicht er gewesen. Auf einmal kommt ihm der Platz, der ihm hier eingeräumt ist, wie ein unrecht erworbenes Gut vor, man ist in Deutschland, jeder einzelne hat Verpflichtungen gegen die Gesamtheit. Das geht nicht an, dass er sich hier breitmacht, während draußen die anderen, die ebensoviel gezahlt haben wie er selbst, sich die Beine in den Leib stehen. Sein Gewissen empört sich gegen den unbegründeten Vorzug.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Feuer in Nachbarhaus
Karl Hans Strobl
Impressum
2022 © Verlag Heliakon, München
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Titelbild: Pixabay (thommas68)
Herausgeber: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Überarbeitete und korrigierte Fassung
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
I. Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II. Teil
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
III. Teil
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
I. Teil
1.
Heinz Haberland steht auf dem Leipziger Bahnhof.
Die lange Bahnfahrt von Königsberg her steckt ihm noch in den Knochen. Und dann dieser Tag: Laufereien in Leipzig, Besorgungen für die Firma — »da Sie ja ohnehin über Leipzig fahren« — Verhandlungen mit der Fabrik in Miltitz, kaum Zeit genug zu hastigem Essen … Jetzt hat Heinz Haberland ein dringendes Verlangen nach einem behaglichen Eckplatz im Zug … ein Blick in die Zeitung … eine Zigarette und dann Zurücklehnen in die Dämmerung, durchpulst vom taktmäßigen Stampfen der Fahrt.
Ein Verslein aus einem Kinderbuch taucht in Heinz auf, das man nach dem zackigen Takt der Räder sprechen kann und mit dem man sich herrlich in den Schlaf wiegt: »Das Bübchen — im Stäbchen — ist müde — ich wett’ — es reckt sich — und streckt sich — und möcht gern — ins Bett …«
Dann fährt der Zug ein und ist gestopft voll Menschen; nur wenige steigen aus, und all die schwarzen Schwärme von Messebesuchern wollten mit. Nein, es ist keine Rede von Eckplatz und Zurücklehnen. Die Leute stehen in den Gängen einander auf den Füßen und es gehört viel gute Laune und Selbstzucht dazu, um nicht Krach zu schlagen.
In Dresden, denkt Heinz, beim Umsteigen … vielleicht ist es dann besser und ich kann mir einen Platz erobern. Erfahrungsgemäß sind die Züge zur tschechoslowakischen Grenze nicht so voll besetzt. Geduldig verbringt er die Wartezeit auf dem Bahnsteig. Als aber der Berliner Zug kommt, ist er genau so voll wie der Zug von Leipzig, es ist eine Verschwörung des reisenden Publikums gegen Heinz; er muss noch das Stück bis zur Grenze ausharren, zum Glück ist es ja nicht mehr weit bis Bodenbach.
Er beißt die Zähne zusammen … nicht einmal die Möglichkeit, eine Zigarette anzuzünden. Über den plumpen Nacken eines dicken Herrn hinweg sieht Heinz auf dem Fenster des nächsten Abteils ein Täfelchen. Vorbehalten! Was heißt Vorbehalten?, rumort der Geist der Unbotmäßigkeit in Heinz. Vorbehalten bei einer solchen Überfüllung? Vielleicht sitzt ein Bankpräsident darin oder ein hoher Offizier oder eine kranke Dame.
Alles eins, widerspricht Heinz der Mahnung zur Ordnung, es gehört sich nicht, in einem Abteil allein zu sitzen, wenn die Leute draußen einander die Zehen abtreten. Ich werde sagen: Gestatten Sie, ich bin hundemüde, von Königsberg … es ist die dritte Nacht, ein Tag Berlin, ein Tag Leipzig dazwischen, ich werde nicht stören.
Die Schiebetür klafft um eine halbe Handbreit, Heinz schiebt sie weiter aus und stößt sie dem dicken Herrn in den Rücken. Die Leute sehen ihm nach, sie mögen denken, wenn einer so ohne Weiteres in ein Abteil tritt, auf dem Vorbehalten steht, so hat er auch ein Recht dazu.
Heinz schlüpft in den Abteil und stellt mit Verwunderung fest, dass er völlig leer ist. Es ist nicht einmal Gepäck vorhanden, das Fenster ist herabgezogen und der Vorhang flattert im Zugwind, ab und zu klatscht er wie eine Peitsche. Heinz zieht die Scheibe hoch und hebt seinen Koffer ins Gepäcknetz.
Jemand sagt hinter Heinz: »Die nächste Station Pirna … dann Schandau … in Bodenbach Gepäcks- und Passrevision.«
Schuldbewusst sieht sich Heinz nach dem Schaffner um: »Ich hab mich hier hereingesetzt, weil ich …«
Ein breites, gemütliches Lächeln wirkt beruhigend: »Ist doch Ihr Abteil, Sie haben doch bezahlt.« Und der Schaffner zieht vor den jetzt doch misstrauisch gewordenen Mitreisenden die Türe zu.
Verblüfft starrt Heinz auf den Vorhang, der die Leute aus dem Gang ausschließt. Wenn dies jemandes Abteil ist, dann sicher nicht das Heinz Haberlands, und wenn jemand dafür gezahlt hat, so ist es gewiss nicht er gewesen. Auf einmal kommt ihm der Platz, der ihm hier eingeräumt ist, wie ein unrecht erworbenes Gut vor, man ist in Deutschland, jeder einzelne hat Verpflichtungen gegen die Gesamtheit. Das geht nicht an, dass er sich hier breitmacht, während draußen die anderen, die ebenso viel gezahlt haben wie er selbst, sich die Beine in den Leib stehen. Sein Gewissen empört sich gegen den unbegründeten Vorzug.
Eben will er den anderen die Türe öffnen und sie einladen hereinzukommen, da Verlangsamt der Zug die Fahrt, die Bremsen ziehen an, und dann bricht ein heftiges Musikgetöse über das Verschnaufen der Maschine herein. Der Bahnhof steht voll Menschen, Heinz sieht Fahnen und Laubgewinde um große beleuchtete Inschriften: „Willkommen.“
Pirna feiert ein Fest, und nun beginnt draußen ein Drängen und Stoßen, Rufen und Lachen zum Zug herauf und aus den Fenstern hinab. Wie aus einer riesenhaften Hülse wird ein dicker, lärmender Strom von Menschen aus dem Zug gedrückt.
Der ganze Gang ist leer geworden, und Heinz braucht über seine Eroberung keine Gewissensbedenken mehr zu haben. Er kann sieh häuslich einrichten, wenn nicht etwa der rechtmäßige Besitzer des Abteils noch zurückkommt. Dass Heinz einen Vorgänger gehabt hat, ist an dem Aschenbecher zu ersehen, der mit Asche und den langen Mundstücken russischer Zigaretten angefüllt ist. Aber es sieht nicht so aus, als ob Heinz mit dessen Rückkehr zu rechnen hätte, denn wenn jener etwa als Nachzügler noch im Speisewagen verblieben wäre, so hätte doch sein Gepäck noch im Abteil sein müssen. Er ist wohl, schließt Heinz, vom Schaffner unbemerkt, schon vor Dresden ausgestiegen.
Heinz kann seinen Platz nach Belieben wählen. Ehe er sich beim Fenster niederlässt, wischt er über einen dunklen Fleck auf dem Lederbezug, der verdächtig glänzt, als sei dort eine Flüssigkeit ausgegossen worden. Er zieht seine Finger etwas angewidert zurück; sie sind feucht und klebrig und leicht rötlich gefärbt. Da hat sein Vorgänger einen süßen Rotwein vergossen und es nicht für nötig gehalten, den Fleck zu entfernen. Es gibt schon allerhand Leute und darunter auch solche minder zarten Gewissens, die sich den Teufel darum scheren, wer sich in ihre Rotweinflecke setzt.
Heinz nimmt den anderen Fensterplatz; aber da er sich zurücklehnt, spürt er eine harte Kante in seinem Rücken. Er greift nach hinten und zieht ein Buch hervor, das zwischen der Polsterung des Sitzes und der Lehne steckt. Es ist ein russisches Buch und Heinz liest den Titel: Dostojewski „Aus einem Totenhaus“. Zweifellos ist sein Vorgänger ein Russe gewesen und hat das Buch beim Aussteigen vergessen. Ganz gut, denkt Heinz, denn die Kenntnis des Russischen, die er in der Kriegsgefangenschaft erworben hat, gibt ihm die Möglichkeit, sich mit dem Buch die Zeit zu vertreiben, ehe er es abliefert.
Während er in dem Buch blättert, hat der Zug auch noch in Schandau gehalten und nun schiebt sich die Tür abermals auf.
»Nächste Station Bodenbach«, macht der behäbige Schaffner nochmals aufmerksam, »Zoll- und Passrevision. Wenn Sie deutsche Zeitungen haben, die werden Ihnen ohnehin weggenommen …«
Es gibt Heinz Haberland keine Ruhe, er ist ein Feind aller Unordnung und Unklarheit: »Hören Sie«, sagt er, »das war doch nicht mein Abteil …«
Verwundert starrt ihn der Schaffner an, dann scheint ihn ein Zweifel zu überkommen, ob dieser Reisende überhaupt ernst zu nehmen sei. »Sie fahren doch schon seit Berlin mit uns«, sagt er vorsichtig.
»Ich bin erst in Dresden eingestiegen«, beharrt Heinz.
Einen Augenblick überlegt der Schaffner: »Gewiss sind Sie in Dresden eingestiegen«, gibt er höflich zu und beeilt sich, die Tür zu schließen.
Was das alles zu bedeuten hat, wird aber jetzt vollkommen unwichtig, da die Lösung der Frage bevorsteht, was sich in Bodenbach ereignen werde. Wird der Grenzübertritt gelingen oder wird sich ein Engel mit flammendem Schwert, anzusehen wie ein Passbeamter, vor Heinz aufrichten und ihn andonnern: »Eingang verboten?« Es gibt eine schwarze Liste und es hängt alles davon ab, ob der Name Heinz Haberland sich auf ihr befindet, und wenn er sich darauf befindet, ob ihn der Beamte gerade im Gedächtnis hat. Möglich ist auch, dass man ihm sagen wird: »Auf Sie warten wir schon lange! Kommen Sie nur gleich mit!« Die Tschechoslowakei ist kein Staat, in dem so etwas nicht möglich wäre. Es gibt da ganze Urwälder von Paragrafen, in die man sich im Handumdrehen verstricken kann, und eine besondere tückische Stelle dieser Wildnis nennt sich Schutzgesetz, da ist jeder Schritt von würgenden Ranken und giftigen Dornen bedroht.
Was man Heinz Haberland vorzuwerfen hat, ist, dass er damals seinen Pass nicht abgeliefert hat und ohne Erlaubnis der hohen Obrigkeit nachts über die Grenze gegangen ist. Gewiss verstößt das irgendwie gegen irgendetwas!
Bis jetzt hat Heinz seine Besorgnis zu unterdrücken vermocht. Seine Müdigkeit war größer gewesen und dann war der Kampf um den Sitzplatz und schließlich das Rätselraten wegen des Abteils. Jetzt aber ist die Besorgnis da und hat sich ihm wie eine große dicke Schlange um die Brust gewunden.
Nun ist es so weit, dass man sich rüsten muss, der Zug durchfährt den letzten Teil der Strecke in rascher Fahrt und an gewissen kleinen Anzeichen der wohlbekannten Landschaft, die Heinz auch nachts nicht entgehen, merkt er die Nähe Bodenbachs.
Je unsicherer man sich fühlt, desto mehr muss man den Eindruck völliger Sicherheit machen, sagt sich Heinz, und so sieht er den tschechischen Passbeamten geradezu herausfordernd an. Der Mann blättert verschlafen und gleichgültig in Haberlands Pass und drückt, während Heinz’ Herz langsam eine Siegessymphonie zu läuten beginnt, seinen Stempel ein.
Der Passbeamte wird vom Zollbeamten abgelöst, der seine Beschwörungsformel spricht und so ein paar beiläufige Griffe in Heinz’ Koffer tut, und dann fragen auch die Devisenbeamten nur so obenhin nach Heinz’ Geldverhältnissen.
Vielleicht ist es die Tafel Vorbehalten, an Heinz’ Abteil, die in den Fährlichkeiten der Grenze eine solche magische Wirkung hat; die Tafel wird durch eine andere ersetzt, die dasselbe auf Tschechisch sagt, und Heinz behält dank dieser bahnamtlichen Fürsorge, die über ihn wacht, sein gesondertes Abteil auch weiterhin ungestört bis Prag, obzwar der Zug nach und nach wieder übervoll wird.
2.
Als Heinz Haberland die Bahnhofssperre hinter sich hat, gesellt sich ihm ein kleiner Herr in gelbem Überzieher zu, der ihm zuerst aufmerksam ins Gesicht gesehen hat und nun neben ihm einhergeht.
»Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?«, fragt der Herr im gelben Überzieher nach einigen Schritten.
Zweierlei ist an dieser Frage seltsam: dass sie überhaupt getan wird und dann, dass es in russischer Sprache geschieht. Was geht es diesen wildfremden Menschen an, ob man eine gute Fahrt gehabt hat oder nicht; und es ist nur Heinz Haberlands angeborene Gutmütigkeit, die ihn bestimmt, zu antworten: »Ja, ich danke Ihnen … zuerst habe ich ja keinen Platz gefunden, aber dann hat man mich sogar in einem vorbehaltenen Abteil fahren lassen …« Heinz beantwortet die Frage in russischer Sprache, vier Jahre Kriegsgefangenschaft sind seiner Sprachbegabung genügend gewesen, um sich sogar eine leichte Färbung der Mundart anzueignen, wie sie in der Gegend um Irkutsk gesprochen wird.
Der Herr neben Heinz nickt und sagt: »Das Telegramm aus Bodenbach ist vor zwei Stunden eingetroffen.«
Heinz bleibt plötzlich stehen und schaut den Herrn im gelben Überzieher misstrauisch an. Der weiche braune Hut beschattet ein lang gezogenes Gesicht mit einer blonden Bartbürste zwischen der Nase und dem waagrechten Strich des lippenlosen Mundes. »Ja — was wollen Sie eigentlich von mir?«, fragt Heinz plötzlich schroff und diesmal in deutscher Sprache, um zu zeigen, dass er eine weitere Annäherung nachdrücklich ablehnt. Ein Verdacht hat sich plötzlich in ihm aufgerichtet; man hat ihn hier in Prag erwartet, sein Eintreffen ist gemeldet worden, matt hat nachträglich noch in der schwarzen Liste nachgesehen und seinen Namen gefunden. Es ist ein Herr von der Polizei, der ihn in Empfang genommen hat; genau so sieht der Herr auch aus, als ob er von der Polizei wäre. Solange es nicht entschieden ist, wie man sich zu Heinz Haberlands Einreise stellen würde, ist er ein unbehagliches Gefühl nicht losgeworden. Nun, da er Gewissheit zu haben glaubt, erfasst ihn ein Ingrimm über dieses tückische Spitzelwesen. Die anderen mögen die Macht für sich haben, aber er hat das gute Gewissen und das Recht für sich, denn hier steht sein Vaterhaus und das ist mehr, und wenn sie es zu arg treiben, so will er ihnen schon seine Meinung ins Gesicht sagen.
Übrigens geht der fremde Herr auf Haberlands Sprachenwechsel zuvorkommend ein. Er sagt auf deutsch: »Bitte, geben Sie dem Mann den Koffer.«
Da steht an Haberlands anderer Seite ein Mann in einer russischen Leinenbluse und mit einer russischen Tellermütze auf dem Kopf und nimmt Heinz, ehe er sich zur Wehr setzen kann, den Koffer aus der Hand.
»Geben Sie den Koffer her!«, fährt Heinz den Mann an. Aber der ist schon voraus, beim Bahnhofsausgang hinaus, und als ihm Heinz nacheilt, sieht er, dass der Träger den Koffer in einem wundervollen mausgrauen Kraftwagen neben dem Fahrer verstaut. »Bitte, bitte … es ist unser Wagen«, sagt der Herr im gelben Überzieher, während der Mann in der Russenbluse den Wagenschlag aufreißt.
Zwei Herren auf den Vordersitzen erheben sich halb, lüften sehr höflich grüßend die Hüte. »Fahren Sie zum Wilson-Bahnhof«, sagt Heinz drohend, mit einem letzten Versuch, Unbefangenheit zu heucheln und so zu tun, als sei ihm die Lage unklar, »mein Zug geht um 7 Uhr 12 weiter.«
Der Herr im gelben Überzieher lächelt bloß und auch die zwei Herren im Wagen lächeln, als hätte Heinz Haberland einen guten Spaß gemacht, es ist übrigens ein sehr höfliches, beinahe unterwürfiges Lächeln, wie man es dem Spaß eines Höhergestellten zu zollen hat. Der Herr im gelben Überzieher verneigt sich sogar ein wenig. »Rokitanski!« sagt er und schlägt den Kragen seines Überziehers zurück. Heinz erblickt auf der Innenseite einen runden Metallschild mit Hammer und Sichel, dem Abzeichen Sowjet-Russlands und der G. P. U.
Also doch die Polizei, denkt Heinz. Die G.P.U. versieht hier den Dienst der Geheimpolizei, recht nett, da lässt sich ja noch allerhand anderes erwarten.
Sanft und gleitend setzt sich der Wagen in Bewegung, die Hybernerstraße hinab, am Pulverturm vorbei, die lange Zeile des Grabens dahin. Es hat gar keinen Sinn, sagt sich Heinz, nicht den mindesten Sinn, Erklärungen zu verlangen oder nach dem Ziel der Fahrt zu fragen. Welches Ziel wird sie schon haben als die Polizeidirektion? Es ist am besten, zu schweigen. Heinz drückt sich in seine Ecke, diese Menschen sind Luft für ihn, es zittert nichts mehr in ihm, die Sache muss durchgekämpft werden; sein Schweigen strömt nur Verachtung aus. Nur um eins ist es ihm zu tun, ein Gedanke hat sich in sein Hirn gebohrt und hält eine nagende Unruhe wach: wie er dem Vater und der Schwester Nachricht zukommen lassen soll. Er selbst, hallo, da sollen sie auf Granit beißen, aber er wird daheim erwartet; wenn er hier festgehalten wird, so kann es geschehen, dass er den Vater überhaupt nicht mehr am Leben antrifft. Dann wäre diese ganze Fahrt mit allem Drum und Dran ihres eigentlichen Zieles beraubt, denn das war ja die Jahre her Heinz Haberlands tiefste Sehnsucht gewesen, den alten Mann noch einmal zu sehen und seine welke Hand in die seine nehmen zu können.
Heinz würgte an seiner Wut, er ist nahe daran, irgendeinen befreienden Blödsinn zu begehen. Aber dann sagt er sich: nein, nur keine Ausbrüche, es ist am besten, abzuwarten was kommt, und ohne Umstände alles zuzugeben. Denn was hat er denn schließlich schon angestellt? Den Kopf kann es auf keinen Fall kosten; vielleicht lassen diese Russen eher mit sich reden als die Tschechen und gestatten ihm die Fahrt zum Vater.
Indessen ist der Wagen an der Einmündung des Grabens in den Wenzelsplatz angekommen und aus dem großen Viereck des freieren Himmels strömt Morgendämmerung herab. Die endende Aprilnacht schickt ihre Bummler und Nachtschwärmer heim und das arbeitende Prag beginnt die Straßen zu füllen. Im Begriff, die Fahrt in der Nationalstraße fortzusetzen, wird der Wagen zum Halten gezwungen. Aus der Nationalstraße kriecht eine riesenhafte Raupe heran und biegt nach rechts auf den Wenzelsplatz ein, ein ungeheurer Heerwurm, bestehend aus vielen klirrenden, rasselnden, stählernen Panzergliedern. Tank nach Tank kommt da in der Morgendämmerung angekrochen, seltsame wandelnde Türme voran, denen solche von leichterer Bauart folgen. Die Erde dröhnt, man spürt die Erschütterung des Bodens, die Straße scheint sich unter dem Gewicht der Mordwagen durchzubiegen. Es dauert eine ganze Weile, Hunderte von Tanks kommen vorüber, ehe die kleinen Einmannwagen den Beschluss machen. Sie tragen keinerlei Abzeichen, aber an den Sowjethelmen der Besatzung erkennt Heinz, dass es sowjetrussische Tanks sind.
Unwillkürlich schaut Heinz seinen Nachbarn fragend an, und Rokitanski nickt ihm höflich bestätigend zu. »Zweite Don-Brigade«, sagt er.
Du lieber Himmel, so stehen die Dinge! Es ist also wahr, was manche Zeitungen behaupten und was hier immer wieder abgeleugnet wird. Schon sind sowjetrussische Truppen im Land und das muss doch seine Bedeutung haben; eine Ahnung nahe gerückter Gefahr engt Heinz Haberlands Brust ein.
Jetzt kann der Wagen endlich wieder losbrausen und nun ist es auch nicht mehr weit zur Polizeidirektion. Aber nichts da von Polizeidirektion, sie bleibt rechts liegen und da ist man auch schon am Nationaltheater. Über dem Vorbau baumelt eine Gestalt, von einer über die Brüstung hinausgeschobenen Stange hängt sie an langem Strick bis fast zum Pflaster herab. Im frischen Morgenwind von der Moldau her dreht sie sich langsam um sich selber, eine Puppe, und es ist kein Zweifel, wer dargestellt und gemeint ist. Sie trägt ein braunes Hemd und die Hakenkreuzarmbinde; die Beine sind bis zur Hüfte verkohlt von dem Feuer, das man unter ihr angezündet hatte und dessen Spuren noch das Pflaster schwärzen.
Eine Gruppe betrunkener Nachtschwärmer hat sich über sie hergemacht und setzt sie unter dem wohlwollenden Lächeln zweier wachehaltender Polizisten mit brüllendem Gelächter wie eine Glocke in Bewegung.
»Noch von der gestrigen Kundgebung«, klärt Rokitanski mit einem Lächeln auf.
Der Kraftwagen fährt weiter über die Legionenbrücke und es wird Heinz immer rätselhafter, wohin man ihn nun bringen wird, da man an der Polizeidirektion vorbeigefahren ist. Kleinseitner Ring … zum Hradschin hinan? Nein … an der Thomaskirche vorüber … vor dem Waldstein-Palast hält der Wagen. Diener öffnen den Schlag. Wachen stehen stramm, ein Pförtner von Denkmalsgröße stößt mit dem Stab auf den Boden. Es hat den Anschein, als ob nicht ein Gefangener ankäme, sondern eine hochwichtige diplomatische Persönlichkeit. Einen Augenblick lang nimmt Heinz an, dass dies alles Veranstaltungen seien, um ihn zu verhöhnen oder irrezuführen, aber was für einen Zweck sollte dies haben?
Man bringt ihn auch nicht in irgendein finsteres Loch, sondern führt ihn die breite Treppe hinan ins erste Stockwerk, eine reich verzierte Tür öffnet sich. »Hier sind Ihre Zimmer«, sagt Rokitanski. Es sind drei oder vier Zimmer, die alte Pracht und eine neuzeitliche Bequemlichkeit vereinigen. Die hohen Fenster sehen aus den Waldsteingarten, das alles schaut, weiß Gott, nicht nach Haft und Gefängnis aus.
Und dann sagt Rokitanski, ehe er sich zurückzieht, noch etwas zum Kopfzerbrechen.
»Sie werden das Bedürfnis haben, sich ein wenig auszuruhen. General Jergunow wird sich erlauben, Ihnen um elf Uhr seine Aufwartung zu machen.«
Das mit dem Bedürfnis des Ausruhens stimmt, aber wie soll man ausruhen, wenn einem solche Rätsel zum Raten aufgegeben werden? »General« und »erlauben« und »Aufwartung?« Was soll das heißen?
Der Generalissimus Waldstein hat, als er mit dem Kaiser bös war, diesen Palast erbaut. Der Kaiser sollte nur wissen, dass Waldstein mächtig und reich genug ist, ein ganzes Stadtviertel niederzulegen und dort einen Palast zu erbauen, ebenso prächtig wie die Burg auf dem Hradschin, zu dessen Füßen der Palast liegt. Zu Füßen, aber so, dass es beinahe wie ein Spott ist, denn von oben kann man erst recht sehen, wie groß sich dieser Untertan dahergebaut hat, mit einer ganzen Stadt, und dass er sich grad so gut neben die königliche Burg hätte setzen können, wenn es ihm nur beliebt hätte.
Dann ist der alte Prunkbau einem tschechischen Ministerium eingeräumt worden, in dem darüber nachgedacht worden ist, wie man am besten alles zum Nachteil der Deutschen drehen und wenden könnte. Jetzt haben sich offenbar die Bolschewiken hineingesetzt, denn Heinz hat auf dem Weg in seine Zimmer überall auf den Kanzleitüren russische Aufschriften gesehen. All dies, Kanzleigebäude und Dienerschaft und Empfang und Benehmen sieht aber ganz und gar nicht nach Prolet-Bolschewismus aus; es hat sozusagen einen bürgerlich beamtenhaften Anstrich, ja betont vielleicht sogar etwas Vornehm-Ministerielles, geradezu Höfisches. Das Auflümmeln, den Dreck, das Fäustballen und das Spucken hat man jedenfalls überwunden und den Massen überlassen, hier hat man sich in eine höhere Kaste erhoben und befleißigt sich europäischer Form und Lebensart.
Was aber, um Himmelswillen, hat dies alles mit Heinz Haberland zu tun? Warum hat man ihn hieher gebracht und was will man von ihm?
Das ist ein Rätselraten, das sehr geeignet ist, alle Müdigkeit zu vertreiben. Heinz wäscht sich gründlich in einem üppig ausgestatteten Badezimmer und nimmt frische Wäsche aus dem Koffer. Ach, und da ist ja das Buch, das er in seinem Abteil gefunden hat, Dostojewskis „Aus einem Totenhaus“. Er hat ganz vergessen, es, wie beabsichtigt, abzugeben; dazu ist es nun zu spät, übrigens ist es kein solcher Wertgegenstand, dass sein Verlust dem Eigentümer schmerzlich sein müsste.
Heinz nimmt ein Frühstück ein, das ihm auf silberner Platte gebracht wird, Kaviar, Butter, Röstbrot, Lachs und warme Fleischpastetchen zum Tee, ganz fürstlich. Dann tritt Heinz ans Fenster und sieht auf den Garten hinaus. Der Rasen ist ganz blau von Veilchen, Primelfarben leuchten grell. Entlang der Mauer aber stehen auf einem offenbar frisch ausgeführten Wehrgang Maschinengewehre eines unbekannten Typs. Zweiunddreißig Maschinengewehre zählt Heinz längs des Stückes Gartenmauer, das sein Blick übersehen kann.
3.
Eine verschnörkelte Barockuhr, die vielleicht schon dem Generalissimus Wallenstein die Zeit gewiesen hat, klingelt silbern die elfte Stunde.
Mit dem letzten dünnen Schlag öffnet sich die Tür, ein Diener in einem Tscherkessenrock lässt wie im Palast irgendeines der verflossenen Großfürsten einige Herren ein und verneigt sich tief.
Ein unterfetzter rundlicher Mann mit rotem Gesicht in einer Uniform mit vielen Goldschnüren ist den anderen voran und schreitet lebhaft auf Heinz Haberland zu.
»Ich heiße Sie herzlich in Prag willkommen, Genosse Hochkommissär«, sagt er mit einer piepsigen Kinderstimme.
Heinz Haberland hat Zeit gehabt, sich sein Benehmen zurechtzulegen. Er steht steif an dem Tisch in der Mitte des Zimmers, stemmt die linke Faust gegen die Marmorplatte und sagt ernst und gemessen: »Was wünschen Sie von mir?«
»Wir begrüßen Sie, Genosse Slawruski«, sagt der General, »wir freuen uns, dass die Stunde gekommen ist. Wir begrüßen Sie herzlich!« Und die anderen, die mit ihm gekommen sind, murmeln auch etwas, das nach Begrüßung klingt.
Heinz schaut sich das Gefolge an, das aus vier Herren besteht. Der eine ist der Genosse Rokitanski, der zweite in bürgerlicher Kleidung ein junger Mann, den man fast für ein verkleidetes Mädchen halten könnte. Sein Gesicht ist von einer gelblich getönten Blässe, die mandelförmig geschnittenen Augen haben einen schwermütigen Aufschlag. In diesem elfenbeinfarbenen Gesicht leuchten die schön geschwungenen Lippen in einem so brennenden Rot, als habe der Stift nachgeholfen, und die herabgezogenen Mundwinkel sprechen von einer trauerumschatteten Seele.
Des Generals Begleiter drei und vier sind zwei hochgewachsene Offiziere, stramm und schweigsam. Alle fünf halten den Blick erwartungsvoll auf Heinz gerichtet, als müsste nun von ihm eine Kundgebung kommen. Da aber Heinz, nun neuerlich verwirrt, schweigt, ergreift der blasse junge Mann mit sanfter Stimme das Wort: »Ihre Ankunft ist uns erst gestern durch den Geheimsender aus Leningrad gemeldet worden. Wir haben nur diese Zimmer hier rasch instand setzen können. Ich hoffe, Sie werden trotzdem zufrieden sein; wenn Sie noch Wünsche haben, so brauchen Sie sich nur an mich zu wenden … an Genossen Beryll.«
»Es sind dieselben Räume«, setzt Rokitanski hinzu, »die der Herzog Wallenstein bewohnt hat.«
In was für einen Narrenturm bin ich da geraten? Denkt Heinz, ich werde hier offenbar mit einem anderen verwechselt, und es ist höchste Zeit, in diese Sache Klarheit zu bringen.
»Sie befinden sich im Irrtum, meine Herren«, sagt er, »ich bin nicht der, den Sie erwarten. Und im Übrigen darf ich Sie bitten, sich der deutschen Sprache zu bedienen. Mein Russisch reicht nicht so weit.«
Die Herren sehen einander wieder an und lächeln, und es ist wieder jenes Lächeln, das man gegenüber den unbegreiflichen Launen eines hohen Herrn hat. Und sie gehen auch ohne ohne Weiteres auf den Wunsch ein, wenigstens der General Rokitanski und Beryll; die zwei Offiziere schweigen jetzt auf Deutsch weiter wie vorhin auf Russisch.
»Ihre Vorsicht ist gut, Genosse Hochkommissär«, sagt der General, »wir Verstehen, dass Sie vorsichtig sein müssen. Aber wir fünf sind beauftragt, Sie zu empfangen und Ihre Befehle entgegenzunehmen.« Und Rokitanski zieht ein Papier hervor, auf dem wohl das bestätigt ist, was der General eben gesagt hat.
Aber Heinz wirft keinen Blick darauf, mögen die Fünf in des Teufels Namen seine Großmutter zu empfangen beauftragt sein. Er verliert jetzt die Geduld und nun ist ihm wirklich schon alles gleich. »Ich heiße Heinz Haberland«, sagt er erbost, »und bin ein Deutscher und nicht der Genosse Slawruski. Und jetzt sagen Sie mir endlich einmal, was dies alles hier zu bedeuten hat?«
Ein wenig betreten sind die Herren dieser Richtigstellung gegenüber nun doch.
Aber da meldet sich der Genosse Beryll zu Wort. Seine roten Lippen öffnen sich ein wenig zu einem Lächeln, sodass die weißen, wohlgebildeten, tadellosen Zähne sichtbar werden.
Er hat etwas entdeckt. Er hat drüben auf dem Spiegeltisch neben der Barockuhr aus Schildpatt und Elfenbein das rot gebundene Buch entdeckt.
»Belieben der Herr Heinz Haberland«, sagt er, »dieses Buch als Reiselektüre mitgehabt zu haben?«
»Ja … das heißt …«
Beryll hat das Buch schon aufgenommen: »Dostojewski „Aus einem Totenhaus“ … ein gutes Buch, ein schönes Buch, ja … wäre heute keiner von den Unseren, der Dostojewski, zu viel von Menschlichkeit und innerer Frömmigkeit und anderem Opium fürs Volk, aber er ist tot, da kann man es ja sagen, dass er ein großer Dichter war. Damals hat man es nicht besser gewusst.« Er blättert mit den schlanken Fingern, als suche er etwas Bestimmtes. Er scheint es nach kurzem Stöbern gefunden zu haben. »Da!«, sagt er und zeigt zuerst dem General und dann Rokitanski auf Seite 36 ein Wort, das durch einen dünnen roten Strich bezeichnet ist.
Offensichtlich bringt dieser Fund Erlösung und Erleichterung, die beiden Männer atmen auf und in ihre Mienen tritt Zuversicht und Befriedigung. Eine zu weit getriebene Vorsicht, nichts anderes, eine hartnäckig festgehaltene Laune, nicht wahr? Sie können wieder lächeln.
»Dieses Buch ist …« will Heinz beginnen.
»Gestatten Sie«, sagt der junge Mann, und nimmt ein Schächtelchen aus der Tasche. Er packt aus: eine kleine Kerze, ein Feuerzeug und ein Fläschchen mit einer grünen Flüssigkeit und einem Pinsel darin. Er schlägt das Buch auf und klappt es auseinander, der Kopf mit den sorgsam gekräuselten Locken senkt sich über das letzte leere Blatt. Erstaunt schaut Heinz Haberland seinem Beginnen zu. Mit raschen, geschickten Strichen pinselt der junge Mann die grüne Flüssigkeit aus dem Fläschchen über die Innenseite des Blattes.
Donnerwetter, auf solche Weise pflegt man wohl Geheimschriften auf den Leib zu gehen, und Heinz ist nun aufs äußerste gespannt, was daraus werden soll.
Inzwischen hat Rokitanski die Kerze entzündet, sie brennt mit hellgrüner Flamme und Beryll hält das benetzte Blatt in den aufsteigenden warmen Luftstrom. Er bewegt es darin hin und her, ein eigenartiger Geruch verbreitet sich und das Blatt krümmt sich ein wenig. »Ein etwas altertümliches Verfahren«, bemerkt Beryll entschuldigend, »aber unter gewissen Umständen immer noch das aller sicherste. Ich halte von diesen neuartigen Selengeschichten nicht viel. Hier kommt es auf Bruchteile von Graden der Weckflüssigkeit an, ein Erraten gibt es da nicht.« Indessen werden Schriftzüge sichtbar und je weiter die Verdunstung fortschreitet, desto deutlicher treten sie hervor. Sie schießen zu Worten aneinander, die Worte reihen sich zu Zeilen, die Zeilen ordnen sich untereinander, die ganze Seite ist endlich mit der verborgen gewesenen Schrift bedeckt.
»Sehen Sie!«, sagt Beryll mit einem müden Ausdruck wie nach einer anstrengenden Arbeit. Sechs Köpfe drängen sich eng aneinander, die Augen laufen gierig die Zeilen entlang.
»Genosse Wladimir Stepanowitsch Slawruski, Hochkommissär, Politbüro, intern, ist beauftragt, die Vorbereitungen zu überprüfen, festzustellen, ob die Bereitschaft vorhanden ist, und, sofern alles seine Billigung findet, den Zeitpunkt des Losschlagens zu bestimmen. Es unterstehen seinem Befehl General Jergunow hinsichtlich der politischen Entscheidungen sowie sämtliche G.P.U.- und Politkommanden im Bereich der tschechoslowakischen Republik.«
Und unter diesem Austrag steht der Name des Väterchens, das über das gewaltigste Zerstörungswerkzeug gebietet, das die Menschheit je gekannt hat, des roten Zaren im Kreml zu Moskau.
»Und noch dies«, sagt jetzt Rokitanski, holt aus der Brusttasche ein Lichtbild, das er Heinz Haberland vorhält. »Heute morgens mit Bildfunk aus Moskau gekommen.«
Sonderbar, ein Lichtbild, das Heinz Haberland vorstellt, Heinz Haberland, soweit man dies wenigstens nach dieser etwas verschwommenen Wiedergabe beurteilen kann. Ganz genau kann es ja nicht sein, das kann man bei dieser Art der Übertragung nicht verlangen, aber die Ähnlichkeit ist überwältigend, das gesteht sich Heinz Haberland selbst ein.
Heinz Haberland richtet sich auf, er ist nicht mehr er selbst, er ist ein Werkzeug in der Hand der Vorsehung. Es bleibt ihm nichts anderes übrig als zu sagen: »Ich übernehme den Befehl. Es ist alles in Ordnung.« Und die fünf Herren Verneigen sich.
Dann aber sprudelt der General Jergunow gleich lebhaft los. »Ja … und nun … nun wird es wohl das erste sein … Sie werden sich ja wohl im Sinne Ihres Auftrages überzeugen wollen … nicht wahr? … ich stehe zur Verfügung, Genosse Hochkommissär …«
»Ich bitte Sie um Ihren Bericht, Genosse General«, sagt Heinz gemessen und sehr von oben her.
»Die tschechische Armee ist kriegsbereit … Mobilisierung binnen 24 Stunden …«
»Ich halte nicht viel von ihr«, zweifelt Heinz.
»Ist ganz gut imstand, hat mächtig aufgeholt«, versichert der General. »Modern ausgerüstet … durch uns.«
»Und wir?«
»5 Schützenkorps«, rattert der General eifrig herunter, »3 Kavalleriedivisionen, 10 Infanteriedivisionen«, und er stößt in beängstigender Hast die Zahlen und Namen hervor, zählt die leichten und schweren Artillerieregimenter auf, die Pionier- und Eisenbahn- und Gastruppen, die Scheinwerfer- und Tankkompagnien, Minenwerfer, Panzerkraftwagen und Kampfwagen, eine endlose Litanei von Mord und Vernichtung. Er redet sich in Siedehitze, er spreizt die Finger der einen Hand und rechnet mit den Fingern der anderen an ihnen, er zieht ab und zu ein kleines Büchlein aus der Brusttasche seines Uniformrockes und wirft einen Blick hinein. Aber es ist nicht nötig, man merkt ihm an, dass er alles genau im Kopf hat, es ist nur Nervosität, die ihm vortäuscht, eine Einzelheit sei ihm nicht genau gegenwärtig. Schließlich sieht der arme General wie gesotten aus; keine Kleinigkeit, dem Genossen Slawruski, Hochkommissär, Politbüro, intern, Rede stehen zu müssen, der rechten Hand des Diktators, seinem geheimnisvollen Helfer, den bisher vielleicht bloß ein Dutzend Menschen von Angesicht zu Angesicht gesehen hat.
»Wenig!«, sagt Heinz kalt, als Jergunows Atemnot eine Pause erzwingt.
»Die Hauptsache nicht zu vergessen«, schnauft der General, »die Luftwaffe! Zehn Fliegerbrigaden, daneben die selbstständigen Aufklärungs-, Jagd- und Bombengeschwader mit den entsprechenden Staffeln und den getarnten Flughäfen in Kaschau, Preran, Königgrätz, Turnau, Laun und Luditz …«
»Die Entscheidung fällt in der Luft«, bemerkt Heinz so überlegen, dass der wirkliche Genosse Slawruski sich auch nicht überlegener hätte äußern können.
»Richtig … sehr richtig … und Sie werden sich in der Tat überzeugen, Genosse Hochkommissär … die neuen Bomber, Typ Potomski … Ich bitte Sie, Genosse Solotow, geben Sie dem Genossen Hochkommissär eine Übersicht über die Luftstreitkräfte … Genosse Solotow ist Kommandant der Luftstreitkräfte …«
»Ja, ja«, nickt Heinz beinahe ungeduldig und tut, als erzähle man ihm da überflüssigerweise bekannte Dinge.
Jetzt macht einer der beiden schweigsamen Offiziere den Mund auf, Genosse Solotow also, und es zeigt sich, dass der Gegner nichts zu lachen haben wird, wenn die Sowjet-Luftflotte losbraust. Die Stützpunkte sind so eingerichtet, dass von ihnen aus binnen dreißig Minuten nach Kriegsausbruch die Jagdstaffeln und schweren Bomber über Breslau, Leipzig und München, binnen vierzig Minuten über Berlin sein können. Es gibt Kasematt-Flughäfen, Stratoflieger, fliegende Festungen mit sechzig Mann Besatzung und Yperit-Bomben, nicht zu vergessen die unbemannten fernlenkbaren Torpedoflugzeuge und die Amphiflieger, diese Höllenmaschinen, die, wenn sie die Bomben abgeworfen haben, niedergehen und auf der Erde als Tanks weiterkämpfen.
Heinz hört das ruhig an und behält, obzwar ihn Entsetzen schüttelt, seine hochmütige Miene bei.
»Wir haben zwei Drittel unserer Luftstreitkräfte hier vereinigt«, schließt Solotow. »Und das dritte?«, fragt Heinz
»Im Osten selbstverständlich«, antwortet Solotow ein wenig verwundert.
»Ich weiß«, tut ihn Heinz kurz ab, »aber glauben Sie, dass dies genügt?«
Ehe Solotow fragen kann, wie dieser Zweifel gemeint sei, lässt ein Geräusch die Anwesenden aufhorchen. Von einem harmlos aussehenden schwarzen Kästchen, das auf dem Kaminsims steht, ist die Vorderwand herabgefallen.
»Der Hradschin meldet sich!«, sagt Beryll und geht mit weichen, leisen Schritten zum Kamm. Er nimmt den Hörer heraus: »Ja … Jawohl«, spricht er in das Kästchen hinein, »ist hier … ist eingetroffen … alles in Ordnung … jawohl … sind auf dem Weg … in zehn Minuten sind wir oben.«
Er klappt das Kästchen zu und wendet sich zu Heinz: »Sie sehen … der Hradschin erwartet Sie schon mit Sehnsucht … ich denke, wir können aufbrechen.«
4.
Die einstmals königliche Burg auf dem Hradschin ist nicht nach einem einheitlichen Plan entstanden. Jahrhunderte haben an ihr gebaut und Mauern getürmt, niedergerissen und wieder anders aufgeführt, man hat die Bauteile kunterbunt durcheinandergeschoben, hat den Burgfelsen ausgehöhlt, dass sich weitläufige Keller und Katakomben im Stein dahinziehen, die irgendwo durch Gänge und Treppen überraschend wieder zu Tag führen. Oft genug hat die eine Zeit vergessen, was die vergangenen Zeiten gebaut haben, man hat irgendeine Öffnung vermauert, und was dahinter liegt, ist, unwichtig für die betreffende Gegenwart, zum Geheimnis geworden.
Die neue Republik hat es, stolz auf die Vergangenheit dieser Burg, unternommen, Schichten abzutragen, minder bedeutsames Neues zugunsten des Älteren zu beseitigen, man hat alte Pläne zu Rat gezogen und ist so der Burg auf manches ihrer Geheimnisse gekommen.
Und eines dieser neu entdeckten Geheimnisse ist das Gemach in dem Teil der Burg, der zu einem der ältesten Bestände gehört, dem Bau Wratislaws des Ersten. Zwischen der Georgskirche, die auf ihn zurückgeht, und dem von der frommen Milada, der Schwester Boleslaws des Zweiten, gegründeten Kloster, steckt dieser enge Raum, der Jahrhunderte hindurch verschollen war. Vielleicht war dieser Raum jenes Zimmer, von dem die Burgsagen berichten, dass sich in ihm die entscheidendsten Besprechungen, Verschwörungen und sonstige geheime Dinge abgespielt hätten, weil den allerwenigsten Menschen etwas von seinem Vorhandensein bekannt war. Die Gewölbe sind schwerstes zehntes Jahrhundert, und wie durch ein Wunder lässt ein hoch gelegenes Fenster doch auch etwas Tageslicht ein. Nur der hohen Kunst der mittelalterlichen Baumeister war es möglich, Zugang und Raum so zu verbergen und das Fenster so anzubringen, dass es auch von außen niemandem aufgefallen ist.
Erst der gründlichen Durchforschung der ganzen Bauwelt des Hradschin ist es gelungen, diese zwischen Georgskirche und Kloster eingekeilten Räume zu entdecken, neben anderen ähnlichen Funden zum Jubel und Triumph des romantischen Teiles der tschechischen Seele. Denn es verhält sich mit dieser so, dass sie in zwei Teile zerfällt. Mit dem einen strebt sie nach den letzten Errungenschaften des sachlichen Geistes der neuen Zeit. Es kann ihm in allen Dingen nicht amerikanisch genug zugehen, Eisen, Beton, Glas und gepresstes Papier sind dieses Strebens Baustoffe; dieser Teil der Seele besteht darauf, zu zeigen, wie jung das Volk ist und dass es im technischen Fortschritt führt. Mit dem anderen, romantischen Teil seiner Seele sucht es nach seiner Vergangenheit. Es will zeigen, wie alt es ist, und hat dabei auch schon einige Enttäuschungen auf sich nehmen müssen. Es hat die Fälschung der Königinhofer Handschrift umjubelt und beweihräuchert, aber nun ist es um so stolzer auf jedes Stück wirklichen Altertums, das zutage gefördert wird.
Nun hat man zu dem alten Gemach noch einige Nebenräume hinzugenommen, die man von dem Kloster abgetrennt hat, und hat alles wieder jenem Zweck gewidmet, dem das alte Zimmer gedient hat. Der sozusagen öffentliche Geheimdienst der Republik ist in einem anderen Teil der Burg untergebracht, hier aber hat die politische Romantik ihr innerstes Heiligtum, wo unter dem Schutz der glorreichen Vorzeit und vor jedem Unberufenen behütet die wichtigsten, letzten Entscheidungen fallen.
Drei Männer sind es, die hier die russischen Gäste ungeduldig erwarten. Sie sind keineswegs so eines Sinnes, diese drei, wie es nötig wäre, um mit einem Vertragspartner zu einem raschen Entschluss zu kommen. Der General Biskup freilich, der weiß ganz genau, was er will. Er hat eine Landkarte auf dem Mitteltisch ausgelegt und im grellen Licht der herabgezogenen Lampe mit bunten Fähnchen besteckt. Die blauen bedeuten die tschechischen, die roten die bolschewistischen Streitkräfte, und die ganze Karte ist voll von diesen Fähnchen; insbesondere aber in der Nähe der Grenzen stecken sie so gedrängt, dass sie wie ein kleiner blauroter Wald aussehen. Für den General Biskup ist die Sache ganz einfach: So und so, und er nimmt eine Handvoll Fähnchen und steckt sie ein gutes Stück jenseits der Grenzen wieder ein. So, das ist der Vorstoß der motorisierten Truppen in der ersten Stunde nach Kriegsausbruch! Er nimmt einen Zirkel, spannt ihn über den Maßstab am Rand der Karte — recht weit klaffen die Schenkel auseinander — und zieht nun von bestimmten Punkten Halbkreise. Das ist der Wirkungsbereich der Luftwaffe in der ersten halben Stunde nach Kriegsbeginn. Ganz einfach, nicht wahr? Hochbeinig, breitbrüstig, ein strahlendes Lächeln auf dem roten Bauerngesicht steht er da, dieser aus dem Volk hervorgegangene Feldherr, ein Held, ein kommender Sieger.
Ein knochiger Schädel, der auf einem langen, mageren Hals sitzt, beugt sich über die künftigen Schlachtfelder. Der Minister Chwatal zieht die Lampe noch tiefer herab. Dem düsteren Mittelalter mag zu seinen Verschwörungen das kärgliche Licht aus dem Fensterschlitz genügt haben. Der Minister Chwatal führt seinen Namen, der soviel bedeutet wie: »Er beeilte sich«, mit Unrecht. Er ist der Zauderer, der Mann der Hemmungen und Bedenken, ihm erscheint diese Sache mit den Fähnchen gar nicht so einfach wie dem General Biskup. Auf der Karte geht so etwas viel zu glatt vor sich.
»Aber die Deutschen werden sich das auch nicht so ohne Weiteres gefallen lassen«, meint er kopfschüttelnd.
»Sie müssen überrumpelt werden.« In dem Kopf dieses Mannes aus dem Volk spielt sich das alles auf die natürlichste Weise von der Welt ab. Er ist der Mann des Kriegshandwerks, man braucht ihm nur zu sagen: Los! Und das andere ist seine Sache. Aus der Tiefe eines Klubsessels meldet sich eine Stimme. Als man zuerst nach Jahrhunderten der Vergessenheit diesen Raum betrat, lag der Staub in tiefen samtigen Schichten auf morschem Gerät, auf Stühlen, Bänken, Tischen und den Wappen uralter böhmischer Geschlechter, die in die Wand eingefügt worden sind. Jetzt hat man die Wappen gereinigt und die Farben aufgefrischt, aber anstelle der wurmstichigen Einrichtung sind natürlich Klubsessel, Diplomatenschreibtische und alle die Vorrichtungen getreten, die in der Kernzelle eines so bedeutungsvollen Geheimdienstes vorhanden sein müssen.
In die Tiefe eines der Klubsessel versunken, sitzt ein verhältnismäßig junger Mann mit einem schwarzen Kinn- und Schnurrbart und schwarz gerandetem Kneifer. Er hat sich an dem Für und Wider der beiden anderen bisher nicht viel beteiligt. Jetzt aber scheint es ihm nötig, seine Meinung zu sagen: »Es wird seine Schwierigkeiten haben«, sagt er, »genau so, wie wir so ziemlich Bescheid wissen, was drüben vorgeht, werden die wohl immer auch darüber unterrichtet sein, was wir beabsichtigen. Vergessen Sie nicht, meine Herren, wir haben dreieinhalb Millionen Spione im Land. Wir haben sie ja leider immer noch nicht ausrotten können. Und trotz aller Vorsicht haben wir es nicht verhindern können, dass Spionage getrieben wird; trotz der Strenge unserer Urteile finden sich immer wieder Leute, die Kundschafterdienste tun. Glauben Sie, dass die drei Todesurteile gestern im Pilsner Prozess jemanden abschrecken werden?«
Der Minister Chwatal nickt dem im Klubsessel zu, sehr befriedigt, dass der Minister Kramr, der Mann mit dem deutschen Namen und der glühenden tschechischen Seele, seine Partei ergriffen hat: »Das Pilsner Urteil steht auf sehr schwachen Beinen. Es ist, genau genommen, juristisch überhaupt nicht haltbar …«
»Wie viele Urteile sind denn in solchen Fällen juristisch haltbar?« kommt es aus der Tiefe des Klubsessels. »Wenn sie nur politisch haltbar sind.«
»Die Frage ist«, sagt Chwatal und fährt mit der Zungenspitze über das vorstehende Ende des Zigarettenpapiers, in das er goldgelben Tabak kunstgerecht eingerollt hat. Er hat seinerzeit, noch im alten Österreich, als blutjunger Beamter in Bosnien gedient und hat dort allerhand Landessitten angenommen. Das Selbstdrehen der Zigaretten zum Beispiel, wie es dort mit Meisterschaft geübt wird. Seine Unterbeamten nennen den Minister Chwatal den Bosniaken, und es gibt Leute, die behaupten, sein Zaudern und seine Bedenken seien in der türkischen Gemütsart begründet, die dort unten zu einem Teil seines Wesens geworden sei.
Jetzt ist die Zigarette fertig, Chwatal macht einen Zug und wiederholt: »Es ist nur die Frage, ob es nicht klüger gewesen wäre, die Sudetendeutschen zufriedenzustellen. Jetzt, da es die Verteidigung der Republik gilt, rächt es sich, dass wir an den Deutschen keine ganz zuverlässigen Staatsbürger haben … haben können.« Er denkt einen Augenblick lang nach und berichtigt sich selbst: »Obzwar die Unzuverlässigkeit durchaus nicht so groß ist, wie sie von uns hingestellt wird.«
Exzellenz Kramr streicht mit der Hand über die Lehne des Klubsessels hin und der große Brillant, ein Geschenk des Emirs von Afghanistan bei seinem Besuch in Prag, blitzt mit einem kurzen, vielfarbigen Feuerstrahl auf: »Man muss solche Dinge immer etwas übertreiben, damit man sich ins Recht setzt.«
»Es ist das natürliche Recht eines jeden Volkes, das wir den Deutschen vorenthalten«, beharrt Chwatal.
»Nein«, sagt Kramr scharf, »wir dürfen in unserer Lage mit den natürlichen Rechten nicht so freigiebig sein.«
»Wir hätten es mehr als einmal in der Hand gehabt, einen aufrichtigen Frieden und eine Versöhnung herbeizuführen. Stattdessen haben wir immer nur so getan als ob und haben Europa Sand in die Augen gestreut …«
»Die Deutschen haben eine Menge großer Philosophen, aber ihr größter ist der Mann, der das Als-ob zu einem System gemacht hat. Das ist das richtige System für ein Europa, das nichts anderes verlangt, als Sand in die Augen gestreut zu erhalten …«
Aber dieser Mann, dieser Bosniak mit der türkischen Gemütsart, der sonst immer aus lauter Vorsicht und Bedenken besteht, ist heute irgendwie ausgewählt und in seinen Gedankengängen nicht aufzuhalten. »Das ist keine Philosophie auf lange Sicht«, sagt er hartnäckig, »und das muss man den Deutschen ja nachsagen, dass sie das friedliebendste Volk sind, wenn man sie in Ruhe lässt. Aber wir wollten ihnen ja keine Ruhe gönnen …«
Der Mann im Klubsessel lacht kurz auf und seine Stimme klingt spöttisch: »Wollen Sie nicht lieber sagen, Herr Kollege, wir konnten nicht …« Er macht eine Pause und setzt mit noch größerem Nachdruck hinzu: »Wir … durften nicht.«
Chwatal räuspert sich, er möchte etwas entgegnen, er hätte eine Menge zu sagen, und die neue Zigarette, die er zu rollen begonnen hat, zittert in seiner Hand, dass der Tabak auf die Landkarte rieselt. Aber nun stellen sich zur rechten Zeit doch wieder seine Hemmungen ein. Nein, er mit seinen Ausgleichswünschen gilt ja schon längst, als verdächtig auf der Liste der Politiker, die ins alte Eisen gehören, und dass er mit manchen Dingen, die sich hier zutragen, nicht restlos einverstanden ist, das wird ihm natürlich auch wieder übel angekreidet. Man hat ihn in den obersten Rat der nationalen Verteidigung aufgenommen, weil er in seiner Stellung nicht zu umgehen war, aber er steht auf schwankendem Boden, das weiß er zu genau. Längst schon hätte er alles hingeschmissen, wenn er nicht geglaubt hätte, durch sein Verbleiben doch vielleicht Schlimmstes verhüten zu können.
Und von Kramr weiß man, dass er Freimaurer ist, dass er seine Befehle von jener geheimnisvollen Macht empfängt, die sich anmaßt, die Geschicke der Völker zu dunkeln, nur ihr bekannte Ziele zu lenken. Wenn er solche Worte wie vorhin mit solchem Nachdruck ausspricht, so haben sie gewiss ihre Bedeutung. Es erscheint Chwatal also besser, zu schweigen oder irgendwie ins Harmlosere abzulenken.
Der General Biskup hat sich nicht hineingemischt. Was für ein Herumgerede? Hin und her und hin und her, ein fruchtloses, unnützes Wortemachen. Als ob es darauf ankäme! Jetzt ist er ungeduldig geworden und platzt in das brütende Schweigen hinein, von dessen Gefährlichkeit er keine Ahnung hat. Er ist der Mann aus dem Volke, seine Mutter führt noch heute in der weiten, sonnendurchglühten Ebene der mährischen Hanna auf dem väterlichen Hof in ungebrochener Kraft die Wirtschaft Biskup ist der Mann des Kriegshandwerks, sein Weg geht geradeaus. Er sagt furchtlos und bieder: »Wozu zerbrechen wir uns die Köpfe … die Entscheidung über das, was zu geschehen hat, liegt ja doch nicht bei uns …«
Es ist ungefähr dasselbe, wag Kramr gesagt hat. Aber Chwatal meint, Bigkup gegenüber könnte man doch eher einen Widerspruch wagen, und er setzt auch schon dazu an, da leuchtet eine Scheibe an der Wand gegenüber auf.
»Sie kommen!«, sagt Exzellenz Kramr.
5.
Die Herren aus dem Wallensteinpalast haben das Auto auf einem verträumten Platz des Hradschins halten lassen und den Rest des Weges zu Fuß zurückgelegt. Sie betreten die Burg auch nicht beim Haupteingang, sondern durch eine unscheinbare Seitenpforte, wo sie der Vertraute erwartet, der sie durch ein Gewirr von Gängen und Treppen an Ort und Stelle bringt.
Eine Schiebetür gleitet in der Wand lautlos zurück und die vier Herren treten ein. Sie sind jetzt nur zu viert, die beiden Offiziere, bloß Sachverständige im Kriegsfach, sind nicht mitgekommen, Genosse Slawruski weiß ja nun, was er wissen muss.
Dem neuen Ankömmling gilt selbstverständlich die größte Aufmerksamkeit Exzellenz Kramr hat sich aus dem Klubsessel erhoben und die Krückstöcke ergriffen, die neben ihm lehnen. Er bewegt sich nur mühsam au den Stöcken. »Die Pedale wollen nicht recht gehorchen«, sagt er entschuldigend zu Slawruski, »ich bin ein berühmter Fall. Die Arzte wissen nicht recht, was sie aus mir machen sollen. Vielleicht ist es Kinderlähmung und sie verschweigen es mir nur.«
»Bitte, behalten Sie Platz«, sagt Slawruski höflich.
Kramr nimmt beide Stöcke in die linke Hand und reicht den Herren die Rechte. Mit Beryll rauscht er beim Händedruck das Zeichen der Eingeweihten.
»Sie bringen uns also die Vollmacht?«, erkundigt sich Kramr.
Ja, die Vollmacht ist da und der Vollmachtsträger, der zu bestimmen hat, was geschieht. Sie sprechen natürlich Deutsch wie immer. Tschechisch und Russisch, zwei verwandte slawische Sprachen, nicht wahr? Aber doch nicht verwandt genug, dass der eine den anderen restlos verstünde. Da ist die Feindessprache immer noch der beste, allen gangbare Ausweg.
»Und wie haben Sie unseren großen Freund verlassen?« erkundigt sich Krame.
»Mit Arbeit überhäuft, wie Sie sich denken können. Eine übermenschliche Kraft! Er ist wie Atlas, der eine Welt auf seinen Schultern trägt.«
Sie nicken zustimmend. Ja, ja, es ist wirklich so, ein Atlas, der die Welt trägt. Sie betrachten den Mann mit Ehrfurcht, der des täglichen Umganges mit dem Moskauer Gewaltigen gewürdigt wird. Sie wüssten gern mehr, wie er lebt, wie er isst, wie er arbeitet, man erfährt wenig darüber, er schließt sich vor der Menge ab wie nur einer der blutigen Chane auf asiatischen Thronen. Aber es geht natürlich nicht an, den Genossen Slawruski nach diesen Dingen zu fragen, man muss es ihm überlassen, zu erzählen, was ihm beliebt; übermäßig mitteilsam scheint er ja nicht zu sein. Nun ja, man gibt nicht einem Schwätzer solche Vollmacht zur Entscheidung über das Schicksal der Welt.
»Haben Sie besondere Wünsche für Ihren Aufenthalt, Genosse Hochkommissär?« unterbricht Kramr, der wieder seinen Platz im Klubsessel eingenommen hat, das Schweigen.
»Ich wünsche mit niemandem zusammenzukommen«, sagt der Genosse Hochkommissär, »als mit jenen, mit denen ich zu tun habe. Ich wünsche nicht, dass man von meiner Anwesenheit erfährt. Die Presse ist strenge zu überwachen. Ich würde, wenn das geringste über mich verlautet, die Schuldtragenden zur Verantwortung ziehen müssen. Wollen Sie mir sagen, wer mit meiner Überwachung betraut ist?«
Heinz Haberland hat den richtigen Ton getroffen, das merkt er sofort. »Die Geheimpolizei des Außenamtes!«, sagt Kramr beflissen.
»Unter welcher Leitung?«
»Unter meiner eigenen Leitung!«
»Sie werden dafür sorgen«, sagt der Genosse Slawruski, »dass auch Ihre Leute nicht erfahren, wen sie eigentlich zu überwachen haben.«
Von den alten Gewölben sinkt wieder Schweigen herab. So körperlich, dass sich Heinz’ Blick unwillkürlich zur Höhe richtet, als wäre zu sehen, wie das Schweigen aus dem Stein kriecht und in Gestalt dunkler Tücher herabweht. Man hat ihm während der Fahrt erzählt, was für eine Bewandtnis es mit diesem Raum habe. Das richtige Verschwörernest! denkt Heinz. Was aber auch hier schon an blutigen Gräueln ausgebrütet worden sein mag, es ist nichts als ein Getändel kindischer Launen der Geschichte gegen das, was jetzt hier ins Werk gesetzt werden soll.
»Ich sehe, Sie haben sich auch mit den Ausmarschplänen beschäftigt«, piepst endlich die Kinderstimme des Generals Jergunow.
General Biskup zieht den Atem ein und wölbt die Heldenbrust vor; es ist ungeheuer viel Platz für Atem in diesem mächtigen Brustkasten. »Wir haben uns also endgültig entschlossen, die Waagtal-Linie aufzugeben … das heißt, nicht aufzugeben … aber sie kommt nur mehr als zweite Stellung in Betracht … die hoffentlich niemals ernstlich in Betracht kommen wird.«
»Sie müssen wissen, Genosse Slawruski«, wendet sich der Bolschewiken-General an Heinz, »dass wir uns von vorneherein über die besonderen strategischen Schwierigkeiten unserer Lage im Klaren waren. Ein Blick auf die Karte zeigt ihnen, dass der westliche Teil der Tschechoslowakei auf drei Seiten eingeschlossen wird. Böhmen, Mähren und Schlesien stecken wie in einer Zange, sie befinden sich zwischen den Scheren eines riesigen Hummers, der mit seiner ungeheuren Kraft diese Scheren bloß zu schließen braucht, um die Republik in größte Bedrängnis zu bringen. Es ist der besondere Nachteil der geografischen Lage, und wir haben uns zuerst gesagt, es sei besser, diesen Verhältnissen von vorneherein Rechnung zu tragen und uns darauf einzurichten, den westlichen Teil der Republik vorübergehend preiszugeben, den östlichen Teil durch einen unüberwindlichen Damm abzuriegeln.«
»Aber bedenken Sie«, wirft Chwatal ein, »was das für uns heißt … wir sollen die Kernländer unseres Staates preisgeben, Böhmen und Mähren räumen … Prag aufgeben … unser Prag. Unsere Leute hätten das nie und nimmer verstanden. Sie hätten gefragt: was ist das für ein Krieg, den ihr da angezettelt habt? So haben wir uns das nicht vorgestellt.« Er zieht eine Zigarette, die er nach Bosniakenart in der Tasche gedreht hat, hervor, feuchter den Papierrand an und klebt ihn fest. Dann sagt er: »Und die Räumung des Westens, … das waren ja auch im wesentlichen Gedankengänge unserer sowjetrussischen Bundesgenossen.«
Offenbar enthält diese Feststellung einen versteckten Vorwurf. Und Jergunow versteht ihn auch als solchen, er wirft einen schiefen, ärgerlichen Blick auf Chwatal: »Ja, man kann auf solche Empfindlichkeiten keine Rücksicht nehmen, Exzellenz. Da kommt es aufs Ganze an, nicht auf derartige Einzelheiten. Russland hat sogar einen Napoleon besiegt, indem es ihn ins Land hineingelockt hat. Es wird den Rassen damals auch nicht leicht geworden sein. Aber solche Opfer müssen nun einmal gebracht werden.«
»Böhmen ist nicht Russland«, sagt Chwatal trocken, »und zwischen der russischen Grenze und Moskau liegt nicht die schönste Stadt der Welt … liegt kein Prag.«
Aus dem Gewölbe sinkt wieder das Schweigen der Jahrhunderte herab. Nur ein ganz leises, sanft schnurrendes, gleichmäßiges Geräusch wie das Flügelschwirren eines eingesperrten Insekts ist in diesem Schweigen enthalten. Es fällt niemandem auf außer Beryll, und er weiß auch, was es ist. Er hat bemerkt, dass Kramr beim Beginn der Auseinandersetzungen auf einen Knopf an der Seitenlehne seines Klubsessels gedrückt hat, der die Aufnahmevorrichtung in Betrieb setzt. Irgendwo in diesem Raum läuft nun die eingebaute Maschine, die den Laut auf Wachsplatten überträgt, sie selbsttätig auswechselt und Wort für Wort festhält. Beryll nickt dem in seinen Klubsessel versunkenen Kramr zu, und Kramr nickt ebenso unmerklich zurück.
»Wir haben ja auch schließlich darauf Rücksicht genommen«, wendet sich Jergunow wieder dem Genossen Hochkommissär zu, »denn wenn die besondere geografische Lage der Republik ihren Nachteil hat, so ist doch auch andererseits mit ihr ein Vorteil verbunden … Ich erzähle Ihnen ja mit alledem keine Neuigkeiten«, unterbricht sich der General, »Sie werden ja unsere Geheimberichte gelesen haben.«
»Ich kenne sie«, sagt der Genosse Hochkommissär kurz. Heinz Haberland hat sich eine herrliche Art des Verhaltens zurechtgelegt. Er schweigt zuweist. Er lässt die anderen sprechen und tröpfelt nur ab und zu ein Wort in die Unterredung, das dann um so bedeutsamer wirkt und von den anderen mit um so größerer Hochachtung hingenommen wird.
»Also, bitte, nicht wahr«, fährt Jergunow fort, »ich wiederhole Bekanntes um der Deutlichkeit willen. Vom Nachteil haben wir eben gesprochen. Der Vorteil der geografischen Lage besteht darin, dass der westliche Teil der Republik wie ein Keil ins deutsche Gebiet vorgeschoben ist. Er hat, im Großen gesehen, die Gestalt einer Bastion, von der aus ein Ausfall ins Feindesland mit größter Aussicht auf Erfolg unternommen werden kann. Damit kommen wir den Wünschen unserer tschechischen Freunde entgegen …«
General Biskup, dem der sowjetrussische Kollege allzu sehr den Wind aus den Segeln genommen hat, kann sich nicht länger zurückhalten. Er will auch zur Geltung kommen, sein Anteil muss festgestellt werden, das verlangt die Gerechtigkeit. »Die Pläne gehen zum größten Teil auf mich und meinen Generalstab zurück«, versichert er. Ja, er ist auch jemand, das soll der Genosse Slawruski nur gleich wissen. »Die Waagtal-Linie, in Gottes Namen, das mag eine ganz gute Verteidigungslinie sein … aber, damit hat Exzellenz Ehwatal Recht … wir wollen den Krieg nicht im eigenen Land, wenn wir es vermeiden können. Auf alle Fälle … sehen Sie diese dicke schwarze Linie hier längs der Grenze ... es ist unsere Maginot-Linie, ausgebaut nach allen Regeln der Kunst, noch stärker als die französische, nach meinen Entwürfen. Und sehen Sie … sie verläuft fast durchwegs im deutschen Randgebiet. Wenn es also … ich setze den Fall … zum äußersten kommt, Rückschläge und so … dann spielt sich der Kampf in diesen Gebieten ab. Aber es wird nicht so weit kommen, denn wir tragen den Angriff überraschend nach allen Seiten in das Feindesland hinein …«
»Und von wo soll der Hauptstoß erfolgen?« erkundigt sich Slawruski.