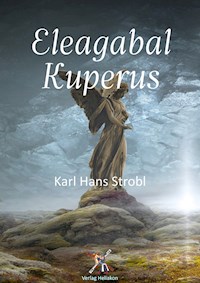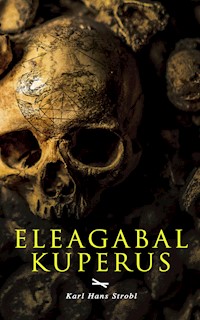Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Grenzen, die durch Zeit, Raum und Tod gesetzt erscheinen, fallen; Zeit und Zeitlosigkeit, Gegenwart und Jenseits fließen ineinander. Noch während Ihrer Frontreisen machten Sie Jagd auf Spuk und fingen einige der Teufel ein, die diesen Weltkrieg der Maschinen heizen wie jeden andern. Ganz unheimlich ist die Wirkung, wenn sinnlose Sinnlichkeit in unsere Erscheinungswelt aus einem Angstzustand von Traum und Nervenüberreizung halb wesenhaft und doch noch körperlos hineingespenstert. Hier wird die Fantasie schöpferisch und Selbstzweck: schafft eine Welt in unsere Welt hinein, bereichert uns mit unerhörten Abenteuern des Instinktes, mit Erlebnissen des eingeborenen Zwiespaltes, der unser Ich gespenstisch teilt, mit im Blut und Traum geahnten Möglichkeiten, die im Bürger seinen Dämon entfesseln. Inhaltsverzeichnis Vorwort Drei Bilder nach Art des Hieronymus Bosch I. - Das Meerweib II. – Am Kreuzweg III. – Der Hexenrichter Der Kopf Die Repulsion des Willens Mein Abenteuer mit Jonas Barg Das Manuskript des Juan Serrano Gebärden da gibt es vertrackte Der Fall des Leutnants Infanger Take Marinescu Das Grabmal auf dem Père Lachaife Das Aderlassmännchen Der sechste Gesell Die arge Nonn' Laertes Der Bogumilenstein Der Schattenspieler Busi-Busi Der Wald von Augustowo Der Triumph der Mechanik
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Titelseite
Impressum
Vorwort
Drei Bilder nach Art des Hieronymus Bosch
Der Kopf
Die Repulsion des Willens
Mein Abenteuer mit Jonas Barg
Das Manuskript des Juan Serrano
Gebärden da gibt es vertrackte
Der Fall des Leutnants Infanger
Take Marinescu
Das Grabmal auf dem Père Lachaife
Das Aderlassmännchen
Der sechste Gesell
Die arge Nonn’
Laertes
Der Bogumilenstein
Der Schattenspieler
Busi-Busi
Der Wald von Augustowo
Der Triumph der Mechanik
Lemuria
Seltsame Geschichten
Karl Hans Strobl
Impressum
2022 © Verlag Heliakon, München
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Titelbild: Pixabay (ipicgr)
Druck und Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Überarbeitete und korrigierte Fassung
Alle Rechte vorbehalten
www.verlag-heliakon.de
Vorwort
I.
Lieber Karl Hans Strobl,
damals, im April 1915, als Sie zu uns ins Quartier kamen, kannten wir uns noch nicht persönlich. Schriftlich hatten wir seit zehn Jahren mancherlei Miteinander zu tun – von Auge zu Auge sahen wir uns erst jetzt. Unser Quartier war damals in Zsolna, das Armeeoberkommando, dem wir angegliedert waren, in Teschen. Der Kriegshimmel war unbewegt und wetterschwül, die Ahnung kommender Ereignisse lag in der Luft und trieb uns Kriegsberichterstatter Tag für Tag nach Teschen fragen. Dem Wiener Schnellzug, den wir von Zsolna aus benutzten, entstieg ein untersetzter, stämmiger Tourist: Ihr kräftig gemeißelter, blondbärtiger Kopf war, nach Bildern, nicht zu verkennen. Wir, in der Blasiertheit unserer Stadtanzüge, schrieben mit erfahrenem Lächeln Ihre feldmäßige Ausrüstung der Naivität jedes anfangenden Kriegsberichterstatters zu, der geradenwegs in die Feuerlinie zu reisen glaubt.
Nun, gar bald begriffen wir, dass für Sie, Wanderburschen im Geblüt, der Wadenstrumpf nicht Kostüm, sondern das naturgegebene Gewand und sein staunenswerter Umfang wohlverdient ist. Unverdrossen warteten Sie durch die Rotmeere Galiziens, kletterten zu den einsamen Wächtern im Alpenschnee empor und schlugen sich durch die wegelosen und bereisten Einöden der albanischen Berge, nur geleitet von jenen traurigen Merkzeichen, die den Untergang eines kleinen, tapferen verblendeten Volkes begleiteten. Selbst was uns willkommene Rast im städtischen Quartier war, wurde Ihnen zum Ausgangspunkt frisch-fröhlicher Entdeckungsstreifen durch die Slowakei.
Das Geheimnis, das sich bei Gorlice enthüllen sollte, wurde streng gehütet. Als die deutschen Militärtransporte durch Zsolna durchzurollen begannen, schob man uns Kriegsberichterstatter in das slowakische Hinterland nach Nagybicscse ab. Wir andern fieberten vor ungeduldiger Erwartung – Sie, in dem stetig starken Gleichmut Ihrer Seele, schrieben derweil auf Ihrer Dachkammer im alten Schloss, die eine rechte Dichterbude aus der Schwindzeit war, am zweiten Bande Ihres „Bismarck“ und pilgerten längs der wirbelnden Waag dem nächsten guten Weinschank zu. Dann kam der große Schlag, das weltgeschichtliche Gewitter, das mit Blitz und Donner die allgemeine Spannung löste. Unser Sonderzug fuhr diesem Donner nach, wir saßen hinten auf dem letzten der offenen Güterwagen, die unsere Automobile trugen: Sie, ich und der Amerikaner; unter unsern baumelnden Beinen schoss das Eisenband dahin und riss die maienjunge Hügellandschaft mit in seine Flucht. Die „Lusitania“ war versenkt, und Mr. Conger sah im makellosen Himmelsblau jenes neue Wölkchen sich zusammenballen, das sich zwei Jahre später zu einem neuen Weltgewitter auswuchs. Was scherte das uns! Wir fuhren ja dem Sieg entgegen! Sie, für Ihr Teil, hatten diesen ersten Herbst und diesen Winter nicht mitgemacht, wo wir wie betrübte Hühner in entlegenen Winkeln hockten, immer wieder aufgescheucht von Keulenschlagen des Kriegsgeschicks, wo wir, von Dukla zur Hohen Tatra gelangten, dann wieder mit dem Hauptquartier über die Karpaten bis Sandec vorrückten und, nach der serbischen Enttäuschung, in die Slowakei zurück geworfen, einen unruhigen Winterschlaf begingen. Bis dahin hatten Sie das Weltgeschehen von der Warte Ihrer Leipziger Redaktion aus betrachtet – nun wollten Sie in Ihre österreichische Heimat zurück und kamen geradenwegs in den Frühling und den Sieg marschiert.
Später waren wir durch Zufall an der Front nicht mehr zusammen. Aber wenn wir dann zurückkamen, trafen wir uns im Quartier. Da gab es Abende, die waren weit vom Krieg und halfen uns aus seinem mörderischen Bann. Sie, Karl Hans Strobl, saßen da am Flügel, die gedrungenen Beine etwas gespreizt, nicht unähnlich dem großen Meister Gottfried Keller aus Stauffer-Berns Radierung, machten handfest und mit unerschrockenem Können die Begleitung, und vom Weinglas fiel ein goldener Schimmer in Ihr Spiel. Denn auch dies haben Sie mit dem Staatsschreiber von Zürich gemein, dass Sie einen guten Tropfen ehren. Prager Studentenjahre haben Sie gewappnet und gefeit zu einer Zeit, wo Bier noch Bier und wohlfeil war. Wir kennen diese Ihre Zeit aus drei Romanen – Büchern eines flammenden Herzens, das jung und ungestüm verlangend ist. Ihr Herz ist, meint der Stabsarzt, nicht so ganz intakt – was weiß (mit Respekt gesagt) ein Stabsarzt von einem Dichterherzen, das aus Natur und jungem Leben um sich nie alternd seine Nahrung zieht!
II.
Woher, habe ich mich oft gefragt, woher nehmen Sie bei all dem noch die Zeit, zu dichten? Ihr Tag scheint restlos ausgefüllt – schien es immer schon, ob auch Ihr Tun den Namen wechselt: Steuer, Redaktion, Kriegsberichterstattung – Tagesfron und dann Erholung. Und doch ist all dies nur das Belanglose neben dem Wesentlichen – wurzelt Ihr stärkster Wert in Ihrer Dichtung, die zugleich auch Ihre größte Arbeitsleistung ist. Wir haben einmal nachgerechnet, dass die Zahl Ihrer Bücher dreißig schon übersteigt, die zusammen in ein paar Mal hunderttausend Exemplaren durch die Welt gegangen sind.
Nicht alles, was Sie schrieben, ist mit gleichem Maß zu messen, aber alles kommt aus einem Born, der unerschöpflich scheint. Ohne die Hemmungen des Literatentums, das sich selbst gar feierlich nimmt, formen Sie die Eingebungen Ihrer Fantasie, bald heiter und mit unbeschwerter Hand, bald mit dem schweren Rüstzeug der Kulturgeschichte, bald aus der Fülle der Gesichte, die Ihr Dämonium sind.
Die erste Periode Ihres Schaffens liegt nun schon anderthalb Jahrzehnte zurück. Ihre Studentenzeit erstand noch einmal in jenen drei Romanem „Vaclavbude“, „Schipkapaß“ und „Das Wirtshaus zum König Przemysl“. Daran ist nichts Besonderes: so fingen hundert an. Das Besondere dieser drei Romane aber ist die Zeitstimmung, aus der sie erwuchsen, ist der Hintergrund, der ihnen historisches Relief verleiht. Denn Ihre Universität ist Prag und die Zeit die der blutigen Zusammenstöße zwischen Tschechentum und Deutschen. Sie, eingeborener und guter Deutscher, standen natürlich auf der deutschen Seite und haben redlich Hiebe ausgeteilt und empfangen. Allein – und das ist, bei Ihrem Temperament, besonders auffällig – es ist kein Hass in diesen jungen Büchern, die doch das Recht der Jugend nutzen könnten: ungerecht zu sein. Sie wahren die ritterliche Gegnerschaft der Mensur: man misst die Klingen und misst damit die eigene Kraft an der des andern. Je überlegener der Gegner, um so größer die Ehre, ihm gewachsen zu sein oder kämpfend zu unterliegen. Sie standen von Kind auf in viel zu enger Berührung mit dem tschechischen Nachbarn, waren mit seiner Geschichte, seiner Sprache, seinen Liedern, seiner Musik und seinem Farbenfrohsinn zu vertraut, um je blindwütigem Hass oder parteiischem Dogma zu verfallen. Deshalb und um ihrer ungeschminkten Frische willen werden diese Romane aus einem Prag, das heute auf Abbruch steht, ihren wert behalten: Staackmann tat recht und dankenswert daran, sie in seinen Verlag zu übernehmen und neu herauszugeben. Letzten Endes steckt ja auch der ganze zukünftige Strobl schon darin. Noch Ihre letzten Helden, der ewig schwanke Matthias Merenus und der ewig starke Bismarck, holen sich auf dem Fechtboden ihre ersten Siege; Ihr studentischer Doppelgänger Binder nimmt, in der nächtlichen Begegnung mit Tycho de Brahe, ein wenig unbeholfen noch, das Hineinspielen des Übersinnlichen vorweg, das später Ihren Nationalismus durchtränkt; und der Ausklang der „Vaclavbude“ ist zugleich Quintessenz Ihres Dichtens: »das Leben in seiner ganzen, jauchzend, schönen, glühenden, blutrünstigen Grausamkeit".
Es ist die Lust an den Dingen dieser Erde, ohne Unterschied, die Ihnen die Feder führt und selbst noch die betrüblichen Angelegenheiten heiter wendet – handle es sich nun um die „Wer Ehen des Matthias Merenus“ oder um die kleinbürgerlichen Kriegsaffären des deutschen Mittelalters, in die Ihre „Drei Gesellen“ geraten, oder gar um die Familiensorgen des großen Korsen, der an Paulinens schwesterlicher Hand unversehens in das tragikomische Bereich des Menschlich-Allzumenschlichen entgleist. Der Schilderer selbst erlebter Studentenabenteuer hat sich zum Geschichtsschreiber ausgewachsen, der den immer gleichen Menschheitstrieben in der kulturellen um Welt anderer Zeiten nachgeht. Im „Frauenhaus von Brescia“ ist es das Italien des dreizehnten Jahrhunderts, das Sie in einem Feuerbrand der Sinne heraufbeschwören, in den „Drei Gesellen“. Ihr heimatliches Brünn, wie es sich nach dem dreißigjährigen Krieg gab, in den „Streichen der schlimmen Paulette“ das Elba des verbannten Kaisers. Dabei wandelt sich Ihr Stil mit dem heraufbeschworenen Zeitgeist: vom burschikosen Studententon zu bedachtsam wägender Chronistenart, von wild flackernder Vision zu jener epischen Gelassenheit, die sich handfest neben Meister Raabes schmerzliches Behagen und Fontanes feine, gütig verstehende Ironie stellt. Ihr „Bismarck“ vollends hat von dem kernigen Deutsch des Alten selber, dem Sie da ein dreibändiges Denkmal setzen: mit dichterischer Freiheit im Detail, aber voll Respekt vor dem Wesentlichen einer weltgeschichtlichen Gestalt und durchdrungen von den politischen Problemen, die Bismarck Problem seines Lebenswaren. Mir, als Niederdeutschen, wird es stets erstaunlich bleiben, wie frappant Sie niederdeutsche Junkerart zu treffen vermochten – nicht vergessen sei, dass es ein deutscher Osterreicher ist, der uns den ersten Bismarckroman gab – den ersten, der mit Fug und Recht den großen Namen tragen darf, weil er den erkorenen Vorwurf mit der Künstlerhand des Dichters meistert.
Der „Bismarck“, dessen zwei bisher erschienenen Bänden der dritte zu gelegener Zeit nachfolgen wird, ist das eine Ihrer beiden Hauptwerke; das andere ist der „Eleagabal Kuperus“. In diesem gewaltigen Roman, der die bewegenden Kräfte der Zeit: den Moloch des Kapitals gegen den betrachtenden, den künstlerischen und den erfinderischen Geist einsetzt, hat sich Ihr Können zeitlos dokumentiert. Um den großen, liebenswerten Zauberer Eleagabal Kuperus, Gestalt gewordenes Symbol Ihres kraftvoll an sich reißenden Künstlertums ballen sich Motive und Stoffe, Weltenchaos um den Sonnenkern, werden Form um die Urform des Romans, füllen ihn, bereichern ihn, drohen ihn zu sprengen: kein zweiter deutscher Autor heute könnte sich diese Verschwendung aus der Fülle innerer Gesichte erlauben, die in einen Roman zusammenrafft, was andere in ein Dutzend auseinandergezogen hätten. Mit weitausgreifender und herrischer Gebärde fasst Eleagabal Kuperus in ein Werk, was dieser Sammelband hier einem halben Dutzend Novellenbänden entlehnt: den Triumph des dichterischen Willens über die naturgegebene Begrenztheit.
In diesen Eingebungen Ihrer Fantasie ist alles, was das Leben stark und männlich macht: Vitalität und Kraftgefühl, sinnliches Genießen, Instinkte der Grausamkeit und Wille zur Macht. Ein Wille, der mit dem Tod noch nicht zur Ruhe kommt, der gierig in das Übersinnliche hinübergreift und aus ihm mit Gespenstern, Vampiren, Teufeln, Hexen, Alben und Lemuren heimkehrt. Sexuelle Unersättlichkeit saugt im „Grabmal auf Père Lachaise“ und als „Aderlassmännchen“ spinnenhaft das in ihr Netz gegangene Leben aus, sexuelle Schuld hegt Schwester Agathe, „die arge Nonn’“, durch die Jahrhunderte. Eifersucht leiht dem erstochenen „Laertes“-Spieler zur Rache noch einmal Gestalt und Maske, vorzeitige Liebestrennung ruft die Studentin Bettina, ruft den „Schattenspieler“ aus dem Grab.
Die Grenzen, die durch Zeit, Raum und Tod gesetzt erscheinen, fallen; Zeit und Zeitlosigkeit, Gegenwart und Jenseits fließen ineinander. Noch während Ihrer Frontreisen machten Sie Jagd auf Spuk und fingen einige der Teufel ein, die diesen Weltkrieg der Maschinen heizen wie jeden andern. Ganz unheimlich ist die Wirkung, wenn sinnlose Sinnlichkeit in unsere Erscheinungswelt aus einem Angstzustand von Traum und Nervenüberreizung halb wesenhaft und doch noch körperlos hineingespenstert. Hier wird die Fantasie schöpferisch und Selbstzweck: schafft eine Welt in unsere Welt hinein, bereichert uns mit unerhörten Abenteuern des Instinktes, mit Erlebnissen des eingeborenen Zwiespaltes, der unser Ich gespenstisch teilt, mit im Blut und Traum geahnten Möglichkeiten, die im Bürger seinen Dämon entfesseln. Alles, was entfesselt, hilft da mit: Geschlechtlichkeit, Genussgier, Trunk. Darin den Altmeistern der fantastischen Novelle, den Poe und E. T. A. Hoffmann, gesellt, sind Sie unbedenklicher und hemmungsloser in den treibenden Instinkten, brutaler in den letzten Konsequenzen und Meisterstücke wie „Die arge Nonn’“, „Das Grabmal auf dem Père Lachaise“, „Das Manuskript des Juan Serraño“ kongenial dem Meisterlichsten, was dem Genie der beiden großen Geisterbeschwörer gelang. Übrigens, was rede ich viel – der Leser dieses Sammelbandes mag da selbst entscheiden.
Es liegt mir fern, Sie auf das Schema des Gespensternovellisten festzunageln. Sie haben in Novellen diesseitiger Art die gleiche Könnerschaft bewiesen; noch Ihr letzter Band „Die Kristallkugel“ ist dafür Zeuge. Und vor allem: so stattlich Ihre bisherige Arbeitsleistung ist, so halten Sie ja nicht am Ende, sondern schaffen aus dem Vollen, das uns immer wieder überrascht.
In diesem Sinne grüße ich den alten Karl Hans Strobl, dem ich und Hunderttausende mit mir zu danken haben, und grüße zugleich den Neuen, auf den ich mich freue, als Ihr Kriegs- und hoffentlich bald Friedenskamerad.
Leonhard Adelt.
Rodaun, 10. Mai 1917.
Die „Drei Bilder nach Art des Hieronymus Bosch“ und „Der Kopf“ sind der Sammlung „Aus Gründen und Abgründen“ (Verlag L. Staackmann in Leipzig, 1902), die Novellem „Die Repulsion des Willens“, „Mein Abenteuer mit Jonas Barg“, „Der sechste Gesell“, „Laertes“ und „Der Triumph der Mechanik“ dem Band „Bedenksame Historien“ (Verlag L.Staackmann in Leipzig, 1907), die Novellen, „Das Manuskript des Juan Serraño“, „Der Fall des Leutnants Infanger“, „DasAderlaßmännchen“, „Die arge Nonn’“ und „Der Schattenspieler“ dem Novellenband „Die knöcherne Hand“ (Verlag Georg Müller, München 1911) entnommen.
„Das Grabmal auf dem Père Lachaise“ findet sich erstmalig in einem Sammelband: „Das unheimliche Buch“ herausgegeben von Felix Schloemp (Verlag Georg Müller, München 1913), „Der Wald von Augustowo“ in einem anderen Sammelband „Der Gespensterkrieg“ (Verlag der Lese in Stuttgart, 1915), „Der Bogumilenstein“ in Nummer 16 der „Jugend“ von 1916.
Die Novellem „Geberden da gibt es vertrackte“, „Take Marinescu“ und „Busi-Busi“ sind bisher unveröffentlicht.
Drei Bilder nach Art des Hieronymus Bosch
I. - Das Meerweib
Der lange Peters kommt wie ein Besessener ins Dorf, zurückgerannt. Schon von weiten fuchtelt er mit den überlangen Armen in der Luft.
Die Frau Pastorin wirft gerade zufällig einen Blick aus dem Küchenfenster. Wie sie den langen Peters daherrennen sieht und mit den Beinen werfen und den Händen winken, da fällt ihr vor Schreck der Schöpflöffel aus der Hand. Die Frau Pastorin ist in anderen Umständen. Der jähe Schreck fährt ihr siedend heiß durch die Glieder. Totenbleich sinkt sie auf die Holzkiste am Herd. Mit der einen Hand hält sie den schmerzenden Leib, mit der anderen tastet sie zitternd und krampfhaft längs der Wand. Die bebenden Finger werfen das Salzfass vom Nagel, dass es klirrend zerspringt und das weiße Salz sich mit dem grauen Staub vor dem Herd vermengt. Ihre Augen starren weit geöffnet und angsterfüllt ins Leere.
Der lange Peters rennt unterdessen durch das Dorf und brüllt alles heraus. Die langen Beine wirft er hinter sich und mit den Armen schlenkert er wie mit Windmühlenflügeln. Dabei brüllt er, was ihm aus der Lunge geht.
Aus allen Türen stürzen die Weiber und dem langen Peters nach. Der aber lässt nicht ab, bis er alle Straßen durchrannt hat. Dann steht er mitten auf dem Dorfplatz, bleich und keuchend vor Anstrengung.
Um ihn die neugierigen, ungeduldigen Weiber.
Was es gibt? Ja, was es gibt’s? … Ja … Was? … Was? …
Ein Meerweib haben sie gefangen, die Fischer, unten am Strand … und sie liegt im Sand und kann nicht fort … das Wasser hat sie ans Land gespült … und sie hat einen Fischschwanz und grünes Blut … und sie liegt noch unten … und alle sollen kommen, sie anschauen.
Da fahren die Weiber auseinander und in Hauben und Tücher, und in wenigen Augenblicken geht der ganze Zug im Laufschritt beim Dorf hinaus. Hintennach humpelt, so schnell sie die alten süße tragen wollen, die kleine, vertrocknete, über hundertjährige Großmutter von Peters. An der Hand führt sie den kleinsten Urenkel, der noch nicht recht laufen kann und fortwährend umkippt.
Der Wind bläst in die Röcke und Tücher der Frauenzimmer, dass das Zeug wie lose Segel hintennach flattert.
Von der hohen Düne sehen sie schon unten die dunkle Gruppe der Fischer. Die stehen in einem Knäuel beisammen und betrachten etwas, das in ihrer Mitte liegt.
Jetzt teilen die Weiber den Kreis der herumstehenden Männer und da liegt das Meerwunder vor ihnen.
Halb Weib, halb Fisch … Ein kleines, blasses Gesicht mit blauen, geängstigten Augen, die voll tödlichen Grauens von einem zum anderen wandern. Schweres, feuchtblondes Haar um die Schultern. An den knospenden, jungen Brüsten zittern im stürmischen Heben und Senken kleine Wassertropfen.
Aber wo bei Menschenkindern die Beine beginnen, leuchtet ein zartes, rosarotes und grünes Geschuppt. Und immer dichter werden die glänzenden Schildchen, bis sie sich enge aneinander schließen und den walzenförmigen Unterleib bedecken, bis wo er in eine Fischflosse endet. Über das Schwanzende aber dicht unterhalb der Flosse, geht querüber ein gräulicher Schnitt klaffend und tief. Die Flosse ist nur durch ein schmales Band noch mit dem Leib verbunden. Aus dem Schnitt quellen langsam und träge große, schwere Tropfen grünen Blutes. Ringsumher ist der Sand grün gefärbt.
Eine messerscharfe Strandklippe muss das Meerweib verwundet und eine Welle die Hilflose an den Strand gespült haben.
Im Kreise stehen die Fischer und die Weiber und Kinder und schauen mit dummen Augen auf das Wunder.
Dann löst sich langsam der Bann. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was soll man mit ihr anfangen? …
Einer schlägt vor, sie an Stricken in das Dorf hinauf zu schleifen. Nein, nicht ins Dorf, zetern die Weiber …
Der Pastor soll raten! Einer soll den Pastor holen! … Und der Peter, mit seinen langen Beinen rennt um den Pastor.
Die andern schreien weiter durcheinander. Ein Gewirr von Fragen. Eine Antwort weiß keiner.
Die blauen, müden und todesängstlichen Augen des Meerweibes irren von einem zum andern. Endlich heften sie sich auf den Jens.
Der flachsköpfige, breitschultrige Jens hat sich in die erste Reihe gedrängt. Er fragt nichts, er antwortet nicht, er schaut nur stumm und starr auf das Meerweib zu seinen Füßen.
Ihre irrenden Augen haben einen Ruhepunkt gefunden und umklammern mit bebendem Blick seine Gestalt. Da treffen ihre suchenden Blicke die seinen … und wie schamhaft und scheu greifen ihre kleinen, bleichen Hände in den schweren feuchtblonden Haarmantel und breiten ihn über die zarten, jungen Brüste.
Die beiden hören gar nicht, wie die Stimmen und Fragen um sie her durcheinander schwirren. Der reiche Klaas hat den Vorschlag gemacht, das Teufelszeug einfach zu erschlagen und wieder in das Wasser zurückzuwerfen. Damit sind die Weiber alle einverstanden und die Männer wollen nach ihren Booten laufen und die Ruder holen.
Da richtet sich der Jens aus seinem Schweigen auf.
Das Weib wird nicht erschlagen, erklärt er mit seiner tiefen Stimme. Das wird er mitnehmen und ausheilen; und wenn sie gesund ist, wird er sie wieder ins Wasser lassen.
Aber Jens – schreit seine Mutter aus dem Haufen.
Und es sei dem Jens alles eins, was die andern sagen. Wenn man die Tiere nicht martern dürfe, wie der Herr Pastor sage, so müsse man wohl auch der da helfen, die doch zur Hälfte Mensch sei.
Die Weiber erheben darüber ein großes Gezeter. Und Jens’ Mutter fängt an zu weinen.
Der Pastor würde ihm schon recht geben, meint der Jens.
Da kommt der Pastor, schreien einige, und der Pastor tritt auch schon in den Kreis.
Er ist sehr erregt und seine Beine schlottern. Die Hände zittern und auf seiner Stirn steht der Angstschweiß. Sein Weib windet sich daheim in Schmerzen.
Was es gibt?
Der Jens, der Jens … schreien alle.
Der Jens erklärt dem Pastor, was er vorhat.
Der aber fährt sich mit dem Handrücken über die Stirn, als wolle er sich besinnen. Dann beginnt er zu sprechen, hastig und abgebrochen.
Was der Jens vorhabe, dürfe er in seiner Gemeinde nicht dulden. Alles Mitleid und alle Nächstenliebe gehe nur auf Gottes Geschöpfe. Die da aber sei ohne Zweifel ein Geschöpf des Teufels und da wäre es übel getan, sich solch Teufelswerk mit ins Dorf zu nehmen.
Erschlagen, erschlagen, ruft der Klaas und noch einige andere mit ihm.
Der Pastor aber meint, er sei auch nicht für das Erschlagen. Man solle das Meerweib ruhig liegen lassen; sei sie ein Blendwerk der Hölle, so werde sie wieder verschwinden und sei sie ein Fisch, so werde sie die Flut schon wieder ins Meer mitnehmen.
Jetzt aber sollten sie alle auseinandergehen und ihre Arbeit aufnehmen und das Meerweib in Ruhe lassen.
Dann drängt sich der Pastor wieder durch den Kreis davon und eilt mit langen Schritten nach Haus.
Langsam zerstreuen sich die Leute.
Nur der Jens bleibt zurück. Mit gesenktem Kopf sieht er auf das Weib nieder. Ihre blauen Augen sind ruhiger und stiller geworden. Dank und Vertrauen ist in ihnen. Sie weiß, dass er für sie gesprochen hat.
Da rüttelt eine derbe Faust Jens’ Schulter. Komm … Der Vater steht neben ihm. Aber Jens schüttelt bloß den Kopf. Er will dableiben. Aber der Vater rüttelt stärker. Die rote Wut steigt ihm zu Kopf. Er droht … Da greift Jens mit seinen eisernen Fingern nach der Faust auf seiner Schulter, dass die Gelenke knacken.
Die beiden Männer starren sich ins Gesicht. Aber … da sieht Jens auf der Düne oben die Mutter. Ihre Röcke und das Kopftuch flattern und jammernd ringt sie die Hände.
Da lässt Jens die Hand des Vaters fahren und geht aufwärts dem Dorf zu. Er fühlt die Blicke des armen Weibes, wie sie sich fragend und flehend an ihn heften … aber er geht weiter, immer weiter, dem Dorf zu …
***
Über die schmale Mondsichel huschen die Wolken. Das Meer geht hohl. Sein Brausen tönt bis ins Dorf. Dort ist längst alles finster. Nur im Haus des Pastors ist hinter den roten Fenstergardinen Licht. Ein matter roter Schimmer liegt in dem kleinen Vorgarten. An dem Staketenzaun schleicht eine Gestalt vorbei – Jens.
Einen Augenblick hält er und sieht nach dem erleuchteten Fenster hinüber. Er weiß, dass da ein Weib mit dem Tode ringt. Er beißt die Zähne zusammen und murmelt einen grimmigen Fluch.
Dann geht es beim Dorf hinaus und über die Düne hinunter. Auf dem weißen Sand liegt ein dunkler Fleck …
Das Meerweib hört Schritte. Sie hebt müde den Kopf. Und da kniet auch Jens schon neben ihr nieder und spricht zu ihr mit sanften, guten, mitleidigen Worten. Er weiß sie versteht ihn nicht. Aber der Klang muss ihr wohltun.
Ihre fieberheißen Hände haben sich in die braunen Fäuste des Burschen versteckt.
Dann beginnt sie zu singen, leise und trüb, Worte in einer fremden Sprache. Wie dicke, graue Nebel über einsamen Felseilanden – so dumpf und schwer sind die Töne – und so unendlich traurig.
Jens lauscht … und er weiß nicht, dass ihm die Tränen über das Gesicht rollen.
Dann besinnt er sich. Er hat Speise mitgebracht, Brot und Fische, und bietet sie ihr an.
Aber sie schüttelt nur den Kopf. Und dann singt sie wieder.
Jens kniet bei ihr und hält ihre Hände in den seinen, bis die Sterne erblassen und der Morgenwind beginnt.
Da erhebt er sich und sieht sie noch einmal an: Ich komme wieder.
Und sie versteht die fremden Worte und das Versprechen, und ihr Blick ist mild und ruhig, wie er die Düne hinan steigt …
***
Den ganzen Tag über ist im Dorf große Unruhe. Mit leisem scheuen Schritten gehen die Leute um das Haus des Pastors, wo die Fenster mit den roten Gardinen verhangen sind und es so totenstill ist. Einige wollen ersticktes, wie in Kissen hineingebissenes Schreien und Wimmern gehört haben. Um Mittag ist der Pastor im Garten hinter dem Haus gestanden und hat regungslos auf den fernen Streifen Meer hinabgesehen, mit der langen Pfeife in der Hand. Und dann hat er plötzlich wie ein Rasender mit dem Kopf der Pfeife in die Glaskugel auf einem Rosenbäumchen hineingeschlagen, dass die Splitter nach allen Seiten gespritzt sind, und ist ins Haus zurückgelaufen. Es liegt etwas Unheimliches in der Luft.
Im Hause des Jens war am frühen Morgen Lärm. Der Vater hat vom Nachtwächter erfahren, dass der Jens unten am Strande war. Und es ist zum Streit gekommen und der Jens hat die Hand gegen den Vater erhoben und hat ihn gegen den Ofen geschleudert, dass der Kopf des Alten ein tüchtiges Loch erhalten hat. Aber schließlich hat der Alte den Jens doch überwältigt und ihn über die Stiegen hinaufgetragen wie ein Kind und ihn in seine Kammer gesperrt. Im Dorf ist ein wildes Murren gegen das arme, verlassene Meerweib unten am Strand. Einige junge Burschen waren unten und berichten, dass sie auf dem Sand liege, regungslos, mit geschlossenen Augen. Nur am leichten Atmen hätten sie gemerkt, dass sie noch lebe. Sie hätten sie necken und mit Sand werfen wollen, aber die Luft dazu wäre ihnen vergangen, wie sie in das bleiche sterbende Gesicht gesehen.
Aber die Alten machen das Weib doch verantwortlich für all das Friedensstörende heute im Dorf. Der reiche Klaas meint, es wäre besser gewesen, wenn man das Teufelszeug gleich gestern erschlagen hätte.
Und dann, am späten Abend erfahren die Leute, dass die Frau Pastorin ein totes Kind zur Welt gebracht habe. Das Kind habe einen unförmigen Wasserkopf und an den verkrüppelten Füßen einen rötlichen und grünen, metallischen Schimmer wie Fischschuppen. Und die Frau Pastorin müsse sterben, rettungslos.
Da fasst die Leute eine große Wut, sie wollen gleich hinunter zum Strand und das Meerweib erschlagen, denn die ist doch daran schuld. Aber die Nacht dunkelt herein und die Beherztesten weht es vom Meere her so eisig an, dass sie umkehren. Morgen … bei Tageslicht … in der Frühe.
Wie es ganz finster geworden ist und im ganzen Dorf kein Licht mehr brennt – nur das traurige Flackern hinter den roten Gardinen im Pastorshaus ist noch wach – steigt der Jens aus dem Kammerfenster.
Wie eine Katze. Lautlos und vorsichtig. – Nur die breiten Schultern machen im engen Fensterrahmen Mühe. Aber es gelingt Jens drückt sich durch – und dann ein Sprung auf den weichen Rasen vor dem Haus. Von der Wucht des Falles knickt Jens zusammen, aber er rafft sich wieder auf. Wie er an dem rot verhangenen Fenster des Pastorshauses vorüber rennt, ballt er die Fäuste und knirscht einen wilden Fluch zwischen den Zähnen.
Und das Meerweib weiß, dass er kommen wird. Sie richtet sich auf den Armen auf und streckt ihm den Kopf entgegen. Und Jens küsst die blassen Lippen und die tief in die dunklen Höhlen zurückgesunkenen Augen.
Dann singt sie noch einmal. Wie Nebel über einsamem Felsenriss schwimmen die Töne – purpurn grollt dazu das Meer. Dann reißen die Nebelschleier und klar und golden wird ihr Lied. Sonnenschein liegt über der Flut und immer ruhiger und stiller wogt und wallt es … und schläft dann leise ein.
Das Weib hat Jens’ Hand erfasst und auf ihre Brust gelegt. Und die Hand wühlt sich durch den schweren Haarmantel durch und zärtlich und leicht legt sich die schwere, arbeitsharte auf die zitternden Brüste des Weibes.
Und Jens fühlt das Leben dieses Herzens, wie es mit dem verklingenden Lied immer leiser und leiser wird – und dann – ein letzter, wilder Herzschlag, ein krampfhaftes Greifen nach seinem Arm, und das Weib reckt sich zurück …
Jens sitzt und starrt in den beginnenden Morgen.
Sein Auge ist trocken. Nicht eine Träne hat er für seinen tiefen Schmerz. Und doch ist dieser Schmerz so leicht und frei. Nur etwas quält ihn. Er weiß erst nicht, was? Aber jetzt entsinnt er sich. Er hat es wohl gehört, was unten im Zimmer besprochen wurde. Sie wollen kommen und sie erschlagen.
Aber sie sollen sie nicht finden …
Mit gewaltiger Anstrengung erhebt er sich. Den Leichnam nimmt er auf seine Arme. Sein Blick brennt fest auf ihrem kleinen, starren Gesicht, von seinem rechten Arm herab baumelt bei jedem Schritt die zerschnittene Flosse.
So schreitet er ins Meer hinaus. Mit sicherem Sprung setzt er von Stein zu Stein und vom letzten großen Felsblock schleudert er mit mächtigem Schwung den Leichnam hinaus.
Ein Aufspritzen und Gurgeln – und die Ebbe führt den Körper fort …
Wie Jens wieder auf dem Strand ankommt, hört er schon von oben, von der Düne, die Stimmen der Männer aus dem Dorf.
Er weiß sofort: einige sind angetrunken. Das heisere, blecherne Gelächter kennt er schon.
Sie sollen ihn nicht sehen.
Er legt sich platt in eine Dünenfalte und lässt den Zug vorüber.
Im Morgengrauen sieht er fast alle Männer und Burschen des Dorfes mit Stöcken, Knütteln und Rudern. Einige sind betrunken. Dem Zug voran schreitet Jens’ Vater mit dem weißen Tuch um den zerschlagenen Kopf. Die Faust krampft er um ein großes Beil. Auch er ist betrunken. Die Augen blutunterlaufen, das Gesicht gerötet.
Endlich sind sie vorbei. Jens jagt die Düne hinauf. Auf dem halben Weg zum Dorf hört er hinter sich wütendes, enttäuschtes Geschrei.
Jens rennt weiter. Er will das Dorf und seine Kammer erreichen, ehe die Männer zurückkommen. Sie sollen nicht wissen, was in dieser Nacht vorgegangen ist.
Wie Jens am Haus des Pastors vorüberkommt, sieht er alle Fenster weit offen.
Er weiß jetzt, das Weib da drin hat ausgelitten. Und er drückt sich gegenüber den Häusern entlang vorbei und knirscht durch die zusammengebissenen Zähne einen wilden Fluch.
II. – Am Kreuzweg
Am Kreuzweg sitzen drei graue Riesenweiber. Die eine hat ihren linken Fuß gegen das Försterhaus gestemmt und kratzt sich mit den dürren Knochenfingern den Schmutz zwischen den Zehen hervor. »Hu –hu« macht der Tannenwald und schüttelt sich. Im Zimmer drin zucken der Förster und sein Weib unter dem lähmenden Entsetzen eines Alps. Das Kind in der Wiege wimmert leise.
Die zweite hat sich ganz klein gemacht und schnitzt mit einem großen scharfen Messer an dem hölzernen Christusbild an der Weggabel. Zuerst schneidet sie lange Späne von dem Stamm und den Querbalken des Galgenholzes. Sie singt murmelnd: »Horum pitschorum … Rex Judaeorum« … Dann schält sie Schicht um Schicht des weichen Holzes von des Heilands Nase, bis sie ganz verschwunden ist und nun der weiße Fleck in dem wetterschmutzigen Gesicht hervorleuchtet. Jetzt nimmt sie das Messer und setzt es mit der Spitze auf den Nabel des hölzernen Leibes. Wie einen Quirl dreht sie es in den gelben Händen, rascher, immer rascher, bis ein großes, tiefes Loch in den Körper gebohrt ist. Dann bläst sie die Holzreste und den Staub aus dem Loch … durch das Dunkel glühen ihre Augen wie die eines Wolfes.
Die dritte sitzt aufrecht. Mit dem Haupt ragt sie hoch über die schwarzen Tannenwipfel da unten. In ihren Händen zappelt etwas. Ein dicker, feister Bauer. Knacks – hat sie ihm den rechten Fuß abgebissen. Behaglich schnalzt und kaut sie … »Ob … i …« wimmert der Bauer … »Aus … auslassen« … Mit freundlichem Grinsen blickt sie auf den fetten Bissen in ihrer Hand … »Ich habe … mein Weib … meine Kinder warten auf mich daheim.« … »So«, macht die Riesin … »mein Weib … ich kann nicht sterben« … »Soo«, grinst die Riesin wieder, »da hast du dein Weib«, und sie setzt ihn in seinen Hof vor das Stubenfenster. Drin ist es hell. Er will sich aufstellen – aber er bricht zusammen. Die Riesin greift in den Mund: »Da hast du deinen Fuß.« Jetzt stellt sich der Bauer auf die Zehen. Drinnen am Tisch die Lampe … der Tisch gedeckt … zwei Krüge Bier, zwei halb volle Gläser, zwei Teller mit Knochen, in der Mitte eine Schüssel mit einer angeschnittenen Ganshälfte, eine andere mit Selchfleisch.
Auf dem Stuhl bei der Tür ein Radmantel und ein breitkrempiger Hut mit zwei Quasten hinten. Auf dem Stuhl beim Tisch ein Wams, eine Lederhose. Der blaue Vorhang vor dem breiten Ehebett ist zugezogen, vor dem Bett ein Paar hohe Schaftstiefel, ein Paar Pantoffeln … Der Bauer wendet sich vom Fenster, er ist leichenblass. »Meine Kinder«, stammelt er. Die Riesin führt ihn zum Schweinestall. Der Bauer zittert. Mit einem Ruck hebt die Riesin das hölzerne Dach ab. Der Bauer kann jetzt hineinsehen. Ein furchtbarer Gestank. In der Ecke sitzt der Knabe, zusammengekauert, regungslos … erdfahl im Gesicht, mit gebrochenen Augen. In der anderen Ecke steht die Muttersau über dem kleinen Mädel und bohrt mit dem Rüssel in das weiße Fleisch und reißt große setzen aus dem zarten Körper. Es zuckt noch in diesem kleinen Körper und das warme Blut hat die Ferkel trunken gemacht, dass sie sich quietschend stoßen und drin wälzen.
Die zwei drin im Bett hören einen Schrei, einen markerschütternden Schrei. –
Hoch über den schwarzen Tannenwipfeln steckt die Riesin mit behaglichem Grinsen den fetten Bissen in den stinkenden Rachen. Knacks – die harten Knochen krachen – aus den Mundwinkeln läuft Fett und Blut herunter.
An der Weggabelung hat die zweite ein Feuer aus Kuhmist und dürren Tannenästen angezündet. Gerade unter den Füßen des Christusbildes. Die nackten Füße schmoren in den heißen Flammen aus Kuhmist und dürren Tannenästen. Der ganze Körper zuckt und windet sich im Schmerz. In die Höhle des Leibes hat sie die herausgerissenen Blätter aus einem alten Gebetbuch gestopft, und wenn die Flammen heraufzüngeln und das alte, gelbe Papier zu knistern und zu glimmen beginnt, dann springt sie dreimal über das Feuer und freut sich. Mit ernster Gebärde nimmt sie den Rosenkranz vom Hals und wirft Kugel auf Kugel in das Feuer. Dann summt sie: »Ho-rum pi-tscho-rum – Rex Ju-dae-orum.« – Von der abgeschnittenen Nase träufeln langsam große, schwere, schwarze Bluttropfen über das bleiche Gesicht, den verzerrten Körper bis in das Feuer, wo sie zischend sterben.
Am Försterhaus hat die Riesin mit der großen Zehe den Rauchfang eingedrückt. Polternd krachen die Ziegel auf die Herdplatte nieder. Mit einem Schrei fährt die Försterin aus dem bösen Schlaf auf. Alles ist still. Die Uhr ist stehen geblieben. »Hu – hu« macht der Tannenwald draußen und schüttelt sich. »Vater« – sie rüttelt den Mann. »Vater … was is denn« … sie rüttelt stärker, noch stärker, verzweifelt, »ja, was ist denn« … sie greift seine Hand … »ist ja ganz kalt … Jesus Maria-Josef … macht’s a Licht.«
Ein plötzlicher Windstoß hat die Wolken zerrissen. Das Mondlicht fällt in blendender Reinheit in den schwarzen Tannenwald und auf den Kreuzweg. Um die Tannenwipfel schweben Nebelfetzen, die sich langsam heben und im glitzernden Mondlicht verschwimmen. Im fernen Dorf bellt kläglich ein Hund.
Im Försterhaus wird gerade Licht angezündet … Orum – orum – machen die Unken im Sumpf …
III. – Der Hexenrichter
Tapp … tapp … tapp … tapp … tapp … kommt es über die hölzerne Stiege hinauf … Das ist der Herr Doktor … unsicher, verdammt unsicher klingt heute das sonst so fest gefügte: »tapp … tapp.« Auf einmal klirr … rrr … rr … ein ganzer Schlüsselbund kollert über die Stiegen hinunter … wieder … tapp … aber jetzt abwärts. Dann lange Stille … endlich wieder ganz leise und schüchtern, wie verschämt und verlegen ob des nächtlichen Spektakels vom Fuße der Treppe tapp … tapp … Dazu ein leises, fauchendes Scharren, wie wenn jemand sich mit der suchenden Hand an einer rauen Wand entlang tastet … Schritt für Schritt behutsam … lang … krasch-dumm … ein Zusammenstoß von Stahl und Stein … Das ist der eiserne Wandhaken zur Befestigung der Treppen beleuchtenden Kienspäne und der Steinkopf des hochgelehrten Herrn Doktors, des Mitgliedes unseres Schöppengerichtes, des weit und breit im Land hochgebenedeiten und gepriesenen Hexenrichters … tapp … tapp … endlich vor der Tür zum Schlafgemach ein Seufzer der Erleichterung …
Der Schlüssel knirscht im Schloss, und der rostige Riegel schiebt sich zurück.
Finster … pechfinster … in dem Junggesellengemach. Der Herr Doktor tappt nach dem Feuerzeug … na, das dauert … endlich glimmt der Zunder … Der Schwefelfaden brennt und da … erstrahlt ein Umkreis von drei Schritten im rötlich-gelb-grauen Licht der Unschlittkerze. Der Herr Doktor hat ein rotes Gesicht – sein Samtbarett sitzt ihm tief im Nacken, der Pelzkragen seiner Schaube ist links unternehmend aufgestellt, während er sich rechts an seinen gewohnten Platz um die Schultern des Trägers schmiegt … Mit breitgestellten Beinen bückt sich der Doktor, um den glimmenden Schwefelfaden vom Fußboden aufzulesen. Der Schwefelfaden hat in den schneeweißen, sandüberstreuten Boden bereits ein schwarzes, hässliches Loch gebrannt. Der Doktor brummt etwas Unverständliches … Wie er sich stöhnend aufrichtet – – da sitzt auf seinem Tisch in der Mitte des Zimmers der Satan. Er hat seinen Schweif nachlässig unter dem linken Arm durchgezogen und schaut den Doktor mit großen, runden, feurig glühenden und gutmütigen Augen an. Aha – denkt der Doktor … der verdammte Strohwein! Wie Seine Majestät sich bemerkt sieht, springt sie vom Tisch herunter … tapp macht der Menschenfuß – klapp der Pferdehuf. Mit einem Ruck hat er den Schweif zwischen den Beinen nach vorn gezogen und hält ihn kerzengerade und steif vor sich hin, wie die Garde beim fürstlichen Schloss ihre Musketen, wenn Hoheit vorbeifährt.
Der Herr Doktor ist ganz geschmeichelt. Er greift grüßend an sein Barett und winkt dankend ab. Seine Majestät geht aus der Paradestellung heraus und zieht sich wieder rückwärts auf den Tisch herauf. Aber sogleich hopst er wieder herunter … tapp – klapp … er hat den missbilligenden Blick des Hausherrn bemerkt. Er geht zu dem blumenbemalten Koffer im Winkel hinter dem Spind und nimmt von dort eine wollene Decke. Er muss den Hausbrauch kennen. Die wollene Decke wird auf den Tisch gebreitet und dann lässt sich der Gast behaglich darauf nieder.
Aus der dunklen Ecke, wo das breite, weiße Bett steht, ein unterdrücktes Lachen. Auf dem jungfräulichen Kopfpolster des Doktors eine wirre Flut von blonden Locken, unter der schweren Decke lugt ein rosiges Gesicht hervor. Wenn zwei von den gewichtigen, leuchtenden Strähnen sich berühren, dann springen tausende vom kleinen Funken über und ein leises Knistern geht durch die Stille … Unter dem Lockengewirr schauen zwei tiefe Augen hervor, so lockend und geheimnisvoll, sehnsüchtsbang und verheißend; Engelaugen – Vampiraugen … Dem Doktor wird ganz eigentümlich … es ist ihm, als ob die zwei Augen in ihm saßen, zwei glimmende Feuerkugeln, die schmerzen und wohltun, die wärmen und im nächsten Augenblick alles Brennbare ringsum in Flammen setzen können.
Er greift sich an die Schläfen. Da drin pocht ein ganzes Hammerwerk.
Zaghaft nähert er sich dem Fußende des Bettes und versucht mit spitzen Fingern den Zipfel der Decke zu lüften. Er hat eine unbezwingliche Lust bekommen, die Füße dieses Wesens zu sehen.
Er hat die bestimmte Vorstellung, dass diese süße klein und warm und weiß sein müssen und will sie zwischen seine großen, roten und immer feuchtkalten Froschhände nehmen. Da springt Seine gehörnte Majestät mit einem gewaltigen Satz über den Tisch hinüber und gibt ihm einen tüchtigen Klaps über die Hände. »Au!«, macht der Doktor und reibt sich wimmernd die verbrannten Stellen.
»Stehn lassen«, sagt der Schwarze, »das muss ich machen.« Und er zieht mit einer jähen Bewegung die Decke bis zu den Füßen herab. Da liegt der weiße Frauenleib in seiner nackten Schönheit. Dem Doktor ist es, als ob er mit dem Kopf voraus in heißes Wasser geworfen würde. Er sieht zuerst gar nichts. Dann setzt er sich an den Bettrand, macht seine Hand so leicht als möglich und fährt liebkos end längs der sanft geschwungenen Hüftenlinie herab. »Nicht kitzeln«, sagt sie leise und windet sich verschämt, doch die großen Augen blicken ihn herausfordernd an.
Da wirft sich der Doktor auf sie und bedeckt ihren Mund mit glühenden Küssen … und sie schlingt die weißen Arme um ihn … im letzten Augenblick der Besinnung ist ihm, als ob das nicht weiche, warme Frauenarme, sondern harte, sehnige, haarige, lange Affenarme wären … dann versinkt er in ihr …
Er erwacht von einem kräftigen Griff an der Schulter … zuerst weiß er nicht«, wo er ist. Doch das Rütteln dauert fort. Seine schwarze Majestät hat ihn fest gepackt und lässt nicht nach, bis er ganz zu sich kommt. Das Licht ist ausgebrannt, ein unausstehlicher Gestank ist im Zimmer … nach Fett und verglostem Docht. Der Mond ist hervorgekommen und scheint taghell ins Zimmer – in dem zerwühlten Bett liegt das Weib. Das Gesicht ist blau, wie das einer Erwürgtem – die verquollene Zunge hängt ihr weit aus dem Hals – der Körper ist krampfhaft verrenkt.
Der Doktor ist ganz verwirrt.
»Ich will dir etwas zeigen«, sagt Seine Majestät und tupft mit dem schwarz behaarten Zeigefinger auf eine Stelle zwischen den Brüsten des Weibes. Dem Doktor erregt das ein Unwohlsein. »Pfui Teufel«, sagt er. »Wie, bitte«, sagt Seine Majestät. Der Doktor schweigt. Der Schwarze tupst noch einmal. Mit einem Knall fliegt der Nabel aus dem Bauche des Weibes heraus, wie der Pfropfen aus einer Knallbüchse. An dem Nabel hängt eine lange, weiße Schnur, von regelmäßigen Kerben gegliedert, wie ein Bandwurm. Der Nabel fällt zu Boden und zieht den weißen Bandwurm nach. Der windet sich wie in eigenem Leben am Boden. Und mehr, immer mehr von der weißen Schnur dringt hervor, immer schneller … in Spiralen, Achtern und Schlangenwindungen … unerschöpflich ist der Schoß des Weibes … schon ist der ganze Boden voll. Der Doktor steigt auf einen Stuhl. Es schüttelt ihn.
Und die dünne, weiße Schnur wird dicker, schon hat sie die Stärke eines Regenwurmes. Die Kerbe werden tiefer und schneiden die einzelnen Glieder stark voneinander ab … und noch immer quillt es aus dem Nabelloch hervor … jetzt hat die Schnur schon Daumendicke. Die Glieder schwellen an und werden fast kugelig – und nun trennen sich alle die abgeschnürten Glieder voneinander und rollen selbstlebend im Zimmer umher – einige hüpfen in die Höhe, andere rasen mit entsetzlicher Geschwindigkeit zwischen ihren Geschwistern umher.
Da bekommen alle diese runden, weißen Kugeln ein neues Aussehen. Zwei süße mit Vogelklauen, einen langen, breiten, schwer nachschleppenden Hinterteil und ein Haupt – ein bärtiges, ernstes Haupt mit einem Samtbarett – lauter kleine Doktorhäupter. Schon sind sie faustgroß und werden größer.
»Schau deine Kinder«, sagt der Satan.
Dem Doktor schießt eine rote Flamme in den Kopf. Er springt von seinem Stuhl und trampelt wütend auf der quabbeligen Masse herum … »Ho–ho!« schreit er, »ho–ho!« und macht wilde Sätze. Ein Gequietsch und Gequieke wie von Millionen zerstampfter junger Vögel.
»Was fällt dir ein?«, ruft der Satan grimmig und packt den Doktor bei einem Bein und wirbelt ihn sich um den Kopf, bis ihm der Atem ausgeht. Dann stellt er ihn wieder hin. Kaum ist der aber wieder zur Besinnung gekommen, so springt er wieder in die Masse und stampft und trampelt. »Ho – ho!«, schreit er, »ho – ho!«
Da wird der Satan still und ernst und knüpft von dem Busch seiner Schwanzspitze eine rote, seidene Schnur und reicht sie dem Doktor.
Des Doktors Augen werden starr und er steht still und regungslos. Dann macht er aus der Schnur eine Schlinge und legt sie sich um den Hals und zieht und zieht – bis er zusammenbricht. Das Weib im Bett hat sich aufgerichtet und sieht ihm mit glühenden Augen zu.
Aus der Ferne ertönt das Horn des Nachtwächters. Unter dem Fenster klingt der taktmäßige Schritt der Scharwache.
Der Brunnen am Marktplatz rauscht im Mondschein, die Sandsteinfigur des Flussgottes mit der Wasser spendenden Vase richtet sich auf und schaut nach den Fenstern des Doktors hinüber.
Die Justifizierungskommission, die dem Doktor am nächsten Morgen das Protokoll über die stattgefundene Justifizierung der gestern verbrannten Hexe zur Unterschrift bringen will, kann nicht ins Zimmer. Es geht allerlei Gemunkel und Geraune durch die Leute. Auch im Hause hat man unheimliche Dinge gehört. Wie dann die Tür gesprengt wird – daliegt der Doktor tot am Boden, mit einer rotseidenen Schnur um den Hals – auf den Händen sind zwei große Brandwunden. In dem zerwühlten Bett schwimmt eine trübe stinkende Jauche.
»Hm, hm«, macht der Ratsälteste. »Hm – hm«, machen die übrigen wohlweisen Herren im Chor.
Der Kopf
Es war ganz finster im Zimmer … alle Vorhänge zu … kein Lichtschimmer von der Straße und ganz still. Mein Freund, ich und der Fremde hielten uns an der Hand, krampfhaft und bebend. Es war eine fürchterliche Angst über uns … in uns …
Und da … kam eine weiße, hagere, leuchtende Hand durch die Finsternis auf uns zu und begann an dem Tisch, an dem wir saßen, mit dem bereitliegenden Bleistift zu schreiben. Wir sahen nicht, was die Hand schrieb, doch wir fühlten es in uns … gleichzeitig … wie wenn es mit feurigen Buchstaben vor unseren Augen gestanden hätte …
Es war die Geschichte dieser Hand und des Menschen, dem sie einst gehört hatte, was da in der tiefen Finsternis der Mitternacht von der weißen, leuchtenden Hand auf das Papier gekritzelt wurde:
… – Wie ich die mit rotem Tuch ausgeschlagenen Stufen hinan schreite … da … wird es mir doch etwas eigentümlich ums Herz. In meiner Brust schwingt etwas hin und her … ein großes Pendel. Die Ränder der Pendelscheibe sind aber haarscharf wie Rasiermesser und wenn das Pendel im Schwingen meine Brustränder berührt, fühle ich dort einen schneidenden Schmerz … und eine Atemnot, dass ich laut röcheln möchte. Aber ich heiße die Zähne zusammen, dass kein Laut hervor kann und balle meine auf dem Rücken gefesselten Fäuste, dass unter den Nägeln das Blut hervorspritzt.
Jetzt bin ich oben. – Alles ist in schönster Ordnung; nur auf mich wird noch gewartet. – Ich lasse mich ruhig im Nacken rasieren und bitte dann um die Erlaubnis, zum Volke zum letzten Mal sprechen zu dürfen. Sie wird mir gewährt … Wie ich mich umwende und die endlose Menge übersehe, die da dicht gedrängt, Kopf an Kopf, um die Guillotine herumsteht, alle diese blöden, stumpfsinnigen, vertierten, teils philisterhaftneugierigen, teils lüsternen Gesichter, diese Masse von Menschen, dieser vierzehntausendfache Hohn auf den Namen Mensch – da kommt mir die ganze Sache so lächerlich vor, dass ich laut auflachen muss.
Doch da sehe ich die Amtsmienen meiner Henker sich in strenge Falten legen … verdammte Frechheit von mir, die Sache so wenig tragisch zu nehmen … ich will die guten Leute nicht noch mehr reizen und beginne schnell meine Ansprache:
»Bürger«, sage ich, »Bürger, ich sterbe für euch und für die Freiheit. Ihr habt mich verkannt, ihr habt mich verurteilt … aber ich liebe euch. Und als Beweis meiner Liebe hört mein Testament. Alles, was ich besitze, sei euer. Hier …«
Und ich wende mich mit dem Rücken gegen sie und mache eine Gebärde, die sie nicht missdeuten können …
… Ringsum ein Brüllen der Entrüstung … ich lege schleunigst und mit einem Seufzer der Erleichterung meinen Kopf in die Höhlung … ein sausendes Zischen … ich fühle nur ein eisiges Brennen im Hals … mein Kopf fällt in den Korb.
Dann ist mir, wie wenn ich den Kopf unter Wasser gesteckt und die Ohren voll davon hätte. Dunkel und verworren dringen die Geräusche der Außenwelt zu mir, ein Summen und Brummen ist in den Schläfen. Auf dem ganzen Querschnitt meines Halses habe ich das Gefühl, wie wenn dort Äther in großen Mengen verdunstete.
Ich weiß, mein Kopf liegt im Weidenkorb – mein Körper oben auf dem Gerüst, und doch habe ich das Gefühl der vollständigen Trennung noch nicht; ich fühle, dass mein Körper leise strampelnd auf die linke Seite gesunken ist, dass meine auf dem Rücken gefesselten, geballten Fäuste noch leicht zucken und die Finger sich krampfhaft ausstrecken und zusammenziehen. Ich fühle auch, wie das Blut aus dem Halsstumpf strömt und wie mit dem entströmenden Blut die Bewegungen immer schwächer werden und auch mein Gefühl für den Körper immer schwächer und dunkler, bis es mir unterhalb des Halsabschnittes immer finsterer wird.
Ich habe meinen Körper verloren.
In der vollständigen Finsternis vom Halsabschnitt abwärts spüre ich auf einmal rote Flecke. Die roten Flecke sind wie Feuer in schwarzen Gewitternächten. Sie fließen auseinander und breiten sich aus Öltropfen auf einer stillen Wasserfläche … wenn sich die Ränder der roten Flecke berühren, dann spüre ich in den Augenlidern leichte elektrische Schläge, und meine Haare auf dem Kopfe sträuben sich. Und jetzt beginnen sich die roten Flecke um sich selbst zu drehen, rascher, immer rascher … eine Unzahl brennender Feuerräder, glutflüssige Sonnenscheiben … es ist ein Rasen und Wirbeln, dass lange Feuerzungen hinten nachlecken und ich die Augen schließen muss … ich fühle die roten Feuerräder aber noch immer in mir … zwischen den Zähnen steckt es mir wie trockener glaskörniger Sand in allen Fugen. Endlich verblassen die Flammenscheiben, ihr tolles Drehen wird langsamer, eine nach der andern erlischt, und dann wird es für mich von meinem Halsabschnitt abwärts zum zweiten Mal finster. Diesmal für immer. –
Über mich ist eine süße Mattigkeit gekommen, ein verantwortungsloses Sichgehenlassen, meine Augen sind schwer geworden. Ich öffne sie nicht mehr, und doch sehe ich alles um mich her. Es ist, als ob meine Augenlider aus Glas und durchsichtig geworden wären. Ich sehe alles wie durch einen milchweißen Schleier, über den sich zarte, blassrote Adern verästeln, aber ich sehe klarer und größer als damals, als ich noch meinen Körper hatte. Meine Zunge ist lahm geworden und liegt schwer und träge wie Lehm in meiner Mundhöhle.
Mein Geruchssinn aber hat sich tausendfach verfeinert, ich sehe die Dinge nicht nur, ich rieche sie, jedes anders, mit seinem eigenen, ihm eigentümlichen Geruch.
In dem weidengeflochtenen Korb unter dem Fallbeil der Guillotine liegen außer dem meinen noch drei andere Köpfe, zwei männliche und ein weiblicher. Auf den rot gefärbten Wangen des Frauenkopfes kleben zwei Schönheitspflästerchen, in dem gepudertem hoch auffrisierten Haar steckt ein goldener Pfeil, in den kleinen Ohren zwei zierliche, diamantgeschmückte Ohrringe. Die Köpfe der beiden Männer liegen mit dem Gesicht nach abwärts in einer Lache von halb getrocknetem Blut, quer über den Schädel des einen zieht sich eine alte, schlecht verheilte Hiebwunde, das Haar des anderen ist schon grau und spärlich.
Der Frauenkopf hat die Augen verkniffen und rührt sich nicht. Ich weiß, dass sie mich durch die geschlossenen Augenlider betrachtet …
So liegen wir stundenlang. Ich beobachte, wie die Sonnenstrahlen an dem Gerüst der Guillotine aufwärts rücken. Es wird Abend, und mich beginnt zu frieren. Meine Nase ist ganz steif und kalt und die Verdunstungskälte auf meinem Halsquerschnitt wird unangenehm.
Auf einmal ein wüstes Gejohle. Es kommt näher, ganz nahe, und plötzlich fühle ich, wie eine kräftige Faust meinen Kopf mit rohem Griff beiden Haaren fasst und aus dem Korbe zieht. Dann spüre ich, wie ein fremder, spitziger Gegenstand in meinen Hals eindringt – eine Lanzenspitze. Ein Haufe trunkener Sansculotten und Megären hat sich über unsere Köpfe gemacht. In den Händen eines kräftigen, baumlangen Menschen mit einem roten, aufgedunsenen Gesicht schwankt die Lanze mit meinem Haupt auf der Spitze hoch über der ganzen wilderregten, brüllenden und schreienden Menge.
Ein ganzer Knäuel von Männern und Weibern ist über die Verteilung der Beute aus den Haaren und Ohren des Frauenkopfes in Streit geraten. Sie wälzen sich wild durchund übereinander – ein Kampf mit Händen und Füßen, mit Zähnen und Nägeln.
Jetzt ist der Kampf zu Ende. Reifend und schreiend fahren sie auseinander, jeder, der ein Stück davonträgt, von einem Haufen neidischer Genossen umdrängt …
Der Kopf liegt am Boden, entstellt, beschmutzt, mit den Spuren der Fäuste überall, die Ohren zerrissen von dem gewaltsamen Ruck, mit dem sie die Ringe an sich genommen haben, die sorgfältige Frisur zerzaust, die gepuderten Strähne des dunkelblonden Haares im Straßenstaub. Der eine Nasenflügel von einem scharfen Instrument zerschlitzt, auf der Stirn die Zeichen eines Stiefelabsatzes. Die Augenlider sind halb geöffnet, die gebrochenen, glasigen Augen stieren geradeaus.
Endlich bewegt sich die Volksmenge vorwärts. Vier Köpfe stecken an langen Spießen. Gegen den Kopf des Mannes mit den grauen Haaren richtet sich vornehmlich die Wut des Volkes. Der Mann muss besonders missliebig gewesen sein. Ich kenne ihn nicht. Sie speien ihn an und werfen ihn mit Kotklumpern. Jetzt trifft ihn eine Handvoll Straßenkot derb am Ohr … was ist das? Hat er nicht gezuckt? Leise, unmerklich, nur mir wahrnehmbar, nur mit einem Muskelband?
Die Nacht bricht herein. Man hat uns Köpfe nebeneinander auf die eisernen Gitterstäbe eines Palastgitters aufgesteckt. Ich kenne auch den Palast nicht. Paris ist groß. Auf dem Hof lagern bewaffnete Bürger um ein mächtiges Feuer herum … Straßenlieder, Witze, brüllendes Gelächter. Der Geruch von gebratenem Hammelfleisch dringt zu mir herüber. Das Feuer verbreitet einen Duft nach kostbarem Rosenholz. Die wilden Horden haben die ganze Einrichtung des Schlosses in den Hof geschleppt und verbrennen nun Stück für Stück. Jetzt kommt ein zierliches, elegant verschnörkeltes Sofa an die Reihe … aber sie zögern, sie werfen das Sofa nicht ins Feuer. Ein junges Weib mit kräftigen Zügen, in einem vorn offenen Hemd, das die vollen, festen Formen der Brust zeigt, spricht unter lebhaften Handbewegungen auf die Männer ein.
Will sie sie bereden, ihr das kostbare Stück zu überlassen, hat sie plötzlich Lust bekommen, sich als Herzogin zu fühlen?
Die Männer zögern noch immer.
Das Weib deutet auf das Gitter, auf dessen Spitzen unsere Köpfe stecken, und dann wieder auf das Sofa.
Die Männer zögern – endlich stößt sie sie beiseite, reißt einem der Bewaffneten den Säbel aus der Scheide, kniet nieder und beginnt mit kräftigen Armen mithilfe der Klinge aus dem Rahmenholz des Sofas die kleinen, emailköpfigen Nägel, mit denen der schwere Seidenstoß an das Holz gespannt ist, herauszuziehen. Die Männer helfen ihr jetzt.
Nun zeigt sie wieder auf unsere Köpfe.
Einer der Männer nähert sich mit zögernden Schritten dem Gitter. Er sucht. Jetzt klettert er an den eisernen Stäben empor und holt den misshandelten, geschändeten Frauenkopf herab.
Ein Grauen schüttelt den Mann, aber er handelt wie unter einem Zwange. Es ist, als ob das junge Weib dort beim Feuer, das Weib im roten Rock und vorn offenen Hemd mit ihren wildlüsternen Raubtierblicken alle die Männer um sich herum beherrschte. Mit steifem Arm trägt er den Kopf bei den Haaren zum Feuer hin.
Mit einem wilden Aufschrei der Lust packt das Weib den toten Kopf. Wirbelnd schwingt sie ihn an den langen Haaren zweimal, dreimal über das hoch aufflammende Feuer.
Dann kauert sie nieder und nimmt den Kopf auf den Schoß. Wie liebkosend streicht sie einige Male über die Wangen … im Kreise um sie haben sich die Männer niedergelassen … und nun hat sie mit einer Hand einen der kleinen, emailköpfigen Nägel, mit der anderen einen Hammer ergriffen, und mit einem kurzen Hammerschlag hat sie den Nagel bis an den Kopf in den Schädel eingetrieben.
Wieder ein kurzer Hammerschlag, und wieder verschwindet einer der Nägel in dem dichten Frauenhaar.
Dazu summt sie ein Lied. Eines jener furchtbaren, wollüstigen, seltsamen, altertümlich-zauberhaften Volkslieder.
Die blutigen Scheusale um sie her sitzen still und schreckensbleich und starren mit furchtsamen Augen aus dunkeln Höhlen auf sie hin. Und sie hämmert und hämmert und treibt Nagel aus Nagel in den Kopf und summt dazu im Hammerschlagtakt ihr altes, seltsames Zauberlied.
Plötzlich stößt einer der Männer einen gellenden Schrei aus und springt auf. Die Augen sind weit vorgequollen, vor dem Mund steht der Geifer … er wirft die Arme nach rückwärts, dreht den Oberkörper wie im schmerzlichen Krampf nach rechts und links, und aus seinem Mund dringen gellende, tierische Schreie.
Das junge Weib hämmert und singt ihr Lied.
Da springt ein zweiter vom Boden auf, heulend und mit den Armen um sich schlenkernd. Er reißt einen Brand aus dem Lagerfeuer und stößt sich damit vor die Brust – wieder und immer wieder, bis seine Kleider zu glimmen beginnen und ein dicker, stinkender Qualm sich um ihn verbreitet.
Die anderen sitzen starr und bleich und hindern ihn nicht an seinem Beginnen.
Da springt ein dritter auf – und jetzt fasst der gleiche Taumel auch die andern. Ein betäubender Lärm, ein Kreischen, Johlen, Schreien, Brüllen, Heulen, ein Durcheinander von Bewegungen, von Gliedmaßen. Wer fällt, bleibt liegen … aus seinem Körper stampfen die anderen weiter …
In dieser Orgie des Wahnsinns sitzt das junge Weib und hämmert und singt …
Nun ist sie fertig, und nun hat sie den über und über mit den kleinen, emailköpfigen Nägeln beschlagenen Kopf auf eine Bajonettspitze gesteckt und hält ihn hoch über die heulende, springende Masse empor. Da reißt jemand das Feuer auseinander, die Scheiter werden aus der Glut gezerrt und verlöschen Funken sprühend in dunkeln Winkeln des Hofes … es wird finster … nur einzelne brünstige Schreie und wildes Toben, wie von einem furchtbaren Handgemenge – ich weiß, alle diese wahnsinnigen Männer, diese wilden Bestien haben sich jetzt über das eine Weib geworfen, mit Zähnen und Klauen …
Vor meinen Augen wird es schwarz.
Blieb mir mein Bewusstsein nur so lange, um all das Gräuliche zu sehen … es dämmert … dunkel und unbestimmt, wie das scheidende Licht an trüben Winternachmittagen. Es regnet auf meinen Kopf. Kalte Winde zausen mein Haar. Mein Fleisch wird locker und schwach. Ist das der Beginn der Verwesung?
Dann geht mit mir eine Veränderung vor. Mein Kopf kommt an einen andern Ort, in eine finstere Grube; aber dort ist es warm und still. In mir wird es wieder heller und bestimmter. Noch viele andere Köpfe sind mit mir in der finstern Grube. Köpfe und Körper. Und ich merke, Köpfe und Körper haben sich gefunden, so gut und so schlecht es gehen will. Und in dieser Berührung haben sie wieder ihre Sprache gefunden, eine leise, unhörbare, gedachte Sprache, in der sie miteinander sprechen.
Ich sehne mich nach einem Körper, ich sehne mich darnach, endlich einmal diese unerträgliche Kälte an meinem Halsabschnitt, die schon fast ein heißes Brennen geworden ist, loszuwerden. Aber ich spähe vergebens. Alle Köpfe und Körper haben sich gefunden. Mir bleibt kein Körper übrig. Doch endlich, nach langem, mühseligen Suchen finde ich einen Körper … zu unterst, bescheiden in einer Ecke … einen Körper, der noch keinen Kopf hat – einen Frauenkörper.
Etwas in mir sträubt sich gegen eine Verbindung mit diesem Körper, aber mein Wunsch, meine Sehnsucht siegt und so nähere ich mich – von meinem Willen bewegt – dem kopflosen Rumpf und sehe, wie auch er meinem Kopf entgegenstrebt – und nun berühren sich die beiden Schnittflächen … Ein leichter Schlag, das Gefühl einer leisen Wärme. Dann tritt vor allem eines hervor: Ich habe wieder einen Körper.
Aber seltsam … nachdem das erste Empfinden des Wohlbehagens vorüber ist, spüre ich den gewaltigen Unterschied meiner Wesenshälften … es ist, als ob ganz verschiedene Säfte sich begegnen und mischen würden. Säfte, die miteinander nichts Gleichartiges haben.
Der Frauenkörper, dem mein Kopf nun aufsitzt, ist schlank und weiß und hat die marmorkühle Haut der Aristokratin, die Wein- und Milchbäder nimmt und kostbare Salben und Öle verschwendet. Doch an der rechten Brustseite, über die Hüfte und einen Teil des Bauches eine sonderbare Zeichnung – eine Tätowierung. In feinen, überaus feinen blauen Punkten, Herzen, Anker, Arabesken und immer wiederkehrend ineinander verschlungen und verschnörkelt die Buchstaben J und B. – Wer mag das Weib wohl gewesen sein?
Ich weiß, ich werde das einmal wissen – bald! Denn es entwickelt sich aus dem unbestimmten Dunkel der Körperlichkeit unterhalb meines Kopfes eine Umrisslinie. – Unklar und verschwommen haftet schon die Vorstellung meines Körpers in mir. Aber von Minute zu Minute wird diese Vorstellung deutlicher und bestimmter. Dabei dieses schmerzhafte Durchdringen der Säfte meiner Wesenshälften. Und plötzlich ist es mir, als ob ich zwei Köpfe hätte … und dieser zweite Kopf – ein Frauenkopf, – blutig, entstellt, verzerrt, – ich sehe ihn vor mir – über und über mit den kleinen, emailköpfigen Nägeln vollgeschlagen. Das ist der Kopf, der zu diesem Körper gehört – zugleich mein Kopf, denn ich fühle in meinem Schädeldach und Gehirn deutlich die Hunderte von Nagelspitzen, ich möchte aufbrüllen vor Schmerzen. Alles um mich versinkt in einem roten Schleier, der, wie von heftigen Windstößen hin- und hergezerrt, durcheinanderwogt.
Ich fühle es jetzt, ich bin Weib, nur mein Verstand ist männlich sicher. Und jetzt steigt aus dem roten Schleier ein Bild auf … ich sehe mich vor mir in einem mit verschwenderischer Pracht ausgeschmückten Zimmer. Ich liege in weichen Teppichen eingegraben … nackt. Vor mir, über mich gebeugt ein Mann mit den harten, rohen Zügen des Mannes aus den untersten Schichten des Volkes, mit den arbeitsharten Fäusten, der wetterbraunen Haut des Matrosen. Er kniet vor mir und sticht mit einer spitzen Nadel seltsame Zeichnungen in mein weiches Fleisch. Das schmerzt und bereitet doch eine seltsame Art von Wollust … ich weiß, der Mann ist mein Geliebter.
Da zieht ein kurzer, nadelscharfer Schmerz meinen Körper zu einer zuckenden Wonne zusammen. Ich schlinge dem Mann meine weißen Arme um den Hals und ziehe ihn zu mir herab … und küsse ihn und lege seine harten, schwieligen Hände auf meine Brust und meine Schultern und küsse ihn wieder in einer taumelnden Raserei und umklammere ihn und ziehe ihn fest an mich, dass er atemlos stöhnt. –