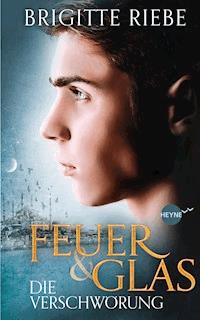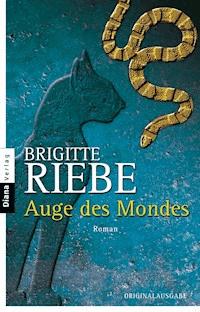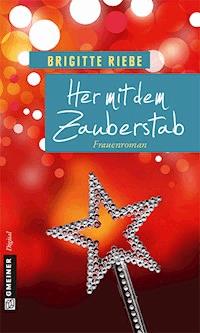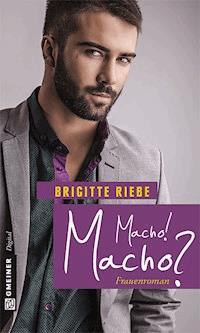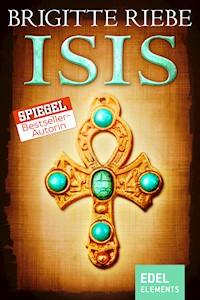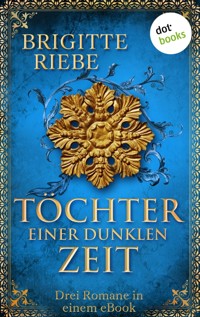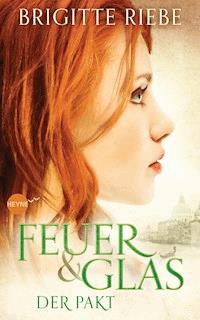
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Brigitte Riebe bei Heyne fliegt
- Sprache: Deutsch
So magisch, romantisch und spannend wie in „Feuer und Glas” war die deutsche Erfolgsautorin Brigitte Riebe noch nie
Venedig im Jahr 1509: Ein machtvolles Glasartefakt und die letzte Erinnerung an einen verschwundenen Vater … Eine uralte Fehde zweier verfeindeter Völker … Und ein Mädchen, das nicht ahnt, dass es den Schlüssel zur Rettung Venedigs in seinen Händen hält …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Brigitte Riebe
Feuer & Glas
BRIGITTE RIEBE
FEUER & GLAS
DER PAKT
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2012 by Brigitte Riebe
Copyright © 2012 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Martina Vogl
Karte: Andreas Hancock
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-07688-7V003
www.heyne-fliegt.de
Für Saskia
Venedig, auf göttliches Geheiß in den Fluten gegründet,
von Wasser umgeben, von Mauern aus Wasser geschützt.
Wer immer es wagen sollte, diesem Gut der Allgemeinheit Schaden zuzufügen, soll nicht geringer bestraft werden
als der, der die Mauern der Vaterstadt beschädigt.
Dieses Edikt hat ewige Gültigkeit.
Magistro alle aqua, 1505
Prolog
Er hörte Schritte hinter sich und ging schneller.
Konnten sie ihn aufgespürt haben?
Auf der nächtlichen Piazetta war er allein gewesen, hatte sich immer wieder nach allen Seiten umgeschaut, froh darüber, dass seine Hände trotz der inneren Anspannung ruhig blieben. Trotzdem war er erleichtert, als die Arbeit schließlich beendet war. Schon halb im Gehen, hatte er sich noch einmal umgedreht. Alles wie gewohnt. Niemand würde bemerken, was er getan hatte.
Sie kamen näher.
Er konnte sich nicht länger einreden, dass es Zufall war. Zu viel stand für alle auf dem Spiel.
Sein Blick flog zu den nachtdunklen Fassaden entlang der schmalen Calle, die er gewählt hatte, weil sie ihm am sichersten erschienen war. Alle Läden waren geschlossen, keine Menschenseele schien mehr wach zu sein. Genau aus diesem Grund hatte er bis nach Mitternacht gewartet, was er nun bedauerte. Selbst wenn er jetzt laut um Hilfe schrie – niemand würde ihn hören.
Er lief los.
Seine Verfolger taten es ihm nach.
Er hörte das Klacken genagelter Stiefel in seinem Rücken. Hier, in der Nähe des Arsenals, wo die meisten Arbeiter lebten, hatten sie unlängst damit begonnen, den unebenen Boden mit länglichen Steinen zu pflastern. Eines Tages würde ganz Venedig damit bedeckt sein.
Es mussten drei sein oder vier. Einer zog das Bein nach, was seine Ohren störte. Das Fauchen des Feuers, denen sie seit Kindheitstagen ausgesetzt gewesen waren, hatte sie nicht abgehärtet, sondern nur noch empfindlicher gemacht.
Was hatte man ihnen in Aussicht gestellt, wenn sie ihn lebend in die Hände bekamen?
Er dachte an das Mädchen, sein Mädchen, das nun die ganze Last tragen musste. Jetzt lag alles in ihrer Hand. Dazu musste sie allerdings erst erfahren, wozu sie auserwählt war – und wenn es das Letzte war, was er zustande brächte.
Sollte er ins Wasser springen?
Auch so würde er sein Boot nicht mehr erreichen, das fest vertäut am Kai auf ihn wartete. Die Feuerinsel und ihre Bewohner warteten umsonst auf ihn.
Das Keuchen hinter ihm kam näher.
Er würde keine Gelegenheit mehr bekommen, seinen Leuten alles zu erklären. Ab jetzt war er ausgestoßen, jemand, den man ungestraft Verräter schimpfen konnte.
Als er den ersten harten Schlag spürte, flog er nach vorn und gewann dabei noch einmal an Geschwindigkeit, dann aber zog einer der Verfolger an ihm vorbei und versperrte ihm den Weg. Ein zweiter tat es ihm nach.
Er saß in der Falle.
Zwei vor ihm, zwei hinter ihm – die Schläge und Stöße kamen nun von allen Seiten, auf die Brust, in den Bauch, auf den Rücken. Den Kopf. Ihre Gesichter waren vermummt, aber er wusste, wer sie waren.
Irgendwann fiel er zu Boden.
Sie rissen ihm die Hände nach hinten und banden sie zusammen. Danach verschnürten sie seine Beine. Ein stinkender Knebel erstickte seine Flüche.
»Du wirst reden«, hörte er jemanden bellen. »Und wenn wir dir dafür bei lebendigem Leib die Haut abziehen müssen!«
Sie schleiften ihn weg wie einen nassen Sack, stießen ihn die Stufen nach unten in einen modrigen Schiffsbauch.
Gnädige Benommenheit umhüllte ihn.
Als er wieder zu sich kam, hörte er neben sich das Fiepen von Ratten. Er versuchte sich zu bewegen, doch es gelang ihm nur mühsam. Die Seile schnitten tief in sein Fleisch, die Haut brannte.
Füße und Beine waren wie taub.
In der Dunkelheit konnte er nichts als vage Umrisse ausmachen. Kisten, Seile, seltsame Leinwandrollen.
Alles Rüstzeug für eine weite Reise?
Dann näherten sich Schritte. Der Schein einer Kerze, die ihm überhell erschien.
Jemand riss seinen Knebel heraus.
»Wo ist sie? Wo hast du sie versteckt?« Wieder jene Stimme!
Er schüttelte den Kopf, unfähig, mit diesem ausgedörrten Mund auch nur einen Satz hervorzubringen. Und selbst wenn er hätte reden können – von ihm würden sie nichts erfahren.
Er erhielt eine Ohrfeige, die seine Ohren dröhnen ließ.
»Wir haben Zeit«, sagte sein Peiniger. »Und unzählige Möglichkeiten, deinen Willen zu brechen. Du ahnst nicht, wie einfallsreich wir sein können!«
Erneut zwängte der Knebel ihm grob die Zunge zurück. Dann war er wieder allein.
Nach einer Weile spürte er, wie seine Beine klamm wurden. Auch Hände und Unterarme waren nicht mehr trocken.
Spätestens da wusste er, dass das Wasser stieg.
Erstes Kapitel
Millas Herz schlug hart gegen die Rippen, und in ihren Augen brannten Tränen – Tränen der Wut. Natürlich hatten sie wieder gestritten. Sie stritten jedes Mal, wenn die Handelsflotte aus Konstantinopel in Venedig einlief, doch so schlimm wie heute war es noch nie gewesen. Aber wie konnte ihre Mutter ihr auch ins Gesicht sagen, dass sie ihren Mann nun endgültig und offiziell für tot erklären lassen wollte?
Kalkweiß war Savinia geworden, als habe der Zorn jegliche Farbe aus ihrem Gesicht gewischt, während ihr Kinn angriffslustig nach vorn schnellte.
»Ich hab es endgültig satt, verstehst du? All dieses Warten und Bangen, dieses zermürbende Hoffen! Fünf Jahre ist es nun her, seit er uns verlassen hat. Kein Wort seitdem, kein Brief – gar nichts!«
Und jetzt, genau in diesem Moment, hätte Milla endlich ihr Geheimnis offenbaren müssen. Aber sie hatte sich doch verpflichtet, Stillschweigen zu bewahren!
»Papa ist kein Verräter, auch wenn die Leute es behaupten«, sagte sie stattdessen. »Als seine Frau dürftest du so etwas nicht einmal denken!«
»Ach, nein? Seit seinem Verschwinden sind neun Handelsflotten nach Venedig zurückgekehrt. Und war dein heiß geliebter Vater vielleicht auf einem einzigen dieser Schiffe?«
Savinia hatte den Nudelteig gepackt, um ihn auf den Tisch zu klatschen, als sei er der heimliche Übeltäter. Dem Resultat allerdings würde es kaum schaden. Alles, was durch ihre Hände ging, schmeckte, das wussten nicht nur die Marktleute zu schätzen, die scharenweise ins ippocampo einfielen. Inzwischen strömten auch immer mehr Gäste aus anderen Stadtteilen herbei. Dank Tante Ysas Unterstützung hatten Mutter und Tochter in der kleinen Taverne nahe der Rialtobrücke ihr Auskommen gefunden.
Warum also wollte Savinia ausgerechnet jetzt wahrmachen, was sie bislang nur angedroht hatte?
Milla ahnte den Grund, und das machte sie nur noch wütender.
Es musste an diesem Salvatore liegen, der ihrer Mutter beharrlich nachstieg – inzwischen verstrich kein Tag mehr, an dem er nicht bei ihnen aufgetaucht wäre. Kaum schob sich sein Glatzkopf in den niedrigen Raum, schien alles dunkler zu werden. Er redete viel, unterstrich seine Worte mit ausladenden Gesten und schien sich nicht darum zu scheren, dass sich Millas Gesicht bei seinem Anblick augenblicklich verschloss wie eine Auster.
Savinia hingegen errötete dann immer, warf den Kopf mit dem weizenblonden Zopf in den Nacken und wiegte sich in den Hüften, als sei sie ein junges Mädchen. Was fand sie nur an diesem Widerling, wo sie doch schließlich immer noch mit Leandro verheiratet war, dem besten Glasbläser von Murano, dem wunderbarsten Vater der ganzen Welt?
Wie sehr Milla ihn vermisste!
Noch immer stand ihr sein Bild so lebendig vor Augen, als sei er niemals fort gewesen: die stets verstrubbelten rötlichen Locken, denen er seinen Spitznamen »Feuerkopf« verdankte, die blitzenden Augen, und natürlich seine geschickten Hände, die aus rauem Quarzsand fragilste Kostbarkeiten zu formen vermochten. Savinia behauptete, er habe sich heimlich aus dem Staub gemacht, um in der Ferne sein Glück zu suchen und darüber seine Familie vergessen.
Aber Milla wusste es besser: Schließlich gab es einen Beweis dafür, den sie als ihren kostbarsten Schatz hütete. Doch was konnte seitdem nicht alles geschehen sein?
Vielleicht lag er ja längst mit einem Messer zwischen den Rippen am Meeresgrund, weil er Murano ohne Erlaubnis verlassen hatte, was für einen seiner Zunft tödlich sein konnte.
Der heftige Schmerz, der sie bei dieser Vorstellung durchfuhr, zwang Milla zum Innehalten. Sie stellte den Fuß auf die kleine Holzbrücke und beugte sich vornüber. Zunächst verschwamm alles vor ihren Augen, allmählich jedoch kehrten die klaren Umrisse zurück, und auch das Herzrasen ließ nach.
Nach einer Weile hob sie vorsichtig den Kopf und sah eine Gondel, die sich lautlos genähert haben musste. Lichtblau gestrichen war sie und am Bug mit einer eisernen Rosette geschmückt. Daneben thronte eine Katze, statuengleich, die Vorderpfoten dicht nebeneinander. Ein paar Sonnenstrahlen, die sich über die Hausdächer geschmuggelt hatten, ließen ihr Fell schimmern. Auf dem silbergrauen Untergrund saßen schwarze Tupfen, wie von der Hand eines Malers spielerisch hingeworfen.
Millas Blick fiel auf den schlanken Mann, ungefähr eine Handvoll Jahre älter als sie, der vom Heck aus die Gondel steuerte, wenngleich sein Ruder im Augenblick bewegungslos in der Gabel lag. Schwarze Haare umrahmten ein schmales Gesicht. Die Hose und das enge Wams, unter dem ein weißes Hemd hervorschaute, waren grau und aus schlichtem Stoff geschneidert, aber er trug sie mit Grazie und Eleganz.
Ein Prinz, schoss es ihr unwillkürlich durch den Kopf – aber in der Stadt des Löwen gab es, wie jedes Kind wusste, keine Prinzen. Und doch ging etwas von ihm aus, das sie auf rätselhafte Weise anzog, eine Aura von Vornehmheit, Stärke und Mut.
Hatte sie ihn zu lange neugierig angestarrt?
Als hätte er ihren Blick gespürt, schaute der Unbekannte nun zu ihr. Seine Augen waren von einem leuchtenden Blaugrün. Es war die Farbe der Lagune, so einmalig, dass Milla deren unverwechselbare Gerüche plötzlich wieder in der Nase hatte, ganz so, als lebten sie noch alle zusammen friedlich in dem roten Haus auf Murano. Wie viel angenehmer war es dort gewesen als in der winzigen, feuchten Wohnung hier, in der man schon wach wurde, wenn nebenan jemand nur zu husten begann.
Ihr Vater hatte sie ab und zu in seinem alten Boot mit hinaus genommen, sobald seine Arbeit am Ofen beendet war.
»Das Meer ist unsere Mutter«, hatte Leandro bei dem kurzen Ausflug gesagt, der ihr letzter werden sollte – doch das hatte sie damals noch nicht ahnen können. »Unser aller Mutter. Das sollten wir niemals vergessen, selbst wenn manche von uns glauben, die Flügel des Löwen seien aus Eisen und deshalb stark genug, um die Lagune für immer zu beschützen. Doch sie irren sich, Milla, und wenn sie nicht rechtzeitig zur Besinnung kommen, werden wir alle teuer dafür bezahlen.«
Lange hatte Milla nicht mehr an diese Worte gedacht, doch mit einem Mal waren sie ihr wieder ganz gegenwärtig. War der Fremde in der blauen Gondel ein Zauberer, der ihr Herz berühren und damit vergessen geglaubte Erinnerungen lebendig machen konnte?
Jetzt flossen ihr tatsächlich ein paar heiße Tränen über die Wangen, doch sie wischte sie schnell weg; schließlich wollte sie nicht kindisch wirken. Doch die blaue Gondel war längst an ihr vorbeigeglitten. Und wenn sie nicht zu den Allerletzten an der Mole von San Marco zählen wollte, musste auch sie sich jetzt beeilen.
Je näher sie der Piazza kam, desto enger wurde es in den Gassen. Die halbe Stadt schien auf den Beinen – eigentlich kein Wunder, wenn man bedachte, dass die muda diRomania, die zweimal pro Jahr nach Konstantinopel segelte, nahezu drei Wochen Verspätung hatte. Schlimmste Vermutungen hatten bereits die Runde gemacht, über Piraten, Seebeben und heimtückische Überfälle feindlicher Mächte war spekuliert worden – aber nun waren die fünf großen Galeeren, im Spätherbst ausgelaufen, endlich wieder heil zurück.
Und mit ihnen ihr Vater?
Ein dicker Kloß steckte auf einmal in Millas Hals und saß darin fest. Aufgeregt war sie an jenen besonderen Tagen stets gewesen, doch bislang hatte immer die Mutter sie begleitet, um nach anfänglichem Schimpfen und Streiten schließlich doch ihre schweißnasse Hand zu drücken und beruhigende Worte zu murmeln, wenn selbst nach stundenlangem Warten nirgendwo ein Feuerkopf auftauchen wollte, der mit breitem Lachen auf sie beide zustrebte.
Ob es heute anders sein würde?
Ysa hatte versprochen zu kommen, allerdings war sie bislang nirgendwo zu sehen. Eine seltsame Mischung aus Ausgelassenheit und Ungeduld lag in der Luft, die Millas Anspannung noch verstärkte. Inzwischen war an ein Durchkommen kaum noch zu denken, so dicht ballten sich die Menschen. Vor allem vorne, an der Mole, kam es bereits zu kleineren Rempeleien, weil keiner dem anderen freiwillig Platz machen wollte.
Milla ließ sich zurückfallen, um Schutz am Fuß einer der zwei großen Säulen zu suchen, die die Piazzetta schmückten. Der Platz unter dem geflügelten Löwen war von einer Gruppe johlender Jugendlicher besetzt, was sie ärgerte, denn nirgendwo sonst fühlte sie sich sicherer. Als die jungen Männer dann auch noch anzügliche Zeichen in ihre Richtung machten, übersah sie diese zwar geflissentlich, nahm dann aber doch mit dem Fuß der anderen Säule vorlieb.
Als sie sich an den kühlen Stein lehnte, überfiel sie ein merkwürdiges Kribbeln. Sie lugte hinauf zu der Statue, die San Teodoro verkörperte, den uralten Schutzheiligen der Stadt, wie ihr Vater erzählt hatte, aufrecht auf einem Krokodil stehend. Ihr fiel ein, dass sie eigentlich kaum etwas über ihn wusste, während sie über den geflügelten Löwen nebendran von Kindheit an unzählige Geschichten gehört hatte, an die sie sich noch ganz klar erinnerte.
Doch jetzt zog sie das Geschehen an der Mole ganz in seinen Bann. Als Erstes würden die Passagiere aussteigen, für die bereits zahlreiche Gondeln zum Weitertransport warteten. Sie stritten sich um Platz mit den Lastkähnen, die die mitgebrachten Waren löschen und an verschiedenste Plätze in der Stadt transportieren würden. Den Anblick der Sklaven vom Schwarzen Meer, die anschließend zur Riva degli Sciavoni gezerrt werden würden, wollte sie sich lieber ersparen.
Er kommt, er kommt nicht, er kommt, er kommt nicht, er kommt …
»Da bist du ja«, hörte sie plötzlich Ysas Stimme. »Ich hatte schon Angst, dich in dem Gewimmel zu übersehen!« Ihre Tante kniff die Augen zusammen und starrte zu den Schiffen hinüber.
»Glaubst du, er ist dieses Mal dabei?«, fragte Milla bang.
»Es gibt immer einen Weg zurück«, sagte Ysa. »Nur der Tod schließt die Tür. Und ich würde spüren, wenn Leandro nicht mehr am Leben wäre.«
Wieder dieses heftige Schuldgefühl, das Milla wie einen Stich im Herzen spürte. Hätte sie sich nicht wenigstens ihr, Tanta Ysa, anvertrauen müssen?
»Er würde uns niemals im Stich lassen«, fuhr Ysa fort. »Dazu kenne ich ihn viel zu gut!«
»Aber wenn er vielleicht gar nicht nach Konstantinopel ausgelaufen ist …« Milla hielt plötzlich inne.
Schimmerte dort drüben im Sonnenlicht nicht ein roter Schopf?
Auf den ersten Blick schien alles zu stimmen: die Größe, die Statur, sogar die bräunliche Schecke, die ihr Vater so oft getragen hatte! Wie von selbst setzten sich ihre Beine in Bewegung, und nun fiel es ihr plötzlich ganz leicht, sich zielstrebig durch die Menschenmenge zu bewegen und einen Weg zu bahnen.
»Lasst mich durch!«, rief sie und setzte sogar die Ellbogen ein. »Mein Vater …«
Doch als sie vor dem Mann angelangt war, blieben ihr alle Worte im Hals stecken.
Er war um vieles jünger als Leandro, Anfang zwanzig, wie sie schätzte. Sein Gesicht war sommersprossig und wirkte freundlich, was die hellen Augen unter rötlichen Brauen unterstrichen. Das Haar erwies sich von Nahem als weniger stark gelockt und war eher braun als rot, wenngleich hie und da eine Feuersträhne aufblitzte. Alles in allem ein gut aussehender Mann – wenn sie dafür jetzt einen Blick gehabt hätte.
»Du suchst deinen Vater?«, fragte er lächelnd. »Ich fürchte, damit kann ich leider nicht dienen! War er denn bei der letzten muda dabei?«
Milla schüttelte den Kopf, versuchte die bittere Enttäuschung zu vertreiben und rang um die richtigen Worte.
»Nein, er ist schon viel länger fort, aber Ihr seht ihm ein wenig ähnlich«, brachte sie schließlich hervor. »Verzeiht, Messèr, wenn ich Euch …«
»Marco. Marco Bellino.« Sein Lächeln vertiefte sich, was ihm etwas überraschend Jungenhaftes gab. »Du kannst mich ruhig duzen. So alt bin ich nämlich noch gar nicht.« Eine Falte erschien zwischen seinen Brauen. »Bist du nicht die Kleine, die im ippocampo bedient?«
»Ich heiße Milla«, erwiderte sie. »Milla Cessi.«
»Die Tochter von Leandro Cessi? Dem Glasbläser?«
Freudiger Schreck fuhr ihr in alle Glieder. Das hörte sich ja an, als ob er ihn kannte!
»Ist mein Vater endlich zurück?«, fragte sie.
»Sag du es mir!« Sein Blick war plötzlich wachsam.
»Du hast seinen Namen eben so seltsam betont«, sagte Milla. »Als ob du etwas wüsstest.«
»Nur das, was alle wissen.« Seine Stimme klang auf einmal ganz flach. Weil er der Tochter eines stadtbekannten Verräters nicht über den Weg traute?
All ihre Sympathie für den jungen Mann, der so freundlich gewesen war, war mit einem Mal verflogen. Sollte er doch denken, was sie alle dachten! Milla wusste, dass es anders sein musste.
Hilfesuchend blickte sie sich nach Ysa um, doch die war ein wenig zurückgeblieben und stand gerade mit drei Männern zusammen, die heftig auf sie einredeten, als versuchten sie, sie von etwas zu überzeugen.
Feuerleute aus Murano?
Milla glaubte, zwei davon wiederzuerkennen. Aber was machten sie hier in Venedig?
Sie spürte, wie sich Enttäuschung und Wut in ihr zusammenballten und eine glühende Kugel bildeten, die jeden Augenblick explodieren konnte. Verzweifelt kämpfte sie dagegen an. Ihr Vater war auch heute wieder nicht dabei gewesen. Vielleicht würde er niemals mehr zurückkehren – und dann gab es auch keinen Grund mehr für Savinia, nicht zum Magistrat zu gehen und ihn offiziell für tot erklären zu lassen. Wenigstens müsste dann die scuola von Murano die Auszahlung des Witwen- und Waisengelds leisten, das sie so dringend brauchten, um die Renovierung der Taverne in Angriff zu nehmen. Aber dann würde ja auch dieser schleimige Salvatore ihre Mutter ungeniert weiter belästigen, wenn nicht gar mehr …
Zwei Männerstimmen rissen sie aus ihren Gedanken.
Die eine gehörte Marco Bellino, die andere hatte sie noch nie zuvor gehört. Tief klang sie und gelassen – da war er wieder, jener fremde Gondoliere von vorhin!
»Ich kann Euch nicht mitnehmen.« Sah er dabei Milla an, oder hatte sie sich das nur eingebildet?
Um ihn herum schien das Licht auf einmal ganz verändert, war weniger gleißend, als schimmere etwas Kühles, Bläuliches hindurch.
Milla beschlich ein seltsames Gefühl, das sie noch nie zuvor empfunden hatte, doch Marcos Stimme holte sie wieder in die Wirklichkeit zurück.
»Ihr seid leer, und ich muss dringend zum Hintereingang des Arsenals! Also macht gefälligst keine Umstände und lasst mich einsteigen!«
»Nehmt eine andere Gondel. Oder schwimmt meinethalben. Ich stehe nicht zur Verfügung!« Jetzt klang der Fremde so scharf wie eine frisch gewetzte Klinge.
»Hört zu, Gondoliere, meine Mission …«
»Und wenn es der Heilige Vater höchstpersönlich wäre, der Euch befehligt – meine Antwort lautet Nein!« Abermals ein kurzer Blick zu Milla, den sie nicht zu deuten wusste.
Sie sah, wie Marcos Kiefer zu mahlen begann. Seine Rechte hatte er unter der Schecke verschwinden lassen, als fürchte er, sie könnte sich sonst selbstständig machen. Sein ganzer drahtiger Körper schien unter Spannung zu stehen.
»Ich bin es nicht gewohnt, dass man …« Marco verstummte.
Ein seltsamer Tross bewegte sich auf die blaue Gondel zu. Voran schritt ein Mann mit öligen schwarzen Haaren, seine beachtliche Leibesmitte wurde von einer roten Schärpe geschmückt. Ihm folgte ein feengleiches dunkelhaariges Mädchen, an dessen schmalen Handgelenken bei jedem Schritt goldene Reifen klirrten. Sie schien mehr zu schweben als zu gehen, bis zu den Füßen in ein Gewand aus meergrünem Brokat gehüllt, das im Sonnenlicht mit dem leicht bewegten Wasser am Kai um die Wette glitzerte. Den Abschluss bildete ein braunhäutiger Junge in weißen Hosen und mit den größten Ohren, die Milla jemals gesehen hatte. Bronzenen Segeln gleich, standen sie nahezu waagrecht von seinem Kopf ab.
Aber was war auf einmal mit dem Licht geschehen?
Noch immer schien die Sonne hell und strahlend, und doch war Milla, als umgebe die Fremden ein zartes bläuliches Wogen, wie sie es sonst nur kannte, wenn sie in tiefes Wasser blickte. Uralte Geschichten schossen ihr durch den Kopf: von Meeresleuchten, geheimnisvollen Wesen, die die dunkle Tiefe bewohnten, und Schätzen, die am Grund auf Bergung warteten. All diese Legenden wurden auf den Inseln der Lagune während der dunklen Wintermonate gern weitergegeben, und bislang hatte Milla all das für Märchen und Fantasiegespinste gehalten, die man Kindern zum Einschlafen erzählte. Doch was sie nun zu sehen bekam, erschien ihr so wirklich, dass leichter Schwindel sie erfasste.
Milla rieb sich die Augen.
Das Blau war verschwunden. Erneut tauchte die hoch stehende Sonne alles in gleißendes Licht – und mehr gab es nicht zu sehen. Vermutlich hatten ihre überreizten Sinne ihr einen Streich gespielt.
Der Gondoliere half beim Einsteigen und umarmte dabei das Trio freudig, während der Kater aufgesprungen war und sich zärtlich an den Beinen der Schönen rieb.
»Wo habt ihr eure Sachen?«, hörte Milla ihn fragen, während er das Mädchen strahlend anlächelte, was ihr seltsamerweise einen Stich versetzte.
»Alles schon auf dem richtigen Weg«, sagte der Mann, und seine hart klingende Sprechweise war ebenso auffällig wie sein exotisches Äußeres. »Ein verdammt gutes Gefühl, endlich wieder nach Hause zu kommen!« Sein Blick bekam etwas Suchendes. »Aber wo steckt denn unser lieber alter Freund? Es geht ihm doch gut?«
»Bestens!«, lautete die Antwort. »Der Onkel erwartet uns bereits.«
Jetzt schaute er nicht mehr zu Milla.
Warum nur hatte sie auf einmal diesen schalen Geschmack des Verlusts im Mund, während sie der blauen Gondel nachschaute, die sich zwischen vielen anderen auf dem Canal Grande immer weiter von ihr entfernte?
»Du kommst spät.« Die Stimme des Weißhaarigen war ebenso leise wie scharf. »Ich hatte dich früher erwartet.«
Marco Bellino verscheuchte den Anflug von Unmut, der in ihm aufsteigen wollte. Wie hätte er ahnen können, was ihm bevorstand, als er vor wenigen Monaten das Arsenal zum ersten Mal betreten hatte? Inzwischen war er dem heimlichen Herrscher von Venedig direkt unterstellt – dem Mann, der die wichtigsten Entscheidungen traf, auch wenn offiziell der Doge an der Spitze des Großen Rats die Staatsgeschäfte führte. Alles, was jenen Mann betraf, schien wie in Nebel gehüllt, glich der Lagune an trüben Herbsttagen. Wenigen war es vergönnt, persönlich zu ihm vorzudringen, und vielleicht hielt sich deshalb hartnäckig die Legende, er sei schon seit Jahren nicht mehr am Leben.
»Ich wurde aufgehalten, Admiral«, sagte er. »An Tagen wie heute strapazieren die Wasserleute unsere Geduld noch mehr als gewöhnlich.«
Der Weißhaarige blieb weiter konzentriert über seine Konstruktionszeichnungen gebeugt.
»Läuft alles nach Plan, werden sie bald wissen, wo sie hingehören. Feuer ist seit je das beste aller Argumente. Es wird ihnen zeigen, wer in dieser Stadt das Sagen hat!« Sorgfältig faltete er das oberste Pergament zusammen. »Baumeister Fioretto soll morgen nach der Frühmesse vorsprechen. Seine Pläne für den Umbau der Seilerei müssten jetzt endlich so weit sein.«
Marco nickte und spürte, wie er am ganzen Körper zu schwitzen begann, was nicht nur an der Frühlingssonne lag, die auf die dicken rötlichen Mauern herabbrannte. Seine Aufgaben waren vielfältig und zum Teil denkbar ungewöhnlich. Anfangs hatte ihn das verwirrt, und er hatte den Versuch gewagt, sich Notizen zu machen, um ja nichts zu vergessen. Doch als der Admiral das entdeckt hatte, wäre es beinahe zum Bruch gekommen.
»Keinerlei Aufzeichnungen. Keine Zeugen. Alles, was innerhalb dieser Mauern geschieht, obliegt absoluter Geheimhaltung. Wer das nicht begreift, hat hier nichts verloren!«
Inzwischen wusste Marco, worauf es ankam. Es gab sogar Momente, da war er sich fast sicher, ein Stück seiner Achtung ergattert zu haben – beileibe nicht sein Vertrauen, denn der mächtige alte Mann vertraute nur sich selbst. Doch dann, von einem Lidschlag auf den anderen, konnte alles wieder ganz anders sein.
»Wie steht es um die Arbeiten in Halle sieben?«, lautete die nächste Frage.
»Keine weiteren Vorfälle«, erwiderte Marco scheinbar ungerührt, obwohl er es gewesen war, der den betroffenen Familien die traurige Nachricht hatte überbringen müssen. Ein Seil, an dem Fässer mit heißem Pech hingen, war plötzlich gerissen, zwei Männer von der glühenden Ladung übergossen worden – und daran gestorben. Einen halben Tag war es zu einer regelrechten Revolte unter den Arsenalotti gekommen, wie sich die Männer, die in der riesigen Staatswerft beschäftigt waren, voller Stolz nannten. Doch dann war wieder Ruhe eingekehrt. Wer wollte schon riskieren, einen der begehrtesten Arbeitsplätze Venedigs aufs Spiel zu setzen?
»Die Witwen sollen beim Patron vorsprechen«, sagte der Admiral. »Zügig. Damit kein Gerede aufkommt. Sobald ihre Söhne alt genug sind, können sie den Platz der Verstorbenen einnehmen.«
»Wird erledigt.«
»Weiß man inzwischen, wer das Unglück verschuldet hat?«
Natürlich hatte Marco bereits Nachforschungen in Gang gesetzt, doch die Arbeiter in der Seilerei hielten fest zusammen und ließen nichts nach draußen dringen.
»Ich bleibe dran«, sagte er. »Einer redet immer.«
»Zeit ist das Einzige, was wir nicht haben.«
Von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang konnte im Arsenal eine komplette Galeere fertig gebaut werden – eine schier unvorstellbare Leistung, die Marco nicht für möglich gehalten hätte, wäre er nicht selbst dabei gewesen. Noch heute erinnerte er sich an das Geräusch, mit dem der Bug ins Wasser klatschte, an das Rufen der Arsenalotti, an das Rot der Sonne, die als leuchtender Ball aus der Lagune gestiegen war. Ganz Europa beneidete die Lagunenstadt um diese außergewöhnliche Leistung. Voraussetzung dafür war allerdings, dass keiner der komplizierten Abläufe unterbrochen oder gestört wurde.
Würde nun der Satz folgen, den Marco in seinen Albträumen schon seit Wochen hörte?
Du lässt nach, Bellino. Einen wie dich kann ich hier nicht gebrauchen, und du weißt, was das zu bedeuten hat …
»Wie machen sich die Neuen?«, fragte der Admiral stattdessen.
»Ganz ordentlich«, erwiderte Marco erleichtert, aber dennoch mit gebotener Vorsicht, denn wenn er mit seiner Einschätzung danebenlag, würde er das zu büßen haben.
»Am Ende des Monats wird sich entscheiden, ob sie bleiben können.«
Marco nickte abermals. »Die Liste der Anwärter ist endlos. Im Bedarfsfall können sie von heute auf morgen ausgetauscht werden.«
»Hör auf, mich mit Banalitäten zu langweilen! Sag mir lieber, ob es Neuigkeiten gibt. Die Kriegslunte ist bereits mit Flüssigkeit getränkt. Ein Funke – und sie kann sich entzünden.«
Jetzt kam es auf jedes Wort an.
»Leider noch immer keine brauchbare Spur«, sagte Marco nach einer winzigen Pause. »Auch unsere Gewährsleute in Konstantinopel wissen nichts. Fast könnte man meinen, der Feuerkopf habe sich in Luft aufgelöst.«
Erstaunlich behände kam der Admiral auf ihn zugehinkt.
»Ein Wunder?« In seinen Augen stand ein boshaftes Funkeln. »Schade nur, dass ich nicht an Wunder glaube! Und selbst wenn er verschwunden bleibt: Bring mir endlich, wonach wir schon so lange suchen. Du weißt doch, was davon abhängt.
Die Liga will uns vernichten, doch das darf niemals geschehen. Wir könnten unsere Feinde vernichtend schlagen – auch wenn wir dafür das Blut einiger Venezianer opfern müssen.«
Marcos Rücken war inzwischen schweißnass.
»Ich werde alles daransetzen …«, begann er.
Der Mund des Alten war hart geworden, eine dünne, weißliche Linie, die nichts Gutes verhieß.
»Was zählt, sind Ergebnisse, Bellino!«, unterbrach er ihn. »Der Verräter hat doch eine Tochter, oder etwa nicht?«
Seite an Seite arbeiteten sie in der winzigen Küche, ebenso stumm und verbissen, wie sie sich gestern für den Rest des Tages aus dem Weg gegangen waren. Als die dicken Bohnen endlich gar waren, Mutter und Tochter gleichzeitig nach dem Topf griffen und ihn damit um ein Haar vom Herd gestoßen hätten, riss Ysa der Geduldsfaden.
»Ich weiß nicht, welche von euch beiden sturer ist!«, rief sie mit hochroten Wangen. »Bald schon werden unsere Gäste vor der Tür mit den Füßen scharren, und ihr führt euch auf wie alberne Gänse. Vertragt euch endlich wieder, sonst setze ich euch alle beide an die Luft!«
Sie reichte Leandro kaum bis zur Schulter, und dennoch war unübersehbar, dass die beiden Geschwister waren. Das gleiche Feuerhaar, die gleiche Mimik, die gleiche Art, schnell aus der Haut zu fahren, um schon im nächsten Moment in Lachen auszubrechen und alles wieder vergessen zu haben. Obwohl Ysa auf den ersten Blick offen und fröhlich erschien, gab es doch vieles, das rätselhaft an ihr war. Vielleicht liebte Milla ihre Tante genau deshalb und ließ sich mehr von ihr sagen als von ihrer Mutter, die schnell einschnappen und lange beleidigt sein konnte, wenn Milla nicht spurte.
Milla schluckte, war gleichzeitig aber heilfroh, dass das ungute Schweigen endlich ein Ende hatte.
»Offenbar kommst selbst du allmählich zur Vernunft.« Savinia gönnte ihr einen kurzen Seitenblick, ein erstes Friedensangebot, wie Milla aus Erfahrung wusste. »Deshalb hab ich mir die Angelegenheit gestern ja auch erspart. Jedes Mal wieder von Neuem erleben zu müssen, wie all die anderen aussteigen, während Leandro …«
Ysa hatte einen kurzen Schrei ausgestoßen, der Mutter und Tochter zusammenzucken ließ.
»Petersilie ist aus«, rief sie. »Kein Fitzelchen haben wir mehr!«
Auf Murano hätten sie nur in den üppigen Garten gehen müssen, um sich das Gewünschte frisch abzuschneiden, hier in Venedig jedoch war alles ganz anders. Zwar hatten sie noch ein paar getrocknete Kräuter über den Winter retten können, doch ihre Gäste waren anspruchsvoll und maulten, wenn es an Frische fehlte.
Milla riss ihre Schürze ab und warf sie auf den Tisch.
»Bin schon unterwegs«, sagte sie. »Vielleicht ist ja noch etwas zu kriegen.«
Beim Hinausgehen angelte sie unauffällig nach ein paar Fischköpfen, weil sie genau wusste, welch ausgehungerte Meute sie an der Hintertür erwarten würde. Natürlich saß der magere einäugige Rote bereits in Position, neben seiner Gefährtin, der Schwarzen mit den weißen Pfötchen. Aber es gab auch einen Gast, der sie zutiefst erstaunte: die getüpfelte Katze aus der Gondel. Jetzt, da sie so nah war, erkannte sie, dass es ein Kater war – ein schlankes, junges Tier mit wachsam gespitzten Ohren.
»Was willst du denn hier?«, murmelte Milla, nachdem sie die Dauergäste versorgt hatte, und warf ihm den letzten Fischkopf hin, über den er sich sofort hermachte. »Hast du deinen Gondoliere auch mitgebracht?«
Zu ihrer Überraschung ließ der Kater einen Teil seiner Beute liegen und folgte ihr, nicht bei Fuß wie ein gehorsames Hündchen, aber doch in knapper Entfernung. Blieb sie stehen, hielt er ebenfalls inne, ging Milla weiter, setzte auch er sich wieder in Bewegung. Das letzte Stück rannte sie, weil sie sah, wie die ersten Händler ihre Stände schon zuklappten.
»Petersilie!«, stieß sie hervor, als sie bei dem dicken Händler am Ende des Markts angelangt war, der meistens noch etwas in der Hinterhand hatte. Heute allerdings schien selbst er in Nöten. Ihr Blick flog über seinen nahezu leeren Stand. »Alles, was du hast!«
Was sich bei näherer Betrachtung als recht dürftig erwies – gerade einmal vier Bündel streckte er ihr entgegen.
»Wir leben in schwierigen Zeiten«, klagte er. »Seitdem Venedig seine gierigen Finger nach dem Festland ausgestreckt und sich die ganze Welt gegen uns zusammengerottet hat, mucken sogar die Bauern auf. Drei magere Gemüsekisten konnte ich heute ergattern, und das sündteuer! Außerdem habe ich läuten hören, dass Brot ab nächster Woche doppelt so viel kosten soll.«
»Dann muss meine Mutter auch die Preise aufstocken – und die Gäste werden murren oder ausbleiben.«
Er zuckte die fleischigen Schultern.
»Wir, die Kleinen, haben seit je ausbaden müssen, was die Großen aushecken. Daran wird sich nie etwas ändern.« Als sie in ihrer Rocktasche nach Münzen zu kramen begann, grinste er. »Lass dein Kupfer stecken«, rief er. »Sag lieber der schönen Savinia, sie soll mir heute Abend Ravioli mit Ricotta und Petersilie kochen – und mich damit zum glücklichsten Mann Venedigs machen!«
Als sich Milla zum Gehen wandte, saß der Kater direkt neben ihr und schaute mit seinen hellgrünen Augen zu ihr auf.
»Es geht zurück zur Taverne, Signor Puntino«, entfuhr es ihr.
Puntino – kein passenderer Name hätte ihr einfallen können!
Der Kater schien der gleichen Meinung zu sein, fuhr sich einmal mit der Pfote lässig über das Gesicht und folgte ihr, als sei es niemals anders gewesen.
Der halbe Markt war gekommen, als hätten die Händler seit Tagen nichts Anständiges mehr zu essen bekommen. Sogar Wartezeiten nahmen sie ohne zu murren in Kauf, lachten und scherzten, bis sie endlich einen Tisch bekamen. Zwischendrin musste immer wieder Geschirr gespült werden, weil Teller, Schüsseln und Becher auszugehen drohten. Doch irgendwie meisterten sie auch das, und als der letzte Gast das ippocampo schließlich verlassen hatte, atmeten alle drei Frauen erleichtert auf.
Ysa sank mit einem Seufzer auf einen Hocker und fächelte sich Luft zu. »Noch mehr solcher Tage – und ich schwimme nach Murano zurück«, murmelte sie.
»Geh nach Hause und ruh dich ein wenig aus«, sagte Savinia zu ihrer Tochter. »Aber vergiss die Schmutzwäsche nicht.« Sie strich sich das Haar aus der schweißnassen Stirn. »Heute haben sie alle geschlungen, als sei ihr letzter Tag auf Erden angebrochen!«
»Der dicke Gemüsehändler meint, das liege daran, dass sich die ganze Welt gegen Venedig verschworen habe …«
»Wenn dieser alte Fresssack nichts im Bauch hat, redet er immer Unsinn. Mach schon, dass du rauskommst, Milla. Könnte ein langer Abend werden.«
Warme Nachmittagssonne empfing sie, als sie aus der Hintertür stolperte. Milla stopfte das lästige Wäschebündel hinter ein paar Kisten. Darum würde sie sich später kümmern. Sie wusste, dass die Mutter Hilfe brauchte, aber im Augenblick hatte sie dazu einfach keine Lust.
Um nach Hause zu gelangen, hätte sie sich jetzt nur rechts und dann wieder links halten müssen, stattdessen zog es sie in die andere Richtung, nach vorn, zum glitzernden Wasser. Sie hörte das Kreischen der Möwen, die sich um Essensreste zankten, sie sah die Gondeln, die auf dem Canal Grande unterwegs waren, und plötzlich überfiel sie jähe Sehnsucht nach Murano.
Was war wohl aus dem roten Haus und dem kleinen Garten geworden? Savinia hatte ab und zu davon gesprochen, es zu verkaufen, dafür jedoch, soweit Milla wusste, noch keinen Finger gerührt. Weil sie insgeheim hoffte, dass ihr Mann doch zurückkam, und all das barsche Getue eigentlich nur Selbstschutz war?
Etwas zog plötzlich ihre Aufmerksamkeit auf sich.
Saß dort drüben auf der großen Holzbrücke nicht der getüpfelte Kater aus der blauen Gondel?
Langsam ging sie auf ihn zu.
Er wartete nicht ab, bis sie ganz bei ihm angelangt war, sondern setzte sich kurz zuvor in Bewegung. Milla folgte ihm. Mit erhobenem Schwanz stolzierte er über die Rialtobrücke, zielstrebig, aber ohne Eile, vorbei am Fontego dei Tedeschi, die Niederlassung der deutschen Händler in Venedig. Beim Campo San Bartolomeo bog er links ab, dann rechts, dann wieder links, um schließlich eine kleine Brücke zu überqueren.
Milla fiel auf, wie hoch das Wasser stand.
Bis zum Sommer war es nicht mehr lange hin, und doch behaupteten alte Leute, sie könnten sich nicht daran erinnern, dass es je zuvor in einem Frühling so viel geregnet habe. Selbst an trockenen Tagen schien die Flut immer stärker zu werden, geradezu in die Stadt hineinzudrängen, als wollte sie mit aller Macht zurückerobern, was die Menschen einst dem Meer abgerungen hatten.
Die Gassen wurden stiller und schmaler, je weiter sie gelangte, wenngleich die meisten Häuser hier aus Stein waren und damit anzeigten, dass sie von wohlhabenden Leuten bewohnt wurden. Wie anders es bei ihnen im Marktviertel war, wo alles aus Holz gebaut war und man schon ängstlich den Atem anhielt, sobald ein Funke flog!
Nicht zum ersten Mal überkam Milla Angst, sich zu verlaufen. Zu Hause, auf Murano, hatte sie jeden Winkel gekannt und sich selbst mit geschlossenen Augen zurechtgefunden – doch Venedig erschien ihr noch immer wie ein Labyrinth, in dem man allzu leicht verloren gehen konnte.
Plötzlich war das Tier verschwunden.
Milla machte ein paar Schritte nach rechts, dann nach links und blieb schließlich unschlüssig stehen. Sie hörte leises Plätschern aus einem Kanal, den sie von hier aus nicht sehen konnte. Erst nach einer Weile fiel ihr auf, dass die Mauer vor ihr unterbrochen war.
Mitten im Ziegelwerk befand sich eine Tür!
Sie berührte das eng gefächerte Holz, das im unteren Bereich einen breiteren länglichen Schlitz aufwies, und erschrak, weil es unerwartet nachgab, als sie es berührte.
Milla spähte in einen kleinen, gepflasterten Hof und trat ein, obwohl ihr Herz vor Aufregung laut klopfte. Langsam ging sie weiter, auf einen Brunnen zu, aus poliertem rötlichem Stein gefertigt, hinter dem eine Treppe hinauf zum Haus führte. Seitlich konnte sie exakt gestutzte Buxbaumkugeln ausmachen sowie den säuberlich geharkten Rand eines bunten Blumenbeets, offenbar ein liebevoll gepflegter Garten, der direkt zum Wasser führen musste.
Täuschte sie sich, oder war die Luft hier drinnen eine Spur bläulicher?
»Was willst du hier?« Das Venezianisch war fehlerfrei, klang allerdings in ihren Ohren so schnarrend, als blase ein kräftiger Wind in ein hölzernes Gestell.
Der Junge mit den Riesenohren!
Er hockte auf der steinernen Treppe und grinste ihr entgegen.
»Nichts«, stammelte Milla verlegen. »Ich dachte nur … der Kater … ich meine Puntino …« Sie verstummte.
»Er hat dich hergebracht?« Der Junge lachte fröhlich. »Sieht ihm ähnlich, diesem kleinen Strolch! Du nennst ihn Puntino? Das passt!«
Ob die anderen wohl auch in der Nähe waren? Das Mädchen mit den goldenen Reifen, der Dicke mit der roten Schärpe, der dunkelhaarige Gondoliere …
»Ich kenn dich doch!« Geschmeidig hatte sich der Junge erhoben, machte aber keinerlei Anstalten, herunter zu Milla zu kommen, sondern redete weiterhin von oben auf sie herab. »Du warst gestern an der Mole. Und hast uns die ganze Zeit angestarrt.«
Milla nickte.
»Ihr seid aus Konstantinopel?«, fragte sie und spürte, wie ihre Kehle bei der Frage eng wurde.
Sein Kopf begann zu wackeln, als sei er an einer unsichtbaren Schnur befestigt.
»Eigentlich sind wir überall zu Hause. Aber den Winter über waren wir dort, das ist richtig. Du kennst Konstantinopel?«
»Leider nein«, sagte sie. »Ich habe die Lagune noch nie verlassen.«
»Und woher stammst du?«
»Aus Murano. Dort, wo die Glasbläser leben. Aber jetzt wohnen wir hier, in Venedig.«
Mit einem Satz sprang er zu ihr herab. »Du gefällst mir«, rief er. »Du bist so – anders!«
»Wie meinst du das?«, fragte Milla verdutzt.
»Darf ich dein Haar anfassen?« Noch bevor sie antworten konnte, hatte er schon danach gegriffen und wickelte sich eine Locke um den Finger. »Wie stark es ist! Und wie es von innen heraus glüht! Man könnte fast meinen, es bestünde aus Feuer. Da muss man ja achtgeben, dass man sich nicht daran verbrennt.« Er zog seine Hand zurück, spitzte die Lippen und begann übertrieben zu blasen, als stünde er vor großem Publikum.
Ein Spinner, dachte Milla, die ihre Haare nicht besonders mochte, weil sie sich so schwer bändigen ließen, und musste unwillkürlich lächeln. Aber ein sehr liebenswerter Spinner!
»Und wie heißt du?«, fragte sie.
»Ganesh«, antwortete eine weibliche Stimme an seiner Stelle. »Ich hoffe, er war nicht zu aufdringlich, das ist er nämlich manchmal.« Das fremde Mädchen war unbemerkt zu ihnen getreten und sah Milla nun so neugierig an, als wolle sie in ihr Innerstes blicken.
Was nahm sie sich heraus, sie derart unverhohlen anzustarren! Lag es daran, dass die Fremde sich überlegen fühlte, weil sie so anmutig und unnahbar wirkte?
»Hast du auch einen Namen?«, unterbrach das Mädchen ihre Gedanken.
»Ich bin Milla.«
Sie konnte einfach nicht aufhören, ihr Gegenüber anzustarren, das ihr wie eine Prinzessin erschien – eine Prinzessin mit schlechten Manieren allerdings! Den grüngoldenen Brokat von gestern hatte sie gegen lichtblaue Seide vertauscht und so geschickt um den Körper gewickelt, dass ihre sanften Rundungen betont wurden. Bei jeder Bewegung raschelte das kostbare Material, doch sie trug es so selbstverständlich, als sei es schlichtes Leinen.
Unwillkürlich lugte Milla an sich hinunter.
Anfangs hatte sie sich geärgert, wenn ihre Kleidung beim Bedienen etwas abbekam. Inzwischen hatte sie sich so sehr an die unvermeidlichen Spritzer und Flecken gewöhnt, dass sie ihr kaum noch auffielen. Jetzt allerdings machte es ihr sehr wohl etwas aus. Wenn sie doch nur ihr Sonntagsgewand angehabt hatte, das sie gestern auf der Piazzetta getragen hatte! In dem verblichenen gelben Rock und dem ausgefransten Mieder kam sie sich gegenüber der eleganten Fremden vor wie eine Küchenmagd.
»Ganesh? Alisar – seid ihr so weit?«, hörte sie eine Stimme rufen, die ihr nicht unvertraut war. »Wir wollen aufbrechen!«
Eine Spur von Blau, das aus der geöffneten Tür floss.
Der Gondoliere trat heraus. Auf seinen Schultern lag der Kater, eine getüpfelte Pfote lässig baumelnd, als sei es seine Lieblingshaltung. Die Augen des schwarzhaarigen Mannes weiteten sich leicht, als er Milla erkannte, und seine Miene wurde ernst.
Das Blau wurde stärker.
Sie spürte, wie alles Blut aus ihrem Kopf strömte, und ihr wurde heiß und zugleich eiskalt. Würde sie im nächsten Moment ohnmächtig zu seinen Füßen hinsinken? Milla ballte die Hände zu Fäusten und zwang sich zum Weiteratmen.
Noch immer sah er sie unverwandt an.
Das Blau um ihn vertiefte sich noch mehr, war wie das leuchtende Türkis der Lagune an warmen Sommertagen, das wie eine Welle auf sie zurollte.
Es war keine Einbildung. Es war zum Greifen nah – und machte ihr Angst.
Milla öffnete den Mund und schloss ihn wieder, ohne einen Ton hervorzubringen, weil alle Worte plötzlich versiegt waren.
Dann drehte sie sich um und rannte davon, so schnell sie konnte.
Die abendliche Arbeit im ippocampo verrichtete sie wie abwesend, und das rächte sich. Milla brachte ein halbes Dutzend Mal Speisen an die verkehrten Tische und sorgte damit für reichlich Verwirrung. Erstaunlicherweise schien Savinia ihre gute Laune deswegen nicht zu verlieren – nicht einmal, als sie zwischendrin hinausging, offenbar die schludrig versteckte Wäsche entdeckte, die Milla ganz vergessen hatte, und danach mit einem Schmunzeln die Küche wieder betrat.
»Vielleicht mute ich dir zu viel zu«, sagte sie zu ihrer Tochter, während sie die Ravioli abgoss und anschließend in Olivenöl schwenkte. »Du bist gerade erst sechzehn geworden und hast keine einfache Zeit hinter dir. Nimm es mir nicht übel, wenn ich manchmal ruppig bin. Wir tragen das schmutzige Zeug gemeinsam nach Hause, was meinst du? Zusammen ist das eine Kleinigkeit!«
Milla gelang es nicht richtig, sich über dieses Angebot zu freuen, denn soeben hatte Salvatore die Taverne betreten. Er bestellte Weißwein und Sardinen, verschlang aber vor allem ihre Mutter mit Blicken, als sie kurz in den Gastraum kam, um ihn zu begrüßen. Dass man Savinia hinterher fröhlich in der Küche pfeifen hörte, machte alles nur noch schlimmer.
»Lass dich nicht so hängen«, flüsterte Ysa ihr im Vorbeigehen zu. »Die anderen Gäste können schließlich nichts dafür!«
»Aber er ist doch dein Bruder …«
»Und dein Vater. Du solltest ihm mehr vertrauen, Milla! Das hat Leandro verdient.«
Der Satz fuhr ihr tief ins Herz.
Wusste die Tante etwas, das sie bislang für sich behalten hatte?
Ysa ging seit je eigene Wege, das war nichts Neues für Milla. Doch auch sie hütete ihre Geheimnisse, und das betraf nicht allein ihren verborgenen Schatz. Und so hatte sie auf die Frage, wo sie nachmittags gewesen sei, lediglich mit Schulterzucken geantwortet.
Dabei wurde Milla die Bilder und Geräusche aus dem kleinen Garten nicht mehr los. Ganeshs Ohren, die das Gegenlicht wie durchsichtig gemacht hatte. Das Spiel der raschelnden Seide, sobald sich Alisar bewegt hatte. Vor allem aber jenes leuchtende, zutiefst beunruhigende Blau, das den Gondoliere umflossen hatte. Bei ihrem Anblick war sein Lächeln jäh erloschen.
War sie ihm zuwider? Und wenn ja – weshalb?
Und warum nur tat dieser Gedanke so weh?
»Noch einen Krug vom Weißen, Mädchen!«, hörte sie Salvatore am hintersten Tisch krakeelen. Heute war er offensichtlich allerbester Laune, nachdem er in den vergangenen Tagen eher bedrückt gewirkt hatte. Lag es daran, dass ihre Mutter ihm verraten hatte, dass sie nun bald offiziell Witwe sein würde?
Am liebsten hätte Milla ihm den gesamten Inhalt des Krugs über den blanken Schädel geschüttet, so zuwider war er ihr – doch unter Ysas zwingenden Blicken gelang es ihr, sich zusammenzureißen.
»Wie wäre es mit einem Ausflug?« Salvatore besaß tatsächlich die Dreistigkeit, Milla am Handgelenk zu packen und sie ganz nah heranzuziehen. »Einer kleinen Bootspartie beispielsweise? Savinia hat schon so lange versprochen, mir euer altes Haus auf Murano zu zeigen. Da solltest du unbedingt dabei sein!«
Sprachlos vor Wut starrte Milla ihn an.
»Ich könnte euch helfen, es loszuwerden«, fuhr er ungerührt fort. »Als Arsenalotto habe ich nun mal allerbeste Verbindungen. Ein Wort von mir an der richtigen Stelle – und ihr könntet all eure Geldsorgen auf einen Schlag los sein!«
»Ich muss weiterarbeiten.« Sie zog ihren Arm zurück und wollte davoneilen, er jedoch bekam einen Zipfel ihres Rocks zu fassen und hielt sie fest.
»Du kannst mich nicht ausstehen«, murmelte er. »Dein Pech, Kleine! Aber du wirst lernen müssen, dich an mich zu gewöhnen, ich hoffe, das weißt du. Deine Mutter und ich werden nämlich bald …«
Milla riss sich los und rannte durch die Küche, ohne Savinia eines Blickes zu würdigen, durch die Hintertür und hinaus, wo sie endlich wieder Luft bekam.
Sie lehnte sich an die dunkle Mauer. Nach einer Weile spürte sie eine warme Hand auf ihrem Arm.
»Ich mag es nicht, wenn du dich so klein machst«, sagte Ysa leise. »Feuerleute wie wir lassen sich nicht unterkriegen!«
»Früher vielleicht!«, fuhr Milla auf. »Damals, als Vater noch bei uns war …« Sie verstummte, plötzlich nicht mehr imstande, weiterzusprechen.
»Das legt man niemals ab. So bist du geboren, und das bleibst du bis zum Ende deines Lebens, das weißt du doch! Leandro mag vielleicht nicht mehr in Venedig sein, aber er ist noch immer hier bei dir.« Sanft tippte Ysas Finger gegen Millas Brust. »Du musst dich lediglich erinnern, Milla. Ich weiß, es wird dir gelingen.«
Das Mondlicht hatte Ysas Farben gestohlen, und dennoch war es, als würde sie von innen her glühen.
»Was meinst du damit?«, sagte Milla. »Woran soll ich mich erinnern?«
»Das wirst du selbst herausfinden.«
»Kannst du mir dabei nicht helfen?«
»Ich werde tun, was in meinen Kräften steht. Aber sein Fleisch und Blut bist du!«
Etwas Kühles wehte Milla an, und plötzlich glaubte sie, die vertrauten Gerüche der Lagune zu schmecken.
»Ich möchte nach Murano«, sagte sie, ohne lange nachzudenken. »In unser altes Haus. Aber nicht mit diesem Idioten.«
»Vergiss ihn. Er ist ein Niemand.«
»Du sollst mitkommen! Besorgst du uns ein Boot?«
Ysa lächelte. »Das will ich gern tun. Und jetzt geh zurück, aufrecht und stolz. Du bist die Tochter deines Vaters – vergiss das niemals, Milla!«
Jetzt war es leichter, wieder in den Gastraum zurückzukehren. Salvatore übersah sie einfach für den Rest des Abends, während es Milla gelang, die anderen Gäste anzulächeln. Als es ans Spülen ging, vermisste sie Ysa.
Wo mochte sie hingegangen sein?
In der kleinen Küche stand die Luft, deshalb öffnete Milla das Fenster einen Spaltbreit.
»Unsere Geduld geht zu Ende«, hörte sie jemanden sagen. »Und du bist seine einzige Schwester. Wen, wenn nicht dich, hätte er ins Vertrauen gezogen?«
Verwundert spähte sie hinaus – die drei Männer vom Morgen bedrängten Ysa erneut. Sie waren Glasbläser und durften damit Murano per Dekret eigentlich lediglich zum sonntäglichen Glasmarkt auf der Piazza verlassen. Und doch spazierten sie seit den Morgenstunden unbehelligt in Venedig herum!
»Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß.« Die Tante klang patzig. »Und selbst wenn ihr mich jetzt Tag für Tag ins Verhör nehmt – es wird trotzdem nicht mehr!«
»Wir können auch anders.« Die zweite Stimme klang jünger und schriller. »Bislang haben wir dich verschont. Sollten wir aber annehmen müssen, dass du seinen Verrat …«
»Leandro ist kein Verräter! Wann geht das endlich in eure Spatzenhirne?«, rief Ysa. »Ich bin ja bereit, euch zu helfen. Aber nur, wenn ihr mich das auf meine Weise machen lasst. Sonst wird gar nichts daraus. Habt ihr verstanden? Und jetzt verzieht euch. Ich hatte einen harten Tag und bin hundemüde!«
Ein Brummen, dann waren die Männer verschwunden.
Milla tauchte die Hände zurück ins Spülwasser. Sie würde Ysa fragen, was das alles zu bedeuten hatte – sobald sie beide ungestört waren.
Zweites Kapitel
Die Glocken von San Giovanni Elemoisinario weckten Milla aus einem unruhigen Schlaf. Sie hatte lebhaft geträumt, von Gondeln, blauen Prinzen und fliegenden Katzen, war zwischendrin immer wieder aufgewacht, um erst wieder in tiefen Schlummer zu sinken, als es schon dämmerte. Nachdem sie sich die Müdigkeit aus den Augen gewaschen hatte, fand sie die Wohnung leer vor – was nur bedeuten konnte, dass Mutter und Tante bereits auf dem Markt waren.
Es war ein seltsames Gefühl, allein durch die vollgestopften Räume zu streifen, in denen nun auch noch ihre Möbel untergebracht waren. Zum ersten Mal, seit sie in Venedig lebte, fragte sie sich, wie es wohl für Ysa sein mochte, mit ihnen zu teilen, was zuvor ihr allein gehört hatte. Die Tante war seit Jahren Witwe, und an Gianni, ihren Mann, besaß Milla nur vage Erinnerungen. Wenige Male waren die beiden bei ihnen zu Besuch auf Murano gewesen, die Insel, die ihr Vater als Glasbläser unter höchster Strafandrohung niemals verlassen durfte. Und so war es alles andere als eine Selbstverständlichkeit gewesen, nach Leandros rätselhaftem Verschwinden die mittellose Schwägerin und deren Tochter bei sich aufzunehmen. Ysa jedoch hatte mit ihrem ansteckenden Lachen und einer herzlichen Umarmung Fremdheit oder Peinlichkeit erst gar nicht aufkommen lassen.
Milla wollte gern ein wenig davon zurückgeben, indem sie heute im ippocampo nach dem Rechten sah, bevor die beiden mit ihren Einkäufen zurück waren. So rasch sie nur konnte, schloss sie ihr hellgrünes Mieder mit den widerspenstigen Haken, knotete den Rock in der Taille zusammen und fuhr in die Holzpantinen, die man erst seit Kurzem wieder ohne Strümpfe tragen konnte. Danach rannte sie die Treppen hinunter, um ja die Erste zu sein.
An der Haustür lief sie Signore Cassiano in die Arme, ihrem Vermieter, der immer etwas zu nörgeln hatte.
»Auch schon auf?«, murmelte er griesgrämig. »Eure Taverne soll ja seit Neuestem gesteckt voll sein, wie man hört!«
»Mutter und Tante Ysa würden sich freuen, Euch als Gast im ippocampo begrüßen zu dürfen«, erwiderte Milla diplomatisch.
Eigentlich gehörte zur Taverne auch eine kleine Wohnung, direkt darüber gelegen. Wie viel bequemer wäre diese Lösung gewesen! Doch Cassiano hatte dort eine ältliche Verwandte mit einer Warze am Kinn einquartiert, die an Ausziehen nicht dachte. Stattdessen beschwerte sie sich über Küchendünste, die angeblich ihren Mittagsschlaf störten, vor allem aber über die wachsende Schar hungriger Katzen im Hof, für die sie Milla nicht ganz zu Unrecht verantwortlich machte.
»Das würde meinem empfindlichen Magen wohl kaum bekommen!« Mit einem Mal sah er richtig leidend aus, doch Millas Mitgefühl verschwand rasch wieder, als er weiterredete: »Wenn die Geschäfte so gut laufen, könnt ihr ja auch mehr Miete bezahlen. Richte also deiner Tante aus, dass sie mit meinem Besuch zu rechnen hat!«
Milla nickte knapp und schob sich an ihm vorbei, nicht ohne den Atem anzuhalten, denn er stank aus allen Poren nach Knoblauch, dem er offenbar trotz seiner angeblichen Magenschwäche in riesigen Mengen zusprach.
Venedig war bereits hellwach, das bemerkte Milla sogar auf der kurzen Strecke, die sie bis zur Taverne zurückgelegt hatte. Noch immer waren Scharen von Lastträgern unterwegs, wenngleich Milla deren Gemüsekisten leerer erschienen als sonst. Lediglich die Männer, die das Eis anschleppten, auf dem das fangfrische Meeresgetier angeboten wurde, ächzten unter unvermindert schwerer Ladung. Der dicke Händler mit seinen düsteren Prognosen kam ihr unwillkürlich wieder in den Sinn, doch als die heisere Stimme der Wasserverkäuferin ertönte, bei der sie Stammkunden waren, schob Milla diese Gedanken beiseite.
Wusste der Himmel, wie die Frau ihren brüchigen Karren mit all den Tonkrügen über die zahlreichen Brücken hievte, die sie auf ihrer täglichen Route quer durch die Stadt zu überqueren hatte! Manchmal japste sie so herzzerreißend, wenn sie bei ihnen angelangt war, dass Ysa ihr einen Becher Wein einschenkte, der dann jedes Mal erstaunlich schnell leer getrunken war.
»So ganz allein heute, Mädchen?« Ihr Tonfall verriet abgrundtiefe Enttäuschung.
»Warte!«, rief Milla, die sich plötzlich sehr erwachsen vorkam. »Dein Geld kriegst du heute von mir. Und durstig sollst du auch nicht bleiben müssen.«
Für einen Augenblick glaubte sie aus den Augenwinkeln einen grauen Katzenschwanz zu erspähen, der allerdings blitzschnell wieder verschwunden war. Doch Milla wunderte sich nicht. Alles, was sie in jenem verschwiegenen Garten erlebt hatte, erschien ihr mittlerweile ohnehin einem Traum näher als der Wirklichkeit – leider hatte diese Wirklichkeit sie viel zu schnell wieder eingeholt.
Sie bückte sich nach dem Zweitschlüssel, der für Notfälle in einem Blumentopf lag, und ärgerte sich, als sie beim Umschauen feststellen musste, dass die wieselflinken Augen der Alten sie dabei neugierig verfolgten. Eigentlich sollte niemand von diesem Versteck wissen, das hatten Mutter und Tante ihr eingeschärft. Aber was gäbe es in der kleinen Taverne außer ein wenig Wechselgeld schon zu stehlen?
Milla stieß die Fensterläden auf, ließ die weiche Frühlingsluft hinein und schloss die Vordertür auf. Ein paar Sonnenstrahlen fielen auf den gestampften Boden, der ständig gefegt wurde und doch schon wieder schmuddelig aussah. Zusammen mit der Wasserverkäuferin hievte sie die Krüge in den kleinen Vorratsraum, dann griff sie in Ysas Versteck neben dem Herd und zog ein paar Münzen heraus.
»Hier«, sagte sie. »Für dich.«
Die gichtige Hand blieb so lange fordernd ausgestreckt, bis sie ihr einen Becher Rotwein gereicht hatte. Dann endlich verwandelte sich das Japsen in zufriedenes Brummen.
Da hatte Milla längst zu fegen begonnen, eine einfache Melodie summend, die sie seit ein paar Tagen nicht mehr losließ. Während sie noch einmal über die Tische wischte, spürte sie plötzlich, wie hungrig sie war. Rasch lief sie in die Küche, um die Glut zu entfachen. Danach stellte sie die Eisenpfanne auf die Feuerstelle, goss Öl hinein und schlug ein halbes Dutzend Eier auf, um Savinia und Ysa nach ihrer Rückkehr mit einem Imbiss zu überraschen. Der kräftige Geruch ließ ihren Magen noch lauter knurren, doch plötzlich war es, als wären die Mauern der kleinen Taverne verschwunden.
Jenes Blau – war es wirklich gewesen?
Vielleicht würde sie nach der gestrigen überstürzten Flucht niemals mehr Gelegenheit erhalten, das zu erfahren.
Erneut überfiel Milla das Gefühl von Verlust. Aber wie konnte das sein, wo sie jenen Mann doch kaum kannte?
»Sollte das, was hier gerade in der Pfanne verkohlt, etwa unser Frühstück sein?«
Mutter und Tante waren mit ihren Körben zurück!
»Ich wollte doch nur …«