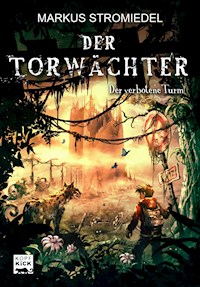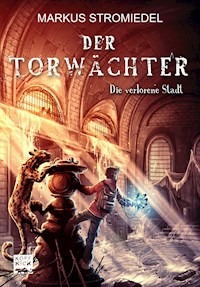Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kick-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Selig
- Sprache: Deutsch
In Kreuzberg wird ein Anschlag auf ein vierstöckiges Mietshaus verübt, nur ein neunjähriger Junge überlebt. Kommissar Paul Selig soll die Wogen in der Öffentlichkeit glätten. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf verschwörerische Machenschaften im Innenministerium. Doch die Drahtzieher schlagen zurück: Durch Manipulation der Daten im System der Terrorabwehr wird Selig vom Jäger zum Gejagten. Ein fast aussichtsloser Kampf beginnt … Feuertaufe von Markus Stromiedel: Spannung pur im eBook!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Stromiedel
Feuertaufe
Politthriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In Kreuzberg wird ein Anschlag auf ein vierstöckiges Mietshaus verübt, nur ein neunjähriger Junge überlebt. Kommissar Paul Selig soll die Wogen in der Öffentlichkeit glätten. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf verschwörerische Machenschaften im Innenministerium. Doch die Drahtzieher schlagen zurück: Durch Manipulation der Daten im System der Terrorabwehr wird Selig vom Jäger zum Gejagten. Ein fast aussichtsloser Kampf beginnt …
Feuertaufe von Markus Stromiedel: Spannung pur im eBook!
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
Epilog
Was ich noch sagen wollte
»Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.«
Artikel 1.1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
Prolog
Der Tod kam in das Haus, als alle schliefen. Nichts kündigte ihn an: nicht das leise Rauschen der nächtlichen Stadt, das durch gekippte Fenster in die Schlafzimmer drang, nicht das blasse Licht des Mondes, das behutsam über die Gesichter der Schlafenden strich. Keine Tür knarrte, kein Hund bellte, kein nächtlicher Spaziergänger schreckte auf und schlug Alarm. Der Tod ließ niemandem eine Chance.
Nur ein Bett, im dritten Stock, war leer.
Die Decke fest über seinen Kopf gezogen, kauerte Yarik in der Ecke seines Verschlages und weinte voller Wut. Wenn er doch nur tot wäre! Dann würden seine Mutter und sein großer Bruder schon merken, was sie an ihm hatten! Yarik zog seine Nase hoch und rieb sich mit dem Ärmel des Schlafanzuges über seine tränennassen Augen. Es war gemein, dachte er, dass Ismael ihn verraten und der Mutter gesagt hatte, er habe sich hinter dem Sofa verborgen! Jetzt würde er morgen der Einzige in ihrer Klasse sein, der den Krimi im Fernsehen nicht angeschaut hatte. Alle würden ihn auslachen.
Er wollte nicht mehr ausgelacht werden!
Yarik schluchzte auf, rollte sich unter der Decke zusammen, zog seine Taschenlampe etwas näher an sich heran. Er würde jetzt sterben, und dann würden sie ihn finden, morgen früh, wenn er nicht in seinem Bett läge, sondern hier unten, tot und kalt. Dann würden sie sehen, was sie davon hatten, ihn so gemein zu behandeln! Er kuschelte sich in sein Kissen, das er aus der Wohnung geschmuggelt und hier hinunter in den Keller geschafft hatte, um sich sein Versteck zwischen den alten Schränken und Kartons gemütlicher zu gestalten. Der Gedanke an seine Rache tröstete ihn ein wenig. Yarik spürte, wie der Schlaf ihn zu umhüllen begann, und erschöpft vom Weinen ließ er sich hineinfallen in diese warme, weit geöffnete Hand.
Ein leises Klirren schreckte ihn auf. Es war dunkel, seine Taschenlampe brannte nicht mehr. Yarik setzte sich auf. Sein Herz klopfte ihm bis zum Hals. Ängstlich lauschte er in die Dunkelheit. Im Keller war es still, auch aus dem Treppenhaus drang kein Laut. Oder waren da Schritte?
Leise schlüpfte Yarik aus seinem Versteck und huschte zum Kellerfenster. Das Licht des Mondes fiel matt durch das staubblinde Glas. Er zog die Holzkiste heran, kletterte darauf, stellte sich auf seine Zehenspitzen und spähte hinaus. Niemand war zu sehen, der nächtliche Platz vor dem Haus war leer. Ein dunkler Wagen stand in der Auffahrt zum Hof, halb verborgen hinter den überfüllten Mülltonnen. Yarik hatte den Wagen noch nie in ihrem Viertel gesehen.
Er hob die Hand, wischte den Staub vom Glas, um das Auto genauer in Augenschein nehmen zu können. Im gleichen Moment stellte sich ein Springerstiefel in sein Blickfeld, keinen Meter von ihm entfernt. Erschrocken fuhr Yarik zurück, sein Fuß trat an den Rand der Kiste, kippte ins Leere, und er verlor das Gleichgewicht. Erst im letzten Augenblick hielt er sich an einem Gasrohr fest, bevor er sich durch den Lärm des Sturzes verraten hätte.
Leise zog er sich auf die Kiste zurück und spähte nach draußen. Der Stiefel war vor dem Kellerfenster stehen geblieben, jetzt beugte sich das Bein, das in dem schwarz polierten Schaft steckte, und eine Hand griff nach den Schnürsenkeln. Fasziniert sah Yarik die winzige Tätowierung auf der linken Hand des Stiefelträgers, in der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger: ein kleiner, fein gearbeiteter Drache. Die rote Zunge des Fabeltiers leckte gierig aus dem geöffneten Maul. Yarik schien es, als lache der Drache ihn an, böse und triumphierend. Dann hatte der Stiefelträger seine Schuhbänder festgezogen, das Bein streckte sich, verschwand wie die Hand mit dem Drachen aus Yariks Blickfeld.
Vorsichtig, jedes Geräusch vermeidend, stieg Yarik von der Kiste und schlich zur Kellertür, drückte sie leise in das Schloss. In den neun Jahren seines Lebens hatte er gelernt, sich vor hochgeschnürten Stiefeln in Acht zu nehmen, vor allem abends und in der Nacht, wenn es gefährlich war, unaufmerksam durch die Stadt zu gehen. Wenn er sich ganz ruhig verhielte, wusste Yarik, dann würde ihn niemand beachten. Er war nichts als ein kleiner Junge, unauffällig und nicht wert, dass man an ihn einen Blick verschwendete, geschweige denn ein Schimpfwort oder einen Schlag. Er würde sich verstecken, bis die Gefahr vorbei war, so wie immer. Denn dass Gefahr herrschte, das spürte er.
Behende schlängelte Yarik sich zwischen den zwei Schränken hindurch in sein Versteck und schob die bereitliegende Pappe vor den Spalt. Dann hockte er sich auf die Matratze, zog die Decke über sich und tastete nach seinem Glücksbringer, einem kleinen Pferd aus Metall, das er immer bei sich trug. Leise, kaum hörbar, begann er zu singen, das Lied, das sein Vater immer gesungen hatte, als er noch lebte und die Mutter noch lachte. Doch die Angst blieb. Yarik spürte, diesmal war etwas anders. Er ahnte, diesmal würde er nicht weglaufen, würde er sich nicht verstecken können.
Er hörte das Knistern erst, als es lauter wurde. Jemand kratzte an der Kellertür, klopfte mit vielen kleinen Händen, um Einlass zu erbitten. Yarik zögerte. Vorsichtig schlich er sich aus seinem Versteck, näherte sich der Tür, legte behutsam sein Ohr an das Holz. Verblüfft zuckte er zurück: Das Holz der Tür war warm! Erstaunt griff er zur Klinke, schob intuitiv den Ärmel seines Schlafanzuges zwischen das Metall und seine Haut und zog die Tür auf. Im gleichen Moment roch er den Rauch. Doch es war schon zu spät: Genährt durch den Sauerstoff, der aus dem Keller in den engen Vorraum unter dem Treppenhaus drang, schossen die eben noch glimmenden Flammen in die Höhe, brüllend und nach Nahrung gierend. Yarik taumelte zurück, mit verbrannten Wimpern und Haaren, sah erschrocken, wie die Flammen zunächst die Kellerstiege und dann die Unterseite des alten Holztreppenhauses erfassten und es anzufressen begannen, schnell und unaufhaltsam, Meter für Meter, als hätte jemand dem Feuer den Weg gebahnt. Dann hörte er die ersten Schreie aus dem Haus.
Panisch sah Yarik sich um. Die Kellertür brannte, ebenso die Vorderseite des Küchenschranks, der sein Versteck zur Tür hin begrenzte. Yarik hustete, duckte sich unter den Qualmwolken, die den Raum zu füllen begannen, hindurch und tastete sich zum Kellerfenster. Die Kiste stand noch dort. Er kletterte hinauf, stellte sich auf die Zehen und streckte sich, doch sein Arm war nicht lang genug, um an den verrosteten Schließhebel des Fensters zu gelangen. Hustend und mit tränenden Augen sah Yarik sich um. Sein Blick fiel auf einen Autoreifen, der in einer Ecke lag. Er sprang von der Kiste, versuchte, den schweren unter einem Stapel alter Decken und Kartons liegenden Pneu hervorzuzerren. Doch der Reifen hing fest, sperrte sich seinem verzweifelten Reißen. Yarik fing an zu weinen.
Das Feuer hatte inzwischen den gesamten Küchenschrank erfasst, gerade sprang es über auf den zweiten Schrank, die andere Seite der Lücke, durch die er so oft geschlüpft war. Yarik sah sein Versteck verbrennen, jenen Ort, an dem er sich immer wieder verborgen und davon geträumt hatte, ganz weit weg zu sein, in einer Welt, in der man ihn wollte und liebte. Er begriff, er würde nicht mehr leben, wäre er jetzt in seinem Verschlag, auf seiner Matratze, unter seiner Decke.
Yarik hustete, er spürte, die Luft zum Atmen wurde weniger und weniger. Ihm schwindelte. Er richtete sich auf, wischte sich seine Tränen aus dem Gesicht. Er wollte nicht sterben! Mit aller Kraft stemmte er sich gegen den festhängenden Reifen, fühlte, wie sich das vom Feuer schon warme Gummi dehnte. Dann, mit einem Ruck, sprang ihm der Reifen entgegen. Mühsam zerrte Yarik ihn zum Fenster und wuchtete ihn auf die Kiste, dann kletterte er hinauf, hustend und taumelnd, dem unter der Decke wabernden tödlichen Qualm entgegen. Er streckte sich, tastete nach dem Griff des Fensters, zerrte an dem klemmenden Hebel. Nichts rührte sich. Yarik hustete, zerrte erneut, rüttelte an dem verrosteten Mechanismus, wieder und wieder. Er spürte, es wurde warm an seinen Beinen, die Kiste hatte zu kokeln begonnen, und das Gummi des Reifens begann zu qualmen. Yarik sah nicht hinab, zerrte weiter, benommen vom Rauch und der Hitze. Dann sprang der Riegel zurück, und das Fenster schwang auf.
Gierig sog Yarik den Sauerstoff ein, der durch die Fensteröffnung in den Keller drang, so wie auch das Feuer den Sauerstoff gierig aufsog. Mit einem Knall schossen die Flammen in die Höhe, schlugen an die Decke und weiter die Kellerstiege hinauf bis hoch in das Treppenhaus, wo sie sich mit den anderen Brandherden zu einer meterhohen Feuersäule verbanden. Yarik spürte, wie seine Kleidung zu brennen begann. Im gleichen Moment gab die Kiste unter ihm nach. Hustend, die tränenden Augen zusammengekniffen, griff Yarik zu, er packte den Rahmen des Fensters, hielt sich fest. Mit den Füßen verzweifelt an der Wand entlang kratzend, versuchte er sich hinaufzuziehen, während das heiß werdende Metall des Fensterrahmens seine Handflächen zu verbrennen begann. Entsetzt spürte Yarik, seine Kraft ließ nach. Verzweifelt krallten sich seine Finger um die Kante des Rahmens. Dann ertastete sein rechter Fuß einen Vorsprung im Mauerwerk. Mit letzter Kraft stemmte Yarik sich ab, drückte seinen Oberkörper durch die Öffnung hinaus ins Freie. Erleichtert spürte er den kühlen Erdboden unter seinen blutigen Händen. Er zog die Beine durch das Fenster, riss sich die brennenden Hausschuhe von den Füßen, ebenso seinen Schlafanzug, der sich in der Hitze zusammengezogen hatte und qualmend kokelte. Nackt bis auf seine Unterhose kroch Yarik vom Haus fort, immer weiter, er spürte nicht die Scherben unter seinen Händen, die auf dem Boden lagen, er kroch und kroch, bis er fühlte, dass die Hitze hinter ihm nachließ. Dann hielt er inne und drehte sich um.
Das große vierstöckige Gebäude stand komplett in Flammen. Aus den Fenstern des Treppenhauses loderten sie wie Feuerwesen, die einen wilden Tanz aufführten und hinaus in die Nacht sprangen. Auch aus anderen Fenstern züngelte das Feuer. Yarik sah hinauf zum dritten Stock, dorthin, wo er lebte, mit seiner Mutter, seinem Bruder, seiner Schwester. Die Fenster waren unversehrt. Doch hinter den Glasscheiben flackerte rot der Schein der Flammen, die in der Wohnung wüteten. Dann sah er die Mutter: eine brennende Gestalt. Die Arme hochgerissen, taumelte sie zum Fenster, schwankte und fiel zur Seite, den Vorhang mit sich reißend. Im selben Augenblick platzte das Glas in der Hitze des Feuers, die Flammen schossen heraus. Dann zerbarst das Glas des zweiten Fensters, des dritten, des vierten.
Regungslos starrte Yarik hinauf, unfähig, das Gesehene zu begreifen. Er setzte sich, schlang die Arme um seine Beine und begann leise zu singen, seinen Körper im Takt der Melodie wiegend, den Blick starr auf das brennende Haus gerichtet.
Er sang noch, als die Feuerwehrleute ihn fanden.
Erster Teil
Ein halbes Jahr zuvor, am 17. April, zehn Monate nach dem ersten Anschlag
1
Es war ein Tag so wie viele andere zuvor: grau und regnerisch, die aufgehende Sonne irgendwo hinter den dichten Regenwolken, ein Tag der müden Blicke aus viel zu warmen Betten, ein Tag des hunderttausendfachen Wunsches, sich einfach umzudrehen und weiterzuschlafen.
Es war der Tag des Sündenfalls.
Hauptkommissar Paul Selig hatte frei an diesem Tag, die Reparatur des Hausdaches stand an, er wollte mit seinem Sohn zum Baumarkt. Sie frühstückten lange.
Seine Kollegin Maria saß im Büro und starrte missgelaunt auf die Akten, die sich auf ihrem Schreibtisch stapelten. An diesem Tag fragte sie sich das erste Mal, ob ihre Entscheidung, in Seligs Ermittlungsgruppe zu wechseln, die richtige gewesen war.
Auch Dirk Rüther, Polizeisprecher und Kontaktbeamter des Polizeipräsidenten, war missgelaunt, er hatte ein Grußwort für seinen Chef zu schreiben, eine Aufgabe, die er schon Wochen vor sich herschob und die an diesem Tag erledigt sein musste.
An diesem Tag ging ein gutaussehender muskulöser Mann auf das Kanzleramt zu, festen Schrittes, die Augen auf sein Ziel gerichtet. Er erreichte die Pforte, zeigte seinen Ausweis, lächelte, betrat das Innere des sorgfältig gesicherten Areals. Er war einer der wenigen, die wussten, dass dieser Tag alles ändern würde.
2
Susanne Bergstedt stand am Fenster ihrer Wohnung im obersten Stock des Kanzleramts und starrte hinaus. Es hatte zu regnen begonnen, ein feiner nasser Nebel, den der Wind in dichten Wolken über den Tiergarten trieb, ostwärts hetzenden Fliegenschwärmen gleich.
Gerade passierten die gepanzerten Mannschaftswagen des Spezialkommandos des Bundeskriminalamts den Tiergarten, dunkle, feucht glitzernde Käfer, die aus den Straßen des Regierungsviertels hervorgekrochen waren und sich zu einer Reihe formiert hatten, um am Holocaust-Denkmal vorbei in den Schluchten des Potsdamer Platzes zu verschwinden. Zwei Wagen mit je acht Polizisten waren am Platz der Republik zurückgeblieben, als Wache, falls die Demonstranten zurückkehren sollten.
Susanne Bergstedt wandte sich ab, ging hinüber in die großzügige offene Küche und trank einen Schluck Tee, den sie sich aus ihrem Büro mit hinaufgenommen hatte. Er war kalt und schmeckte bitter. Sie seufzte und stellte die Tasse in die Mikrowelle. Dann aß sie den Obstsalat, den ihre Büroleiterin in die Wohnung hatte bringen lassen.
Ein knappes halbes Jahr war es her, dass sie mit den Stimmen ihrer Partei zur Bundeskanzlerin gewählt worden war, als Nachfolgerin des gestürzten Bachstein, der noch am Abend der Bundestagswahl seinen Verzicht auf das Amt erklärt hatte. Er wolle Platz machen für einen Neuanfang, hatte es geheißen. Bachstein war nach Brüssel geschickt worden, während sie von den Parteistrategen als ideale Verkörperung dieses Neuanfangs auserkoren worden war. Zwar galt sie in ihrer Partei als blass und unbequem. Nach dem Skandal um den manipulierten Wahlkampf jedoch, der Deutschland erschüttert hatte, waren Werte wie Prinzipientreue, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit plötzlich wertvolle Eigenschaften, die sie aus der zweiten Reihe der Partei an die Spitze der Republik katapultiert hatten.
Es klopfte, dann betrat ihre Büroleiterin die Wohnung, Bea Traub, ihre rechte Hand seit ihrer Berufung zur Staatssekretärin im Gesundheitsministerium vor bald zwölf Jahren. Susanne Bergstedt wandte sich um und sah sie fragend an.
»Die Hauptwache meldet, Herr Keppler ist eingetroffen.«
»Und Weyland?«
»Wartet in Ihrem Büro.« Bea Traub zögerte. »Er lässt ausrichten, dass er nicht den ganzen Tag Zeit habe.«
Nichts in Susanne Bergstedts Miene verriet, was sie über die respektlosen Worte des Innenministers dachte. »Richten Sie ihm aus, ich bin gleich bei ihm. Und bringen Sie Herrn Keppler zu uns, sobald er oben ist.«
Die Büroleiterin nickte und verließ die Wohnung.
Einen Augenblick stand die Kanzlerin regungslos, drei exakte Sekunden, ein Ritual, das ihr half, sich zu konzentrieren. Dann hob sie ihren Kopf, und mit ruhigen Schritten ging sie hinüber zur Tür.
»Wenn Sie den Einsatzbefehl geben, sind wir in zwölf Stunden kampfbereit.« Den Körper gestrafft, stand Matthias Keppler in der Mitte des einhundertvierzig Quadratmeter großen Büros und beantwortete ruhig die Fragen, die ihm gestellt wurden.
Nachdenklich betrachtete Susanne Bergstedt den Einsatzleiter der neuen Antiterroreinheit. Sympathisch und mit festem Blick schien Keppler wie von Hollywood gecastet, das Idealbild eines Elitesoldaten im Kampf gegen den Terror: souverän und zu allem entschlossen. Seine muskulöse Statur und mehr noch seine Haltung verliehen ihm Präsenz, und er wirkte gelassen, so als ob ihn der Anlass ihrer Zusammenkunft nicht weiter berührte. Nur ein unterhalb seines rechten Auges zuckender Muskel verriet seine innere Anspannung.
Die neue Antiterroreinheit, deren erster Einsatzgruppe Keppler vorstand, war auf Initiative des Innenministers Horst Weyland gegründet worden. Von Protesten unbeirrt, hatte Weyland den Kampf gegen den Terror dazu genutzt, mit neuen von ihm entworfenen Sicherheitsgesetzen seine Macht noch weiter auszuweiten. Unter dem Schock der Terroranschläge in Berlin, Hamburg und Wiesbaden hatte der Innenminister sein Gesetzespaket durch das Parlament gepeitscht, ohne dass einer der Abgeordneten begriffen zu haben schien, dass Weyland dem dreigeteilten System aus Parlament, Polizei und Gerichtsbarkeit eine vierte Macht beistellen werden würde, die ohne Kontrolle durch die anderen handeln konnte. Der Aufbau der neuen Antiterroreinheit, zuvor eine Unterabteilung der Bundespolizei, war eine der ersten Anordnungen, die Weyland auf der Basis der neuen Gesetze erteilt hatte.
Die Kanzlerin ging zu ihrem Schreibtisch, setzte sich und öffnete die Akte, die auf der Arbeitsfläche lag. »Und Sie sind sich sicher, dass die neuen Sicherheitsgesetze Ihren Einsatz rechtfertigen?«
Keppler nickte. »Paragraph 4 Absatz 3 ist eindeutig formuliert. Die Juristen des Innenministeriums haben es noch einmal geprüft.«
»Es ist ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der – wie sagten Sie? Der betroffenen Zielpersonen.«
Keppler wollte antworten, doch ein ärgerliches Schnauben aus der Tiefe des Büros unterbrach ihn. »Welche Persönlichkeitsrechte?« Schwerfällig erhob sich Innenminister Horst Weyland aus seinem Sessel. »Wir reden von Terroristen. Von Menschen, die unsere Freiheit und unser Leben bedrohen.«
»Es sind Deutsche.«
»Die im Ausland in Terrorcamps ausgebildet wurden.«
»Können wir ihnen das nachweisen?«
»Worauf sollen wir warten? Auf den nächsten Anschlag? Wir müssen uns verteidigen! Falsche Rücksichtnahme schadet nur.«
Nachdenklich lehnte Susanne Bergstedt sich zurück, während sie über die Worte des Innenministers nachdachte. Horst Weyland war ein alter Fuchs im politischen Geschäft, der Dienstälteste ihrer Regierung. Er war ihr Berater im Hintergrund, auf Druck des Parteivorstands, der um Weylands Raffinesse und Kaltschnäuzigkeit wusste – Eigenschaften, die Susanne Bergstedt abgingen. Sie wusste, Weyland hatte selbst Ambitionen gehabt, Kanzler zu werden. Doch in dem Wirbel um den manipulierten Wahlkampf, den Weylands persönliche Referentin zu verantworten hatte, hatte er froh sein müssen, sich auf seinem Posten halten zu können.
Langsam schüttelte die Kanzlerin den Kopf.
Weyland sah es überrascht. Er wandte sich an Keppler. »Lassen Sie uns bitte allein!«
Keppler deutete eine knappe Verbeugung an und verließ, ohne eine Miene zu verziehen, den Raum. Weyland wartete, bis sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. Dann drehte er sich um, sah ungehalten die Kanzlerin an. »Was soll das heißen, Susanne?«
»Ich finde das Vorgehen unangemessen.«
»Unangemessen?« Weyland war ehrlich verblüfft. »Du selber hast die neuen Sicherheitsgesetze mit verabschiedet. Und jetzt willst du sie nicht nutzen?«
»Die Existenz eines Gesetzes alleine rechtfertigt nicht seine Anwendung.«
Erneut schnaubte Weyland ärgerlich. »Wir können nicht von einem Kreuzzug reden und dann einen Kuschelkurs fahren! Es geht um die Sicherheit unseres Staates!« Eindringlich sah der Innenminister sie an. »Susanne, wir foltern sie nicht. Wir stecken sie nicht ins Gefängnis. Wir wollen sie nur überwachen. Das ist alles.«
»Und wenn etwas schiefgeht? Wenn jemand zu Schaden kommt? Man würde uns zerreißen. Und das zu Recht.«
»Es wird nicht passieren.«
»Kannst du das garantieren?«
Stille breitete sich im Raum aus.
Weyland nickte langsam. »Gut, machen wir einen Test. Wir suchen uns eine Zielperson, die mit Sicherheit schuldig ist.«
»Das wissen wir von keinem der Männer.«
»Ich dachte auch nicht an die Terrorverdächtigen auf der Liste des Bundeskriminalamts. Ich dachte an einen Kriminellen.«
Die Kanzlerin runzelte die Stirn. »Und wie soll das gehen? Die Strafverfolgung gehört in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft. Und die ist Sache der Länder.«
Weyland grinste. »Warum sollten wir unser Know-how nicht der Polizei zur Verfügung stellen? Wir teilen die Technik. Und die Verantwortung.« Er ärgerte sich, nicht eher auf diesen Gedanken gekommen zu sein.
Die Tür öffnete sich leise, die Büroleiterin betrat den Raum. »Die Vertreter der Afrikanischen Allianz warten im Sitzungssaal.«
Die Kanzlerin quittierte den Hinweis mit einem Nicken. Dann ging sie zu ihrem Schreibtisch, klappte die dort liegende Akte zu und reichte sie Weyland. »Tu’s. Aber ich weiß nichts davon. Das ist deine Sache.«
Weyland nahm die Akte und sah der Kanzlerin nach, die nun mit schnellen Schritten ihr Büro verließ.
Sie lernt schnell, dachte er nicht ohne Achtung. Er ahnte, bald würde sie ihn nicht mehr brauchen.
Ihm blieb nicht mehr viel Zeit.
Die Sonne brach gerade durch die Wolken, als der Chauffeur des Innenministers den Wagen vor dem Portal des neuen Ministeriums vorfuhr. Ohne den imposanten Bau eines Blickes zu würdigen, stieg Weyland aus und betrat das Gebäude. Anders als noch am Morgen standen keine Demonstranten vor dem Haupteingang, die Polizei hatte die ungenehmigte Versammlung aufgelöst, auf Weylands persönlichen Wunsch: Er verabscheute es, von den Proleten des Landes, wie er die Demonstranten im kleinen Kreis nannte, belästigt zu werden.
Matthias Keppler, der aus dem Kanzleramt mit hierhergefahren war, folgte Weyland in das Ministerium.
Der Expressaufzug brachte sie direkt in die Skyhall im obersten Stockwerk, eine lichtdurchflutete Halle aus Glas, die in einen offenen Dachgarten überging. Die Sonnenstrahlen brachen sich in den mit Tausenden von Regentropfen benetzten Scheiben, eine Kaskade aus Farben und Licht, die Keppler blinzeln ließ.
Der Innenminister durchmaß mit großen Schritten die Skyhall, reichte seiner bereitstehenden Sekretärin den Mantel, orderte Kaffee und stieß die Tür zu seinem Büro auf. Ohne innezuhalten, ging er zum Besprechungstisch, setzte sich, wartete, bis auch sein Begleiter Platz genommen hatte.
Er hatte Keppler in einem Trainingszentrum der GSG9 kennengelernt. Keppler war dort für die Auswahl neuer Bewerber zuständig gewesen, ein noch junger Ausbilder, der zuvor in zahlreichen Einsätzen brilliert hatte und für seine Härte und Zielstrebigkeit bekannt war. Anders als seine Vorgänger hatte er die neuen Aspiranten nicht unter den Beamten der Bundespolizei rekrutiert, sondern war, indem er die Dienstvorschriften umging, direkt in die Polizeischulen gegangen, um junge unverbrauchte Kämpfer, wie er es nannte, für die Elitetruppe der Polizei zu gewinnen.
Keppler setzte sich, sah Weyland abwartend an.
Der Innenminister schwieg, bis die Sekretärin zwei Tassen Kaffee auf den Tisch gestellt hatte und zurück in das Vorzimmer gegangen war. Dann berichtete er von der geplanten Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei.
Keppler war entsetzt. »Jemand aus dem Polizeipräsidium soll den Einsatz leiten? Ein Sesselfurzer?«
»Verstehen Sie nicht? Es ist auch in Ihrem Interesse.«
»Aber ich geh da rein! Ich trage das Risiko!«
»Und er die Verantwortung. Besser geht’s nicht! Oder wollen lieber Sie einen Kopf kürzer gemacht werden, wenn der Einsatz schiefgeht?«
Schweigend mahlten Kepplers Kiefer aufeinander.
Der Innenminister betrachtete sein Gegenüber nachdenklich, während er einen Schluck aus seiner Tasse nahm. Muskulös und breitschultrig, wirkte Keppler in dem gestylten Ambiente des Ministeriums seltsam hilflos wie ein aus dem Krieg zurückgekehrter Soldat, der sich mit Anzug und Krawatte als Zivilist verkleidet und mit Mühe versucht, im Alltag zurechtzukommen. Doch Weyland wusste, ihn zu unterschätzen wäre fatal. Keppler war mehr als nur ein spezialisierter Elitekämpfer: Er war, wie Weyland fand, die perfekte Mischung aus Instinkt und Intellekt, mit der notwendigen emotionalen Fähigkeit, Gefühle wie Mitleid oder Skrupel auszublenden. Beeindruckt von Kepplers Entschlossenheit, hatte Weyland ihn an die Spitze seiner neuen Antiterroreinheit geholt und ihm den Auftrag gegeben, eine schlagkräftige Truppe aufzubauen. Er tat es im Bewusstsein, eine Waffe zu schaffen, die nicht einfach zu kontrollieren war. Doch er war fest davon überzeugt, dass sie nur dann den Kampf gegen den Terror gewinnen konnten, wenn sie sich der gleichen Mittel bedienten wie ihre Gegner.
Keppler sah auf. Seine Kieferknochen standen still. Er nickte. »Gut. Soll er glauben, er ist der Chef.«
Weyland lächelte zufrieden. »Sehr schön.« Er stand auf. »Ich habe den Kontaktbeamten des Polizeipräsidenten angefordert. Er ist perfekt für diesen Job. Sie werden keine Probleme mit ihm haben.«
Auch Keppler erhob sich.
Weyland ging zur Tür, öffnete sie, sah Keppler auffordernd an. »Warten Sie bitte nebenan, bis ich sie hereinrufe! Dann stelle ich Ihnen Dirk Rüther vor.«
3
Leise, wie von einer unsichtbaren Hand bewegt, drehte sich die schwere Stahltür in ihren Angeln und schwenkte zurück in die Türöffnung. Ein leises Surren, dann griffen die Zahnräder im Inneren des Stahlmantels ineinander, schoben vier fettglänzende Riegel in den Türrahmen. Ein letztes Klicken, dann war es still.
Neugierig sah Dirk Rüther sich um. Am Morgen noch hatte er im Polizeipräsidium in seinem Büro gesessen und lustlos das Grußwort des Polizeipräsidenten zur Jahrestagung der Berliner Industrie- und Handelskammer geschrieben. Jetzt, vier Stunden später, war er dabei, in einen Bereich der Stadt vorzudringen, der ihm verboten schien und von dem er nicht einmal geahnt hatte, dass es ihn gab.
Er hatte den Innenminister nur kurz gesehen, eine Begegnung so lang wie ein Händedruck, dazu einige joviale Worte, die keinen Raum ließen für die Fragen, die Rüther bewegten. Dann hatte der Minister die Tür geöffnet und ein missmutiges Muskelpaket hereingewunken, das sich als Matthias Keppler vorgestellt und Rüther mit einer Kopfbewegung aufgefordert hatte, ihm zu folgen. Schweigend waren sie vom Innenministerium Richtung Hauptbahnhof gefahren, am Schifffahrtskanal entlang bis zur nördlichen Einfahrt des Tiergartentunnels, der den Hauptbahnhof und das Regierungsviertel unterquerte. Kurz darauf hatte Keppler den Wagen in der Tiefgarage unterhalb des Bahnhofs abgestellt und war ausgestiegen, um zu einer unauffälligen Tür zu gehen, die in einer Ecke der Garage in die Wand eingelassen war. Rüther hatte Mühe gehabt, ihm zu folgen.
Die Treppe, die sich hinter der schweren Stahltür verbarg, führte hinab zu einem kleinen Raum, der an einer zweiten Stahltür endete. Auch hier war ein Nummernblock montiert, dazu ein Handscanner.
Keppler legte die Linke auf die in die Wand eingelassene Glasfläche und tippte mit der Rechten einen Code auf dem Nummernfeld. Ein Licht blitzte auf, dann ertönte ein leises Tonsignal, gefolgt von einem Klicken, und die Tür öffnete sich. Keppler bedeutete Rüther mit einer Handbewegung, in das Zentrum der unterirdischen Anlage einzutreten. Gespannt folgte Rüther der Aufforderung.
Der im Halbdunkel liegende Raum, der sich hinter der Schleuse auftat, war überraschend groß. Rüther brauchte einen Moment, bis sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten. Wie in der Steuerzentrale einer Raketenbasis waren eine größere Anzahl von Computerarbeitsplätzen in drei langen halbrunden Reihen hintereinander angeordnet. Die Wand an der vorderen Breitseite des Raumes, auf die die Arbeitsplätze ausgerichtet waren, bedeckte ein riesiger Flachbildschirm, der wiederum von einer Doppelreihe kleinerer Bildschirme umrahmt war. Die Monitorwand war dunkel, alle Bildschirme waren ausgeschaltet genau wie die Computermonitore vor den verlassenen Arbeitsplätzen. Einige der Tische waren noch mit Schutzhüllen aus Kunststoff bedeckt, offenbar waren sie unbenutzt und warteten darauf, in Betrieb genommen zu werden.
Nur ein Monitor am Rand der zweiten Reihe war erleuchtet. Ein Techniker saß vor dem Computer, ein graugesichtiger Mann, der konzentriert auf den Bildschirm blickte und auf der Tastatur arbeitete, ohne den Blick zu senken.
Neugierig sah Rüther sich um, sich einmal um seine Achse drehend. »Was ist das hier?«
Keppler antwortete widerwillig. »Die neue Überwachungszentrale.« Ohne eine weitere Erklärung ging er hinüber zu dem beleuchteten Computerarbeitsplatz. Rüther folgte ihm.
Der Graugesichtige unterbrach seine Tätigkeit und sah auf. Keppler nickte ihm wortlos zu. Mit einer schnellen Bewegung tippte der Techniker eine Tastenkombination auf der Tastatur, einen Lidschlag später tauchte das Bild eines kahlköpfigen Mannes auf dem Monitor auf. Ein weiterer Befehl, die Wand an der Breitseite des Raumes leuchtete auf, und das Gesicht des Mannes erschien auf dem großen Flachbildschirm.
»Hugo Valdez.« Keppler wies auf das Foto. »Achtundfünfzig Jahre alt. Spanier, aus Madrid. Kopf eines international agierenden Kartells: Waffen, Drogen, Produktpiraterie – alles, womit man Geld verdienen kann. Wenn unsere Informationen stimmen, kommt er heute nach Berlin.«
Rüther betrachtete das so harmlos wirkende Gesicht des Spaniers, der mit einem leicht spöttischen Lächeln auf sie herabsah. »Warum er?«
Keppler überging die Frage. Er rief auf dem Bildschirm einen Stadtplan auf, in dem ein roter Punkt blinkte. »Dort ist die mobile Basis, von der aus der Einsatz gegen Valdez geleitet wird. Später, wenn die Leitungen geschaltet sind und die Zentrale in Betrieb ist, können wir solche Einsätze direkt von hier aus steuern.«
»Und was ist meine Aufgabe?«
»Dieser Fall gehört in die Zuständigkeit der Polizei. Als Kontaktbeamter des Polizeipräsidenten leiten Sie die Aktion.« Keppler verzog keine Miene. »Gitzinger wird Ihnen alles erklären.«
Der Techniker nickte.
»Und wo werden Sie sein?«
Keppler lächelte schmallippig. »Einer muss ja raus an die Front. Computer alleine reichen nicht.« Wortlos wandte er sich ab und ging davon, bis sein massiger Körper mit der Dunkelheit des Raumes verschmolz. Ein Klicken, eine Tür an der Seitenwand öffnete und schloss sich wieder. Dann war es still.
Ein wenig hilflos stand Rüther hinter dem Computertechniker, der gerade mit einem Tastendruck den Computer herunterfuhr und den Bildschirm ausschaltete. Noch während Rüther darüber nachdachte, was er nun sagen solle, drehte der Techniker sich zu ihm um.
»Ich fahr Sie rüber.«
Keppler verließ die Einsatzzentrale, in der Hand den Koffer mit seiner Ausrüstung. Er hatte den westlichen Treppenschacht gewählt, weniger, um Rüther nicht zu begegnen, als vielmehr, um unauffällig an seinen Einsatzort zu gelangen. Mit schnellen Schritten stieg er die Betonstufen hinauf, hielt in der Schleuse am Ende der Treppe seine Hand vor den Taststrahl des Scanners und tippte seinen Code ein. Ein kurzes Tonsignal ertönte, der Zentralcomputer gab den Weg frei hinaus in das Untergeschoss des Hauptbahnhofes. Keppler schlüpfte durch den Türspalt, sah sich kurz um: Niemand beachtete ihn. Er wartete, bis die Hydraulik die Tür wieder verschlossen hatte. Dann ging er den Bahnsteig entlang in Richtung der Rolltreppen.
Ein Fernzug fuhr ein, Momente später war die eben noch leere Plattform mit Reisenden gefüllt, Menschen, die Taschen, Rucksäcke und schwere Koffer wuchteten oder einfach nur dort stehen blieben, wo sie den Waggon gerade verlassen hatten, und den Kopf in den Nacken legten. Sie waren überwältigt von der Imposanz des Bahnhofs, welche sich selbst hier unten vermittelte, trotz der billigen Deckenverkleidung, die ein vor Jahren an sich selbst gescheiterter Bahnchef hier hatte einziehen lassen. Leuchtende Säulen strebten von den Bahnsteigen gen Himmel, in deren Inneren Fahrstühle, strahlenden Lichtkörpern gleich, zu den oberen Geschossen glitten. Daneben streckten sich wie Leuchtfinger die Rolltreppen den Reisenden entgegen und trugen sie in einem stetigen Strom hinauf in die Haupthalle. Mit jedem Meter, den sie überwanden, öffnete sich den Staunenden ein riesiger Raum unter einem gewaltigen Glasdach, das einer Kirche würdig gewesen wäre und die Halle zur Kathedrale erhob. Ein vielsprachiges Stimmengewirr flirrte durch die Luft.
Keppler, der sich unter die Reisenden gemischt hatte, hatte kein Auge für die Schönheit der Architektur. Seine Gedanken kreisten.
Was für ein Idiot!
Unwillkürlich griff er seinen Koffer fester, als er an Rüther dachte. Er hatte sich erkundigt: Rüther war als Sprecher des Polizeipräsidenten bekannt für sein eloquentes Auftreten und sein geschicktes und berechnendes Taktieren innerhalb des Polizeiapparates. Als Verwaltungsbeamter hatte er jedoch keinerlei operative Erfahrung. Undenkbar, dass ein Bürohengst mit Schwielen am Arsch ihm sagen wollte, was er zu tun habe!
Keppler dachte an die Worte des Innenministers, Rüther sei nicht wirklich ernst zu nehmen. Er riss sich zusammen, zwang sich, sich auf den vor ihm liegenden Einsatz zu konzentrieren. Von seiner Vorbereitung, wusste er, hing der Erfolg ihrer Arbeit ab. Er versprach sich viel von diesem Tag: Die Aktion gegen Valdez würde der Beweis sein, dass ihre Einsatztruppe schlagkräftig war und effektiv die ihr gestellten Aufgaben löste.
Den Fluss der Reisenden kreuzend, ging Keppler hinüber zum U-Bahnhof und fuhr die Rolltreppe hinab zum Bahnsteig der U-Bahn-Linie 55. Ein Zug wartete mit offenen Türen. Keppler entwertete eine Fahrkarte und bestieg einen der Waggons. Kurz darauf schlossen sich die Türen, und die Bahn fuhr an.
Seit knapp zwei Wochen war die U-Bahn-Linie wieder in Betrieb; nach dem Attentat hatte es fast ein Jahr gedauert, den zerstörten Schacht unterhalb des Platzes der Republik instand zu setzen. Die inzwischen bis zum Alexanderplatz verlängerte Strecke war seit ihrer Wiedereröffnung vor allem bei Besuchern aus Japan sehr beliebt, die mit wohligem Grusel vom Hauptbahnhof aus unter dem Bundestag vorbei bis zum Brandenburger Tor fuhren und sich dabei auf ihren Handys Videos vom Attentat ansahen, kurze Filme, die im Internet kursierten und zumeist gefaked waren, was aber niemanden zu stören schien.
Sechs Minuten später verließ Keppler die U-Bahn am Pariser Platz, gemeinsam mit einer Gruppe japanischer Schülerinnen, deren Wangen rot waren von der Aufregung, die sie während der Fahrt erfasst hatte. Er mied die Gruppe, stieg stattdessen, immer zwei Stufen nehmend, die Treppe hinauf zur Oberfläche. Dann blieb er stehen und sah sich um.
Das Brandenburger Tor erstrahlte in poppigen Farben, das Wahrzeichen Berlins war mit der Werbung für eine Kreditkarte verhüllt worden, ein Spektakel, das der ewig klammen Stadt eine knappe Million Euro einbrachte und die geplante Schließung der städtischen Seniorenbegegnungsstätten um zwölf Monate verschob. Keppler widmete der aufdringlichen Verkleidung nur einen kurzen Blick: Seine Aufmerksamkeit galt dem Hotel an der Südostseite des Platzes, einem großen Bau direkt neben der Akademie der Künste. Die Fassade imitierte mit ihren neoklassizistischen Gesimsstreifen scheinbar bessere Zeiten und wirkte einladend und großzügig, obwohl sich die Geschosse dahinter auf Neubauhöhe duckten, um eine größere Anzahl von Hotelzimmern im Inneren des Hauses unterzubringen. Gerade fuhr ein schwerer Geländewagen vor dem Portal vor, der doorman öffnete die Tür, ließ den Fahrer aussteigen und nahm den Schlüssel entgegen, während ein livrierter Hoteldiener sich um das Gepäck kümmerte.
Keppler blickte auf die Uhr: Noch vier Stunden. Es würde knapp werden, aber es war zu schaffen. Er tastete nach der Waffe, die er in die rechte Tasche seiner Jacke gesteckt und dort mit der Lederschlaufe gesichert hatte. Dann griff er nach seinem Koffer, ging quer über den Platz auf den Hoteleingang zu und betrat an dem grüßenden doorman vorbei die Halle.
4
Behutsam drückte Keppler die Tür des Putzraumes, in dem er sich umgezogen hatte, einen Spalt auf und schaute hinaus. Der Gang im Untergeschoss des Hotels lag verlassen da, nichts rührte sich. Wie aus weiter Ferne war Stimmengemurmel zu hören, ein vielsprachiges Wispern, das vermutlich durch die Rohre der Klimaanlage aus der Eingangshalle des Hotels hierhergetragen wurde.
Keppler schlüpfte durch den Spalt, schloss die Tür leise hinter sich und ging an den Kühlräumen vorbei zum Personaltreppenhaus, während er die Uniform, die er trug, zurechtzog. Die Etagenkellnerlivree saß schlecht, sehr zu seinem Missfallen, sie war zu schmal geschnitten für seinen durchtrainierten Körper. Er hasste es, unzulänglich ausgerüstet zu sein.
Ein junger Aushilfskoch verließ den Lagerraum und kam Keppler entgegen, auf dem Arm eine vollgepackte Gemüsekiste. Sich seine Anspannung nicht anmerken lassend, trat Keppler zur Seite und nickte dem Koch kurz zu. Der junge Mann lächelte zurück und gab eine Reihe von schiefen Zähnen frei, während er die Kiste an Keppler vorbeitrug.
Das Personaltreppenhaus war schmucklos, die Form folgte dem Zweck wie alles hinter den Kulissen des Hotels. Die neonerleuchtete Sachlichkeit in den Versorgungsgängen stand in scharfem Kontrast zu der gediegenen Eleganz, die im Gästebereich herrschte und mit der die Innenarchitekten an eine Zeit anknüpfen wollten, die der Bau nie erlebt hatte.
Keppler wollte das Treppenhaus gerade betreten, als ihm ein auf Hochglanz polierter Servierwagen auffiel, der im Gang vor dem Personalfahrstuhl stand. Ein großer Obstkorb war auf dem mit einem weißen Überwurf bedeckten Wagen drapiert. Ohne zu zögern griff Keppler sich den Wagen, schob ihn in die offen stehende Fahrstuhlkabine und betätigte den obersten Knopf des Bedienpanels. Leise schlossen sich die Türen.
Wenig später hatte er das fünfte Stockwerk des Gebäudes erreicht. Mit einem leisen »Pling« öffneten sich die Türen. Keppler schob den Servierwagen hinaus in den Hotelflur und orientierte sich. Nur wenige Türen gingen von dem Gang ab, dazwischen standen an Antiquitäten erinnernde Möbel, auf denen dezente Trockenblumengestecke Staub fingen. Ein schwerer Teppich bedeckte den Boden. Kein Laut war zu hören.
Die Suite, die Valdez gebucht hatte, lag links vom Fahrstuhl am Ende des Flurs. Keppler nahm den Wagen und schob ihn den Gang hinab, blickte, als er die Tür der Suite erreicht hatte, auf die Uhr. Ihm blieb nicht viel Zeit: Um sechzehn Uhr musste er das Hotel wieder verlassen haben. Er klopfte, sah sich kurz um und schob dann den vorbereiteten Schlüssel in das Schloss. Mit einem leisen Klicken glitten die Zapfen in die Vertiefungen des Schlüsselbarts. Momente später stand er im Inneren der Zimmerflucht, die sich hinter der Tür verbarg. Er horchte kurz, bevor er den weißen Überwurf des Servierwagens anhob und die Tasche hervorholte, die er darunter abgestellt hatte. Ein Schraubendreher lag in einem der Fächer bereit. Keppler nahm ihn, warf ihn kurz in die Luft und fing ihn geschickt wieder auf, die einzige übermütige Bewegung, die er sich erlaubte. Dann begann er mit geübten Griffen, die Vertäfelung über dem Durchgang zum Esszimmer der Suite zu lösen.
Plötzlich hörte er ein Geräusch an der Tür. Keppler erstarrte. Eilig drückte er die halbgelöste Vertäfelung zurück und schob mit einem Fuß die Tasche hinter die Sitzgruppe. In der gleichen Sekunde drehte sich ein Schlüssel im Schloss, und die Tür der Suite öffnete sich. Eine junge Frau betrat den Raum, ein Zimmermädchen, wie er an ihrer Kleidung erkannte. Sie brachte zwei Bademäntel und einen Stapel Handtücher. Als sie Keppler sah, fuhr sie erschrocken zusammen.
Keppler setzte ein entspanntes Lächeln auf, während er den Schraubendreher in die Tasche seiner Uniformjacke schob. »Guten Morgen.«
Das Zimmermädchen erwiderte erstaunt seinen Gruß. »Was machst du hier?«
»Sonderwunsch der Protokollabteilung. Der Obstkorb war nicht üppig genug. Und du?«
»Ich hab die Handtücher vergessen.« Misstrauisch sah sie ihn an. »Bist du neu? Ich kenn dich nicht.«
Unauffällig tastete Keppler nach seiner Waffe, die in der Tasche seiner Uniformjacke steckte. Er entsicherte sie, während er den Kopf schüttelte. »Ich arbeite sonst im ersten Stock.«
Das Zimmermädchen zog die Augenbrauen hoch, dann grinste sie und ging zur Tür des Badezimmers. »Ah, ein Karrieresprung. Hinauf zu den Reichen und Schönen.«
Keppler erwiderte ihr Grinsen. »Ich helf hier nur aus. Morgen bin ich wieder unten.«
Mit ruhigen Bewegungen griff er nach dem Obstkorb und stellte ihn auf die Glasplatte des schweren Couchtisches, während er aus den Augenwinkeln beobachtete, wie die junge Frau die Handtücher im Bad drapierte. Dann nahm er ein auf dem Servierwagen liegendes Tuch, um die neben dem Sektkühler stehenden Champagnerkelche zu polieren.
Die junge Frau trat in die Tür des Badezimmers und betrachtete Keppler nachdenklich. Keppler tat, als bemerkte er es nicht. Ohne Hast stellte er das Champagnerglas ab, schob unauffällig die rechte Hand in die Tasche. Seine Finger umschlossen den Knauf seiner Waffe.
»Ich heiße übrigens Linn.«
»Bitte?« Keppler drehte sich um.
»Also, eigentlich heiß ich Brigitte. Aber Linn ist doch netter, oder?« Ein verlegenes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
Auch Keppler lächelte. »Das ist sehr viel netter.«
Das Zimmermädchen zögerte, als ob sie auf etwas wartete, dann wandte sie sich zur Tür. »Ich geh dann mal.«
»Mach’s gut, Linn!«
Die junge Frau verließ die Suite und trat hinaus auf den Gang, während sie Keppler einen letzten Blick zuwarf. Dann, mit einem leisen Klacken, glitt die Tür hinter ihr ins Schloss.
Schnellen Schrittes eilte Keppler zur Tür. Durch den Spion beobachtete er, wie das Zimmermädchen den Gang entlangging und die Tür zur Personaltreppe aufzog.
Keppler richtete sich auf, holte seine Waffe hervor und schob mit leiser Erleichterung den Sicherungshebel vor. Dann, nach einem letzten Blick durch den Spion, ging er zurück zum Esszimmer und nahm den Schraubendreher, um die Vertäfelung ganz zu lösen.
Zur gleichen Zeit fiel auf dem untersten Absatz des Personaltreppenhauses dem Zimmermädchen ein, dass sie vollkommen vergessen hatte, den gut aussehenden Etagenkellner aus dem ersten Stock nach seinem Namen zu fragen.
5
Die Livree des Etagenkellners in seiner Tasche verstaut, ging Keppler ruhigen Schrittes durch die Hotelhalle, knapp zwei Stunden, nachdem er das Hotel betreten hatte. Er rückte seine Krawatte zurecht und nickte entspannt der Empfangsdame hinter der Rezeption zu. Dann trat er am doorman vorbei auf die Straße und blieb stehen, so als müsse er sich orientieren.
Touristen aus aller Welt hatten den Pariser Platz erobert, sie schlenderten im Licht der Frühlingssonne durch das Brandenburger Tor oder verweilten an den Tischen der Andenkenhändler, die ihre in Fernost produzierten Berliner Erinnerungsstücke vor allem an Besucher aus Asien verkauften. Wie überall an den wichtigen Plätzen der Stadt registrierten Kameras jede Bewegung.
»Brauchen Sie ein Taxi?« Der doorman hatte ein freundliches Lächeln aufgesetzt.
Keppler lächelte zurück. »Nein, danke. Ich hab’s nicht so weit.«
»Dann noch einen schönen Tag!«
»Den werde ich haben«, erwiderte Keppler und ergänzte in Gedanken: wenn alles gut geht. Er sah auf die Uhr, dann wandte er sich nach rechts und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen, bis zur nächsten Querstraße.
Fünf Minuten später betrat er eine unauffällige Wohnung im fünften Stock eines sanierten Plattenbaus. Dirk Rüther stand am Fenster und schaute auf, als Keppler den Raum betrat. »Und? Alles in Ordnung?«
Keppler nickte wortlos, während er seine Jacke auf das Ledersofa warf. Er trat neben Rüther und beugte sich über das Okular des Fernglases, das auf das Hotel am Pariser Platz ausgerichtet war und durch das Rüther gerade geblickt hatte. Durch die Linsen des Teleskops vergrößert, schienen die Fenster der Suite im fünften Stockwerk zum Greifen nahe zu sein. Er erkannte den Eingang, Teile des Wohnzimmers und den Durchgang zum Konferenzraum. Durch ein zweites Fenster konnten sie quer durch die gesamte Suite hindurch zur Balkontür sehen, hinter der das Brandenburger Tor im Licht der Scheinwerfer leuchtete. Keppler war mit sich zufrieden: Er hatte ihren Beobachtungspunkt perfekt ausgewählt.
»Wird es klappen?« Gespannt sah Rüther ihn an. Keppler antwortete nicht, wandte sich ab und schenkte sich an der altersschwachen Kaffeemaschine, die zwischen der brandneuen Überwachungstechnik wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten wirkte, einen Pappbecher mit Kaffee ein.
Irgendwo aus den Tiefen der Wohnung war das Rauschen einer Toilettenspülung zu hören, kurz darauf betrat der graugesichtige Computertechniker den Raum. Er nickte Keppler zu und setzte sich wortlos hinter die auf dem Esstisch aufgebauten Überwachungsgeräte. Mit geübten Bewegungen aktivierte er die Computer, Momente später flammten die Monitore auf.
Der größte Bildschirm zeigte den Blick durchs Teleskop, dessen integrierte Kamera mit dem Überwachungspult verbunden war. Ein zweiter Monitor gab das unnatürlich verzerrte Bild der winzigen Kamera wieder, die Keppler in einem Spalt der Wandvertäfelung der Suite verborgen hatte. Ein dritter zeigte den Eingang des Hotels, offenbar hatte der Graugesichtige die Sendefrequenz einer der Überwachungskameras am Pariser Platz angepeilt.
Das Telefon klingelte. Rüther kam dem Techniker zuvor und nahm das Gespräch an, horchte wortlos in den Hörer. Er dankte, legte auf, sah Keppler an. »Valdez ist gelandet.«
Keppler spürte Unruhe in sich aufsteigen, ein Gefühl, das ihn ärgerte, kaum dass er es spürte. Er konzentrierte sich, zwang sich zur Ruhe. Dann ging er in den Nebenraum, um sich umzuziehen.
Zehn Minuten später öffnete Keppler die scheppernde Schiebetür und stieg in das Innere des schäbigen Krankenwagens, der unten vor dem Haus parkte und dem man nicht ansah, dass sich in ihm modernste Technik und unter der angerosteten Motorhaube ein überdimensionierter Motor verbargen. Ein letztes Mal prüfte Keppler seine Ausrüstung, dann schloss er den Notfallkoffer, setzte sich auf den neben der Schiebetür montierten Sitz und klopfte gegen die Trennscheibe, die den Laderaum von der Fahrerkabine abgrenzte.
Der Fahrer startete den Motor, ruckelnd fuhr der Wagen an. Keppler lehnte sich zurück. Noch einmal durchdachte er, was vor ihm lag. Was war, wenn ihr Plan nicht aufging? Keppler schloss die Augen: Zweifel kosteten Kraft, und Kraft war das Letzte, was er jetzt unnütz vergeuden durfte.
Der Empfänger in seinem Ohr knackte leise, dann war Rüthers Stimme zu hören. »Valdez ist auf dem Weg zum Hotel.«
Keppler rührte sich nicht.
Die Augen geschlossen, lauschte er seinem Atem, der in die Lungenflügel strömte, ruhig und gleichmäßig, Atemzug für Atemzug. Er war bereit.
6
Mit einer routinierten Bewegung setzte der doorman die Drehtür des Hotels in Bewegung, sah dabei aufmerksam zum Fond der Limousine, die gerade vor dem Haupteingang vorgefahren war und deren verspiegelte Scheiben jeden Blick ins Innere verwehrten. Der breitschultrige Bodyguard, der auf der Beifahrerseite ausgestiegen war, überprüfte wortlos den Eingangsbereich und die angrenzende Hotelhalle, dann gab er seinem Kollegen im Wageninneren ein Zeichen. Die Tür öffnete sich, ein zweiter Bodyguard verließ die Limousine, gefolgt von einem schmalen, asketisch wirkenden Glatzkopf, der sich ein wenig duckte, als er die wenigen Meter bis zum Eingang zurücklegte.
»Herzlich willkommen in unserem Haus, Herr Valdez!« Der Direktor des Hotels deutete eine leichte Verbeugung an, als die drei Männer die Halle betraten. Der Glatzkopf ignorierte den Gruß und ging, begleitet von seinen beiden Bodyguards, direkt zum Lift, der mit offen stehenden Türen bereitstand und vor dem die junge Empfangschefin des Hotels wartete. Mit zügigen Schritten betraten die drei Männer die Kabine, gefolgt von der Empfangschefin, die in der gleichen Sekunde, wie vom Gast gewünscht, die Türen zugleiten ließ. Sanft setzte sich der Lift in Bewegung.
Die junge Frau hatte sich ein wenig abgewandt und musterte aus den Augenwinkeln Hugo Valdez. Sein hageres Gesicht wirkte trotz der Falten alterslos, ein Eindruck, den die sonnengebräunte Haut, die seinen Kopf überspannte, noch verstärkte. Bemerkenswerter jedoch waren Valdez’ Augen, die stahlgrau wie zwei Eisdiamanten in tiefen Höhlen ruhten und nun den Körper der Empfangschefin abtasteten.
Ein leises »Pling« ertönte, die Türen glitten auseinander. Wortlos verließ die Empfangschefin den Lift und ging den Gang entlang bis zur Suite, um die Tür aufzuschließen. Doch bevor sie den Schlüssel in das Sicherheitsschloss stecken konnte, nahm ihr einer der Bodyguards den Schlüsselbund ab, öffnete die Tür und betrat die Zimmerflucht. Zwanzig Sekunden später, die sich endlos hinzuziehen schienen, trat der Mann wieder in die Tür und nickte.
Valdez, der in der Zwischenzeit ungeniert die Empfangschefin taxiert hatte, bleckte die Zähne zu einem knappen Lächeln. »Danke.« Ein letztes Mal ließ er seinen Blick am Körper der jungen Frau hinabgleiten. Dann betrat er die Suite.
»Er ist jetzt im Hauptraum.« Den Zeigefinger auf der Sprechtaste des Mikrophons, saß Rüther neben dem Computertechniker vor den Monitoren und beobachtete, wie Hugo Valdez durch die Suite ging, im Vorbeigehen seinen Mantel auf das Sofa warf und an eines der Fenster trat, um hinüber zum Brandenburger Tor zu blicken. Dann drehte Valdez sich um und gab mit knapper Geste einem seiner Bodyguards einen Auftrag. Der Angesprochene eilte zum Telefon und nahm den Hörer ab.
Rüther hob auffordernd die Hand, doch der graugesichtige Computertechniker hatte schon einen der Schalter am Überwachungspult betätigt. Stumm lauschten sie dem gebrochenen Deutsch des Bodyguards, der beim Zimmerservice zwei Abendessen und eine Flasche Champagner bestellte und nach dem Namen der jungen Empfangschefin fragte, die Herr Valdez gerne zum Abendessen einladen würde.
Der Graugesichtige grinste. »Schätze, mit Steak und Champagner kommt er bei der nicht weit.« Er kannte die Empfangschefin von einem früheren Einsatz, bei dem er als vermeintlicher Servicetechniker die Telefonanlage des Hotels gewartet und dabei unbemerkt die Standleitung zu ihrer Zentrale geschaltet hatte.
Rüther ignorierte die Äußerung des Computertechnikers und sah auf die Monitore, während er sich zum Mikrophon beugte und erneut die Sprechtaste, die der Mann ihm gezeigt hatte, betätigte. »Bereithalten! Es geht los.«
Valdez war an die Bar getreten und hatte sich ein Glas Brandy eingeschenkt. Jetzt schlenderte er durch den vertäfelten Durchgang hinüber zum Esszimmer, um den Raum in Augenschein zu nehmen.
Der Lautsprecher knackte, dann war Kepplers Stimme zu hören: »Jetzt!«
Der Techniker reagierte sofort. Mit einem leisen Klicken gab der Schalter unter dem Druck seines Zeigefingers nach und arretierte.
Gespannt sahen sie auf den Monitor.
Nichts geschah.
Entsetzt blickte Keppler auf den Bildschirm, der bündig in die Innenverkleidung des Krankenwagens eingelassen war und die per Funk übertragenen Aufnahmen aus dem Überwachungspult wiedergab. »Das kann nicht sein! Versucht es noch einmal!«
Der Hörer in seinem Ohr knackte leise, dann war die Stimme von Rüther zu hören. »Es ist sinnlos. Wir brechen die Aktion ab.«
»Verdammt noch mal! Nein!« Keppler war aufgesprungen. Der Wagen federte leicht unter seiner Bewegung. »Das tun wir auf keinen Fall!«
»Wir haben alles geprüft.« Die Stimme des Computertechnikers klang angespannt. »Hier oben bei uns ist alles in Ordnung. Der Fehler liegt bei dir. Vermutlich hast du den Empfänger nicht aktiviert.«
Keppler schüttelte den Kopf, als könne der Techniker ihn sehen. Er war sich sicher, den winzigen Schalter zurückgeschoben und das Gerät scharfgeschaltet zu haben, bevor er es hinter die Vertäfelung geschoben hatte.
Der Motor des Krankenwagens dröhnte auf. Keppler zuckte zusammen, riss ärgerlich das Fenster zur Fahrerkabine auf. »Mach den Motor aus. Sofort! Wir bleiben hier.«
»Aber Rüther hat gesagt …«
»Was dieser Sesselfurzer sagt, ist mir egal«, unterbrach Keppler den Fahrer ungehalten.
»Aber er leitet den Einsatz.«
Ärgerlich schnaubte Keppler auf. »Wir bleiben! Wenn dir das nicht passt, kannst du ja gehen.«
Der Fahrer überlegte. Dann öffnete er die Tür und stieg aus.
Einen Augenblick war Keppler perplex, dann ließ er das Fenster zuschnellen, trat voller Zorn gegen die stählerne Trennwand. Der Wagen dröhnte, und das Blech der Karosserie erzitterte. Eines der empfindlichen Geräte gab Alarm.
Keppler ignorierte das aufdringliche Signal. Fieberhaft dachte er nach. Wo lag der Fehler?
7
Überrascht drehte Hugo Valdez sich um. Er war es nicht gewohnt, dass man sich seinen Bitten, die Befehle waren, widersetzte.
Der Butler, der vor wenigen Augenblicken die Suite im fünften Stock des Hotels am Pariser Platz betreten hatte, erwiderte bedauernd Valdez’ Blick. »Der Hoteldirektor lässt freundlichst ausrichten, dass das Personal seines Hauses nicht für private Kontakte zur Verfügung steht. Sie müssen auf die Anwesenheit der Empfangschefin leider verzichten.«
Valdez starrte den Butler an, dann griff er erbost nach seinem Brandyglas und schleuderte es quer durch den Raum Richtung Servierwagen, den der Butler gerade in das Esszimmer schieben wollte. In letzter Sekunde duckte sich der erschrockene Mann unter dem Geschoss hindurch, bevor er den Wagen losließ und zur Ausgangstür der Suite eilte. Klirrend zersplitterte das Glas an der Vertäfelung im Durchgang, Momente später fiel die Tür ins Schloss.
Ärgerlich trat Valdez an die Bar und schenkte sich ein neues Glas Brandy ein, während der Bodyguard per Funk seinen Kollegen vor der Tür der Suite informierte, dass alles in Ordnung sei und er den Butler gehen lassen könne.
Niemand von ihnen hörte den Mechanismus, der in dem hinter der Vertäfelung versteckten Metallkästchen durch den Aufprall des Glases in Bewegung gesetzt wurde: Befreit von einem winzigen Metallspan, der die filigrane Mechanik blockiert und sich durch die Erschütterung wieder gelöst hatte, griffen leise surrend Zahnräder ineinander und setzten eine scharf geschliffene Metallnadel in Bewegung. Langsam senkte sich die Nadel auf eine fest in eine Halterung eingespannte Glasampulle, bis das Glas leise splitternd unter dem Druck zerbrach. Zischend ergoss sich eine blassgelbe Flüssigkeit in das Innere des Kästchens und begann, sich brodelnd unter dem Druck der Atmosphäre zu verflüchtigen.
Valdez war an den Servierwagen getreten, den der Butler neben dem Durchgang zum Esszimmer stehen gelassen hatte. Noch immer ungehalten, hob er eine der beiden silbernen Hauben hoch und blickte auf den Teller, der unter der spiegelnden Halbkugel verborgen gewesen war. Ein wenig milder gestimmt, sog er den Duft des marinierten Rindersteaks ein. In der gleichen Sekunde spürte er, wie sich sein Hals zuzuschnüren begann.
»Der Einsatz ist gescheitert. Wir brechen ab.« Ungehalten stand Rüther auf. »Es ist nicht mein Problem, wenn Sie unfähig sind, einen Einsatz kompetent vorzubereiten.«
Der Computertechniker protestierte. »Ich habe alles mehrfach geprüft. Die Ausrüstung ist in Ordnung.«
»Offensichtlich ist sie das nicht. Oder haben Sie eine andere Erklärung für diesen Reinfall?« Rüther fixierte den Graugesichtigen: In der Niederlage des anderen hatte er seine Selbstsicherheit wiedererlangt. »Notieren Sie bitte im Protokoll die Uhrzeit und den Grund des Abbruchs. Die Männer unten im Wagen können Schluss machen. Sie bleiben hier und überwachen Valdez.«
Der Computertechniker antwortete nicht, starrte stattdessen überrascht auf einen der Monitore.
Rüther merkte auf. »Was ist?« Er folgte dem Blick des Technikers zu dem Monitor, der die Aufnahmen der in der Suite versteckten Minikamera zeigte: Valdez war neben dem Servierwagen in die Knie gegangen und griff sich, um Luft ringend, an den Hals. Gerade beugte der Bodyguard sich über Valdez, dann eilte er zum Telefon und wählte.
Hastig schaltete der Graugesichtige den Lautsprecher ein, kurz darauf war die Stimme des Bodyguards zu hören: Er bat die Rezeptionistin dringend um einen Notarzt.
Gummisohlen quietschten auf dem Parkett. Rüther fuhr herum, erblickte entsetzt den Fahrer des Krankentransporters, der gerade die Wohnung betreten hatte. »Zurück zum Wagen!«, herrschte er ihn an. Er war blass geworden. »Schnell, bevor es zu spät ist!«
Der Fahrer sah auf den Monitor, begriff, wandte sich eilig um und rannte aus der Wohnung. Krachend donnerte die Tür hinter ihm ins Schloss.
Die Stimme des Graugesichtigen, der nervös die Bildschirme beobachtet hatte, ließ Rüther erneut herumfahren. »Er kommt zu spät.« Der Techniker wies auf einen kleinen Monitor am Rand des Überwachungspultes, er zeigte die Aufnahmen der Kamera, die in die Front des Krankenwagens eingelassen war: Der Wagen beschleunigte gerade, fuhr mit hoher Geschwindigkeit die Wilhelmstraße hinauf.
Rüther war blass geworden. Angespannt setzte er sich neben den Graugesichtigen und beobachtete den Monitor.
Keppler saß am Steuer des Krankenwagens, die Lippen zu einem Strich zusammengekniffen. Er war fest entschlossen, sein Ziel zu erreichen, heute, jetzt, und niemand würde ihn aufhalten, schon gar nicht ein Bürokrat wie Dirk Rüther! Das Martinshorn heulte aufdringlich, fegte die vor dem heranrasenden Rettungswagen erschreckt ausweichenden Autos von der Fahrbahn.
Keppler beschleunigte, kreuzte die Behrenstraße, wich einem wartenden Kleinlaster aus und riss fast ohne zu bremsen das Lenkrad herum. Mit aufheulendem Motor raste der Krankenwagen um die Ecke. Keppler drückte das Gaspedal durch, bis er kurz vor dem Pariser Platz an einer Querstraße auf die Gegenfahrbahn wechselte und vor dem Haupteingang des Hotels stoppte. Drei Japaner, die gerade ihr Gepäck in den Kofferraum eines Großraumtaxis hoben, sprangen erschrocken zur Seite, als der Rettungswagen direkt vor ihnen mit quietschenden Bremsen hielt.
Keppler schaltete das Martinshorn aus, griff sich im Aussteigen den auf dem Beifahrersitz bereitliegenden Notfallkoffer und eilte zum Hoteleingang. Der doorman hatte geistesgegenwärtig die Drehtür aufgeklappt und den Durchgang freigemacht. Jetzt hielt er einen telefonierenden Geschäftsmann zurück, der, versunken in sein Gespräch, nichts von der Aufregung mitbekommen hatte.
Mit zügigen Schritten betrat Keppler die Halle und sah sich um. Die Rezeptionistin lief ihm entgegen, um ihm den Weg hinauf in das oberste Stockwerk zu weisen. Sie eilte voran zum bereitstehenden Aufzug.
Vierzig Sekunden später betrat Keppler die Suite im fünften Stockwerk. Valdez lag auf der Couch, blass und um Atem ringend, die Lippen und die Lider geschwollen. Keppler wollte zu ihm, doch der eine der beiden Bodyguards hielt ihn zurück und begann, ihn nach Waffen zu durchsuchen.
Keppler gab sich ungehalten. »Lassen Sie mich durch. Wir dürfen keine Zeit verlieren.«
Seine Worte ignorierend, tastete der Bodyguard Keppler ab, griff in die Taschen seiner Notarztjacke, öffnete den Koffer. Schließlich nickte er. Keppler schloss den Notfallkoffer und eilte zu Valdez, kniete sich neben ihm nieder. Er imitierte kurz eine ärztliche Untersuchung, dann blickte er auf und sah den Bodyguard an. »Ein schwerer allergischer Schock. Er braucht sofort ein Antiallergikum.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, griff Keppler in den Koffer und holte die vorbereitete Spritze hervor, riss die Kunststoffverpackung auf, nahm die Schutzkappe von der Nadelspitze. Als wäre es Routine, spritzte er ein wenig der Flüssigkeit in die Luft, dann setzte er die Nadel an und stieß sie durch die Haut von Valdez’ Oberarm. Behutsam injizierte er die Flüssigkeit in den Muskel.
Der Bodyguard beobachtete ihn misstrauisch. »Und jetzt?«
»Wir müssen seinen Blutdruck überwachen«, antwortete Keppler. »Die nächsten Minuten sind kritisch.« Er nahm ein unscheinbares Gerät aus einem Fach des Koffers, eine silbern glänzende Manschette, die wie ein automatisches Blutdruckmessgerät aussah und die er mit vielfach geübten Bewegungen um Valdez’ Oberarm legte, sorgfältig darauf achtend, die unauffällige Markierung auf der Innenseite des Geräts über der Einstichstelle der Spritze zu plazieren. Klickend rasteten die Verschlüsse ein. Dann betätigte er den Schalter am Gerät. Mit einem leisen Knistern bliesen sich die Luftpolster auf, dann ertönten in einem gleichmäßigen Abstand leise Tonsignale. Keppler sah auf die Anzeige des Geräts, das scheinbar die Herzschläge zählte, während die Luft langsam aus der Manschette entwich.
In der gleichen Sekunde zuckte Valdez unmerklich zusammen: Erneut bohrte sich eine Nadel in seinen Oberarm, dicker als die erste, doch er spürte den Schmerz kaum, sediert durch das dem Antiallergikum beigemengte Betäubungsmittel. Augenblicke später war alles vorbei: Das leise Zischen, mit dem die Wunde unter der Manschette vereist und die Blutung gestoppt wurde, war kaum zu hören. Keiner der beiden Bodyguards hatte etwas bemerkt.
Für einen Moment zerriss der Nebel, der sich über Valdez’ Bewusstsein gelegt hatte. Wer war der Mann dort vor ihm? Was war geschehen? Im gleichen Moment spürte er, wie der Druck in seinem Hals langsam nachließ.
Erleichtert schloss Valdez die Augen.
Keppler nahm sein Stethoskop hervor, prüfte den Herzschlag des Patienten. Dann richtete er sich auf. »Er ist über dem Berg.« Mit schnellen Bewegungen ließ er die restliche Luft aus der Manschette, löste sie und verstaute sie in seinem Koffer. Unauffällig betrachtete er Valdez’ Oberarm: Die vereiste Einstichstelle war kaum zu sehen, auch die leichte Erhebung unter der Haut würde niemandem auffallen.
»Lassen Sie ihn schlafen! Morgen früh ist er wieder in Ordnung. Lüften Sie die Zimmer ausgiebig! Und räumen Sie alles weg, was er gegessen oder getrunken hat, damit sich so etwas nicht wiederholt!« Keppler lächelte knapp, dann griff er sich seinen Koffer und ging zur Tür, verließ die Suite.
Der Bodyguard blickte ihm nach, dann drehte er sich um und ging zur Bar, auf der immer noch die angebrochene Flasche mit Brandy stand.
Er nahm sie, brachte sie ins Bad und kippte den Inhalt ins Waschbecken. Dann rief er, nachdem er die Fenster geöffnet hatte, seinen Kollegen herbei, und beide trugen den dösenden Valdez ins Schlafzimmer.
Zufrieden mit sich und dem Einsatz verließ Keppler den Aufzug und ging zur Drehtür, durch die gerade ein Notarzt die Hotelhalle betrat und ihn irritiert ansah. Keppler gab sich ärgerlich. »Was machst du denn hier?« Er begrüßte den Notarzt mit Handschlag. »Die haben uns offenbar doppelt informiert.« Dann beruhigte er den Kollegen, alles sei erledigt, dem Patienten gehe es gut. Während er weiterplauderte, legte er seine Hand auf die Schulter des Notarztes und führte ihn mit unmerklichem Druck nach draußen. »Naja, besser einmal zu viel gekommen als einmal zu wenig.« Keppler grinste, verabschiedete sich und öffnete die Fahrertür des Krankenwagens.
Im gleichen Augenblick sah er sie: Eine junge Frau war auf dem Bürgersteig stehen geblieben und blickte ihn erstaunt an. Für einen Moment überlegte Keppler, woher er sie kannte und sie offenbar ihn. In der gleichen Sekunde begriff er: Die Frau war das Zimmermädchen, das er am Morgen getroffen hatte, als Etagenkellner in der Hotelsuite im fünften Stock.
Erstaunt trat die junge Frau an den Wagen. »Was machst du denn hier?«
Keppler lächelte. »Ein Nebenjob. Man muss ja sehen, wo man bleibt.«
»Als Arzt?« Die junge Frau wies verblüfft auf Kepplers Jacke, auf der groß das Wort »Notarzt« prangte.
Keppler tat erstaunt, sah an sich hinab, dann lachte er auf. »Ach so, nein. Ich bin Krankenwagenfahrer. Die Jacke hat mir der Arzt gegeben. Meine eigene ist vorhin bei einem Einsatz total eingesaut worden.«
Die junge Frau nickte, sah sich neugierig den Krankenwagen an. »Und damit fährst du? Mit Blaulicht und so?«
Keppler nickte.
»Nimmst du mich mit?«
Keppler zögerte, dann trat er zur Seite, wies auf das Fahrerhaus. Die Frau grinste keck, dann kletterte sie in den Wagen, setzte sich auf den Beifahrersitz. Keppler folgte ihr, nahm hinter dem Lenkrad Platz, drehte den Zündschlüssel. Der Motor dröhnte auf. Keppler lächelte der jungen Frau zu, dann setzte er den Blinker und drückte das Gaspedal hinab. Der Wagen fuhr an, verschwand im abendlichen Verkehr.