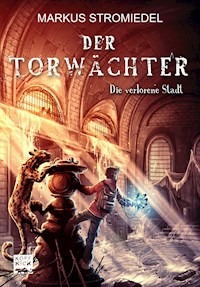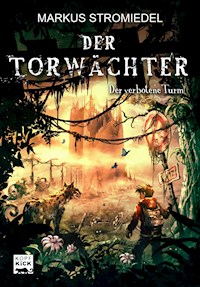
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kick-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Simon hat sich mit seinem Großvater nach Superbia gerettet, in eine Stadt, die unter dem Dschungel verborgen ist. Es ist eine beeindruckende und geheimnisvolle Welt, in der er bald Freunde findet. Doch Ashakida ist in Avaritia zurückgeblieben, und sie braucht dringend seine Hilfe. Simon macht sich auf den Weg, um der Schneeleopardin beizustehen. Er ahnt nicht, dass ihn seine Reise durch die Welten direkt in den Tower führt … "Der Torwächter - Der verbotene Turm" ist der spannende dritte Teil der Torwächter-Reihe und Teil des Internet-Lese-Projektes "Kopf-Kick".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Kopf-Kick
www.kopf-kick.de
www.kick-verlag.de
www.markus-stromiedel.de
Titelseite
Markus Stromiedel
DERTORWÄCHTER
Der verbotene Turm
Kick-Verlag ∙ Bonn
Prolog
Prolog
Simon schlug die Augen auf. Sein Herz klopfte heftig. Wo war er?
Die Welt um ihn herum flirrte, Millionen Teilchen wirbelten durcheinander und setzten sich neu zusammen, um sofort wieder auseinanderzubrechen. Wie ein Tornado umkreiste ihn der bunte Sturm. Nur er selbst blieb, der er war, und das ließ ihn ruhig werden. Geduldig beobachtete er die Teilchen bei ihrem wilden Tanz.
Mit der Zeit ließ das Wogen nach. Simon begann, Formen zu erkennen: der Knauf eines Schaltknüppels, die Rundung eines Lenkrades. Dann spürte er eine Lehne in seinem Rücken. Erstaunt sah er sich um. Er befand sich in einem Auto, es war ein Geländewagen. Offenbar hatte er ihn gefahren, denn er saß auf dem Fahrersitz. Neben sich entdeckte er seinen Rucksack.
Nun formten die Teilchen auch die Welt vor den Fenstern des Fahrerhauses. Simon sah eine Straße, sie war breit und sauber, Bäume säumten die Fahrbahn. Links und rechts reckten sich Häuser in die Höhe, auch dahinter standen Wohngebäude, hoch und imposant, sie gehörten zu einer Stadt voller Menschen. Um Simon herum fuhren Autos, sie umkurvten ihn elegant. Niemand hupte oder sah wütend zu ihm hin, obwohl der Wagen halb auf der Fahrbahn stand und einen Teil der Straße versperrte. Auch die Fußgänger auf dem Gehweg beachteten ihn nicht. Alle schauten auf flache, rechteckige Kästchen, die sie in ihren Händen trugen und von denen sie keinen Blick ließen. Die Autofahrer, bemerkte Simon jetzt, sahen ebenfalls nicht auf die Straße, denn die Autos fuhren, ohne dass jemand sie steuerte.
Was war das für eine Welt? Was war geschehen?
Langsam kehrte die Erinnerung zu ihm zurück. Alles hatte in einem Dschungel begonnen, dorthin war er mit seinem Großvater geflohen. Männer in Schutzanzügen hatten sie mit sich genommen und in ein Krankenhaus gebracht.
Simon stutzte. Warum nur ihn und seinen Großvater? Wo war Ashakida? Sie war in Avaritia zurückgeblieben, fiel ihm ein, und er hatte sich aufgemacht, sie zu retten. War es ihm gelungen?
Simon lehnte sich zurück und schloss die Augen. Er konzentrierte sich. So wie sich die Welt um ihn herum geformt hatte, so fügten sich nach und nach auch seine Erinnerungen wieder zusammen. Simon sah im Geiste das Zimmer, in dem er aufgewacht war, er hörte das Fiepen der medizinischen Geräte, er spürte den rauen Stoff der Decke auf seinem Körper …
1. Kapitel
1
Leise schob Simon die Decke zurück und kletterte aus dem Bett. Der Boden des Krankenzimmers war kalt, Simon zuckte zusammen, als seine nackten Füße die metallisch glänzenden Platten berührten. Er schlich zur Tür und horchte. Draußen im Flur war es still, die Schritte, die er den ganzen Tag über im Gang gehört hatte, waren vor einer Weile verstummt, wenig später war das Licht im Raum dunkler geworden. Simon vermutete, dass es Nacht war. Seit Stunden schon hatte niemand mehr nach ihm geschaut.
Behutsam legte Simon seine Fingerspitzen auf die Sensorfläche, die neben dem Ausgang in die Wand eingelassen war. Für einen Augenblick fürchtete er, eingesperrt zu sein, doch dann leuchtete der Sensor auf, und die Metallfläche, die die Türöffnung verschlossen hatte, glitt zur Seite.
Der Flur vor dem Zimmer war verlassen. An den Wänden glimmten blaue Nachtleuchten, ihr Licht ließ Simons Haut bleich aussehen. Die Leuchtdecke, die bei seiner Ankunft hell gestrahlt hatte, war erloschen und wirkte grau und unscheinbar. Niemand war zu sehen. Simon stand regungslos und wartete mit angehaltenem Atem. Hatte ihn jemand bemerkt? Doch es blieb still, bis auf einen immer wiederkehrenden Piepton, er kam aus einem der Nachbarzimmer und zerschnitt die Stille wie das Ticken einer Uhr.
Leise huschte Simon den Gang hinab. Er sah verschlossene Türen und Fächer mit Medikamenten, dazu medizinische Geräte, ein leeres Krankenbett, ein Rollwagen mit Thermoskannen. Das hier war eine Krankenstation, so viel war klar. Als sie ihn und seinen Großvater hierher gebracht hatten, war er zu erschöpft gewesen, um auf alles zu achten. Jetzt bemerkte er, dass es auch hier im Flur keine Fenster gab, genau wie in seinem Zimmer. Simon fand das seltsam.
Was war das für eine Welt, in der sie nach ihrer Flucht aus Avaritia gelandet waren? »Superbia« hatte sein Opa diesen Ort genannt, nachdem sie das Weltentor passiert hatten und im Dschungel angekommen waren, alleine, ohne Ashakida. Bei dem Gedanken an sie wurde Simons Herz schwer.
Er hatte die Leopardin bei ihrer Flucht zurücklassen müssen, der Stundenfluss hatte Ashakida erfasst und fortgetragen, als sie beide gemeinsam seinen Großvater aus der Hand Drhans gerettet hatten. Sie brauchte seine Hilfe, genau wie Ira und Philja, die von den Soldaten ergriffen worden waren. Er musste so schnell wie möglich wieder zurück! Doch wie sollte er ein Weltentor finden, das ihn nach Avaritia brachte? Alleine hatte er kaum eine Chance, trotz des Ringes, den er trug. Er musste mit seinem Großvater sprechen, denn der konnte ihm sagen, wo es in dieser Welt ein solches Tor gab.
Simon hatte keine Ahnung, in welchem der vielen Zimmer sich sein Großvater befand.
Ein Licht am Ende des Ganges weckte Simons Aufmerksamkeit, es fiel aus einer geöffneten Tür in den Flur und wirkte warm und einladend. Leise schlich Simon näher. Jetzt war eine Stimme zu hören, es war die einer Frau. Sie sang eine seltsame Melodie, Simon kannte sie nicht, und auch die Sprache hatte er noch nie zuvor gehört.
Die Frau im Inneren des Raumes war eine Krankenschwester, sie ging zwischen den Regalen umher und sortierte Medikamente in kleine Schälchen. In der Hand hielt sie einen flachen Bildschirm. Sie bemerkte nicht, dass Simon sie beobachtete.
Er zögerte. Konnte er sich ihr anvertrauen? Oder würde die Schwester ihm nicht glauben und nur auslachen, genau wie die Männer im Dschungel und der Pfleger, der ihn im Krankenzimmer betreut hatte?
Es gab einen Weg, das herauszufinden. Simon schloss die Augen und konzentrierte sich. Er wusste nicht, ob er es schaffen würde, sich mit der Krankenschwester zu verbinden: Zwar war sie nur wenige Meter von ihm entfernt, doch er hatte schon länger nicht mehr versucht, die Gefühle eines anderen Menschen zu lesen.
Es klappte auf Anhieb: Seine Hände begannen zu kribbeln, die Wärme lief seine Arme hinauf und weiter in seinen Rumpf hinein, bis sie seinen ganzen Körper erfasst hatte. Simon wusste, was jetzt kam, und er erschrak nicht mehr: Schlagartig stürzten die Gefühle der Frau in ihn hinein und er spürte, was sie empfand, so als ob es selbst fühlen würde.
Die Schwester war müde, erschöpft von der Nachtschicht, sie freute sich auf ihr Bett und ihr Kind, die Frau dachte gerade intensiv daran. Simon sah das Bild, das die Frau in ihrem Herzen bewahrte: Es war ein Junge, etwas jünger als Simon, er schlief, nur ein strubbeliger Haarschopf lugte unter der Bettdecke hervor. Simon spürte die Liebe, die die Krankenschwester für ihren Jungen empfand, es war ein schönes und starkes Gefühl. Simon machte es traurig, denn er musste an seine eigenen Eltern denken, er vermisste sie sehr. Immer wenn die Schwester ein Medikament auswählte, verblasste das Bild des schlafenden Jungen ein wenig, um danach wieder stark und klar zu leuchten.
Plötzlich durchzuckte etwas die Gefühle der Krankenschwester, es war wie ein heller Lichtblitz, der aus den Wolken hervorbricht und zur Erde züngelt. Überrascht taumelte Simon zurück, im gleichen Augenblick brach die Verbindung ab. Simon sah auf. Erst jetzt bemerkte er, dass die Frau ihn anstarrte: Sie hatte ihn entdeckt.
Ein Lächeln legte sich auf ihr Gesicht. »Ach, du bist es. Puh, hast du mich erschreckt.« Sie zwinkerte ihm zu. »Unser Wunderkind. Ich bin Schwester Lisa.«
Simon war überrascht. »Wieso Wunderkind?«
»So nennen dich hier alle. Weißt du das nicht?«
Er schüttelte den Kopf. »Warum?«
»Weil du mit deinem Großvater draußen im Strahlwald gewesen bist: Und trotzdem sind deine Körperwerte vollkommen normal.« Jetzt erinnerte sich Simon an die Worte seines Opas, nachdem sie durch das Weltentor geflohen und im Dschungel von Superbia wieder zu sich gekommen waren: Er hatte gesagt, sie müssten dort so schnell wie möglich weg.
»Ist denn der Dschungel gefährlich?«
Die Krankenschwester sah ihn an, als habe er etwas sehr Dummes gefragt. »Das weißt du doch! Niemand darf sich ungeschützt im Strahlwald aufhalten. Das hast du schon im Kindergarten gelernt!«
Simon musste daran denken, wie die Männer ihn und seinen Großvater gefunden und mit ihrem Geländewagen fortgebracht hatten. Keiner von ihnen hatte während der Fahrt seinen Schutzanzug geöffnet. Selbst die Visiere ihrer Helme hatten sie nicht hochgeklappt, solange sie im Urwald waren.
Es war eine kurze Fahrt gewesen, vielleicht zehn oder fünfzehn Minuten lang. Die riesigen Meerkatzen, die sie in Superbia begrüßt hatten, waren neben dem Geländewagen hergelaufen, um sie mit lautem Gekreische zu begleiten. Bald hatte sich der Dschungel gelichtet und sie waren auf eine Lichtung gefahren, in deren Mitte ein flaches Gebäude stand. Simon erinnerte es an einen Bunker. Ohne zu stoppen, war der Wagen durch eine Öffnung in das Innere des Hauses geschossen und sofort hatte sich hinter ihnen ein schweres Tor geschlossen.
Die Krankenschwester betrachtete ihn nachdenklich. »Ich glaube nicht an Wunder. Wie bist du in den Strahlwald gekommen?«
Simon biss sich auf die Lippen. Sollte er ihr erzählen, dass er ein Torwächter war? Sollte er ihr sagen, dass die Zeit vor vielen Jahren aufgesplittert war und dass es nun sieben Welten gab, die nebeneinander existierten und sich ähnelten, ohne wirklich gleich zu sein? Sollte er ihr davon berichten, dass Drhan, der Fürst der Finsternis, diese Welten nach und nach erobern und unter seine Kontrolle zwingen wollte? Sollte er ihr erzählen, dass Drhan seine Soldaten geschickt hatte, um ihn zu verfolgen und zu ergreifen? Auch ohne sich noch einmal mit ihr zu verbinden, war ihm klar: Sie würde ihm niemals glauben.
Er zuckte mit den Schultern. »Ist doch nicht wichtig. Ich suche meinen Großvater, das ist wichtig!« Erwartungsvoll sah Simon die Krankenschwester an. »Ich muss ihn unbedingt sprechen.«
»Du kannst nicht mit ihm reden. Tut mir leid.«
»Aber warum nicht? Wo ist er? Bitte sagen Sie es mir!«
Die Schwester betrachtete ihn nachdenklich. Dann legte sie den Bildschirm zur Seite und ging zur Tür. »Komm.«
2. Kapitel
2
Schweigend gingen sie den Gang zurück, durch den Simon gekommen war. Niemand begegnete ihnen, die Krankenstation wirkte wie ausgestorben. Sie passierten Simons Zimmer und bogen in einen anderen Flur ein, dann in einen weiteren, er führte sie zu einem Treppenhaus, in dem die Krankenschwester wortlos abwärts stieg. Bald hatte Simon die Orientierung verloren. Dieses Haus war anders als jedes andere, das er bisher betreten hatte. Es gab kaum rechte Winkel, manche Gänge krümmten sich, andere führten leicht abwärts, um bald schon wieder anzusteigen. Simon kam es vor, als füge sich das Gebäude einem äußeren Zwang anstatt dem Plan eines Architekten.
»Warum gibt es hier keine Fenster?« Suchend sah sich Simon um. So wie in seinem Zimmer, konnte er nirgendwo in den Wänden eine Öffnung entdecken, durch die er hätte sehen können, was draußen war.
Die Schwester lachte. »Warum sollte es hier unten Fenster geben? Du könntest doch sowieso nicht hinausschauen.«
»Hier unten?« Simon war erstaunt.
Die Krankenschwester sah ihn an, als wäre er eine Kuh mit zwei Köpfen. »Ja, natürlich. Du weißt doch, wo wir sind, oder?« Sie betrachtete ihn aufmerksam.
Simon schwieg nachdenklich. Nach seiner Ankunft hatten ihn die Männer zunächst geduscht und ihm neue Kleidung geben, danach war er in einen Untersuchungsraum gebracht worden und sofort eingeschlafen. Die Luft hatte nach süßen Orangen geduftet, das war das Letzte, woran er sich erinnerte. Als er wieder aufwachte, schoben sie ihn gerade in das Zimmer, in dem er den vergangenen Tag verbracht hatte. Niemand wollte seine Fragen beantworten, und jeder, der zu ihm gekommen war, hatte ihn neugierig oder scheu gemustert.
Ihr Weg endete in einem langen Gang, die Schwester stoppte vor einer der Türen, sie war breiter als die von Simons Zimmer.
»Ist er dort drin?«
Die Krankenschwester legte ihren Finger auf die Lippen, als Zeichen, dass er still sein sollte. Dann nickte sie. Sichernd sah sie sich um, bevor sie sich über ein glimmendes Tastenfeld beugte und einen Code eintippte. Das Gerät quittierte die Eingabe mit einem hellen Ton, Momente später summte es leise und die beiden Metallplatten, die den Eingang versperrt hatten, glitten wie die Türen eines Aufzuges zur Seite.
Überrascht blieb Simon stehen.
Vor ihnen lag ein großer Raum, breiter und höher als die anderen, die Simon bisher in der Krankenstation gesehen hatte. Im Zentrum stand eine eigentümlich geformte Maschine, sie sah aus wie ein klobiges Bett mit einer gläsernen Kuppel darüber. Sein Großvater lag unter dieser Kuppel, er hatte die Augen geschlossen. Er trug keine Kleidung, und es gab auch keine Decke und kein Kissen für ihn.
Doch das war es nicht, was Simon überraschte: Es waren die Roboterarme, die im Inneren der Kuppel direkt über der Liegefläche angebracht waren und die über den Körper seines Opas kreisten. Sie bewegten sich behutsam, so als würden sie ihn streicheln. Rotes Licht glühte an ihren Spitzen.
»Was ist mit ihm?« Vorsichtig ging Simon näher an die Maschine heran.
Die Krankenschwester lächelte. »Keine Sorge, es geht ihm gut. Seine Knochenbrüche heilen schnell, auch seine Haut und die inneren Verletzungen. Bald wird es ihm wieder besser gehen.«
»Kann ich mit ihm reden? Ich muss ihn unbedingt etwas fragen.«
Bedauernd schüttelte die Schwester den Kopf. »Er ist sediert.« Sie sah Simons fragenden Blick. »Das bedeutet, sie haben ihm ein Schlafmittel gegeben, damit er die Schmerzen erträgt.«
Erst jetzt sah Simon die feinen Schläuche, die zur Nase und in den Mund seines Großvaters führten. Zwei weitere Schläuche endeten in einer Kanüle, die im Arm des alten Mannes steckte.
»Sie wecken ihn auf, wenn alles verheilt ist. Es dauert nur ein paar Wochen.« Beruhigend legte die Krankenschwester ihre Hand auf Simons Schulter.
Simon fuhr entsetzt herum. »Ein paar Wochen? Das ist zu spät!«
»Wofür zu spät?«
Simon beantwortete ihre Frage nicht. »Ich muss sofort mit ihm sprechen! Bitte!«
»Das geht nicht. Wir dürfen ihn nicht aufwecken. Du willst doch auch, dass er wieder gesund wird, oder?«
»Aber wie soll ich ohne meinen Großvater ein Weltentor finden?« Simon war verzweifelt.
Die Krankenschwester sah ihn erstaunt an. »Was für ein Weltentor?«
Statt einer Antwort trat Simon an die Glaskuppel. »Opa, wach auf! Es ist wichtig!«
»Hör sofort auf damit!« Die Krankenschwester war ärgerlich.
Simon beachtete sie nicht. »Ashakida ist in Gefahr, Opa. Hörst du mich?« Er klopfte gegen das Glas. »Wach auf, Opa! Ich muss zurück nach Avaritia! Sag mir, wo ich ein Weltentor finden kann!« Simon bemerkte, dass sich der Kopf seines Großvaters etwas bewegte.
Eine Hand packte ihn, es war die der Krankenschwester, sie griff nach seinem Arm und zerrte ihn vom Bett fort. »Ich hab dir doch gesagt, dass wir ihn nicht wecken dürfen! Das ist gefährlich!«
»Aber ich brauche ihn! Ich muss Ashakida helfen.«
»Dein Opa braucht Hilfe! Alles andere ist jetzt unwichtig.«
Simon dachte an die Leopardin. Er war verzweifelt: Warum verstand denn niemand, dass er zu ihr musste? Er riss sich los und lief zurück zum Krankenbett. Sein Großvater bewegte sich stöhnend unter der Glaskuppel. Simon sah, dass er seine Augen zu öffnen versuchte. »Opa, hier bin ich!« Aufgeregt versuchte er, die Kuppel über dem Bett zu entriegeln, um sie aufzuklappen.
Plötzlich, Simon rüttelte gerade an den Verschlüssen, ertönte ein lauter Alarm und ein rotes Licht flammte neben der Glaskuppel auf. Erschrocken fuhr Simon zusammen. Die Krankenschwester war blass geworden. Hastig griff sie nach Simons Hand und zog ihn mit sich. Doch bevor sie den Ausgang erreicht hatten, glitten die Türen auseinander, vier Männer in weißen Kitteln stürzten in den Raum. Sie packten Simon und zwangen ihn zu Boden. Auch die Krankenschwester wurde von den Männern überwältigt.
»Opa!« Simon schrie in seiner Verzweiflung. »Opa, hilf mir!«
Einer der Pfleger lief zur Glaskuppel, unter der sich sein Großvater nun aufgerichtet hatte. Er hieb seine Faust auf einen Notknopf, Nebel zischte aus einer Düse im Inneren der Maschine, er hüllte den nackten Körper ein. Bevor die Schwaden die Sicht versperrten, sah Simon gerade noch, wie der Körper seines Großvaters in sich zusammensackte und zurück auf die Liege sank.
»Opa!« Simon strampelte verzweifelt, er versuchte, sich zu befreien, doch es war vergeblich: Der Griff der Männer war fest wie eine Stahlfessel. Jemand riss den Ärmel seines T-Shirts hoch, Simon spürte einen Stich in seinem Oberarm. Momente später wurde ihm schwarz vor Augen.
3. Kapitel
3
Als Simon erwachte, lag er in seinem Bett, die Decke über sich gedeckt. Sie hatten ihn in sein Krankenzimmer zurückgebracht, als er bewusstlos gewesen war. Das Licht an der Decke leuchtete, aus dem Gang waren Stimmen und Schritte zu hören, es musste Tag sein.
Vorsichtig richtete sich Simon auf. Sein Kopf schmerzte, genau wie die Stelle am Arm, an der sie ihm das Betäubungsmittel gespritzt hatten.
Ein Rascheln ließ ihn aufmerken. Eine Frau in einem weißen Arztkittel saß auf dem Stuhl neben seinem Bett und blätterte im Skizzenbuch seines Großvaters. Sein Rucksack stand geöffnet neben ihr. Sie hob ihren Kopf und blickte ihn ernst an. »Ah, da bist du ja.«
Simon betrachtete die Frau: Sie sah streng aus und schien ärgerlich zu sein über das, was geschehen war. Ihr scharf geschnittenes Gesicht und ihre dunklen Haare, die sie zu einem festen Dutt zurückgebunden hatte, unterstrichen diese Wirkung. Und doch gab es etwas an ihr, das ihm vertraut war.
Sie musterte ihn forschend. »Du hast Kopfschmerzen, richtig?« Ohne seine Antwort abzuwarten, legte sie das Buch zur Seite und trat an den Nachttisch, um sich eine bereitliegende Ampulle aus Kunststoff zu nehmen. »Die Dosis, die sie dir gespritzt haben, war zu hoch. Ist aber nicht schlimm, du hast einfach nur ein wenig länger geschlafen.«
Simon setzte sich auf. »Wie lange?« Sein Kopf pochte.
»Die ganze restliche Nacht und den halben Tag.« Mit einer schnellen Bewegung drehte sie den Kopf der Ampulle ab. »Hier, trink das. Hilft gegen die Schmerzen.«
Simon nahm die Ampulle. Das Mittel schmeckte süß und bitter zugleich.
»Ich bin Dr. Lytras. Ich leite diese Krankenstation. Schwester Lisa hat mir alles berichtet. Warum hast du das gemacht?«
Simon wandte den Kopf ab und schwieg.
»Du wolltest etwas von deinem Großvater wissen. Wo ein Weltentor ist, richtig?«
Für einen kurzen Augenblick keimte die Hoffnung in Simon auf, dass sie ihn ernst nehmen und ihm helfen würde. Doch als er aufblickte, sah er den spöttischen Zug um den Mund der Frau.
Sie betrachtete ihn lächelnd. »Du hast offensichtlich eine blühende Fantasie. Sind die Bilder von dir?« Sie wies auf das Skizzenbuch, das sie gerade betrachtet hatte.
Simon schüttelte den Kopf.
»Dann ist das Buch von deinem Großvater? Mit dem du durch das Weltentor gekommen bist?« Erneut lächelte sie, und Simon wusste, dass sie nicht an zersplitterte Welten, an Torwächter und an sprechende Leopardinnen glaubte. Und doch war etwas an ihr, das ihn Zutrauen fassen ließ und ihm Mut machte, alles zu erzählen: von ihrem Umzug in das Dorf des Großvaters, von dem Weltentor, das er aus Versehen geöffnet hatte, von seinen Freunden Ira, Tomas, Filippo und Luc, die er im Dorf kennengelernt und die er später in Avaritia wiedergetroffen hatte. Er erzählte ihr von Iras Oma und ihren Kräutern, von den Kindern in der verlorenen Stadt und von ihrer Flucht, die im Dschungel geendet hatte, an jenem Ort, den sie hier den Strahlwald nannten.
Es war still im Zimmer, als er alles berichtet hatte. Die Ärztin sah ihn stumm an, das spöttische Lächeln war aus ihrem Gesicht verschwunden. Simon tastete sich in ihre Gefühle: Sie glaubte ihm immer noch nicht. Doch etwas an seiner Geschichte hatte sie nachdenklich gemacht.
Schließlich stand sie auf und steckte das Buch zurück in den Rucksack. »Sie wollen dich sehen. Die Wächter warten schon auf dich. Überlege dir sehr genau, was du ihnen sagst.«
Bevor Simon fragen konnte, wen oder was sie damit meinte, war die Ärztin zur Tür gegangen. Sie hielt eine Karte vor den Sensor, die Türflügel glitten zur Seite.
»Er ist wach. Ihr könnt ihn jetzt mitnehmen.«
Die Ärztin trat zur Seite und sah stumm dabei zu, wie zwei Männer, die vor der Tür postiert gewesen waren, den Raum betraten. Sie trugen lange schmucklose Gewänder. Auf ihrer Brust prangte ein Wappen, das Simon an etwas erinnerte. Die beiden forderten ihn auf, mit ihnen zu kommen. Schnell zog sich Simon an, wobei er sich bemühte zu vergessen, dass sowohl die Männer als auch Dr. Lytras mit im Raum waren. Immerhin wandte sich die Ärztin ab, während er in seine Kleider stieg. Niemand sagte ein Wort.
Als er seinen Rucksack nehmen wollte, kam ihm die Ärztin zuvor. »Den kannst du hierlassen.« Simon wollte ihr widersprechen, doch sie legte ihm ihre Hand auf den Arm. »Ich passe auf deinen Rucksack auf. Glaub mir, das ist besser so.« Ihre Augen weiteten sich, so als ob sie ihm ein stummes Zeichen geben wollte, unbemerkt von den Männern.
Simon ließ den Schulterriemen, den er gegriffen hatte, wieder los.
»Viel Glück.« Die Ärztin lächelte. Es war ein freundliches Lächeln.
Simon durchzuckte es: Jetzt wusste er, was ihm an der Frau bekannt vorkam: Das Lächeln der Ärztin erinnerte ihn an Ira.
4. Kapitel
4
Schweigend führten ihn die beiden Wächter durch das Labyrinth der Krankenstation. Bald erreichten sie den Ausgang, doch er führte nicht hinaus auf einen Platz oder auf eine Straße, die Stufen auf der anderen Seite der Tür endeten in einem breiten Tunnel, der Simon an einen U-Bahn-Schacht erinnerte. Die eine Hälfte des Tunnels war für Fußgänger reserviert, auf der anderen Seite flitzten kleine Elektrokarren und Transportwagen vorbei, dazu E-Taxis, Minibusse und dreiräderige Roller. Jetzt begriff Simon, wo sie waren: Sie befanden sich unter der Erde. Deshalb hatte es in der Krankenstation in keinem der Räume ein Fenster gegeben.
»Wo gehen wir hin?«
Die Männer warfen sich einen kurzen Blick zu.
»Ich soll verhört werden, richtig?«
»Sei still.« Einer der beiden knurrte ungehalten.
»Ist es wegen meines Großvaters?« Simon gab sich schuldbewusst. »Das tut mir leid. Ich hatte nicht gewusst, dass es so gefährlich ist, ihn aufzuwecken.« Er beobachtete die beiden Männer genau.
Keiner von ihnen antwortete. Der jüngere der beiden Wächter warf einen zögernden Blick auf seinen Kameraden, er schien zu überlegen, ob er etwas sagen sollte. Schließlich wandte er sich Simon zu. »Wir bringen dich in den Kuppeldom. Bischof Aristide will wissen, wo du herkommst. Niemand überlebt den Strahlwald ohne Schutzanzug.«
»Ruhig jetzt! Kein weiteres Wort!« Ärgerlich unterbrach der ältere Soldat die Worte des anderen. »Wir beide kriegen riesigen Ärger, wenn sie erfahren, dass du mit ihm gesprochen hast.«
Nach einer Weile öffnete sich der Tunnel zu einer hell erleuchteten Halle, Simon brauchte eine Weile, bis er erkannte, dass sie einen ehemaligen U-Bahnhof betraten. Viele Menschen kreuzten den Platz, Simon sah mehrere Schächte, die in der Halle endeten, daneben Läden, Cafés und auch Spielzonen, in denen Kinder Bälle gegen Wände kickten. Sie mussten sich direkt unter der Stadt befinden, nahe dem Stadtzentrum, nur dort gab es unterirdische Bahnhofshallen, die so groß waren wie diese. Doch hier in dieser Welt gab es keine Stadt mehr, stattdessen bedeckte in Superbia ein Dschungel die Erdoberfläche. Simon musste an die von Schlingpflanzen überwucherten Mauerreste denken, die er bei seiner Ankunft zwischen den Bäumen gesehen hatte. Irgendetwas hatte in dieser Welt vor vielen Jahren die Stadt zerstört und die Menschen gezwungen, in den Untergrund zu fliehen.
Die beiden Männer stoppten vor einer Glaswand, die den hinteren Teil der Halle vom vorderen abgrenzte. Die Glasfläche reichte vom Boden bis zur Decke. Ein Wappen war auf die Barriere gemalt, es war rot und schwarz, in der Mitte prangte ein gelber Kreis mit drei abgerundeten Dreiecken, die wie ein Propeller um einen schwarzen Punkt gruppiert waren. Es war das gleiche Wappen, das auf der Brust der Wächter prangte. Jetzt erinnerte sich Simon, wo er den gelben Propeller schon einmal gesehen hatte, es war noch gar nicht lange her: Es war in Avaritias Unterwelt gewesen, in jenem Raum, in den sie sich geflüchtet hatten, nachdem sie dem Stundenfluss entkommen waren. Er hatte das Zeichen auf dem Schild entdeckt, auf dem stand, wie man sich duschen und die Kleidung wechseln sollte.
»Wir bringen den Jungen.« Der ältere der beiden Wächter beugte sich über eine Sprechanlage, sie war in einer neben dem Eingang stehenden Säule eingelassen. Niemand antwortete, nur eine kleine Kamera in der Säule surrte, sie richtete ihr Objektiv auf Simon. Die Tür glitt auf. Die Männer führten ihn durch die Öffnung.
Neugierig sah Simon um sich. Während es vor der Trennwand laut war, schluckten hier dicke Teppiche jeden Laut, und nachdem sich die Eingangstür wieder geschlossen hatte, war es so still, dass es fast in den Ohren wehtat. Die Menschen, die umhereilten, sahen alle sehr geschäftig und irgendwie wichtig aus. Manche trugen eigenartige lange Gewänder, die bis zum Boden reichten. Niemand sagte etwas, alle schienen sich nur durch Blicke zu verständigen. Wer etwas mitteilen musste, beugte sich zu seinem Gegenüber und murmelte es in sein Ohr.
Überraschte Rufe ertönten, die Ersten hatten Simon gesehen. Nach und nach wurden alle auf ihn aufmerksam, und bald starrte ihn jeder an. Eine junge Frau wurde blass, als sie Simon entdeckte. Scheu, fast ehrfürchtig blickte sie ihn an. Ein Stapel Papiere, den sie getragen hatte, rutschte aus ihrer Hand und fiel zu Boden, ohne dass sie es bemerkte. Als Simon an ihr vorbeiging, sank sie auf die Knie und streckte ihre Hand aus, um ihn zu berühren.
Simon wich der Frau aus. Er war irritiert. »Was haben die alle?«
Er bekam keine Antwort. Simon spürte nur, dass der Griff an seinem Arm fester wurde und der Schritt der beiden Wächter zu seinen Seiten schneller.
Der Raum mündete in einer Reihe von breiten Stufen, die wie die Halle mit dickem Teppich bedeckt waren und zu einem prachtvoll verzierten Durchgang hinabführten. Die Tür, mit dem das Portal verschlossen werden konnte, war aus Holz, Simon erinnerte es an das Tor einer Kirche. Es stand offen.
Auf der anderen Seite des Durchgangs öffnete sich eine weitere Halle, noch größer und höher als die, in der sie eben gewesen waren. Das musste der Kuppeldom sein, von dem einer der Wächter gesprochen hatte. Erstaunt sah sich Simon um, er hatte keine Ahnung, wofür der riesige Raum genutzt wurde. Dies hier war kein ehemaliger U-Bahnhof, diese Halle hatten die Menschen eigens in die Erde gegraben. Der Saal war rund, Bänke waren in einem Halbkreis um eine erhöhte Fläche gruppiert. An der Wand direkt gegenüber dem Eingang entdeckte Simon das Wappen, das er draußen auf der Glaswand gesehen hatte, nur hier war es viel größer und noch eindrucksvoller. An der Decke darüber, direkt über der Mitte des Raumes, sah Simon ein riesiges nach außen gewölbtes Fenster, darüber erkannte er die Streben eines Stahltores, das die Kuppel komplett bedeckte. Das Tor war verschlossen, kein Lichtstrahl drang von außen herein.
»Warum hat das so lange gedauert?« Ein dicker Mann war durch eine Seitentür in die Halle geeilt, er trug ein bis zu den Knöcheln reichendes schwarzes Gewand, das Simon an den Talar eines Priesters erinnerte. Der Geistliche im Dorf seines Großvaters hatte ein solches Kleidungsstück getragen. Um den Hals trug der Mann eine dicke Kette, deren Glieder mit Ornamenten geschmückt waren und an der ein ebenso verziertes Medaillon hing. Das Symbol, das die Ornamente umrahmten, ähnelte dem, das über ihnen die Kopfseite des Raumes schmückte.
Mit einer ungehaltenen Handbewegung bedeutete der Mann den beiden Uniformierten, dass sie gehen sollten. »Lasst den Jungen hier. Ich brauche euch nicht mehr.«
Der ältere der beiden zögerte. »Aber Dr. Lytras sagt …«
»Was Dr. Lytras sagt, gilt hier nicht. An diesem Ort bestimme ich, was geschieht. Also lasst mich mit ihm alleine.«
Simon schluckte. Ihm gefiel weder der Mann noch das, was er sagte.
Die beiden Wächter zögerten. Schließlich drehten sie sich um und verließen die Halle. Die Holztür schwenkte vor das Portal, das Krachen, mit dem das Tor ins Schloss fiel, hallte im Inneren des Raumes nach.
Der dicke Mann betrachtete Simon misstrauisch. Er kam näher und umkreiste ihn lauernd. »Mich legst du nicht rein.«
Simon rang seine Angst nieder. »Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Aristide. Ich bin der Bischof in dieser Enklave. Mir untersteht die Gemeinde.«
»Welche Gemeinde?«
»Das weißt du ganz genau. Du bist doch nicht ohne Grund hier!« Der Bischof lachte verächtlich. »Wunderkind! Lächerlich! Wie hast du das gemacht?«
Simon hatte keine Ahnung, was der Mann von ihm wissen wollte.
»Was willst du uns hier vorspielen? Dass du unverwundbar bist? Dass du der Macht des Bösen trotzt?« Aristide kam näher. »Gib’s doch zu! Dich hat jemand mit einem Schutzanzug in den Strahlwald gebracht und gewartet, bis der Rettungstrupp kam. Und hier denkt jeder Trottel, dass ein Wunder geschehen ist, weil du nicht verstrahlt bist!« Er packte Simon. »Los, sag die Wahrheit!«
Eine Stimme ließ ihn herumfahren. »Ich dachte, du glaubst an Wunder, Aristide.«
Ein weißhaariger Mann hatte den Kuppeldom betreten, gemeinsam mit vier weiteren Männern. Alle trugen schlichte weiße Gewänder, die sie über ihre Kleidung geworfen hatten. Nur der Umhang des Anführers, der gerade gesprochen hatte, war golddurchwirkt, sein lockiges Haar wurde durch einen goldfarbenen Stirnreif gebändigt.
Aristide quälte ein Lächeln auf sein Gesicht. »Stephane! Willkommen!« Er wies einladend mit der freien Hand zu der erhöhten Fläche im Zentrum des Raumes, auf der zwölf gepolsterte Hocker in einem Kreis aufgestellt waren. Der Weißhaarige dankte mit einem angedeuteten Nicken und schritt, gefolgt von seinen Begleitern, die Stufen hinauf, um sich zu setzen. Aristide folge ihnen, Simon vor sich her stoßend. Simon spürte den warmen Atem des Mannes in seinem Nacken, der Bischof beugte sich über ihn. Seine Stimme war leise und drohend: »Wehe, du wagst es, mir meinen Platz streitig zu machen. Ein falsches Wort, und du bist erledigt.«
5. Kapitel
5
Aristide stieß Simon in die Mitte des Halbkreises. Die fünf Männer hatten auf den Hockern Platz genommen, auch der Bischof setzte sich auf seinen Stuhl, es war ein thronähnlicher Sessel, der höher als die Hocker war und eine geschnitzte Rückenlehne hatte. Eine Weile sagte niemand ein Wort. Simon fühlte sich unwohl unter den Blicken der Männer, die ihn prüfend musterten.
»Du weißt, wer ich bin?« Der Weißhaarige mit dem Goldreif durchbrach die Stille.
Simon schüttelte den Kopf.
»Ich bin Stephane, ich bin der Ratsvorsitzende dieser Enklave. Das hier sind meine Beisitzer.« Er wies auf seine Begleiter, die mit ernstem Gesichtsausdruck Simon zunickten. »Und wie heißt du?«
»Ich bin Simon.«
Wieder war es eine Weile still. Simon spürte, wie sein Herz klopfte. Er zwang sich, die Blicke der Männer auszuhalten.
»Man hat mir berichtet, dass der Rettungstrupp dich im Strahlwald aufgegriffen hat. Stimmt das?«
Simon nickte.
»Was hast du dort gesucht?«
Simon zögerte. Was sollte er sagen? Die Wahrheit glaubte ihm niemand. »Ich … ich weiß es nicht.«
Der dicke Bischof lachte spöttisch auf. »Er weiß es nicht. Wie rührend.«
»In der Krankenstation wird erzählt«, fuhr der Ratsvorsitzende fort, »dass du ein Weltentor gesucht hast. Das hast du den Pflegern erzählt. Was soll das sein, ein Weltentor? Und warum gehst du dafür in den Strahlwald?«
Simon schwieg hilflos.
»Du musst keine Angst haben. Erzähl uns einfach, wie ihr an den Ort gekommen seid, an dem euch der Rettungstrupp gefunden hat.« Gespannt beugte sich der Weißhaarige vor.
Simon überlegte fieberhaft. Was sollte er ihnen nur sagen?
»Das kann doch wohl nicht wahr sein!« Aristide platzte der Kragen. »Jetzt sag es uns endlich: Wer hat euch in den Strahlwald gebracht?«
»Es waren meine Freunde. Sie haben mich begleitet.« Das, dachte Simon, war noch nicht mal gelogen. Seine Freunde waren auf der anderen Seite des Weltentores zurückgeblieben.
»Deine Freunde also …« Aristide beobachtete ihn lauernd. »Mit einem Wagen und mit Schutzanzügen, richtig?«
Simon nickte stumm. Auf der Wahrheit zu beharren würde das Gespräch endlos verlängern, war ihm klar, und er hatte keine Zeit, sie hier zu vergeuden. Wollte er Ashakida und Ira helfen, musste er dieses Gespräch so schnell wie möglich hinter sich bringen.
Der Bischof ließ Simon nicht aus den Augen, während er weitersprach. »Deine Freunde haben dich und deinen Großvater in den Strahlwald gebracht und dann den Rettungstrupp alarmiert. Und kurz bevor die Retter bei euch waren, haben dein Großvater und du die Schutzanzüge ausgezogen und versteckt. So war es doch, oder?«
Erneut nickte Simon.
Der weißhaarige Ratsvorsitzende war dem Dialog stirnrunzelnd gefolgt. »Wenn es so war, wie Aristide es sagt, dann erkläre mir eines: Dein Großvater war schwer verletzt. Wie ist das passiert?«
»Wir sind in einen Fluss gestürzt. Das Wasser hat uns mitgerissen.«
»Eure Kleidung war aber nicht feucht, als wir euch gefunden haben.«
Simon wusste nicht, was er antworten sollte. Dass sie in einem Plastikfass durch die reißenden Fluten getrieben waren, würden sie ihm nicht glauben.
Ein breites triumphierendes Grinsen legte sich auf das Gesicht des dicken Bischofs. »Sie trugen Schutzanzüge, darum sind sie nicht nass geworden.«
Der Ratsvorsitzende beachtete Aristides Worte nicht. Nachdenklich, ohne ein Wort zu sagen, sah er Simon an. Dann beugte er sich zu seinen Beisitzern und die fünf Männer berieten sich flüsternd. Schließlich stand der Ratsvorsitzende auf. »Die Befragung ist beendet.« Er sah zum Bischof. »Die Wache wird den Jungen zurück auf die Krankenstation bringen. Er bleibt in der Obhut von Dr. Lytras. Sobald es dem Großvater des Jungen besser geht, treffen wir uns wieder.«
»Aber das kannst du nicht machen!« Aristide war empört. »Du weißt, wie ein unerlaubter Aufenthalt im Strahlwald bestraft werden muss.«
Der Ratsvorsitzende begegnete dem Blick des Bischofs kühl. »Du wagst es, mir zu sagen, was ich tun soll? Kümmere du dich um die Seelen deiner Gemeinde, Aristide, und überlass mir den Rest.«
»Aber …«
»Ich bin hier das Gesetz!« Der Ratsvorsitzende unterbrach den Bischof scharf. »Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen!«
Unterdessen hatte einer der Beisitzer den Raum verlassen, jetzt kam er mit den beiden Wächtern zurück. Sie quittierten den Befehl des Ratsvorsitzenden mit einem stummen Nicken und nahmen Simon mit sich.
»Du glaubst, ich mache einen Fehler …« Der Ratsvorsitzende betrachtete Aristide spöttisch.
»Ich glaube es nicht, ich weiß es!«
»Tatsächlich? Dann sage ich dir, was du nicht weißt: Meine Männer haben den Strahlwald durchsucht. Es gibt keine versteckten Schutzanzüge. Auch keine Reifenspuren oder irgendein anderes Indiz, dass jemand die beiden dort hingebracht hat. Es gibt noch nicht einmal Spuren, die zeigen, dass sie durch den Urwald gegangen sind.«
Der Bischof war kreidebleich geworden. Fassungslos starrte Aristide den Ratsvorsitzenden an.
*
Im Gang draußen war es still, und das Licht im Raum war heruntergedimmt, als Simon aus tiefem Schlaf hochschreckte. Er brauchte einen Moment, um sich zu zurechtzufinden. Dann fiel ihm wieder ein, was alles geschehen war.
Die Männer hatten ihn nach der Befragung zurück auf die Krankenstation der unterirdischen Enklave gebracht. Diesmal war es Simon nicht gelungen, auch nur ein Wort aus den beiden Wächtern herauszubekommen. Sie hatten ihn in sein Zimmer gebracht und die Tür verschlossen. Simon hatte es sofort ausprobiert: Er war eingesperrt, er konnte den Ausgang von innen nicht mehr öffnen. Kurz hatte er überlegt, zu schreien oder an die Tür zu hämmern, damit sie ihm öffneten. Doch er wusste, sie würden ihn nicht gehen lassen, selbst wenn jemand auf seine Rufe reagierte. Um nachzudenken, war er kurz in sein Bett geklettert, er war erschöpft gewesen und wollte sich nur einen Moment lang ausruhen. Er hatte nicht bemerkt, dass er eingeschlafen war.
Simon setzte sich auf und lauschte. Etwas hatte ihn geweckt, ein Geräusch, das nicht hierher gehörte. Er stieg aus dem Bett und blickte um sich. Das Krankenzimmer war verlassen, das Nachtlicht neben dem Bett leuchtete. Alles schien unverändert. Doch dann sah er, dass jemand im Raum gewesen sein musste, während er geschlafen hatte: Auf seinem Nachttisch standen ein Tablett mit Essen sowie eine Trinkflasche, und seine Kleidung, die er achtlos über einen Stuhl geworfen hatte, hing sorgfältig zusammengelegt über der Stuhllehne.
Es klopfte leise.
Jetzt wusste er, was ihn geweckt hatte. Simon lief zur Tür. »Wer ist da?«
»Hier ist Schwester Lisa. Kann ich reinkommen?«
»Moment!«
Eilig stieg er in seine Hose und zog sich sein Sweatshirt über – es musste ja nicht sein, dass sie ihn in seiner Unterwäsche sah. »Jetzt.«
Die Tür glitt auf, Schwester Lisa betrat den Raum. Simon erkannte sie nicht sofort. Sie trug keine Schwesterntracht, sondern eine Hose und eine Bluse, sodass sie wie eine ganz normale Frau aussah.
Sie lächelte, als sie Simon erblickte. »Wie geht es dir?«
»Geht so. Warum bin ich hier gefangen?«
Schwester Lisa wurde ernst. »Das war nicht meine Entscheidung, sondern die von Dr. Lytras. Sie fand, es sei das Beste für dich.«
Simon spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Wieso glaubten Erwachsene immer zu wissen, was gut für einen war? Immerhin wurde er im nächsten Jahr 14 Jahre alt, er konnte also gut selbst auf sich aufpassen. Stattdessen sperrten sie ihn hier ein und verhinderten, dass er seinen Freunden half.
Flehend blickte er die Schwester an. »Ich muss hier raus! Bitte!«
Schwester Lisa nickte ernst. »Das sagt Dr. Lytras auch. Und zwar sofort. Sie hat mich gebeten, dich zu mir zu nehmen. Pack deine Sachen, okay?«
Eine Bewegung im Gang vor dem Zimmer ließ Simon stutzen.
Schwester Lisa sah seinen Blick. Sie lächelte. »Ich habe jemanden mitgebracht: meinen Sohn. Du hattest Dr. Lytras von ihm erzählt.« Sie wandte sich um und nickte in die Dunkelheit.
Ein Junge trat aus dem Schatten des Flurs.
Simon zuckte zusammen, als er sah, wer dort hereinkam. »Luc!« Ein Lächeln zog über sein Gesicht. »Das ist ja super!« Freudig ging er auf den Jungen zu.
Luc starrte ihn stumm an, ohne das Lächeln zu erwidern.
Dann drehte er sich zu seiner Mutter um und schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Mama. Ich kenne ihn nicht.«
6. Kapitel
6
Die Wohnhöhle, in der Luc mit seiner Mutter lebte, war gemütlich, aber sehr klein, der Lohn für Lisas Arbeit als Krankenschwester reichte nur für eine P1-Einheit in einer der Siedlungen am Rand der Enklave. Die Box bestand aus zwei Räumen sowie einem Flur und einer winzigen Nasszelle. Luc hatte erzählt, dass Roboter die Wohnboxen in endlosen Reihen in die Erde gruben und die gegrabenen Höhlen sofort mit strahlungsfestem Kunststoff auskleideten. Es dauerte nur wenige Stunden, dann war eine neue Wohnung fertig. Selbst die Luftschächte, die die Wohnhöhlen mit gefilterter Atemluft versorgten, wurden von den Baurobotern gegraben und sofort an das Versorgungsnetz angeschlossen. Dafür brauchten die Arbeiter Wochen, bis sie die Versorgungsleitungen und die Technik installiert und die Elektronik an den Hauptserver angeschlossen hatten.
»Du kannst in meinem Bett schlafen.« Schwester Lisa klappte eine Liege aus der Wand. »Ich lege mich auf das Gästebett im Wohnbereich.«
Neugierig sah Simon um sich. Luc teilte sich mit seiner Mutter den Schlafraum, jeder hatte eine Seite des Zimmers für sich, mit einem Klappbett, einem Schrank und einem Nachttisch. Ein Vorhang trennte die beiden Betten voneinander. Luc hatte seine Hälfte mit Postern und selbst gemalten Zeichnungen geschmückt, sie zeigten Planeten oder startende Raketen, auf anderen Bildern waren fremde Welten zu sehen. Am besten gefiel Simon eine karge Steinlandschaft, durch die eine vieläugige Schlange kroch. Auf dem Regal über dem Bett stand das Modell eines Raumschiffes, daneben hatte Luc kleine Plastikfiguren gruppiert, es waren bunt gekleidete Weltraumkrieger, Simon kannte keinen Einzigen von ihnen. »Ist das aus einem Film?«
Luc nickte.
Simon wies auf den Bösen, gegen den die Weltraumkrieger antraten, einen schwarz gekleideten Kämpfer mit einer unheimlichen Maske und einem langen Umhang. »So einen Ähnlichen gibt es auch bei uns.«
Ehe sie es sich versahen, waren die beiden Jungen in ein anregendes Gespräch vertieft, in dem sie feststellten, dass sie beide die gleichen Geschichten mochten und dass die Filme, die in Simons Welt Gula und in Lucs Welt Superbia gezeigt wurden, in vielen Dingen ähnlich waren.
Lucs Mutter beobachtete sie lächelnd. Die Jungen bemerkten erst nach einer ganzen Weile, dass sie in der Tür stand und ihnen zusah.
»Mama, was soll das?« Luc war es peinlich, dass sie belauscht worden waren.
Lisa lachte auf. »Ich lass euch ja gleich alleine. Aber vorher macht ihr euch für die Nacht fertig. Es ist schon spät.«
Simon zögerte, dann sah er Lucs Mutter an. »Bekommen Sie Ärger, weil Sie mich zu meinem Opa gebracht haben?«
»Mach dir keine Gedanken.« Lisa lächelte. »Jeder auf der Krankenstation versteht, dass du deinen Großvater sehen wolltest.«
Simon nickte ernst und sah sie an. »Danke.«
»Wofür?«
»Dass ich hier sein darf. Ich bin froh, nicht mehr in diesem Krankenzimmer sein zu müssen.«
»Danke nicht mir, danke Dr. Lytras.« Lisa nahm frische Nachtwäsche für Simon aus der Kleiderbox. »Sie ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Sie wirkt so streng, weil sie sich verantwortlich fühlt. Außerdem hast du sie nachdenklich gemacht.«
»Womit?«
»Als du von deinen Freunden erzählt hast, von Ira, Tomas, Filippo und Luc.« Sie warf ihrem Sohn einen kurzen Blick zu.
Simon wollte nachfragen, doch Lucs Mutter beendete das Gespräch resolut. »So, jetzt ist Schluss! Ab ins Bett mit euch. Luc zeigt dir alles. Es ist hier bei uns sicher vieles anders als bei dir zu Hause.«
Simon schwieg bedrückt. Er musste an das Haus des Großvaters denken, das verbrannt war, als sein Vater das offene Weltentor schließen wollte. Er hatte kein Zuhause mehr. Und ob seine Eltern noch lebten, wusste er nicht.
Lisa betrachtete ihn voller Mitgefühl. »Keine Sorge, du wirst deine Eltern wiedersehen.«
Überrascht sah Simon auf. »Woher wollen Sie das wissen?«
Lucs Mutter zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Woher weiß ich, dass deine Geschichte wahr ist? Ich spür’s einfach.« Sie zeigte auf ihr Herz.
Simon schwieg bedrückt. Spontan und ohne zu fragen nahm Lisa ihn in den Arm. Simon sträubte sich ein wenig, doch dann legte er, die Augen geschlossen, seinen Kopf an ihre Schulter.