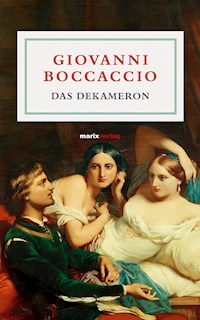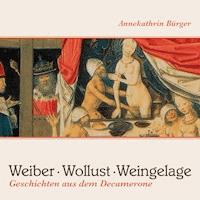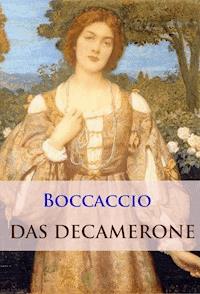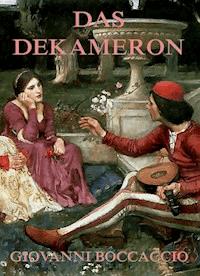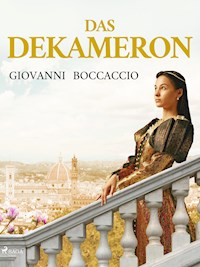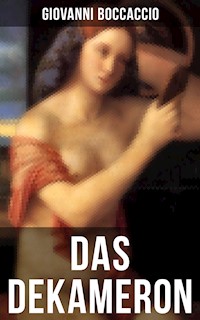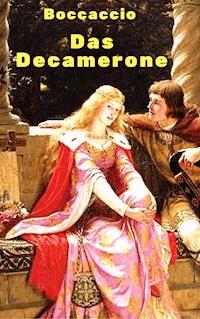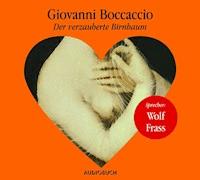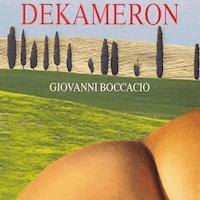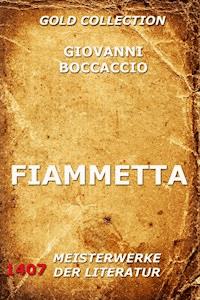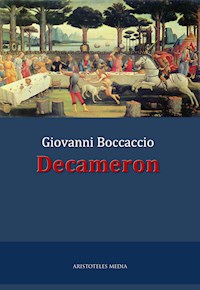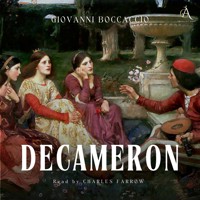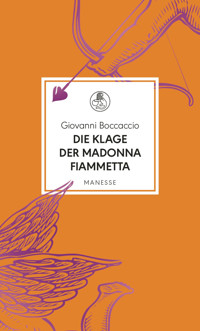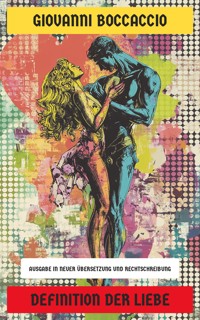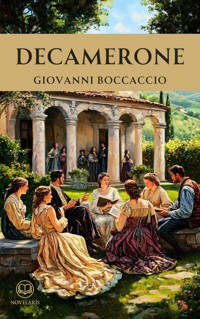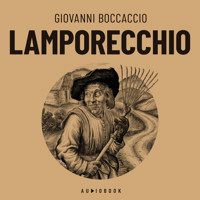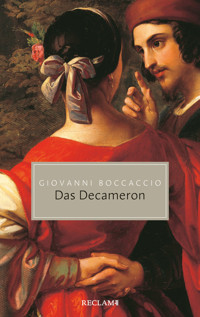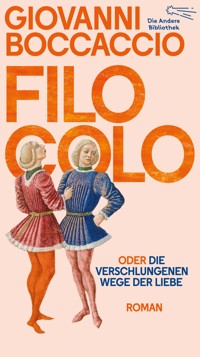
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die Geburtsstunde des europäischen Romans.
Der spanische Thronfolger Florio und die Waise Biancifiore wachsen gemeinsam auf und verlieben sich. Doch Florios Vater ist gegen die Verbindung und verkauft Biancifiore an Sklavenhändler nach Babylon. Unter dem Decknamen »Filocolo«, »Liebesmüh«, begibt sich Florio auf die abenteuerliche Suche nach seiner Geliebten. Nach unzähligen Irrungen und Wirrungen wird das Paar schließlich wieder vereint. Es ist eine spektakuläre Reise durch die großen und allergrößten Themen: Liebe, Krieg, Wahrheit, Herrschaft, Moral und die Frage nach dem Jenseits sind nur einige davon. Dabei ist Boccaccios »Filocolo« nicht nur die Wurzel seines weltberühmten »Decameron«, er markiert auch die Geburtsstunde unseres heutigen Verständnisses von Literatur. Und demonstriert auf eindrucksvolle Weise die unerschöpflichen Möglichkeiten des Romans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1272
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Die Geburtsstunde des europäischen Romans.
Der spanische Thronfolger Florio und die Waise Biancifiore wachsen gemeinsam auf und verlieben sich. Doch Florios Vater ist gegen die Verbindung und verkauft Biancifiore an Sklavenhändler nach Babylon. Unter dem Decknamen »Filocolo«, »Liebesmüh«, begibt sich Florio auf die abenteuerliche Suche nach seiner Geliebten. Nach unzähligen Irrungen und Wirrungen wird das Paar schließlich wieder vereint. Es ist eine spektakuläre Reise durch die großen und allergrößten Themen: Liebe, Krieg, Wahrheit, Herrschaft, Moral und die Frage nach dem Jenseits sind nur einige davon. Dabei ist Boccaccios »Filocolo« nicht nur die Wurzel seines weltberühmten »Decameron«, er markiert auch die Geburtsstunde unseres heutigen Verständnisses von Literatur. Und demonstriert auf eindrucksvolle Weise die unerschöpflichen Möglichkeiten des Romans.
Über Giovanni Boccaccio
Giovanni Boccaccio (Certaldo oder Florenz 1313 - Certaldo 21.12.1375) war der uneheliche Sohn eines Florentiner Kaufmanns und einer Französin. Er wuchs in Florenz auf und ging um 1330 als Kaufmann nach Neapel, studierte die Rechte und beschäftigte sich mit der Antike. 1350 lernte er Petrarca kennen, den er als seinen Lehrer verehrte. Sein bedeutendstes Werk ist das »Decameron« (1348/53), eine Novellensammlung, die die europäische Literatur wesentlich geprägt hat und bis heute beeinflusst.
Moritz Rauchhaus studierte Deutsche Literatur, Philosophie und Europäische Literaturen in Berlin, Rom und Bordeaux. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem auf dem italienischen Spätmittelalter, mediterranen Identitäten und der Wechselwirkung von Kulinarik und Literatur. Für seine Übertragung von Boccaccios »Trattatello in laude di Dante« (Büchlein zum Lob Dantes) erhielt er den Förderpreis des Mazzucchetti-Gschwend-Übersetzungspreises 2024. An der Übersetzung von »Filocolo« arbeitete er über acht Jahre.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Giovanni Boccaccio
Filocolo
oder Die verschlungenen Wege der Liebe
Aus dem Italienischen von Moritz Rauchhaus
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Moritz Rauchhaus: Giovanni Boccaccios Filocolo
Einleitung
Buch I Filocolo
Buch II Filocolo
Buch III Filocolo
IBuch IV Filocolo
Buch V Filocolo
ANHANG
Verzeichnis der Figuren und Orte
Figuren
Orte
Biographien
Danksagung
Bildnachweis
Erläuterungen
Impressum
Giovanni Boccaccio
Raffaello Morghen 1822
Moritz Rauchhaus
Giovanni Boccaccios Filocolo
Einleitung
Giovanni Boccaccio stellte als junger Student, wohl zwischen 1336 und 1338, sein bis dahin umfangreichstes Werk fertig und nannte es nach seiner Hauptfigur Il Filocolo. Damit brachte er nichts weniger als den ersten Prosaroman in einer europäischen Volkssprache in Umlauf, die heute noch verstanden wird. Boccaccio hat selbstbewusst Neuland betreten, was aus zwei Gründen geradezu revolutionär genannt werden kann: Erstens gab es literarische Texte in der italienischen Volkssprache überhaupt erst seit hundert Jahren, zweitens wählte man im Mittelalter für bedeutsame Stoffe stets die Versform, auch für Romane. Aber Boccaccio gehörte einer neuen Generation von Dichtern an, die experimentierfreudig für ihre aufblühenden Metropolen schrieben.
Als Ende des 13. Jahrhunderts in Florenz, Neapel und anderen italienischen Großstädten ein deutlicher wirtschaftlicher Aufschwung spürbar wurde, bekamen die juristisch und kaufmännisch ausgebildeten Akteure dieser neuen Zeit eine eigene Stimme. Die Schulen passten ihre Lehrpläne an, und obwohl das Lateinische in der Kirche und an den jungen Universitäten noch dominierte, kam man plötzlich mit dem Italienischen nicht nur weiter, sondern geradezu hoch hinaus – allen voran mit Boccaccios Muttersprache, dem Florentinischen. Ein neues Lesepublikum mit ganz eigenen Lesegewohnheiten entstand, und zu den ersten Helden dieser neuen Literatur werden nicht nur Dante Alighieri (1265–1321) oder Guido Cavalcanti (1255–1300), sondern wenig später auch Giovanni Boccaccio gezählt.
Geboren wurde er in Certaldo oder Florenz im Jahr 1313, also stammt auch er, wie sein großes Vorbild Dante, aus der Toskana, die noch einige andere weltgeschichtlich bedeutende Söhne und Töchter hervorbringen sollte. Sein Vater Boccaccio di Chellino (1297–1348) war ein erfolgreicher Kaufmann, der nicht nur in den italienischen Handelsmetropolen wirkte, sondern auch in Paris, dem damaligen wirtschaftlichen Zentrum des Abendlandes. Vor allem Kaufmänner und Notare bestimmten das Bild dieser Städte, die so rasant wuchsen, dass sich schon Dante in der Generation vor Boccaccio im 16. Gesang seines Inferno vom schnellen Geld und den neuen Gesichtern in den oberen Schichten einigermaßen irritiert zeigte: »Diese neuen Leute und ihr plötzlicher Gewinn / haben dir Stolz und Überheblichkeit gebracht, / Florenz, so dass du dich darüber schon beklagen musst.« (73–75)
Giovanni Boccaccios genauer Geburtsort ist genauso unklar wie der Name seiner Mutter, die sicher nicht mit seinem Vater verheiratet gewesen ist. Die wenigen biographischen Hinweise zu Boccaccios Kindheit finden sich unter anderem in Texten wie dem Filocolo, jedoch immer nur andeutungsweise und versteckt hinter Decknamen, Allegorien oder Vergleichen (⟶ Buch V, Kap. 8). Wahrscheinlich begann er seine Ausbildung im Alter von sechs Jahren in Florenz bei Giovanni Mazzuoli da Strada, dem Vater des Dichters Zanobi da Strada (1312–1361). Schon früh war Boccaccio mit Zanobi befreundet und las gemeinsam mit ihm Texte Ovids, aber die Studienwege der beiden sollten vorerst weit auseinandergehen. Das Lateinische spielte am Anfang von Giovanni Boccaccios Schullaufbahn keine große Rolle, denn die Interessen des Vaters setzten sich schnell durch: Anstatt sich ganz der lateinischen Grammatik zu widmen, sollte der Sohn auf Grundlage der Volkssprache das Rechnen und Buchhalten perfektionieren, um später selbst Kaufmann zu werden. Schon mit zwölf Jahren konnte Giovanni bemerkenswerte arithmetische Kenntnisse aufweisen, während Zanobi Klassiker lesen und auslegen durfte. In dieser Zeit, wohl mit 13 oder spätestens 14 Jahren, kam Giovanni mit seinem Vater nach Neapel, wo er noch weiter im Handel und später im Recht ausgebildet wurde. In dieser Stadt entstanden auch die ersten literarischen Arbeiten, denn die Poesie ließ ihn nicht los. Sehr zum Ärger seines Vaters setzte er sein intensives Selbststudium fort.
Der Umzug nach Neapel lag für den Vater nahe. Er war schon zuvor in Florenz für das Bankhaus der Familie Bardi aktiv, das einen ebenso beeindruckenden Wohlstand wie Kundenstamm aufweisen konnte: Sie liehen unter anderem dem kalabrischen Herzog Karl (1298–1328) Geld, der von 1326 bis 1327 in Florenz sogar das Amt des Signore bekleidete, also der oberste Herr der Stadt war. Karls Vater war Robert von Anjou (1278–1343), ein späterer Förderer Boccaccios, der keinen geringeren Posten als den des Königs von Neapel innehatte. Dessen Macht wurde von Norden und Süden bedroht, der König war also auf frisches Florentiner Geld angewiesen, um (nicht nur politisch) zu überleben. Wer das garantieren konnte, war natürlich mit der ganzen Familie herzlich willkommen.
Boccaccios Vater stieg zu hohem Ansehen an Roberts Hof auf, er bekam immer bedeutendere Titel verliehen und Aufgaben zugeteilt. Das Leben des jungen Studenten Giovanni wird sich in der Nähe des Castel Nuovo abgespielt haben, unweit des neapolitanischen Sitzes der Bardi, die sich – wie andere Händler auch – im Viertel Portanova niedergelassen hatten. Sein Alltag drehte sich ums Abwiegen von Geldstücken, Ausstellen von Schuld- oder Pfandbriefen, um Ein- und Auszahlungen. Dabei kam die Kundschaft nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auf den Handelsrouten über Land und Meer aus allen Ecken der Welt, die Boccaccio in seinem lateinischen Spätwerk mit enzyklopädischem Anspruch beschreiben sollte.
Doch er kam nicht nur mit den Gestalten, Problemen und Geschichten des Alltags in Berührung, durch die gehobene Stellung seines Vaters hatte er auch Zugang zum neapolitanischen Hof. Viele adlige Figuren dieses Umfelds tauchten in den späteren Texten Boccaccios wieder auf, allen voran König Robert, der wie kaum ein Fürst seiner Zeit die Künste förderte und der Region einen Frieden garantierte, um den die Neapolitanerinnen und Neapolitaner von vielen beneidet wurden.
In dieser Zeit entstanden die ersten Texte Boccaccios, die wir aus seinen eigenen Notizbüchern oder späteren Abschriften kennen: Einige Briefe auf Latein, Stilübungen wie die Elegia di Costanza und die beiden volkssprachlichen Werke La caccia di Diana (die »Jagd der Diana«) und Il Filostrato. Die »Jagd der Diana« dürfte um 1334 entstanden sein, also kurz nach dem 20. Geburtstag Boccaccios, auch wenn wegen der schlechten Quellenlage das Jahr nur geschätzt werden kann. Der Text spielt an König Roberts Hof und beschreibt eine Jagd, die die römische Göttin Diana (zuständig auch für die Keuschheit) mit den schönen Damen der neapolitanischen Hofgesellschaft veranstaltet. In einer Jagdpause sollen Opfer für Jupiter dargebracht werden, aber eine Dame möchte lieber die Liebesgöttin Venus ehren, die daraufhin der Gruppe erscheint. Schon dieses frühe Werk strotzt vor antiken Anspielungen und beweist Boccaccios Interesse an den grenzenlosen Möglichkeiten der Liebe. Die Caccia ist in Terzinen verfasst, also dem Versmaß, das Dante wenige Jahrzehnte zuvor für seine Commedia gewählt hatte. Boccaccio eifert seinem großen Vorbild Dante schon früh nach und sucht dabei seinen eigenen Stil. Und schon in seinem nächsten Werk legt er nach.
Der Filostrato (vermutlich 1335 entstanden) gilt als eines der ersten Werke der italienischen Literatur, das in Oktaven geschrieben ist, also einer Strophenform, die in den Ritterromanen des 16. Jahrhunderts zu großer Berühmtheit gelangen wird, allen voran in Ludovico Ariostos Orlando Furioso (1516). Wie der Filocolo kreist auch der Filostrato um eine mit eigenwilliger griechischer Etymologie benannte Hauptfigur. Der Name soll so etwas wie »von der Liebe besiegt« heißen und begleitet Boccaccio noch bis ins Decameron.
Der Filostrato funktioniert ähnlich wie der Filocolo: In einem Vorwort werden der neapolitanische Hof und eine begehrte Dame angesprochen, die Handlung selbst spielt lange in der Vergangenheit, in diesem Fall zu Zeiten des Trojanischen Krieges. Der Text behandelt allerdings weniger die Ereignisse des Krieges als vielmehr die Gefühle, Unterhaltungen und Gedanken der Figuren. Boccaccio spielt im Vorwort auf die alten Geschichten über den Krieg an, aber meint damit (noch) nicht die Ilias des Homer, die erst einige Jahrzehnte später in Florenz ins Lateinische übersetzt wurde. Seine wichtigste Quelle wird die lateinische Historia destructionis Troiae des sizilianischen Dichters Guido delle Colonne (1210–1287) gewesen sein, der wiederum eine Übersetzung des Trojaromans Benoît de Sainte-Maures (gest. 1173) ist. Boccaccio schreibt also einen volkssprachigen Verstext in Oktaven, der auf ein lateinisches Prosawerk des 13. Jahrhunderts Bezug nimmt, das einen französischen Versroman des 12. Jahrhunderts über den Trojanischen Krieg übersetzt. Wer rasante Mobilität von Texten erst mit dem Buchdruck in Verbindung bringt, irrt gewaltig. Vor diesem Hintergrund wirkt das ausufernde Erzählen im Filocolo tatsächlich weniger überraschend, denn sein wissensdurstiger junger Autor hat nichts anderes als seine Bildung und seinen zukünftigen Ruhm im Sinn.
Boccaccio widmete sich auch schon in jungen Jahren in Neapel mit dem Filocolo einem monumentalen Schreibprojekt in volkssprachiger Prosa. In fünf Büchern und insgesamt 459 Kapiteln entwirft er nach einem rasanten Prolog eine mitreißende Abenteuerreise, in der es um die großen und allergrößten Themen geht: Liebe, Eifersucht, Intrige, gutes und schlechtes Regieren, moralische Zwickmühlen und die Frage nach dem Jenseits sind nur einige davon.
Grundlage des Romans ist die berühmte Liebesgeschichte von Florio und Biancifiore, die im 12. Jahrhundert vermutlich aus dem persischen Sprachraum nach Europa gelangte und danach in zahlreichen Varianten auf dem ganzen Kontinent kursierte. Auch eine italienische Version in Versen existierte bereits vor Boccaccios Lebenszeit, aber selbst wenn er sich bei ihr bedient haben sollte, übertrifft er in seiner umfangreichen Bearbeitung die um ein Vielfaches kürzere Vorlage.
Bei aller Verschiedenheit lassen sich über die Jahrhunderte und Sprachen hinweg Handlungselemente wiederfinden, die unverändert bleiben: Florio und Biancifiore werden am selben Tag geboren und verlieben sich früh Hals über Kopf ineinander; sie werden von Florios Eltern voneinander getrennt, weil sie ihn als Königssohn zu Höherem bestimmt sehen, so dass Florio sich auf die abenteuerliche Suche nach seiner Biancifiore begeben muss; sie finden sich schließlich wieder und können heiraten. Der Filocolo ist die längste und komplexeste Bearbeitung dieses Stoffes. Das Werk eröffnet mit einem entsprechend anspielungs- und wortreichen Prolog, der die ersten vier Kapitel umspannt: Hier wird die Handlung in ihren großen weltgeschichtlichen, mythologischen, poetischen und politischen Kontext eingebettet. Es ist gleichzeitig ein Prolog im Himmel, in der Hölle, am Hof und in der Kirche, aber bereits ab dem fünften Kapitel des ersten Buches beginnt die eigentliche Liebes-, Such- und Abenteuergeschichte.
Schon der Beginn des Filocolo ist rasant und hält sich nicht mit Anspielungen zurück. Im allerersten Kapitel kommt Juno in ihrem von Pfauen gezogenen Wagen auf die Erde, genauer gesagt nach Rom, um den Papst zu ermahnen, die Herrschaft der Könige aus dem Geschlecht der Anjou beginnen zu lassen. Roberts Großvater Karl I. von Anjou (1227–1285) soll in Süditalien den sizilianischen Stauferkönig Manfred (1232–1266) vom Thron stoßen und dafür auf die Unterstützung aller Götter zählen können. Dieser fast schwindelerregende Schnelldurchlauf durch die politische Geschichte des Spätmittelalters hat einen tieferen Sinn: Juno steht hier (wie im gesamten Roman) für die christliche Kirche, die am Ende des fünften Buches triumphiert, sobald alle noch lebenden Figuren getauft sind. Boccaccios König Robert stammt ebenfalls aus dem Hause Anjou und wird ab 1309 Neapel regieren können, weil Karl im Jahre 1266 tatsächlich Manfred in der Schlacht von Benevento besiegt hatte.
Im ersten Kapitel des Filocolo treffen wir schließlich auch den Autor selbst, der an einem Karsamstag in der neapolitanischen Kirche San Lorenzo sitzt, um einer Messe zu lauschen. Eine geheimnisvolle Dame kommt dazu, die sich als Tochter des neapolitanischen Königs Robert herausstellen wird. Sie ist wunderschön, und natürlich verliebt er sich in sie. Ihr eigentlicher Name wird erst einmal verschwiegen, bis sie drei Bücher später als Fiammetta vorgestellt wird, obwohl sie eigentlich Maria heißt (⟶ Buch IV, Kap. 16). Sie wird immer wieder in Boccaccios Schriften auftauchen, hier im Filocolo ist sie sogar der Ausgangspunkt des gesamten Geschehens. Ohne ihren an den Autor gerichteten Wunsch, dass endlich jemand mit angemessenen Worten die schöne Geschichte von Florio und Biancifiore aufschreiben möge, gäbe es das Buch nicht – soweit jedenfalls die inszenierte Legende, die den Bogen vom ersten Kapitel des ersten Buchs zum letzten Kapitel des fünften Buchs spannt. Boccaccio folgt also ihrem Wunsch und widmet sich dem Vorhaben, sein »kleines Büchlein« (⟶ Buch I, Kap. 1) zu schreiben, auf seine ganz eigene Weise. Seine Liebe zu Fiammetta beweist er durch die Nacherzählung der großen Liebesgeschichte von Florio und Biancifiore.
Der Filocolo trägt die folgenreichste Eigenheit von Boccaccios Version übrigens bereits im Titel: Zwar zeigen auch die Vorgängertexte, dass der spanische Prinz Florio seinen Namen verschleiert, bevor er aufbricht, um Biancifiore zu suchen. Hier allerdings gibt er sich selbst den Decknamen »Filocolo«, was so viel wie »Liebesmüh« heißen soll. Er möchte unerkannt bleiben, also nimmt er eine völlig neue Identität an, durch die ihm auch eine neue soziale Rolle zugeteilt wird. Er wird ein Pilger der Liebe, muss also auf alle Privilegien verzichten, die er als Thronfolger sonst genießt. Der Namenswechsel geschieht am Ende des dritten Buchs, also ziemlich genau zur Hälfte des Romans (⟶ Buch III, Kap. 75), bevor Filocolo erst wieder am Ende des fünften Buchs zu Florio wird (⟶ Buch V, Kap. 71). In der Zwischenzeit nennen ihn nicht nur die Erzählstimme, sondern auch seine engsten Freunde und er sich selbst bei dem neuen Namen.
Als er schließlich wieder Florio genannt wird, geht er keinen Schritt zurück, sondern einen nach vorn. Er nimmt seinen alten Namen an, aber gleichzeitig in aller Feierlichkeit auch eine neue Religion. Ganz am Schluss des Romans wird er mit allen anderen noch lebenden Figuren getauft und beginnt ein neues Leben als christlicher Herrscher über Spanien. Die Geschichte spielt allerdings gut 700 Jahre vor Boccaccios eigener Gegenwart, als die Christianisierung einiger Teile Europas noch in der Zukunft lag. Boccaccio verortet seinen Roman zwar in dieser Zeit, aber gibt die historischen und geographischen Begebenheiten nicht treu wieder, sondern so, wie sie zu seiner Geschichte passen, in der die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Phantastischen fließend sind.
Bisher hatte niemand die Liebesgeschichte von Florio und Biancifiore so umfangreich und virtuos erzählt wie Boccaccio: Es ist sein Roman, er gibt ihm Gestalt, auch wenn er den eigenen Namen nur andeutet und nie deutlich ausspricht. Ganz am Anfang und ganz am Ende des Filocolo taucht er als Autor auf, der um Verständnis und Beistand bittet, dazwischen treffen wir ihn in seiner Heimatstadt Certaldo wieder, allerdings verwandelt in einen sprechenden Baum namens Idalogos (⟶ Buch V, Kap. 8). Wenn auch dieser Giovanni seinen Namen nicht nennt, spielt er durchaus auf sich an – zum Beispiel bei der Vorstellung der bedeutenden römischen Papstbasilika San Giovanni in Laterano, benannt nach dem Evangelisten und dem Täufer Johannes (⟶ Buch V, Kap. 52). Hier wird Filocolo vom Priester Ilario alles über das Christentum erfahren und schließlich den Wunsch äußern, selbst getauft zu werden.
Boccaccio verändert auch die Chronologie seiner Vorlagen. Statt zu Ostern, wie in den meisten anderen Versionen der Geschichte, werden die beiden Verliebten zu Pfingsten geboren. Nur sind die drei Ostertage damit nicht ganz vergessen: Boccaccio trifft seine Geliebte Fiammetta an einem Karsamstag, um von ihr den Auftrag zum Schreiben des Romans zu erhalten (⟶ Buch I, Kap. 1). Damit steht das Osterfest zwar noch am Beginn, aber nicht für die Figuren, sondern für ihren Autor.
Wieso also Pfingsten statt Ostern als Geburt der beiden Hauptfiguren? Der Pfingstsonntag ist der 50. Tag des Osterfests und sein formaler Abschluss, wovon wiederum die Gliederung in fünf Bücher des Filocolo abgeleitet ist. Die Apostel werden vom Heiligen Geist erfüllt, sprechen alle Sprachen der Welt und ziehen los, um das Christentum zu verbreiten. In diesem Rahmen wagt Boccaccio eine bis dahin einzigartige Adaption der Geschichte von Florio und Biancifiore: Von Beginn an verschränkt er den mythologischen Götterhimmel mit der christlichen Tradition, mischt antike und zeitgenössische Stimmen und führt zahlreiche Nebenfiguren ein. Obwohl er ganz am Anfang der volkssprachigen Erzähltradition steht, zeigt der Filocolo auf eindrucksvolle Weise die gewaltigen Möglichkeiten der Prosa. Er beweist die Vielseitigkeit des Florentinischen, und zwar mit einer unleugbaren Freude am Spiel mit Verwandlungen, Verschränkungen und Ungewissheiten.
Dabei herrscht durchaus eine genaue Ordnung, denn der Filocolo wird von einer straffen Struktur zusammengehalten, so dass auch die längste Abschweifung immer logisch auf die Haupthandlung zurückverweist. Nach jeder Nebenhandlung kommt der Roman erneut auf zentrale Ereignisse zu sprechen, um den Fortgang der Handlung noch einmal aus anderer Perspektive zu verfolgen: Beispielsweise sind wir am Ende des langen vierten Buches und zu Beginn des fünften plötzlich wieder an dem Handlungsstrang, der am Ende des dritten Buchs erzählt worden war, nämlich Florios Abschied aus Marmorina, der Hauptstadt des Spanischen Reiches. Auf diese Weise bleiben die zahlreichen Exkurse und immer neuen Abenteuer mit der zentralen Reise verbunden, die in Rom mit Junos Auftrag an den Papst beginnt und in Cordoba mit Florios Krönung endet.
Die Abschweifungen beweisen nicht nur Boccaccios Freude am Ausbreiten mythologischen, christlichen, astrologischen oder philosophischen Wissens, sondern machen den Roman zu einem einzigartigen und bis dahin nie dagewesenen Erzählspektakel: Die Geschichte von Florio und Biancifiore lässt sich im Grunde genommen schnell wiedergeben, das wurde vor und nach dem Filocolo häufig getan. Nur diese Geschichte, das heißt Giovanni Boccaccios Geschichte, braucht mehr Platz. Am deutlichsten wird das bei der literaturgeschichtlich wohl folgenreichsten Nebenhandlung des Romans im vierten Buch, denn dort lässt sich nichts weniger als das Ur-Decameron finden.
Auf der Suche nach seiner Biancifiore gerät Filocolo mit seinen Gefährten außerhalb von Neapel in eine kleine Festgesellschaft (⟶ Buch IV, Kap. 14). Hier treffen wir seine Fiammetta wieder, und zwar als Oberhaupt der Gruppe feiernder junger Menschen. Filocolo ist begeistert von ihr und lässt sich deshalb überreden, länger als ursprünglich geplant in ihrem Garten zu verweilen. Dort vertreibt sich die Gruppe die heißen Stunden des Sommertages im Schatten mit einem Spiel. Sie krönen eine Königin – diese Rolle übernimmt Fiammetta – und erzählen sich der Reihe nach 13 sogenannte »Liebesfragen« (quistioni d’amore), die in verschiedensten Konstellationen um das ewig gleiche Problem kreisen: Liebt er mich? Liebt sie mich nicht? Danach muss die Königin eine Antwort auf die Frage finden, die meistens genau das Gegenteil dessen sagt, was die Fragenden hören wollten. Als die Hitze schließlich nachlässt, feiern sie wieder miteinander, bis Filocolo und seine Gefährten kurz darauf Abschied von Fiammetta nehmen (⟶ Buch IV, Kap. 72).
Während im Filocolo diese Form des Erzählens also noch in eine größere Handlung eingebettet ist, wird Boccaccio ihr mit seinem Decameron in der Länge ein eigenes Buch widmen. Zwar sitzen auch dort ähnlich viele Erzählerinnen und Erzähler an einem abgeschiedenen Ort beisammen und tauschen unter der Leitung einer Königin oder eines Königs Novellen aus, allerdings zehnfach so umfangreich: An zehn Tagen werden jeweils zehn Novellen zu einem Tagesthema vorgetragen und kurz kommentiert. Im Decameron entfliehen die zehn jungen Florentinerinnen und Florentiner darüber hinaus nicht nur der Hitze eines Sommertages, sondern vor dem Schwarzen Tod, der großen Pest von 1348. Boccaccio zeigt, dass die Form trotzdem gleich bleibt: Leerstellen sollen mit Literatur gefüllt und Sprache gegen die Ungewissheit gesetzt werden. Es ist deshalb kein Zufall, dass die quistioni d’amore im Filocolo in der Nähe von Neapel und die Novellen im Decameron in der Nähe von Florenz ausgetauscht werden. Denn wenn diese Metropolen auch immer wieder von Katastrophen und Krisen erschüttert werden, ist für Boccaccio an einer Sache nicht zu zweifeln: Wo Sprache und Literatur, wo Witz und Rhetorik zu finden sind, ist die Zivilisation nicht verloren.
Boccaccios Vater hat seinem Erstgeborenen sechs Jahre lang seine Leidenschaft für den Handel nahebringen wollen, musste sich aber 1335 oder 1336 eingestehen, dass dieser Weg zu keinem guten Ende führen würde. Giovanni Boccaccio war inzwischen häufiger über seinen Dichtungen als über den Rechenbüchern zu finden. Der Kompromiss war also ein Studium des Kanonischen Rechts, das heißt, fortan beschäftigte er sich unter anderem mit römischer Rechtsgeschichte sowie der Ordnung der Kirche, ihrer Hierarchie und ihren Gesetzen. Als er mit ungefähr 18 Jahren dieses Studium antrat, war er ein ungewöhnlicher Student, denn er hatte keinen der offiziellen Vorbereitungskurse belegt und keine klassische Lateinbildung genossen, verfügte allerdings schon über ein bemerkenswertes Wissen und Sprachgefühl.
Dem Recht kommt in seinem Werk keine geringe Bedeutung zu: Der Filocolo spielt immerhin in der Zeit Kaiser Justinians I. (482–565), der eine der berühmtesten Gesetzessammlungen der Antike in Auftrag gegeben hatte. Außerdem sind die angesprochenen quistioni d’amore im vierten Buch nicht nur die Keimzelle des Decameron, sondern ebenso eine Feier der juristischen Disputation. Es geht, mehr noch als nur um einfache Liebesprobleme, auch und vor allem um die verschiedenen Möglichkeiten ihrer Deutung. Boccaccio ist nicht an einfachen Lösungen, schnellen Pointen oder verhärteten Positionen interessiert. Es kommt auf Argumente an, auf Auslegungen und nicht zuletzt auf das richtige Sprachgefühl.
In Neapel wirkten damals zahlreiche berühmte Juristen, allen voran Cino da Pistoia (1270–1336), der auf Einladung Roberts in den Jahren 1330 und 1331 einige Vorlesungen hielt, also kurz bevor sich Giovanni in der Universität einschrieb. Cino war nicht nur ein gefeierter Rechtsgelehrter, sondern selbst Dichter und (Brief-)Freund Dantes, dem großen Vorbild Boccaccios. In Giovannis Notizbüchern aus dieser Zeit lässt sich auch die Abschrift eines Briefes von Dante an Cino finden, den er kurze Zeit später in einem eigenen Brief nachahmte. Cino war für ihn der große Held an Dantes Seite, der auf den Spuren des wenige Jahre zuvor verstorbenen Florentiner Dichters wandelte. In Neapel hörte Boccaccio auch zum ersten Mal von Francesco Petrarca (1304–1374), den er sofort verehrte.
In dieser Zeit machte Boccaccio an Roberts Hof außerdem die prägende Bekanntschaft mit Paolo da Perugia (gest. 1348), der die königliche Bibliothek betreute und von seinen Zeitgenossen als umfassend gelehrter Mensch beschrieben wurde. Hier kam Giovanni mit der Astrologie in Berührung, auch durch die Schriften des Gelehrten Andalò del Negri (1260–1334), der wohl als Vorbild für Calmeta (⟶ Buch V, Kap. 8) gedient hat. Außerdem konnte Giovanni hier seine mythologischen Kenntnisse erweitern und las über die griechische und byzantinische Kultur, die – bis hinein in den Titel – für den Filocolo von größter Bedeutung sind. In dieser Zeit studierte Giovanni die Autoren, die die Autoritäten für sein weiteres Schaffen werden sollten.
Denn Vorbilder sind nicht nur die angesprochenen mittelalterlichen Versionen der Liebesgeschichte von Florio und Biancifiore, sondern auch Autoren der römischen Antike wie Valerius Maximus, Ovid, Statius, Vergil oder Lukan sowie der nur wenige Jahre zuvor verstorbene Dante. Der Einfluss ihrer Schriften auf den Roman ist kaum zu überschätzen, immer wieder spielt Boccaccio auf sie an oder zitiert sie direkt, worauf in dieser Übersetzung unter der Angabe der Abkürzung und des genauen Kapitels beziehungsweise Verses hingewiesen wird. Dazu gehören vor allem die folgenden fünf Werke: Die Facta et Dicta Memorabilia von Valerius Maximus (Val. Max.) aus der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts, in der in neun Büchern historische Anekdoten über berühmte Figuren versammelt sind. Ihre Bedeutung für Boccaccio wie für das gesamte europäische (Spät-)Mittelalter war immens; sie fungierten als Nachschlagewerk, aber auch als Inspirationsquelle zur Anreicherung eigener Texte mit ergreifenden, aufwühlenden, unterhaltsamen oder schlicht kuriosen Geschichten.
Außerdem führt kein Weg an Vergils Aeneis (Aen.) vorbei, dem Epos aus dem letzten Drittel des 1. Jahrhunderts v.u. Z., das die Flucht des Trojaners Aeneas aus dem brennenden Troja und seine Ankunft in Italien beschreibt: die wichtigste Erzählung über die Gründung und die Bestimmung Roms. Ebenso prägten ihn Ovids Metamorphoses (Met.), eine im ersten Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts geschriebene mythologische Sammlung von Verwandlungen, und Ovids ungefähr zur selben Zeit entstandenes Lehrgedicht über die Liebe Ars amatoria (Ars). Schließlich ist noch der bereits angesprochene Einfluss von Dantes Commedia zu nennen. Auf diese im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts verfasste Jenseitsreise durch die Hölle (Inf.) bis ins Paradies (Par.) nimmt der Filocolo immer wieder Bezug.
Unter anderem diese Autoritäten sind es, die Boccaccio am Ende des Filocolo als Vorbilder und Lehrer anruft, um vorsichtshalber um Verzeihung zu bitten, dass auch er es gewagt hat, ein so langes Buch zu schreiben (⟶ Buch V, Kap. 97). Die Bescheidenheitsgeste gehört zum Genre und lässt sich deshalb sogar als Ausdruck größten Selbstvertrauens lesen. Wie hätte sich Boccaccio auch wehren können? Es war schließlich Fiammetta selbst, die ihn aufforderte, endlich einen angemessenen Erzählrahmen für die Liebesgeschichte von Florio und Biancifiore zu finden – allerdings in der Volkssprache, weil sie explizit auch ein weibliches Publikum ansprechen soll.
Diese Begründung wird im Vorwort des Decameron einige Jahre später wieder auftauchen, aber hier wie da steckt offensichtlich noch mehr dahinter. Boccaccio verfügte durchaus über genug Lateinkenntnisse, um sich an einer Version zu versuchen, die ein gelehrtes und gesamteuropäisches Publikum honoriert hätte. Er wollte allerdings einen neuen Ring betreten und in diesem brillieren: Die genannten Größen Dante und Cino hatten ernstzunehmende Dichtung in der Volkssprache, genauer im Florentiner volgare, möglich gemacht. Giovanni Boccaccio wollte einer von ihnen werden.
Für Boccaccio ist die Zeit, in der die Geschichte spielt, genauso lange her wie für uns heute der Filocolo alt ist: Zwischen dem späten 6. Jahrhundert, in dem seine Figuren leben sollen, und dem frühen 14. Jahrhundert, in dem er selbst gelebt hat, liegen gut 700 Jahre. Was in der einen Zeit selbstverständlich ist, wird in der anderen nicht mehr ohne Weiteres verstanden. Der Filocolo entstammt spürbar einer spätmittelalterlichen Kultur, die zwar viel mit heutigen Umgangsformen zu tun hat, aber doch eigenen Gesetzen folgte.
Am besten lässt sich das an der Szene in ⟶ Buch VI, Kap. 78 beobachten, wo es heißt: »Ascalion kannte ihn gut und umarmte ihn herzlich. Dann antwortete er ihm fröhlich, wie es sich für eine solche Begrüßung gehörte, und bat ihn, Filocolo ebenfalls willkommen zu heißen, weil er sein Hauptmann war und er in seinen Diensten stand. Bellisano brachte Filocolo also die nötige Ehrerbietung dar und lud ihn und seine Gefährten höflich zu sich ein, was Filocolo mit Ascalions Einverständnis annahm. Sie wurden auf großartige Weise von Bellisano geehrt, der sich bemühte, ihnen alles recht zu machen, weil er Ascalion aus vollem Herzen liebte.«
Selbst in Momenten großer Freude und freundschaftlicher Ausgelassenheit wird also ein sozialer Code eingehalten, der keine regellose Überschwänglichkeit erlaubt, sondern den Rang der beteiligten Personen achten muss: Erst fragt Ascalion seinen Anführer Filocolo, ob er seinen alten Freund Bellisano begrüßen darf, obwohl die beiden deutlich älter sind als Filocolo.
Die gesellschaftliche Stellung bestimmt alles. Der Wert eines Ritters oder einer Dame hängt eng mit ihren Namen zusammen – einerseits dem Namen ihrer Herkunft, andererseits dem Namen, den sie sich gemacht haben. Außerdem lässt sich der Adel eines Fremden schon an dessen Äußerem ablesen, aber wird ganz unleugbar immer aus den Taten sprechen. Wie entstellt man auch sein mag, adlig bleibt adlig (⟶ Buch I, Kap. 30), was sogar die seltsame Folge hat, dass Biancifiores Ziehmutter Glorizia nach langer Abwesenheit für die eigene Familie erst einmal zu adlig wirkt (⟶ Buch V, Kap. 73). Sie ist nach ihrem Abschied aus dem vergleichsweise einfachen Elternhaus zu einer bedeutenden Dame geworden und sieht entsprechend anders aus. Eine andere Kleidung, ein anderer Auftritt oder eine andere Art zu sprechen sind im Mittelalter unmittelbar Zeichen einer neuen Identität. Ohne Geburtsurkunden oder Personalausweise wurde der eigene Platz in der Gesellschaft durch Interaktion mit dieser Gesellschaft verhandelt und war dadurch weniger festgelegt.
Außerdem muss für die Literatur des 14. Jahrhunderts von einer anderen Figurenpsychologie ausgegangen werden als später, nämlich von einer, die nicht oder kaum zwischen Innen und Außen unterscheidet. Jeder Affekt steht den Figuren ins Gesicht geschrieben. Deswegen ist es eine wichtige Tugend der hier dargestellten Gesellschaft, die eigenen Gefühle und Reaktionen zu beherrschen und nichts im falschen Moment an eine zu große Öffentlichkeit dringen zu lassen. Entsprechend ziehen sich die Figuren in versteckte oder private Räume zurück, wenn sie beherzt schluchzen, fluchen oder jubeln wollen. Der beherrschende Auslöser von Gefühlen im Filocolo ist die Liebe in all ihren Ausprägungen von Liebesfreud und Liebesleid.
In diesem Roman wird viel geweint, und zwar von Männern, von Frauen, von Königinnen und Bediensteten. Wir bekommen allerdings durch die Erzählstimme immer vermittelt, wer trotz eines möglicherweise inszenierten Gesichtsausdrucks eigentlich traurig ist, eigentlich fröhlich, eigentlich böse oder eigentlich gut. Wenn auch nicht jede einzelne Träne in diesem Roman gleich bedeutsam oder aufrichtig ist, darf kein Weinen als unnötig abgetan werden, allein schon deshalb, weil die Götter alles sehen und ebenfalls emotional reagieren. Auf den ersten Blick mag viel dafür sprechen, dass der Götterwille alles bestimmt und die Figuren keine Handlungsfreiheit besitzen.
Die wohl größte Besonderheit des Filocolo ist die kühne und geradezu avantgardistische Gleichzeitigkeit von allen Himmeln und Wirkmechanismen, die Boccaccio bekannt waren. Christliche Heilige werden in mythologische Strukturen gewebt und umgekehrt: Juno steht für die Kirche und Jupiter für den christlichen Gott, der seinen einzigen Sohn leben und am Kreuz sterben lässt, damit er die Heiligen aus Plutos Unterwelt befreien kann. Die Antike und Boccaccios Gegenwart verschmelzen. Alles ist in Bewegung: Die Figuren, ihre Schiffe, die Sterne, die Götter, die Träume. Weil kaum etwas Bestand hat, ist die Göttin, auf die es wirklich ankommt, die römische Fortuna.
Sie ist zuständig für das Glück oder das Schicksal, sie gilt für Königinnen wie für Bettler: Wer auch immer die Welt wie auch immer lenkt, Fortuna entkommt man nicht. Sie ist wankelmütig, das wird der Roman nicht müde zu betonen. Deshalb wurde sie im Mittelalter als Dame mit verbundenen Augen dargestellt, die ein riesiges Rad bedient: unermüdlich, unvorhersehbar und ganz nach ihrem unergründlichen Willen. Alle Menschen sitzen auf diesem Rad, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Mit ihrer linken Hand dreht Fortuna uns nach unten, mit der rechten wieder hoch. Der viergliedrige lateinische Merksatz formt einen perfekten, wenn auch schmerzhaften Kreis: regno – regnavi – sum sine regno – regnabo. Ich herrsche – ich habe geherrscht – ich habe kein Königreich – ich werde herrschen. Innerhalb dieses Kreislaufes spielt sich das ganze Leben ab, obwohl nie jemand weiß, auf welcher Stufe er oder sie gerade steht. Nichts hält sie von ihrer Drehung ab, erst recht nicht, wenn jemand eine Krone auf dem Kopf trägt.
Sie wird oft verflucht und ist ebenso oft tatsächlich die Ursache für das Unglück. Aber als Gegenmittel bleiben immerhin noch die Hoffnung und eine gute Portion Optimismus, wie es Filenos namenloser Freund in ⟶ Buch III, Kap. 36 auf den Punkt bringt: »Wohin Fortuna uns auch setzt, von dort kann sie uns nicht mehr verjagen. Den Menschen trifft an jedem Ort der Tod mit dem letzten Schlag und den Tugendhaften ist jedes Land ein Zuhause. Lass dieses Gejammer und steh auf!«
Wer ist im Universum des Filocolo jetzt also wofür verantwortlich oder anders gefragt: Wer darf sich Gott nennen? Die vier Damen, die sich in ⟶ Buch V, Kap. 18 für Göttinnen halten, sammeln zwar Argumente für sich, aber werden von echten Göttinnen zur Strafe dafür in eine Marmorstatue oder in Bäume und Blumen verwandelt. Fiammetta wird geradezu zornig, als man sie nach der Macht der Liebe fragt (⟶ Buch IV, Kap. 46), und schimpft auf Amor, der sich zu Unrecht einen Gott nennen würde, obwohl er die Handlung des Filocolo immer wieder maßgeblich beeinflusst. Eine mögliche Antwort wäre, dass echte Götter andere Figuren aus ausweglosen Situationen befreien, ihnen übermenschliche Kräfte verleihen, ihre Affekte steuern und ihnen im Schlaf erscheinen können. Diese nächtlichen Erscheinungen durchziehen den Text, sind allerdings nicht mit Träumen zu verwechseln. Hin und wieder stellt der Filocolo auch Träume dar (⟶ Buch II, Kap. 57), der Großteil sind allerdings Visionen, die direkte Auswirkungen auf die Handlung haben: Zum Beispiel wacht Florio tatsächlich mit dem Schwert in der Hand auf, das Venus ihm im Schlaf überreicht hatte (⟶ Buch II, Kap. 43).
Sinnbildlich dafür stehen die Diskussionen von Filocolo und Ascalion in ⟶ Buch VI, Kap. 14 und 44. Ascalion ist ein Veteran vieler vergangener Kriege, ein Anhänger der guten alten Zeit, der mit Be- und Verwunderung auf den Tatendrang des jungen Florio schaut. Er schimpft über »Träume« (⟶ Buch VI, Kap. 44), weil er die göttlichen Erscheinungen missversteht. Träume werden als täuschend (⟶ Buch II, Kap. 25) dargestellt und sind auch für die Erzählstimme lächerlich (⟶ Buch II, Kap. 56). In einer Vision hingegen passiert etwas, das ernstgenommen werden muss, denn vor allem hier können eine Göttin oder ein Gott mit den Menschen interagieren. Dabei verbietet sich natürlich jeder Kontakt auf Augenhöhe: Die Göttin spricht, der Mensch hört zu. Die Erscheinung macht die schlafenden Figuren passiv und liefert sie den Bildern und Worten aus, die die Gottheiten ihnen einflößen.
Erscheinungen können allerdings auch komplexe Handlungsstränge vorwegnehmen, um die Figuren, vor allem aber die Leserinnen und Leser zu warnen (⟶ Buch II, Kap. 3) – an einer Stelle schaffen das sogar die Träume, die Kinder des Schlafgottes, allerdings nur, weil die Göttin Diana es veranlasst hatte (⟶ Buch III, Kap. 30). An den Visionen wird deutlich, wieso der Roman im Verhältnis zu den anderen Versionen der Liebesgeschichte von Florio und Biancifiore deutlich länger ist: Durch den vielfältigen Götterhimmel gibt es hier deutlich mehr Stimmen, die etwas zu sagen haben und wissen, wie sie sich Gehör verschaffen. Auch für die Figuren birgt das ein gewisses Risiko, weil alles, was ihnen begegnet, ein Zeichen sein könnte, und nicht einmal ein Baum gefällt werden kann, ohne die Sorge, dass ein darin lebender Gott zornig wird (⟶ Buch V, Kap. 43).
Der schiere Umfang und die Komplexität des Filocolo sind auch deshalb eindrucksvoll, weil der Roman zum Zeitpunkt seiner Entstehung zur Vervielfältigung Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben werden musste. Geschrieben, gelesen, kopiert, gehandelt, aufbewahrt, verloren oder verschenkt werden im Spätmittelalter ausschließlich Handschriften, das heißt Unikate. In Neapel gab es wie in vielen anderen europäischen Städten eine professionelle und höchst effektive Infrastruktur für das Anfertigen von Manuskriptkopien, so dass natürlich auch schon die spätere Verkaufslogik des gedruckten Buchmarktes griff: Beliebte Texte wurden nachgefragt, vervielfältigt, übersetzt und verkauft. Spätestens im 14. Jahrhundert bildete sich – wie eingangs erwähnt – zusätzlich zur etablierten Leserschaft religiös und juristisch ausgebildeter Menschen ein neues urbanes Publikum heraus, das teilweise volkssprachigen Schulunterricht genossen hatte und ganz neue Anforderungen an die eigene Unterhaltung, Erbauung oder Belehrung stellte. Boccaccio gehört zu ihnen, er wird und bleibt ihre Ikone.
Es waren Mönche, Adlige oder Gelehrte, die überhaupt lesen und schreiben konnten und über die Mittel verfügten, zu sammeln, abzuschreiben und weiterzugeben. Die Literatur des Mittelalters wurde also meist zu Ehren einer Herrscher- oder Herrscherinnenfigur verfasst, die sich in dem Werk, das sie in Auftrag gegeben und bestenfalls bezahlt hatte, selbst wiederfinden wollte. Und wer Wissen hatte, wer antike Autoren kannte, wer gelehrt war, der zeigte es auch. Werke dieser Zeit werden nicht primär an Originalität oder Selbständigkeit gemessen, es geht um das gefühlvolle Abwägen von Nachahmung (imitatio) und Überbietung (aemulatio). Auch Boccaccio schreibt ein etabliertes Handlungsmuster um und verewigt sich mit einer ganz eigenen Version, ohne dabei seinen König Robert und dessen Hof zu vergessen.
Boccaccios Frühwerk ist literarisch wie biographisch Neapel verpflichtet. Als im Jahr 1340 eine Finanzkrise das Bankgeschäft der Bardi schwer traf, zog Boccaccio mit seinem Vater zurück in die toskanische Heimat. Seine literarische Arbeit wurde davon nicht unterbrochen. Es entstanden kürzere Werke, aber auch in diesen machte Boccaccio vieles zum ersten Mal: Seine Elegia di Madonna Fiammetta (um 1343) etwa lässt als erster europäischer Roman eine Hauptfigur in der ersten Person von ihren Gefühlen erzählen. Während 1348 die Pest die Florentiner Bevölkerung um fast 80 Prozent dezimierte, verlor Boccaccio viele Freunde und auch seinen Vater, aber aus diesen Erfahrungen schöpfte er die Inspiration für sein Decameron, das eines der einflussreichsten Erzählwerke seines Jahrhunderts werden sollte. Schon 1351 kursierten die ersten Fassungen der Novellensammlung, an der er für den Rest seines Lebens weiterarbeitete. In dieser Zeit sammelte er in seinen Notizbüchern akribisch volkssprachige Gedichte der Vorgängergenerationen, um sie zu studieren und seinen eigenen Platz in dieser illustren Gesellschaft zu suchen. Ein bedeutender Teil der frühesten italienischen Poesie ist nur seinetwegen erhalten geblieben. Er wird insbesondere die Florentiner Autoren fest im literarischen Kanon der europäischen Literatur verankern.
Im Alter widmete sich Giovanni Boccaccio seinen lateinischen Werken, was sicher dem Einfluss Francesco Petrarcas zu verdanken war, den Boccaccio schon Jahre vor ihrem ersten Treffen verehrte. Sie tauschten wertvolle Manuskripte aus, die Boccaccio unter anderem der Vermittlung seines alten Freundes Zanobi da Strada verdankte. Dieser war inzwischen Vikar im Kloster Montecassino geworden, das zahlreiche bis dahin ungeborgene Schätze besaß. Die erhaltenen Briefe sowohl Boccaccios als auch Petrarcas zeigen, mit wie viel Eifer und Faszination hier der europäische Humanismus vorbereitet wird: durch systematische Recherche, Vergleiche verschiedener Überlieferungen und genaues Studium der Quellen.
Auf Boccaccios Bemühungen hin wurde 1360 der erste Altgriechisch-Lehrstuhl Westeuropas für Leonzio Pilato (gest. 1364) eingerichtet. Der große Homer erklang nun also auch auf Latein, und eine leise toskanische Melodie schwang dabei mit. Gegen 1363 zog Boccaccio zurück nach Certaldo, verließ also die großen Städte. Dort überarbeitete er seine Werke und besuchte noch gelegentlich Florenz, angetrieben unter anderem von seiner Verehrung für Dante, die in den letzten Jahren seines Lebens ihren Höhepunkt fand. Zwischen 1350 und 1370 schrieb er insgesamt drei Fassungen seiner Dante-Biographie Trattatello in laude di Dante (sein »Büchlein zum Lob Dantes«), in der zuerst das Beiwort »göttlich« fiel, das noch heute häufig vor Dantes »Komödie« gesetzt wird. 1373 hielt Boccaccio noch öffentliche Vorlesungen zur Commedia, kam jedoch nicht über den 17. Gesang des Inferno hinaus, bevor sich sein Gesundheitszustand erheblich verschlechterte. Er verstarb schließlich am 21. Dezember 1375 in Certaldo.
Der Filocolo hat sich anfangs großer Beliebtheit erfreut. Insgesamt ist der Roman in 55 (teilweise fragmentarischen) Manuskripten überliefert und wurde bis 1500 elfmal gedruckt. Der Filocolo gehört zu den allerersten volkssprachigen Werken, die in Italien überhaupt gedruckt worden sind. Gutenbergs Erfindung hatte schnell die andere Seite der Alpen erreicht: Die erste Druckerei in Rom eröffnete 1467, in Venedig und Mailand zwei Jahre später, bevor auch in Bologna, Ferrara, Neapel und Florenz im Jahr 1471 Bücher gedruckt wurden.
Zuerst wurde angeboten, was sich gut verkaufte, also antike Schriften, die Werke der Kirchenväter und juristische Abhandlungen. Aber schon am 12. November 1472 wurde der Florentiner Filocolo von Johann Petri in Umlauf gebracht, einem Pionier des Druckhandwerks, der in Mainz ausgebildet worden war und in Florenz druckte. Nur acht Tage später legten die Brüder Gabriele und Philipo di Piero ihre Venezianer Ausgabe des Romans nach. Zu diesem Zeitpunkt lag das später so viel erfolgreichere Decameron in nur zwei Ausgaben (von 1470 und 1472) vor, also wurde der Filocolo im 15. Jahrhundert durchaus als ebenbürtig empfunden.
Im 16. Jahrhundert schrieb der Venezianer Lodovico Dolce (1508–1568) den Filocolo als Epos um und nannte es L’Amore di Florio e Biancifiore (»Florios und Biancifiores Liebe«). Er gab dem Roman also genau das formale Gewand, das Boccaccio absichtlich nicht gewählt hatte. Der Humanist Pietro Bembo (1470–1547) lobte in seiner 1525 erschienenen Grammatik Prose della volgar lingua (also den »Schriften über die Volkssprache«) den Filocolo und das Decameron für die herausragende Nutzung der Florentiner Volkssprache. Zahlreiche Übersetzungen entstanden, darunter eine frühneuhochdeutsche Adaption, die 1499 in Metz bei Kaspar Hochfeder unter dem Titel Ein gar schon newe histori der hochen lieb des kuniglichen fursten Florio: vnnd seyner lieben Bianceffora erschien.
Die vorliegende Übersetzung gibt den Roman ungekürzt wieder und kommentiert nicht nur die weitverzweigte Handlung, sondern auch die gelehrten Figurenbezeichnungen: Die für Florios Reise besonders wichtige Göttin Venus zum Beispiel wird nach ihrem Geburtsort, dem Berg Kithairon beziehungsweise der Insel Kythira, häufig Cytherea genannt, Apollo heißt auch Phoebus, seine Schwester Diana entsprechend Phoebe. Boccaccio besaß beim Verfassen des Filocolo nachweislich keine nennenswerten Griechischkenntnisse und benutzt selbst (fast) immer die lateinischen Götternamen. Zeus ist für ihn Jupiter, Poseidon heißt Neptun, Prometheus bleibt Prometheus. Deswegen wird in dieser Übersetzung die jeweilige Namensform im Text belassen und durch Fußnoten erklärt, wobei im Sinne Boccaccios die lateinischen Götterbezeichnungen bevorzugt werden, außer in Fällen, die sich nur auf griechische Figuren beziehen. Darüber hinaus werden alle handelnden Figuren mit ihren italienischen Namen bezeichnet, auch wenn sie aus bekannten römischen Familien stammen, das heißt Lelio Africano ist der Nachfahre von Scipio Africanus.
Alle Verschleierungen, wie die angesprochene Beschreibung von Fiammettas eigentlichem Namen Maria, werden originalgetreu wiedergegeben und kommentiert, damit der spezifische Klang des Romans erhalten bleiben kann, ohne das Verständnis zu erschweren. Gleiches gilt für mythologische Anspielungen, Bibelstellen, direkte Zitate und astrologische Ausführungen. Da viele Kapitel mit mythologisch-astrologischen Konstruktionen zur Beschreibung von Tages- oder Jahreszeiten beginnen, werden die Sternzeichen so kommentiert, wie sie zu Boccaccios Zeiten in den gregorianischen Kalender übersetzt wurden. Der Frühlingspunkt, also der Zeitpunkt, zu dem die Sonne das Sternzeichen Widder betritt, war im 14. Jahrhundert zwischen dem 21. März und 19. April erreicht, heute gut einen Monat später. Wenn von der Entstehung einer Himmelskonstellation gesprochen wird, verweist der Kommentar auf das Sternbild, wenn von einem astrologischen Zeitpunkt gesprochen wird, auf das Sternzeichen. Das Sternbild Widder beschreibt demnach die Geschichte, wie der Widder Chrysomeles zum Dank für sein Opfer von den Göttern in den Sternenhimmel gesetzt wurde, das Sternzeichen Widder beschreibt den Frühlingspunkt.
Giovanni Boccaccios Filocolo steht am Anfang der italienischsprachigen Literaturgeschichte, auch wenn ihm lange kein angemessener Platz im Kanon zugestanden wurde. Das Werk, in dem nichts Geringeres als das Wesen der Liebe sowie die Formenvielfalt des Liebeskummers, der Sehnsucht und der Eifersucht ausgebreitet werden, findet seit Jahrhunderten immer wieder sein Publikum, auf Italienisch, Englisch oder Französisch, im Ganzen oder in Auszügen.
Die frühneuhochdeutsche Adaption aus dem Jahr 1499 bringt es im Titel wie folgt auf den Punkt: Euch große Freud davon bekommen soll. Boccaccio selbst ist im Prolog des Filocolo etwas pragmatischer. Die Leserinnen und Leser seines Romans stellt er sich – natürlich! – als verliebt vor, also ging es ihm beim Verfassen des Werkes nicht so sehr um Freude als um handfesten Trost: »So werdet ihr erkennen, dass ihr nicht die ersten und sicher nicht die letzten Opfer dieser Widrigkeiten seid. Daraus könnt ihr Trost schöpfen, wenn man geteiltes Leid wirklich halbes Leid nennen darf.« (⟶ Buch I, Kap. 2). Die zahlreichen enttäuschten Hoffnungen, Niederlagen, Sorgen und Herausforderungen im Filocolo sollen beweisen, wie unsicher und trotzdem lohnenswert jedes Liebesabenteuer ist. Folglich sind die ersten Worte des ersten Buches Mancate già tanto le forze (wörtlich also »Die Kräfte fehlten schon sehr«) und die letzten Worte des letztes Kapitels Amore conservi (»möge Liebe es bewahren«) – und alles dazwischen liegt in Fortunas unberechenbaren Händen.
Buch I Filocolo
1 Prolog und wie der Autor von seiner Maria gebeten wird, das Buch zu schreiben
S. 39
2 Der Autor ruft die Verliebten dazu auf, sein Buch zu lesen
S. 47
3 Beginn der Erzählung und kurze Ausführung über unseren Glauben
S. 49
4 Wie sich die Nachricht über die Wunder des Heiligen Jakobus im ganzen Abendland verbreitete und besonders in Rom
S. 52
5 Lelio schwört aus Dank für die Schwangerschaft seiner Giulia, zum Heiligen Jakobus zu pilgern, und wie ihm der genannte Heilige im Schlaf erscheint
S. 53
6 Lelio erlaubt seiner Frau, ihn zu begleiten, weil sie beschenkt wurden und weil sie darum gebeten hatte
S. 56
7 Lelio bereitet alles für seinen Aufbruch vor
S. 58
8 Lelio bricht nach Rom auf
S. 58
9 Pluto treibt seine Obersten zusammen, um den Pilgern zu schaden
S. 58
10 Pluto nimmt eine falsche Gestalt an und bringt König Felice dazu, die Römer umzubringen
S. 60
11 Der König wundert sich, das Gespenst so sprechen zu hören
S. 63
12 Er bringt Mars Opfer dar und erkennt ein Zeichen
S. 64
13 Der König wendet sich verblüfft an die Götter und sagt ihnen, nie etwas gegen sie verbrochen zu haben, wodurch sein Reich Schaden verdienen würde
S. 65
14 Sie sehen den Adler über dem Stier und verstehen ihn als gutes Omen
S. 66
15 Nach dem Opfer lässt er die kriegerischen Standarten aufrichten
S. 67
16 Die Sonne zeigt, dass es bald Tag wird, und der König stachelt seine Truppen an
S. 68
17 Durch einen Vergleich wird der Abstieg der königlichen Truppen vom Berg gezeigt und Giulia sieht sie zuerst
S. 70
18 Lelios Gefährten tuscheln untereinander wegen der Truppen, die sie sehen
S. 72
19 Lelio ermuntert seine Gefährten auf verschiedene Weisen zur Schlacht
S. 72
20 Lelio sieht die Verzweiflung seiner Gefährten und hält eine schöne Rede, damit sie in die Schlacht ziehen
S. 73
21 Lelio fordert seine Truppen auf, zu kämpfen
S. 75
22 Giulia sorgt sich um Lelios Kampfeswillen
S. 77
23 Lelio antwortet Giulia und sagt, dass sie zuversichtlich bleiben soll
S. 79
24 Giulia fällt halbtot zu Boden, weil sie Lelio nicht vom Kämpfen abhalten kann
S. 80
25 Lelio betet zum großen Jupiter und welches Zeichen sie vom Himmel erhalten
S. 81
26 Die grausame Schlacht und wie Lelio und seine Truppen tapfer sterben
S. 83
27 Die Freude über den Sieg verwandelt sich für den König und seine Truppen schnell in Trauer, als sie sehen, wie viele ihrer Männer gestorben sind
S. 90
28 Der Autor klagt Fortuna wegen Lelios Zustand an
S. 91
29 Giulia kommt wieder zu sich und weint um ihren verstorbenen Lelio
S. 91
30 Der König schickt Ascalion zu Giulia, weil er sie so stark weinen sah. Und wie der König sie dann tröstet und Giulia mit sich führt
S. 95
31 Der König kehrt nach Marmorina zurück
S. 102
32 Verschiedene Tiere versammeln sich auf dem Schlachtfeld
S. 102
33 Der König zieht siegreich in Sevilla ein
S. 103
34 Die Königin tröstet Giulia, die sehr niedergeschlagen war
S. 105
35 Giulia arbeitet etwas mit den Händen, um ihren Schmerz zu bewältigen
S. 106
36 Pluto will in falscher Gestalt Lelios Tod verkünden
S. 107
37 Pluto erzählt den Römern von Lelios Tod
S. 107
38 Die Römer weinen, als sie von Lelios Tod erfahren
S. 108
39 Die Königin gebärt einen schönen Jungen
S. 108
40 Giulia gebärt ein schönes Mädchen und stirbt
S. 109
41 Giulias Tod wird beweint
S. 110
42 Die Königin trauert über Giulias Tod
S. 111
43 Giulia wird eine ehrwürdige Beerdigung bereitet
S. 112
44 Zu Ehren des Feiertages nennt der König seinen Sohn Florio und Giulias Tochter Biancifiore
S. 112
45 Die Kinder werden erst ihren Ammen und danach Racheo und Ascalion anvertraut, um gut unterrichtet zu werden
S. 113
[1] Fast wären die Kräfte des tapferen Volkes, das auf den alten Trojaner Aeneas zurückging,[1] schon erloschen, so sehr waren sie inzwischen geschwächt. Junos große Macht war daran schuld, denn sie wollte den Tod Didos, der Verlobten aus Karthago,[2] nicht unbestraft lassen. Sie wollte die vielen Kränkungen nicht einfach vergessen. Also ließ sie die Nachkommen für die längst vergangenen Fehler ihrer Väter leiden und eroberte ihre Stadt,[3] die einst über die ganze Welt geherrscht hatte. Doch dann bemerkte sie, dass an den äußersten Rändern des ausonischen Horns[4] noch ein kleiner Zweig dieses undankbaren Geschlechts übrig geblieben war.[5] Dieser Trieb wollte die eigentlich schon vertrockneten Wurzeln seines Stammes wieder aufblühen lassen.
Verärgert über diese Neuigkeiten fasste die heilige Göttin den Entschluss, diesen Trieb abzuschlagen und seinen entflammten Stolz auszulöschen, schließlich hatte sie auch seine Vorfahren[6] schon mit den rechten Mitteln vernichtet. Sie spannte die vieläugigen Vögel[7] vor ihren glänzenden Wagen und schickte die Tochter des Thaumas[8] voraus, um ihre Ankunft zu verkünden. Aus der höchsten Höhe stieg sie zu dem Mann hinab, der ihr den heiligen Dienst auf Erden tat,[9] und sagte:
»O du! Du hast gezeigt, dass du die höchste Würde nicht verdienst. Wie konntest du so achtlos sein, die Stärke unserer Feinde zu unterschätzen? Welche Dunkelheit hat dir die Augen verhüllt, die mehr sehen müssen? Steh auf! Wenn du schon die Waffen des Mars nicht in den Händen halten kannst, kümmere dich um jemanden, der dazu in der Lage ist! Er soll mithilfe Unserer Macht die falschen Triebe auf dem nutzlosen Ast abschlagen, dessen Wurzeln schon seit Langem vertrocknet sind. Er soll so gründlich vorgehen, dass sich niemand mehr an diese Familie erinnert.
Zwischen der spanischen Westküste und dem nördlichen Reich des Boreas liegen fruchtbare Wälder.[10] Dort soll ein tapferer Junge[11] geboren worden sein. Er stammt aus dem alten Geschlecht, das einst auch deine Vorfahren von der hündischen Herrschaft der Langobarden[12] und anderer Feinde unserer Krone befreit hat. Diesen Jungen sollst du rufen, denn für ihn haben wir den letzten Teil unseres Sieges aufgespart. Versprich ihm mächtige Verbündete in unserem Namen: Ich werde die Faune, die Satyre und die Nymphen[13] von unseren Plänen überzeugen.
Neptun und Aeolus[14] haben mir Hilfe zugesagt und auch Mars wird meinen Bitten mit all seiner Kraft folgen. Unser Herr Jupiter wird damit sehr zufrieden sein, weil diese Menschen ihn beleidigt haben. Denn ausgerechnet den Vogel, dessen Gestalt er selbst einige Male wählte, um sich den Sterblichen zu zeigen,[15] verwenden sie gedankenlos als Wappentier. Sie schmücken sich mit ihm, aber opfern eigentlich lieber dem Priapus, als der Tochter des Astraios,[16] ihrer rechtmäßigen Ehefrau. Ich verspreche dir außerdem, dieses fruchtbare Land für Jupiter erneut mit höllischen Furien zu verwüsten, wie ich es schon einmal getan habe, als der heilige Adler in Gestalt des Aeneas nach Italien kam.[17] Damals verhinderte ich seinen Untergang allerdings noch: Ich wollte ihm Zeit geben, Reue zu zeigen und sich meine Vergebung zu verdienen. Außerdem wusste ich, dass von ihm der Gründer dieses päpstlichen Ortes abstammen würde.[18] Kümmere dich nun darum! Solltest du keinen Erfolg haben, werde ich dich nicht weiter unterstützen und dich in seine[19] Hände fallen lassen.«
Nachdem sie das gesagt hatte, stieg sie hinab in Plutos finsteres Reich. Dort rief sie Alekto[20] mit wimmernder Stimme zu sich und sagte: »Du sollst jetzt ein zweites Mal die treuen Nachkommen des Aeneas aufstacheln. Beim ersten Mal reichte deine Kraft nicht aus, um ihn daran zu hindern, ganz Italien an sich zu reißen. Doch das war zu Beginn ihres Aufstiegs und jetzt stehen sie am tiefsten Punkt ihres Verfalls. Dieser letzte Akt wird ihren Ruhm auf der Welt auslöschen.« Nach diesen Worten drehte sie ihren Wagen herum und lenkte ihn wieder hinauf in den Himmel.
Die Kreaturen des dunklen Reiches litten, als sie diese Neuigkeiten hörten, denn ihnen wurde bewusst, dass Junos Wunsch der Hölle viele Seelen kosten würde.[21] Doch dem Willen der heiligen Göttin konnten sie sich nicht widersetzen. Dann brach Alekto auf und kehrte dorthin zurück, wo sie bereits zuvor grausame Schlachten angestiftet hatte. Sie füllte die Köpfe der Großen im Reich mit bösen Plänen gegen ihren Herrn und Gebieter, indem sie ihnen zeigte, wie lüstern er ihre Ehebetten entweiht hatte.[22] Rachelustig und wütend knirschten sie mit den Zähnen und wurden von Alekto so zurückgelassen.
Junos Stellvertreter[23] rief sofort den Jungen zu sich, den der heilige Mund ihm empfohlen hatte. Dieser regierte damals das Gebiet, wo sich die Rhone und die Sorgue treffen.[24] Er berichtete ihm von den großen Belohnungen, die die heilige Göttin für ihn bereithielt, falls er diese Aufgabe annehmen wolle. Außerdem stellte er ihm in Aussicht, seine Stirn mit der Königskrone dieses fruchtbaren Landes zu schmücken, wenn die verfluchte Wurzel erst gänzlich ausgerissen sei. Nicht nur lehnte der tapfere Junge solch ein Angebot nicht ab, sondern ließ sich mit ganzer Kraft darauf ein, weil er sich und den Seinen den Thron zurückerobern wollte, den seine Vorfahren bereits besessen hatten.[25]
Schon nach kurzer Zeit erreichte er dank seiner Stärke und der versprochenen Hilfen sein Ziel. Tapfer und erbarmungslos löschte er Junos Feinde aus und stellte seinen Thron in das ersehnte Reich. Hier zeugte er neue Nachkommen, lebte noch einige Jahre und gab schließlich Gott seine Seele zurück. Jener, der nach ihm den königlichen Thron erbte,[26] hatte viele Söhne. Robert,[27] einer von ihnen, wurde selbst König und regierte mithilfe der Pallas das Land, das ihm seine Vorfahren hinterlassen hatten. Bevor er jedoch König geworden war, hatte er sich in eine edle Hofdame verliebt und mit ihr eine wunderschöne Tochter[28] gezeugt. Um seine Ehre und die der jungen Dame zu schützen, sorgte er sich heimlich und unter einem Decknamen um sie.
Seine Tochter nannte er nach der Dame, die in sich die Vergebung der schamvollen Sünde trägt – es war das dreiste Verlangen unserer ersten Mutter, die sie uns eingehandelt hatte.[29] Dieses junge Mädchen wuchs zu solch besonderer Tugend und Schönheit heran, dass sie dem Vater in ihrem vorbildlichen Verhalten wie auch in anderen Eigenschaften nicht nachstand. Durch ihre bemerkenswerte Schönheit und ihre frommen Taten kamen viele Menschen auf den Gedanken, sie würde eher von Gott als von einem Menschen abstammen.
Dann kam ein Tag, an dem Saturn über die erste Stunde regierte und Phoebus bereits mit seinen Pferden im sechszehnten Grad des himmlischen Widders angekommen war.[30] Außerdem feierte man die glorreiche Auferstehung von Jupiters Sohn aus Plutos qualvollem Reich.[31] Ich, der ich dieses Werk zusammengestellt habe, fand mich genau an diesem Tag in einem anmutigen und schönen Tempel in Parthenope[32] wieder. Er trägt den Namen des Heiligen, der sich für seinen Platz im Himmel auf einem Eisenrost opferte,[33] und hier hörte ich die Messe, die mit lieblichen Melodien gesungen wurde. Gefeiert wurde sie von den priesterlichen Nachfolgern des Heiligen, der als Erster das Haupt demütig senkte, sich mit einem Strick gürtete, die Armut pries und sich ihr verschrieb.[34]
Ich glaube, dass die vierte Stunde des Tages schon hinter dem westlichen Horizont verschwunden war,[35] als mir die wunderbare Schönheit des genannten Mädchens vor Augen kam. Sie betrat die Kirche, um der gleichen Messe zu lauschen, die ich so aufmerksam verfolgte. Ihr Anblick ließ mein Herz zittern und bis in den schwächsten Pulsschlag meines Körpers hallte es laut nach. Ich wusste nicht, wieso, und konnte nicht begreifen, dass meine Aufregung durch diese plötzliche Erscheinung entstanden sein musste. Ich sagte: »O je, was ist das?« Denn ich befürchtete, mir wäre etwas Übles zugestoßen. Aber nach einiger Zeit beruhigte ich mich und nahm etwas Mut zusammen, um die schönen Augen dieses hübschen Mädchens genau zu betrachten. Irgendwann erkannte ich Amor[36] in ihnen, in all seiner anmutigen Gestalt. Obwohl ich lange seiner Macht entkommen konnte, wollte ich nun wegen dieser schönen Dame zu seinem Diener werden. Ich konnte mich an ihr nicht sattsehen und sagte zu Amor:
»Unerschrockener Herr, vor deiner Macht sind selbst die Götter nicht sicher! Ich danke dir, dass du mir mein Glück vor Augen gebracht hast. Ich spüre die Wärme deines Glanzes und mein kaltes Herz findet Trost. Lange Zeit bin ich aus Furcht vor deiner Herrschaft geflohen. Doch nun bitte ich dich, dass du mich durch die Kraft der schönen Augen, die dein liebes Zuhause sind, mit deiner Göttlichkeit erfüllst. Ich kann und will nicht mehr vor dir fliehen, sondern unterwerfe mich demütig und mit gesenktem Haupt deinem Willen.«
Noch hatte ich nicht zu Ende gesprochen, als die leuchtenden Augen der schönen Frau funkelnd und mit brennendem Licht zu mir herübersahen. In diesem Licht sah ich einen strahlenden Pfeil auf mich zufliegen (aus Gold, wie mir schien) und er drang durch meine Augen in mein Herz ein. Sofort fing es vor Freude an der schönen Dame wieder zu zittern an, und das tut es bis jetzt. Mein Herz fing Feuer, unlöschbar und so mächtig, dass meine ganze Seele an nichts anderes als ihre außerordentliche Schönheit denken konnte. So verließ ich diesen Ort mit verwundetem Herzen und nach diesem ergreifenden Erlebnis war ich noch einige Tage lang verwirrt und dachte nur an die wunderschöne Dame.
Dann warf mich Fortuna[37] eines Tages, ich weiß nicht wie, in einen heiligen Tempel, der benannt ist nach dem obersten unter den himmlischen Engeln.[38] Dort hüteten fromme Priesterinnen der Diana ihre kleinen Feuer unter weißen Schleiern und in schwarze Gewänder gekleidet.[39] Nachdem ich dort eintraf, sah ich, wie die schöne Dame meines Herzens mit einigen dieser Priesterinnen in einem festlichen und heiteren Gespräch zusammenstand. Sie luden mich und meine Gefährten höflich ein, zu ihnen zu stoßen. Wir kamen von einem Gedanken zum nächsten und sprachen irgendwann auch über den tapferen Jungen Florio, den Sohn des großartigen Königs Felice von Spanien. Wir erzählten uns voller Bewunderung von seinen Abenteuern.
Die edle Dame fand diese Geschichten unvergleichlich schön, wandte sich mir liebevoll und fröhlich zu und sagte: »Dem Gedenken dieser jungen Verliebten wird Unrecht getan, wenn ihre Taten nicht den gebührenden Ruhm durch die Verse eines Dichters erhalten. Bisher werden sie doch nur von einfachen Menschen nachgeplappert. Man bedenke nur Biancifiores große Beständigkeit: Durch die Kraft der Liebe ist sie sich und ihrem Wunsch immer treu geblieben. Ich bin gerührt von ihrer Geschichte und möchte von mir sagen können, dass auch ich ihren Ruhm vermehrt habe. Deshalb bitte ich dich, dass du ein kleines Büchlein[40] in unserer Sprache zusammenstellst, das von der Geburt, der Liebe und den Abenteuern der beiden bis zu ihrem Ende spricht. Ich bitte dich darum bei der Macht, die du am Tag unserer ersten Begegnung in meinen Augen gesehen hast, als du dich durch die Kraft der Liebe an mich binden wolltest.« Und dann schwieg sie.
Beim Klang der lieblichen Worte aus ihrem reizenden Mund fiel mir ein, dass ich bis zu diesem Tag von der edlen Dame noch nie um etwas gebeten worden war. Ich wollte ihren Wunsch erfüllen, weil ich so neue Hoffnung für meine Liebe schöpfen konnte. Ich antwortete ihr: »Edle Dame, Eure liebe Bitte soll mein ausdrücklichster Befehl sein. Sie bewegt mich so sehr, dass ich nicht ablehnen kann, und sowohl diese als auch jede andere Mühe, die Ihr Euch von mir wünscht, will ich auf mich nehmen. Zwar fühle ich mich in mancher Hinsicht unfähig, doch halte ich mich an das Sprichwort, dass niemand dazu verpflichtet werden kann, das Unmögliche zu tun. Ich werde nach Kräften und mit der Gnade des Herrn, der uns alles gegeben hat, erfüllen, worum Ihr gebeten habt.«
Sie dankte mir mit strahlendem Gesicht und ließ mich gehen, obwohl ich eher aus Vernunft aufbrach und nicht aus eigenem Willen. Sofort dachte ich darüber nach, wie ich das Versprechen umsetzen könnte. Aber weil ich mich, wie ich schon gesagt habe, unfähig fühle ohne deine Gnade, o Spender allen Lebens, möchte ich deine Gnade so unterwürfig von dir erflehen, wie ich nur kann. Ich wende mich an dich voller Ergebenheit, die dir mein Gebet noch angenehmer machen soll. Bitte stütze meine schwache Hand in diesem Vorhaben, der ich jetzt meine Zeit mit den heiligen Gesetzen deiner irdischen Nachfahren verbringe.[41] Es soll nicht aus Übermut zu einer wuchernden Geschichte werden, die deiner hohen Ehre Unrecht tut. Stattdessen will ich sie als dein Diener zum ewigen Lob deines Namens aufschreiben, o großer Jupiter.
[2] O ihr Jungen, ich weiß, dass ihr die Segel eurer neugierigen Köpfe in den Wind gedreht habt, der von den goldenen Flügeln des jungen Sohns der Cytherea[42]