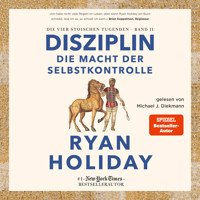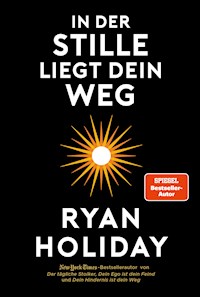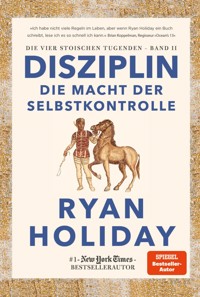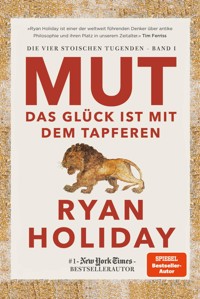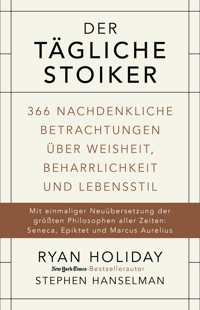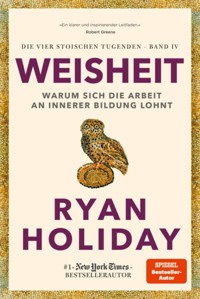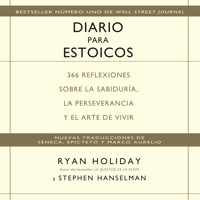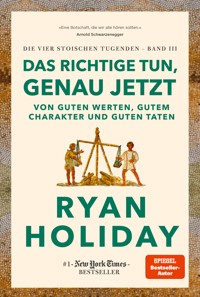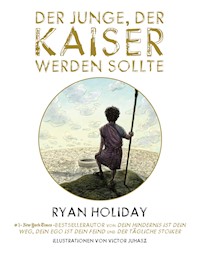15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
George Raveling weiß alles darüber, wie man das Unmögliche möglich macht. Er hat als Trainer den Basketball revolutioniert, stand an der Seite von Martin Luther King Jr., war Mentor von Michael Jordan und hat als Direktor bei Nike die Welt des Sports geprägt – George Raveling ist eine Legende. Doch sein Leben begann im Schatten von Rassentrennung, Tod und schwerer psychischer Krankheit. Für dieses Buch hat sich George Raveling mit Bestsellerautor Ryan Holiday zusammengetan, um die bedeutsamsten Lehren aus seinem außergewöhnlichen Leben und seiner Karriere zu ziehen. Dieses Buch ist keine Biografie, sondern ein Leitfaden für alle, die Hindernisse überwinden und aus eigener Kraft erfolgreich sein wollen. Finden Sie Ihre wahre Bestimmung, entwickeln Sie sich weiter und nutzen Sie Ihr Potenzial. Knüpfen Sie wirklich bedeutungsvolle Beziehungen und machen Sie Ihre täglichen Siege zu Ihren größten Erfolgen. Von der Suche nach einem Mentor bis hin zum Aufbau eines Vermächtnisses bietet dieses Buch alle Werkzeuge, um sich im Leben nicht einfach nur zurechtzufinden, sondern es mit Sinn und Bedeutung zu leben. Und alles beginnt mit der einen Frage: Was ist Ihre Bestimmung?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
RYAN HOLIDAY
GEORGE RAVELING
FINDE DIE BESTIMMUNG DEINES LEBENS
Zeitlose Lektionen für ein erfülltes Dasein
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Wir freuen uns auf eure Anregungen und Fragen
Wichtiger Hinweis
Die im Buch veröffentlichten Empfehlungen wurden von Verfasser und Verlag erarbeitet und geprüft. Der Inhalt dieses Buches beruht ausschließlich auf den persönlichen Erfahrungen des Autors und erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Die benutzten Begrifflichkeiten sind wertfrei. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel What You’re Made For: Powerful Lessons from a Life in Sports bei Portfolio, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Abteilung von Penguin Random House LLC.
1. Auflage 2025
© der Originalausgabe: 2025 Portfolio
© der Übersetzung: 2025 Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag,
Christoph-Rodt-Straße 11, 86476 Neuburg an der Kammel
www.deutscherwirtschaftsbuchverlag.com
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors nicht zulässig. Das gilt gleichermaßen für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Verfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Wir behalten uns die Nutzung der Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. Falls die Publikation Links zu externen Webseiten Dritter enthält, haben wir auf deren Inhalte keinen Einfluss; für diese fremden Inhalte können wir keine Gewähr übernehmen. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung nicht erkennbar.
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Mark Bergmann
Redaktion: Rainer Weber
Satz: Daniel Förster, Belgern
Korrektorat: Rainer Weber
Cover- und Umschlaggestaltung: www.b3k-design.de, Andrea Schneider & diceindustries nach einem Design von Jennifer Heuer
Coverfoto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Craig Fuji
eBook: ePUBoo.com
ISBN druck: 978-3-69066-006-8
ISBN ebook (PDF): 978-3-69066-008-2
ISBN ebook (EPUB, Mobi): 978-3-69066-7-5
Ich widme dieses Buch meiner
Frau Delores Akins, meinem Sohn Mark, meiner Tochter Litisha und Kimati Ramsey
INHALT
VORWORTvon Michael Jordan
George Raveling ist einer der heimlichen Helden meines Lebens. Wir kennen uns inzwischen seit 40 Jahren, und seit sich unsere Wege zum ersten Mal gekreuzt haben, ist er ein wahrer Freund und Mentor für mich gewesen.
Ich habe George mit 21 kennengelernt. Er war damals Assistenztrainer der US-Basketball-Olympiamannschaft und ich ein dürrer Nachwuchsspieler an der University of North Carolina. Ich stand kurz vor dem Wechsel zu den Profis und spielte vor, um den Sprung in das Team zu schaffen, das bei den Spielen 1984 in Los Angeles an den Start ging. George war das Bindeglied zwischen uns Spielern und Coach Bobby Knight. Alle hatten sofort einen super Draht zu ihm, weil er mit jungen Spielern umzugehen wusste und das Spiel in- und auswendig kannte. So ebnete er unserem Team den Weg zur olympischen Goldmedaille. George war der Kitt, der die Mannschaft zusammengehalten hat, wofür ihm bis heute zu wenig Anerkennung zuteilwird.
Auch bei meinem Sponsoringvertrag mit Nike hatte George seine Finger im Spiel. Es ranken sich viele Geschichten darum, wie und weshalb ich damals bei Nike unterschrieben habe. Der wahre Grund dafür war George. Ich wollte eigentlich zu Adidas, wie die meisten wissen. Aber George hat sich für Nike stark gemacht – und ich hörte auf ihn, wenn auch zunächst widerwillig. Er war derjenige, der mich zum inzwischen berühmten Treffen im »Tony Roma’s« in Los Angeles überredet hat. Der Rest ist Geschichte. Ich vertraute George so sehr, dass ich schließlich bei Nike unterschrieb. Ohne George gäbe es heute die Marke Air Jordan nicht.
Ich erlebte innerhalb von zwei Monaten zwei bahnbrechende Momente und George war an beiden beteiligt: der Gewinn meiner ersten olympischen Goldmedaille und mein erster Schuhvertrag mit Nike.
Als ich in den folgenden Jahren in der NBA spielte, blieb ich stets mit George in Kontakt. Er hatte einen starken Einfluss auf mich, wegen seines reichhaltigen Basketballwissens, aber auch weil er gut zuhören konnte und ein toller Gesprächspartner war. Er gab mir viele wichtige Ratschläge mit auf den Weg. Als ich die Michael Jordan Flight School gründete, ein Basketball-Camp, das wir viele Jahre lang in Santa Barbara veranstaltet haben, wollte ich George unbedingt als Leiter verpflichten. Er sagte allerdings erst zu, als er sich versichert hatte, dass wir das Camp richtig aufzogen und ich wirklich jeden Tag dort war. Später boten wir das Camp auch für Erwachsene an – die Senior Flight School – und auch diesem Projekt verhalf George maßgeblich zum Erfolg.
George hat in seinem Leben Beeindruckendes erreicht und ist bis heute ein echtes Vorbild. Er war der erste schwarze Trainer in der Atlantic Coast Conference (ACC), einer der führenden Ligen im US-College-Basketball, zudem der erste schwarze Cheftrainer der damals bedeutenden Highschool-Basketballliga Pac-8 und Gründer der Black Coaches Association, eines Interessenverbandes für schwarze Trainer. Er hat vielen schwarzen Coaches den Weg geebnet und erhält auch dafür zu wenig Anerkennung.
George hatte einen großen Einfluss auf viele Menschen – nicht nur auf mich – und hat viel Gutes und Schlechtes auf dieser Welt erlebt. Ich bin stolz, ihn einen Mentor und einen Freund nennen zu dürfen und freue mich, dass er in diesem Buch seine Lebensgeschichte und seine zahllosen Weisheiten mit seinen Lesern teilt. Wir alle können viel von ihm lernen.
Michael Jordan
EINLEITUNG
»Oft hat ein alter Mann außer seinem Alter nichts anderes für sein langes Leben vorzuweisen.«
SENECA
Als ich 1937 das Licht der Welt erblickte, betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines männlichen Schwarzen in den USA gerade einmal 48 Jahre.
Es war eine Welt voller Gegensätze – mit bahnbrechenden Neuerungen und gleichwohl tief verwurzelter Ungleichheit. In jenem Jahr veröffentlichte ein 35 Jahre alter Trickzeichner namens Walt Disney Schneewittchen und die sieben Zwerge, den ersten Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge. Auf der anderen Seite des Atlantiks drohte ein furchtbarer Krieg auszubrechen, während Pablo Picasso die letzten Pinselstriche seines eindringlichen, herzzerreißenden Anti-Kriegsgemäldes Guernica malte. Im Boxen wurde der »Brown Bomber« Joe Louis Weltmeister im Schwergewicht, einer der wenigen Lichtblicke für die sonst marginalisierte schwarze Community.
Die Golden Gate Bridge war gerade eröffnet worden, ein Wunder der Ingenieurskunst, das fortan über der Skyline von San Francisco thronte. Zahlreiche kluge Köpfe formten mit Erfindungen die Zukunft: Chester Carlson erfand den Fotokopierer, László Bíró perfektionierte den Kugelschreiber, Edwin H. Land legte den Grundstein für die Entwicklung der Polaroidkamera und Henry W. Altorfer entwickelte den elektrischen Wäschetrockner, der die alten Geräte mit Handkurbel ersetzte und somit die Hausarbeit spürbar erleichterte.
All diesen Fortschritten zum Trotz bestimmten Rassentrennung und Diskriminierung nach wie vor das Leben der Afroamerikaner. Ein Kind wie ich war deshalb von Geburt an benachteiligt. In jedem Aspekt unseres Alltags waren wir mit strukturellen Hindernissen konfrontiert: bei der Bildung, bei der Arbeits- oder Wohnungssuche, bei der Gesundheitsversorgung und beim Wahlrecht. Wir lebten vom Rest der Bevölkerung isoliert und waren gezwungen, andere Einrichtungen als Weiße zu besuchen. Würde und elementare Grundrechte wurden uns verwehrt. Uns war eine trostlose Zukunft vorausbestimmt: ein Leben in Armut, voller Sorgen und Not, geprägt von Ungleichheit und Rassismus.
Natürlich habe ich mir über derlei Dinge als Kind noch keine Gedanken gemacht.
Aber es lag etwas in der Luft.
Das heimliche Tuscheln, wenn düstere Mienen wieder einmal Neuigkeiten überbrachten, was einem Nachbarn oder einem entfernten Verwandten zugestoßen war. Hinzu kamen Fliegeralarme, Verdunklungsvorhänge und Luftschutzübungen in der Schule, allgegenwärtige Mahnungen an eine Welt im Krieg. Die Echos der läutenden Kirchenglocken, die wunderschönen Choräle bei Begräbnissen und die langsam voranschreitenden Trauermärsche, die Männer und Frauen in ihrem besten Zwirn – trotz allem hatten sie sich ihre Würde bewahrt. Geradezu kunstvolle Verzierungen eines vergänglichen, grausamen Lebens, das jederzeit vorüber sein konnte.
Der dunkle Schatten der eigenen Sterblichkeit lag stets über uns, doch als ich neun Jahre alt war, stand der Tod direkt vor unserer Haustür. Mein Dad – ein Mann seiner Zeit, eingezwängt von den gesellschaftlichen und rassistischen Fesseln, die unsere Existenz prägten – starb im Alter von 49 Jahren an einem Herzinfarkt, ein in jener Zeit auf tragische Weise gewöhnliches Schicksal für einen Schwarzen. Er hatte als Stallbursche für reiche Pferdebesitzer gearbeitet und schlief oft mit in den Ställen der Tiere, weil er es sich nicht leisten konnte, jeden Tag zur Rennstrecke und zurück zu pendeln.
Bei seinem Tod erkannte ich zum ersten Mal die Vergänglichkeit des Lebens. Dass er so plötzlich kam, dass ein Leben mit einer so zentralen Bedeutung für mich im Nu ausgelöscht werden konnte, ließ mich nicht los. Diese Erfahrung war eine Lehrstunde in Sterblichkeit, die ich nie mehr vergaß und die fortan meinen Blick auf bevorstehende Herausforderungen für immer verändert hat. Nun wohnte ich nur noch mit meiner Mum in dem kleinen Appartement an der Ecke New Jersey und Florida Avenue in Washington, D.C., über einem Laden namens Shep’s Market. In der zweiten Etage gab es drei Wohnungen. Wir hatten eine Küche, ein kleines Wohnzimmer und ein Schlafzimmer mit einem Bett, in dem wir beide schliefen. Das Gemeinschaftsbad mit Wanne, Waschbecken und Toilette mussten sich alle Bewohner des Hauses teilen. Das war nicht immer leicht, aber wir haben es irgendwie hinbekommen.
In jener Zeit war die Bevölkerung von Washington, D.C. zu 73 Prozent schwarz. So erhielt die Stadt später den Spitznamen »Chocolate City«. Viele dieser Menschen waren vor den noch schlimmeren Bedingungen im tiefsten Süden des Landes geflohen und auf der Suche nach einem besseren Leben. In der Landeshauptstadt, im Schatten großer Institutionen wie dem Weißen Haus und dem Kapitol, waren sie in der Lage, ein einigermaßen vernünftiges Leben zu führen, denn dort konnten sie als billige und doch unverzichtbare Arbeitskräfte, die den Regierungsapparat am Laufen hielten, ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Ironie: Wir waren von großer Bedeutung für die alltäglichen Abläufe in der Stadt und dennoch bedeutungslos für die Gesellschaft.
Die Stimmung in unserem Viertel stand in starkem Kontrast zu der extremen Ungleichheit, die unser tägliches Leben bestimmte. Es herrschte ein spürbarer Gemeinschaftssinn. In der oft brutalen Wirklichkeit der Rassentrennung schweißte unser geteiltes Leid uns noch enger zusammen.
Wie viele andere hetzte auch meine Mum zwischen drei Jobs hin und her, damit wir über die Runden kamen. Dafür lief sie täglich sechs Kilometer bis nach Downtown und verabschiedete sich stets mit den Worten: »Dass du mir ja nicht das Haus verlässt!« Dies war mehr als ein üblicher Appell einer Mutter an ihr Kind, es war eine Sicherheitsvorkehrung in einer Welt, in der kleine schwarze Jungs gefährlich lebten.
An der Kreuzung zwischen New Jersey und Florida Avenue war stets eine Menge los, es wimmelte dort nur so vor Menschen, und Fahrzeuge rollten in einem nie endenden rhythmischen Strom vorüber. Ich verbrachte zahllose Stunden an meinem Fenster und betrachtete die Welt da draußen. Die Straße unter mir war voller hupender Autos und bimmelnder Straßenbahnen, die ihren Weg durch die Stadt zogen. Die Straßenbahnen bewegten sich mit einer mechanischen Bestimmtheit, die mich faszinierte. Jede besaß ihre eigene, spezifische Nummer, die ich akribisch in einem kleinen Notizbuch notierte. Dieses kleine Detail hatte mein Interesse geweckt. Wann immer eine Straßenbahn vorbeifuhr, schrieb ich ihre Nummer und die Uhrzeit auf. Und wenn die Bahn dann irgendwann zurückkam, notierte ich die Uhrzeit erneut. Mithilfe dieser kleinen Routine konnte ich an der Welt da draußen teilhaben und Ordnung in das Chaos bringen, das mich häufig umgab.
Mit 13 sah ich, wie meine Mum in der Küche ein Paket Zucker in den Ausguss schüttete, das die kommenden zwei bis drei Monate für uns gereicht hätte. Als ich meiner Großmutter – wir nannten sie »Liebchen« – davon berichtete, war auch ihr bereits aufgefallen, dass meine Mutter sich zuletzt häufiger sonderbar verhalten hatte. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, an welchem Punkt sie völlig den Verstand verlor, aber eines Tages war sie einfach verschwunden. Niemand wusste wohin und es hatte auch niemand vor, mir all das irgendwie zu erklären. Man fand sie schließlich oben in Boston. Sie wurde in die St. Elizabeth Mental Institution eingeliefert, eine psychiatrische Klinik, in der sie den Rest ihres Lebens verbrachte.
Doch trotz dieser Umstände, die mich praktisch zum Vollwaisen gemacht haben, trotz der Verzweiflung, die mich meine gesamte Kindheit über begleitet hat, und trotz der düsteren Statistiken und geringen Erwartungen habe ich überlebt. Obwohl mir das Schicksal ein schlechtes Blatt zugeteilt hat, in einem gezinkten und eigentlich zu kurzen Spiel, sitze ich heute im Alter von 87 Jahren noch immer hier, als Spieler mit Erfahrungen und Erfolgen, die für mehrere Lebzeiten reichen würden.
Ich war der Erste in meiner Familie, der es aufs College geschafft hat. Ich erhielt ein Basketball-Stipendium von der Villanova University. Dort war ich erst der zweite schwarze Spieler in der Geschichte der Uni.
Ich habe mehrere US-Präsidenten getroffen: Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Bill Clinton und Harry S. Truman, der mir eine signierte Ausgabe seiner Autobiografie geschenkt hat.
Ich war einen Wahnsinnssommer lang Wilt Chamberlains rechte Hand. Ich habe Muhammad Ali die Hand geschüttelt. Einmal sah ich den großen Sammy Davis Jr. in einem Restaurant. Ich ging zu ihm, um mich vorzustellen, doch bevor ich ein Wort herausbekam, blickte er zu mir auf – er war nur 1,65 Meter groß – und sagte: »George Raveling!« Ich weiß bis heute nicht, wieso er mich kannte.
Während des Marsches auf Washington stand ich auf den Stufen des Lincoln Memorial neben Dr. Martin Luther King Jr., der mir nach seiner historischen »I Have a Dream«-Rede seine abgetippten Notizen gereicht hat. Ich verwahre sie bis heute in meinem Besitz (mehr dazu im Kapitel »Menschen Hoffnung geben«).
Ich war der erste schwarze Basketball-Coach an der Villanova, der University of Maryland, der Washington State University und der University of Iowa.
Ich habe Olympiasieger und Hall-of-Fame-Spieler trainiert.
Ich habe gegen Jerry West gespielt, noch bevor seine Silhouette das NBA-Logo zierte, bin nach Beijing gereist, als es in den USA noch Peking genannt wurde, habe mit Phil Knight zusammengearbeitet, als Nike noch kein börsennotierter Weltkonzern war, und habe Michael Jordan trainiert, als er noch keine eigene Schuhkollektion hatte.
Es gibt Trainer, die mehr Titel gewonnen haben oder besser bezahlt waren als ich – viel besser zum Teil. Einige wurden richtige Stars. Und trotzdem wurde ich in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame und in die National Collegiate Basketball Hall of Fame aufgenommen, die beiden großen Ruhmeshallen des Profi- und College-Basketballs. Doch derlei Erfolge waren nie mein Antrieb. Für mich waren es andere Dinge, die meinen Job ausmachten. Auf der Tür meines Büros stand auch nie »Basketball-Cheftrainer«, sondern auf meinen Wunsch hin:
GEORGE RAVELING LEHRER
Ich hätte nie damit gerechnet, dass jemand einen Film über mich drehen würde, aber den Film gibt es und er wurde für mehrere Golden Globes nominiert. Oscar-Preisträger und Filmemacher Ben Affleck hat einmal erzählt, wie er sich mit Michael Jordan getroffen hat, um sich vor den Dreharbeiten zum Drama Air: Der große Wurf dessen Segen dafür abzuholen. Im Film wird die Geschichte von Michaels Vertragsunterzeichnung 1984 mit Nike erzählt. Er stellte zwei Bedingungen: Viola Davis sollte seine Mutter spielen und er bestand darauf, dass »George Raveling dabei ist. Er spielte eine wichtige Rolle. Ohne ihn wäre ich heute nicht bei Nike«.
Wenn ich ihn oder andere Spieler heute treffe, wie Charles Barkley, Patrick Ewing oder Dirk Nowitzki (von denen ich manche gecoacht habe, viele aber auch nicht), wenn ich Anrufe von Coaches wie John Calipari, Doc Rivers oder Shaka Smart erhalte oder Leser meines täglichen Newsletters The Daily Coach sich bei mir melden, dann unterhalten wir uns nicht nur über Basketball. Wir unterhalten uns über das Leben. Und über Geschichte.
Und glauben Sie mir, ich habe viel Geschichte erlebt.
In meine Zeit fiel die »Great Depression«, die Weltwirtschaftskrise, aus der uns Präsident Franklin D. Roosevelt herausführte, ebenso der Angriff auf Pearl Harbor und der Großteil des Zweiten Weltkriegs. Präsident Harry S. Truman entschied, Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen. Während der Präsidentschaft von Dwight D. Eisenhower erstarkte die Bürgerrechtsbewegung. Das Attentat auf John F. Kennedy war ein Schock für das ganze Land. Lyndon B. Johnson sorgte dafür, dass der Civil Rights Act und der Voting Rights Act im Gesetz festgeschrieben wurden. Richard Nixon musste im Zuge des Watergate-Skandals zurücktreten. Und Barack Obama wurde der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten.
Ich wurde Zeuge des Koreakriegs und des Vietnamkriegs (ich diente zwei Jahre in der U.S. Army), habe den Fall der Berliner Mauer und den Zusammenbruch der Sowjetunion am Fernseher verfolgt und erlebte den Wirtschaftsboom und die politischen Skandale der Clinton-Jahre und die turbulente Präsidentschaft von George W. Bush, die vom Anschlag auf das World Trade Center sowie den Kriegen in Afghanistan und im Irak geprägt war.
Ich erlebte die großen Fortschritte des Raumfahrtzeitalters, vom ersten Satelliten in der Erdumlaufbahn, als ich 20 war, bis zum ersten Menschen auf dem Mond und dem Bau der Internationalen Raumstation ISS. Es gab große Gesundheitskrisen, wie die Crack-Epidemie, die Verbreitung der Kinderlähmung, die asiatische Grippe, die AIDS-Krise und COVID-19. Ich erlebte die Entwicklung des Fernsehens, der Luftfahrt, des Interstate-Highway-Netzes, der urbanen Voro rte und des Fast Foods; die Erfindung des Internets, der Mobiltelefone, Kreditkarten, E-Mails und Computer, des GPS und des WLAN.
Ich habe mehr als ein Leben gelebt. Mit 57 hatte ich unverschuldet einen schweren Autounfall und brach mir dabei das Becken, neun Rippen und das Schlüsselbein, meine Lunge kollabierte und ich hatte Blutungen in der Brust. Die Ärzte erklärten mir damals, dass 95 Prozent der Menschen, die in ähnliche Unfälle verwickelt sind, sterben. Doch ich überlebte auch das. Wieder hatte ich dem Tod und der Statistik ein Schnippchen geschlagen.
Seit diesem Unfall führe ich ein anderes Leben. Ein Bonus-Leben, wie ich es nenne. Nach 22 Jahren als Basketballtrainer habe ich den Job an den Nagel gehängt. Statt meinen Lebensabend bequem im Schaukelstuhl zu verbringen, heuerte ich als Leiter der Abteilung Basketball international bei Nike an. Dort suchte ich die besten Nachwuchstalente der Welt und entdeckte spätere Starspieler wie Dirk Nowitzki oder Yao Ming, die so den Sprung in die NBA schafften. Außerdem arbeitete ich mehr als zehn Jahre lang als Berater für die Los Angeles Clippers und für das sogenannte »Redeem Team«, das 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Gold holte. Bis heute schreibe, coache und unterrichte ich noch immer, weil es mich jung hält, mir einen Lebenszweck gibt und mir schlicht Spaß macht.
Wenn man so viel erlebt hat wie ich, fällt es schwer, nicht irgendwann philosophisch zu werden. Nicht im abstrakten oder esoterischen Sinn, sondern auf eine nachdenkliche und reflektierende Weise. Als ich eines Tages begann, über mein Leben nachzudenken, ist mir bewusst geworden, dass die Geschichten, die ich erzählen kann, so vielfältig und so spannend sind, wie jene in den Büchern und Biografien, die ich so gerne lese. Ich habe Dinge erlebt, die weit über die Vorstellungskraft des kleinen Jungen hinausgehen, der einst verträumt aus dem Fenster über der Kreuzung New Jersey und Florida Avenue geschaut hat. Je älter man wird, umso kürzer erscheint das Leben. Und doch war ich inzwischen älter als die meisten Menschen, die ich kannte, und eines Tages begann ich mir Fragen zu stellen wie:
Warum ich?
Warum wurde ich bislang verschont und andere nicht?
Warum wurde mir diese zusätzliche Lebenszeit geschenkt?
Und was stelle ich mit diesem Geschenk an?
Diese Selbstreflexion ist für mich kein Luxus des Alters, sondern ein notwendiges Werkzeug, um der Beliebigkeit meiner Existenz eine Bestimmung zu geben. Mir wurde bewusst, dass ich die Antworten, die ich suche, nicht in großen Ereignissen finde, sondern in den ruhigen Momenten, bei Entscheidungen, die ich ganz alleine treffen muss und in der Art und Weise, wie ich jeden neuen Tag angehe.
Natürlich muss man kein so außergewöhnliches Leben wie ich führen, um sich derartige Fragen zu stellen. Vielleicht haben Sie es ja sogar schon getan. Möglicherweise nicht im exakt selben Wortlaut. Aber in nachdenklichen Momenten oder wenn Sie mit alltäglichen Niederlagen oder Erfolgen konfrontiert sind, haben Sie sich bestimmt schon einmal gefragt: Warum bin ich hier? Was ist der Zweck meines Lebens? Welchen einzigartigen Beitrag zu dieser Welt soll ich leisten?
Diese Fragen – und die Antworten darauf – kamen mir nicht alle auf einmal in den Sinn. Ziemlich lange waren sie tief drinnen in meinem Hinterkopf versteckt und wurden erst über Jahrzehnte hinweg langsam immer präsenter. Irgendwann verschmolzen sie dann zu einer einzigen, allumfassenden Frage. Das Notizbuch, in dem ich sie niedergeschrieben habe, besitze ich noch immer.
Und die Frage lautete: Was ist meine Bestimmung?
Von den rauen Straßen in Chocolate City zu den heiligen Hallen der Basketball Hall of Fame und darüber hinaus war mein ganzes Leben eine unfassbare Aneinanderreihung unerwarteter Chancen, hart umkämpfter Schlachten und gelernter Lektionen.
Dieses Buch ist kein Memoir. Ein solches zu schreiben, war nie meine Absicht. Ich möchte damit die Bedeutung und den Sinn des Lebens erkunden. Ich möchte mit meinen Geschichten und Lektionen andere inspirieren, fordern und anregen, darüber nachzudenken, welche Rolle wir alle in diesem komplexen, wundervollen Leben spielen.
Dies ist mehr als meine Lebensgeschichte. Es ist der Versuch, im Kern zu verstehen, was es bedeutet, zu etwas Höherem bestimmt zu sein und allen Widrigkeiten zum Trotz einen Weg zu gehen, der alle Grenzen und Erwartungen sprengt. Es ist eine Aufforderung, über Ihren persönlichen Weg nachzudenken, willkürliche Beschränkungen, die Ihnen auferlegt werden, zu hinterfragen und es zu wagen, von einem Leben zu träumen, das nicht von Statistiken und gesellschaftlichen Erwartungen bestimmt ist.
Mit diesem Buch lade ich Sie ein, sich den Zweck Ihrer Existenz bewusst zu machen. Zu verstehen, was es heißt, ein sinnhaftes und bedeutungsvolles Leben zu führen und sich diese eine Frage zu stellen:
Was ist meine Bestimmung?
Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort und es kann sie auch kein anderer für Sie beantworten, weil es eine ganz persönliche Angelegenheit ist. Sie zu beantworten, ist eine lebenslange Aufgabe, für die Sie sich selbst unter die Lupe nehmen und sich ihre Talente, Interessen, Werte und Erfahrungen bewusst machen müssen. Sie erfordert Mut und den Willen, einen Schritt ins Unbekannte zu wagen, über die Grenzen hinaus, die Ihnen gesetzt wurden. Heraus aus der Schublade, in die man Sie aufgrund Ihrer Herkunft, Ihres Geschlechts oder Ihrer Lebensumstände gesteckt hat.
Sie müssen bereit sein, groß zu träumen. Glauben Sie daran, dass Sie aus einem ganz besonderen Grund geschaffen wurden, für etwas Einzigartiges, das nur Sie dieser Welt schenken können. Hören Sie auf die Stimme tief in sich drinnen, die Ihnen leise flüsternd von einer wichtigen Berufung, einem höheren Lebenszweck erzählt.
Auf den folgenden Seiten werden Sie lernen, Ihren eigenen Weg zu gehen, auch wenn die vorherrschende Meinung und die Erwartungshaltung in der Gesellschaft drohen, sie in eine andere Richtung zu ziehen. Sie werden entdecken, wie man optimistisch bleibt und andere inspiriert, auch und ganz besonders dann, wenn Sie vor schier unüberwindbaren Herausforderungen stehen.
Dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie einfaches Zuhören – und damit meine ich: richtig zuhören -Ihnen im Privat- wie im Berufsleben Türen öffnen kann, von deren Existenz Sie bislang nichts gewusst haben. Sie werden erkennen, wie kleine, tägliche Erfolge sich zu lebensverändernden Leistungen aufsummieren können und dass Sie Ihre größten persönlichen Erfolge häufig dann feiern, wenn Sie anderen helfen.
Wir werden gemeinsam Strategien entwickeln, wie Sie im unvermeidlichen Chaos des Alltags mehr Klarheit schaffen und Ihre Bestimmung finden und wie Sie Beziehungen aufbauen, die die Zeiten überdauern. Sie werden verstehen, wie Sie Ihre eigenen Grenzen kontinuierlich erweitern können, wie Sie weiterwachsen und sich entwickeln, wenn andere sich möglicherweise längst zufriedengegeben haben.
Die einzelnen Kapitel führen Sie durch die verschiedenen Aspekte des Mentorings – sowohl als Mentor als auch als Mentee, als Schützling – und werden Ihnen zeigen, wie diese wechselseitige Beziehung Wellen positiver Veränderung erzeugt, die weit über Ihr direktes Umfeld hinausreichen können. Und schließlich werden wir zusammen auf die ganz großen Themen, wie Lebenszweck, Selbstverwirklichung und Ihr persönliches Vermächtnis eingehen. Ich werde Ihnen das Rüstzeug an die Hand geben, um sich im Leben nicht nur besser zurechtzufinden, sondern um es bewusster, mit einem echten Impact zu führen.
Die Lektionen auf den folgenden Seiten fußen auf jahrzehntelanger Erfahrung in den verschiedensten Bereichen. Sie werden sich dabei Praxiswissen aneignen, das Ihnen hilft, Ihren eigenen Weg zu gehen, Hindernisse zu überwinden, tragfähige Verbindungen zu knüpfen und in jenen Bereichen erfolgreich zu sein, die Ihnen wirklich etwas bedeuten. Dieses Buch wird Ihnen Erkenntnisse liefern, die Sie in jeder Phase Ihres Lebens anwenden können und die es Ihnen ermöglichen, Ihr Handeln auf Ihre ureigensten Werte und Ansprüche auszurichten.
Ich lade Sie ein, mit mir die ganz großen Fragen des Lebens anzugehen und die richtigen Antworten darauf zu finden, mithilfe von Geschichten und Weisheiten vieler Lehrer und Mentoren, die ich kennenlernen durfte, ob im echten Leben oder in zahllosen Büchern. Wohin Ihr Weg Sie führen wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber er beginnt mit der Frage: Was ist meine Bestimmung?
Blättern Sie um und lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden.
»Man muss seinen eigenen Weg finden – eine besondere Nische – und alles geben, um darin der Beste zu sein. Egal, ob Sie neue Wege ebnen oder bereits vorhandene als leuchtend heller Leitstern illuminieren, wichtig ist, dass Sie dabei stets so gut sind, wie Sie nur können.«
WEGBEREITER SEIN
»Glaube heißt, die erste Stufe zu nehmen, auch wenn Sie die ganze Treppe nicht im Blickfeld haben.«
MARTIN LUTHER KING JR.
Nachdem meine Mum in die Klinik eingewiesen wurde, wusste niemand, was mit mir zu tun war. Meine Großmutter – die wir wie gesagt »Liebchen« nannten – hatte damals fünf verschiedene Jobs. Unter anderem arbeitete sie für eine weiße Familie in Georgetown. Sie putzte das Haus, kochte, buk und derlei Dinge. Eines Tages berichtete Liebchen der Dame des Hauses vom Schicksal meiner Mutter und dass sie nicht wusste, was sie genau tun sollte.
»Vielleicht kann Catherine helfen«, schlug die Dame vor.
Wie sich herausstellte leitete Catherine eine Niederlassung des katholischen Wohlfahrtsverbands Catholic Charities. Sie ermöglichte mir, dass ich ein Jungeninternat in Pennsylvania besuchen konnte, der Verband trug dafür die Kosten. Das Internat trug den Namen St. Michael’s, benannt nach dem Bischof Michael J. Hoban, der es 1916 gegründet hatte, um Jungen aus zerrütteten Familien ein neues Zuhause zu geben. Er wollte den Kindern dort nicht nur Essen und ein Dach über dem Kopf bieten, sondern sie unterrichten und Ihnen praktische Fähigkeiten beibringen, mit denen sie später ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten.
Das Internat befand sich auf einem 160 Hektar großen Grundstück, umgeben von Wäldern und Feldern. Es war in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil der Metropole Washington, D.C., und es gab immer etwas zu tun. Wenn ich morgens aufwachte, hörte ich dort nicht das Klingeln der Straßenbahn oder das geschäftige Treiben der Händler, sondern krähende Hähne. Nonnen und Priester gaben den Unterricht und wir Schüler hatten verschiedene Hausarbeiten zu erledigen. Zu meinen Aufgaben gehörte es, die Hühnerställe sauberzumachen, Heuballen zu bündeln, Äpfel zu pflücken und die Flure zu wischen. Ich tat, was immer mir aufgetragen wurde, und war einfach nur glücklich, irgendwo anders zu sein als in der winzigen Wohnung meiner Mum.
Warum Catholic Charities aus den zahllosen bedürftigen Kindern ausgerechnet mich für das Internat ausgewählt hat, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht haben sie irgendetwas in mir gesehen. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Glück und dies war ein wahlloser Akt der Nächstenliebe. Im Leben kommt es manchmal auch nicht darauf an, warum man eine Chance erhält, sondern nur darauf, was man daraus macht.
Ich beschloss, meine zu nutzen.
Am Internat lernte ich Jerome Nadine kennen, der in meinem Leben noch eine wichtige Rolle spielen würde. Er war ein echter Wegbereiter. Jerome war schon vor mir in St. Michael’s gewesen und hat als schwarzer Schüler und Basketballspieler Jungs wie mir den Weg geebnet. Nach seiner Schulzeit wurde er ins Priesteramt berufen, aufgrund seiner sportlichen Erfolge besaß seine Stimme aber auch außerhalb der Kirche noch jede Menge Gewicht und diese Tatsache nutzte er immer wieder, um sich für mich einzusetzen.
Weil ich groß und recht sportlich war, drängte Jerome mich immer wieder dazu, Basketball zu spielen. Von Pater Nadine wusste ich, dass die Basketballer ihre Spiele im gesamten Bundesstaat bestritten. Mir gefiel die Vorstellung, den Campus immer wieder mal zu verlassen und die weite Welt zu bereisen. Ich beschloss deshalb, tatsächlich mit dem Basketballspielen zu beginnen – allerdings war ich nicht besonders gut. Wie durch ein Wunder schaffte ich es trotzdem schon in meinem ersten Jahr in die Schulauswahl. Jahre später fand ich heraus, wieso: Jerome hatte dem Trainer der Mannschaft, Gene Vilela, gesagt: »George wird mal ein guter Spieler, da bin ich mir sicher. Schmeißen Sie ihn nicht raus. Lassen Sie ihn im Team, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht bereit ist. Behalten Sie ihn im Kader.«
Woher er das wusste? Was er in mir gesehen hat? Ich weiß es nicht. Aber dieser Bitte verdanke ich den Rest meines Lebens. Gene versprach, mich in der Mannschaft zu behalten, und tatsächlich wurde ich Jahr für Jahr besser.
Basketball war allerdings nur ein Teil meiner Geschichte. In St. Michael’s war ich in der Obhut einer Gruppe Nonnen, die enorm viel Zeit in mich als Schüler, aber auch als Mensch investiert haben. Die meisten dieser Frauen hatten keine Ahnung von Basketball. Aber sie hatten erkannt, welches Potenzial in mir steckte, und halfen mir nun dabei, es auszuschöpfen.
Eine dieser Nonnen, Schwester Delora, interessierte sich ganz besonders für meine sportliche Entwicklung. Sie besorgte sich öfter die Schlüssel zur Turnhalle, holte mich ab und ließ mich unter ihrem wachsamen Blick eine Stunde lang Körbe werfen. Durch den hingebungsvollen Einsatz von Schwester Delora und Pater Nadine begann auch ich irgendwann daran zu glauben, dass aus mir einmal etwas werden könnte.
Ich konvertierte in St. Michael’s auch zum Katholizismus und Jerome wurde mein Taufpate. In unserem Fall war dies kein bloßer formeller Titel, er symbolisierte eine lebenslange tiefspirituelle und persönliche Verbindung. Pater Nadine verließ die Schule irgendwann, um in verschiedenen Institutionen der Streitkräfte als Militärgeistlicher zu dienen. Einige Monate vor seinem Tod hatte ich ihn noch in San Diego besucht, ein letztes Treffen mit dem Mann, der eine so bedeutende Rolle für meine Entwicklung gespielt hat. Man muss nicht unbedingt an Gott glauben, aber Engel gibt es auf dieser Welt ganz sicher. Menschen wie Pater Nadine.
In meinem letzten Schuljahr zahlte sich die viele Unterstützung und harte Arbeit aus. Ich führte die Rangliste der besten Scorer im ganzen Bundesstaat an, was eine ziemlich große Sache für unsere Schule war. Zahlreiche Zuschauer strömten zu den Partien in unsere kleine Turnhalle, um mich spielen zu sehen, und College-Trainer wurden plötzlich auf mich aufmerksam. Nachdem ich in einem Spiel gegen die St. Rose aus Carbondale 30 Punkte und um die 20 Rebounds geholt hatte, sprach mich auf dem Weg von der Umkleide zum Teambus jemand an: »George!« »Ja, Sir«, entgegnete ich.
»Mein Name ist Jack Ramsay«, sagte der Mann, und reichte mir seine Karte. »Ich bin Head Coach am Saint Joe’s College in Philadelphia. Wir beobachten dich schon eine ganze Weile und möchten dir gerne ein Stipendium anbieten. Ich wollte mich nur kurz vorstellen, denn du wirst mich in dieser Saison sicher noch bei einigen Spielen sehen.«
Dann schüttelte er meine Hand und sagte: »Spiel weiter so gut.« Das werde ich nie vergessen. So einfach war das: Spiel weiter so gut.
Leicht gesagt bedeutet natürlich nicht leicht gemacht, aber der Spruch war ein gutes Motto und ich habe den Rest meines Lebens versucht, mich danach zu richten.
Nachdem ich in den Bus gestiegen war, fragte mein Coach, mit wem ich mich draußen unterhalten hatte. Ich zeigte ihm die Karte. Als er den Namen darauf las, veränderte sich plötzlich sein ganzes Verhalten.
»Was hat er gesagt?«, wollte der Coach wissen.
»Er sagte, dass er mich Spielen gesehen hat und mir ein Stipendium anbieten will«, sagte ich.
Darauf nickte der Coach mir anerkennend zu. Ich spürte, wie stolz er auf mich war.
Deshalb sagte ich: »Coach, kann ich Sie etwas fragen?« »Klar«, entgegnete er.
»Was ist ein Stipendium?«
Ich hatte keine Ahnung. Von dem Konzept, dass eine Universität mir mein Studium finanziert, wenn ich im Gegenzug in ihrer Mannschaft Basketball spiele, hatte ich noch nie etwas gehört.
Ich war aufgeregt und konnte es gar nicht erwarten, Liebchen davon zu erzählen. Ich dachte, dass sie sich genauso freuen und stolz sein würde. Aber sie hatte offenbar noch weniger Ahnung als ich. »Ich dachte, ich hätte dich besser erzogen«, sagte sie barsch, nachdem ich ihr die Neuigkeiten überbracht hatte.
»Wie meinst du das?«, sagte ich baff. »Ich finde, du hast mich ganz prima erzogen.« Und das hatte sie in der Tat. Kein Tag verging, an dem ich mich nicht an ihrem Vorbild orientiert und bestmöglich versucht hätte, umzusetzen, was sie mich gelehrt hat.
»Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich nicht fassen kann, dass du so naiv bist zu glauben, dass irgendwelche Weißen dir das College bezahlen, nur damit du dort Basketball spielen kannst«, erklärte sie mir. »Das ergibt keinen Sinn. Die wollen dich reinlegen.«
Da musste ich lachen, ich konnte nicht anders. Aber ich verstand auch ihre Skepsis. Bei allem, was sie durchgemacht hatte, war es kein Wunder, dass sie misstrauisch war. Ihre Reaktion auf meine eigentlich gute Nachricht war ein eindringlicher Reminder, wie Erfahrungen aus der Vergangenheit unsere Sicht auf zukünftige Chancen formen und manchmal auch einschränken können.
Liebchen war deshalb in vielerlei Hinsicht ein Produkt ihrer eigenen Geschichte. Sie hatte viele schwere Jahre durchgestanden und dabei nie einen Weißen erlebt, der selbstlos oder großzügig zu ihr gewesen ist. Obwohl schon meine Schulbildung von einer karitativen Einrichtung finanziert worden war, erschien es ihr deshalb unglaubwürdig, dass Sport für mich ein Sprungbrett zu höherer – und obendrein kostenloser! – Bildung sein könnte.
Der Bürgerrechtsaktivist und Autor James Baldwin hat beschrieben, wie wir unsere Geschichte stets mit uns tragen und unbewusst von ihr gesteuert werden. Liebchens Reaktion war der lebendige Beweis dafür. Ihre – unsere – Geschichte war in jenem Moment wieder präsent und formte ihre Interpretation dessen, was für mich nach einer unglaublichen Chance klang. Sie konnte sich schlicht nicht vorstellen, dass so etwas möglich war – und ich mir, um ehrlich zu sein, auch nicht so recht. Der Gedanke, dass ein Ballspiel mir die Tür zu einem Universitätsstudium öffnen könnte, schien beinahe zu schön, um wahr zu sein. Wenn wir vorankommen wollen, müssen wir aber manchmal die gedanklichen Fesseln unserer Vergangenheit abstreifen, um Chancen zu erkennen und beim Schopf zu packen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen für unmöglich gehalten hätten.
Zum Glück konnten die Nonnen von St. Martin’s klarstellen, dass die Sache mit dem Stipendium nicht zu schön war, um wahr zu sein, sondern tatsächlich eine einmalige Chance für mich darstellte. Einen Weg in eine bessere Zukunft. Ihr Blick auf die Welt war durch die eigene Geschichte weit weniger belastet als der von Liebchen, weshalb sie das Stipendium sofort als das erkannten, was es war: eine Möglichkeit für mich, einen Weg zu gehen, von dessen Existenz weder Liebchen noch ich je etwas geahnt hatten.
Sie behielten mich fortan jeden Tag nach der Schule da und ließen mich büffeln. Was ich damals nicht wusste: Sie bereiteten mich damit auf die Aufnahmeprüfung der Uni vor. Damals hatte jedes College noch seine eigene Aufnahmeprüfung. Bei einem Besuch in Villanova erklärte mir deren Head Coach Al Severance, dass auch er vorhatte, mir ein Stipendium anzubieten, ich aber zunächst die Aufnahmeprüfung bestehen müsste.
Meine Schulbildung in Washington war nicht unbedingt die Beste, wie Sie sich vielleicht denken können. Der Grundsatz »getrennt, aber gleich«, der im Rahmen der Rassentrennung galt und nach dem uns Schwarzen vergleichbar gute Einrichtungen und Dienstleistungen wie der weißen Bevölkerung zur Verfügung stehen sollten, war natürlich eine schamlose Lüge. Doch mit der Gnade Gottes und jener engagierten Nonnen konnte ich nun all den verpassten Stoff aufholen. Am Ende schnitt ich im Test derart gut ab, dass Coach Severance mir auf der Stelle ein Stipendium anbot. Wir riefen Schwester Evelina an, eine der Nonnen, um ihr Einverständnis einzuholen, dass ich fortan die Villanova University besuchen würde. Das erteilte sie selbstverständlich umgehend, Villanova war schließlich eine katholische Uni. Am darauffolgenden Tag nahm ich das Stipendium an.
Als ich an die Villanova wechselte, erging es mir zunächst wie damals bei meinem Umzug von der Kreuzung New Jersey und Florida Avenue in Washington nach St. Michael’s in Pennsylvania: Ich tauchte plötzlich ein in eine Welt, über die ich so gut wie nichts wusste. Ich glaube, bevor ich nach Villanova kam, war mir gar nicht bewusst, wie arm ich war. Ich wurde vorher auch nur selten mit dem Thema Rasse konfrontiert. Man muss sich den Kontext der damaligen Zeit bewusst machen. Ich kam Ende der 1950er-Jahre auf die Uni, nur wenige Jahre nach dem richtungsweisenden Urteil des Obersten Gerichtshofs, das 1954 im Fall Brown v. Board of Education (»Brown gegen das Bildungsministerium«) die Rassentrennung an öffentlichen Bildungseinrichtungen für verfassungswidrig erklärt hat. Das ganze Land war noch immer mit der Aufhebung der Rassentrennung beschäftigt und viele öffentliche Einrichtungen, besonders im Süden, weigerten sich, die neuen Vorschriften umzusetzen. Die Immatrikulation von James Merediths als erstem schwarzen Studierenden an der University of Mississippi – und die Krawalle, die damit einhergingen – lagen noch in weiter Ferne.
Villanova ist eine private katholische Universität im gleichnamigen Ort in Pennsylvania, die für damalige Verhältnisse bereits recht fortschrittlich war. Sie verschreibt sich bis heute den Werten des Augustinerordens, der sie einst gegründet hat, Werten wie soziale Gerechtigkeit und Inklusion. Trotzdem hatte ich es als einer der wenigen schwarzen Studierenden auf dem Campus nicht leicht. 1959 waren etwa 3000 Studenten und Studentinnen an der Villanova eingeschrieben. Die genau Zahl der Schwarzen darunter wurde nicht dokumentiert, sie muss aber im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich gelegen haben.
Auf einmal befand ich mich inmitten zahlloser Gesichter, die ganz anders aussahen als meines, und musste mich in einer neuen Welt voller Privilegien und Chancen zurechtfinden, die mir bis dato völlig fremd war. Mein neues Leben unterschied sich auf krasse Weise von der Zeit in Washington und selbst von den Jahren in St. Michael’s, wo es zumindest eine Handvoll anderer schwarzer Schüler gegeben hatte.