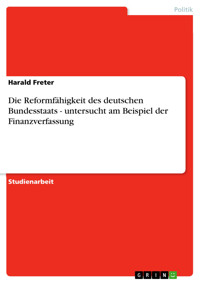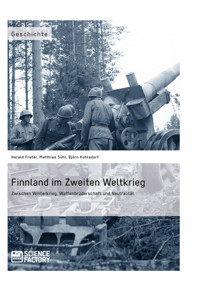
Finnland im Zweiten Weltkrieg: Zwischen Winterkrieg, Waffenbrüderschaft und Neutralität E-Book
Harald Freter
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Sprache: Deutsch
Schon 1939 trägt eine russische Offensive den Zweiten Weltkrieg nach Finnland. Das skandinavische Land gerät in eine isolierte und bedrohte Lage zwischen deutschen und sowjetischen Großmachtinteressen. Dieser Band analysiert Finnlands „Sonderweg“ im Zweiten Weltkrieg und stellt dessen geschichtliche Hintergründe dar. Welchen Handlungsspielraum hatte Finnland tatsächlich im Verlauf des Krieges – und wie konnte es nach Kriegsende seine Unabhängigkeit wahren? Aus dem Inhalt: Der Kampf um Karelien Kriegsverlauf in Finnland: Winterkrieg, Fortsetzungskrieg, Lapplandkrieg Finnland im Spannungsfeld deutscher und sowjetischer Bestrebungen Finnische Außen- und Neutralitätspolitik am Vorabend des Zweiten Weltkriegs Die Finnlandpolitik Hitlers und die deutsch-finnischen Beziehungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © 2013 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: pixabay.com
Finnland im Zweiten Weltkrieg: Zwischen Winterkrieg, Waffenbrüderschaft und Neutralität
Harald Freter (2008): Finnland im Zweiten Weltkrieg im Spannungsfeld deutscher und sowjetischer Großmachtinteressen
Einleitung
Interessenlage der beteiligten Mächte bezüglich Finnland
Der Verlauf des Krieges in Finnland 1939 - 1945
Bewertung der finnischen Handlungsmöglichkeiten
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Matthias Sühl (2010): Finnlands Außenpolitik nach dem ersten Weltkrieg. Vom neuen Staat zum isolierten Land im Winterkrieg und zum Waffenbruder des Dritten Reiches
Einleitung
Finnlands Außenpolitik als neuer Staat
Finnlands Neutralitätspolitik vor dem Winterkrieg
Der Winterkrieg
Der Fortsetzungskrieg
Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis
Björn Kohlsdorf (2005): Entstehung und Wandel der militärischen Koalition Deutschland – Finnland in Kohärenz mit dem Kriegsverlauf an der Ostfront
Einleitung
Genese der Koalition
Die militärische Liaison Deutschland - Finnland
Ende der „Waffenbrüderschaft“
Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis
Einzelpublikationen
Harald Freter (2008): Finnland im Zweiten Weltkrieg im Spannungsfeld deutscher und sowjetischer Großmachtinteressen
Einleitung
Am Ende des Zweiten Weltkrieges besetzte die Sowjetunion die Territorien der mit dem Deutschen Reich verbündeten bzw. von diesem okkupierten Staaten (Ungarn, Rumänien, Tschechoslowakei, Bulgarien, Polen) und führte dort eine Umgestaltung der Staats- und Gesellschaftsordnung nach sowjetischem Vorbild durch. Einzige Ausnahme hiervon war Finnland, das weder okkupiert noch sowjetisiert wurde. Es konnte sowohl seine territoriale Integrität und Souveränität, als auch seine demokratischen Institutionen, seine marktwirtschaftliche Ordnung und sein Gesellschaftssystem erhalten. Mit der Untersuchung der Frage, warum dies so war, ist erst in neuerer Zeit mit der Öffnung entsprechender russischer Archive begonnen worden (Nevakivi, 1994, Troebst, 1998, Büttner, 2001), ohne dass eine abschließende Antwort bislang möglich gewesen wäre.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Gründe hierfür im finnischen Agieren im Spannungsfeld zwischen eigenen nationalen Interessen und dem äußeren Druck Deutschlands und der Sowjetunion im Verlauf und vor allem am Ende des Krieges zu suchen. Die finnische Geschichtsschreibung erklärte nach dem Krieg Finnlands Beitritt zum Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion mit der sogenannten Treibholztheorie Arvi Korhonens (1961), wonach Finnland gegen seinen Willen und ohne eigene Mitwirkung in den Krieg gezogen wurde. Diese Auffassung wurde zunächst von ausländischen (u. a. Krosby, 1969), später dann auch von finnischen Historikern (Jokipii, 1987) immer mehr widerlegt.
Zu fragen ist allerdings, welchen Handlungsspielraum Finnland tatsächlich im Verlauf des Krieges hatte. Zur Untersuchung dieser Frage wird zweischrittig vorgegangen. Zunächst wird die Interessenlage der auf dem finnischen Kriegsschauplatz agierenden Mächte am Vorabend des Zweiten Weltkrieges analysiert. Ausgangspunkt ist die Situation Finnlands nach Erstem Weltkrieg, Bürgerkrieg und den sogenannten Ostkriegszügen. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich die Interessen der Sowjetunion und ab 1933 des nationalsozialistischen Deutschlands.
In einem weiteren Schritt werden dann der tatsächliche Verlauf des Krieges und das damit einhergehende Verhalten Finnlands, Deutschlands und der Sowjetunion dargestellt. Dabei wird der finnischen Periodisierung und Terminologie (Winterkrieg, Fortsetzungskrieg, Lapplandkrieg) gefolgt.
Gezeigt werden soll, dass ein finnischer Handlungsspielraum zwar gegeben, dieser aber letztlich vergleichsweise gering war. Diesen minimalen Handlungsspielraum hat die finnische politische und militärische Führung klug nutzen können, so dass am Ende des Krieges vor dem Hintergrund der militärischen Gesamtkonstellation eine Okkupation des Landes durch die Sowjetunion nicht erfolgte.
An Quellen wird zurückgegriffen auf Dokumentensammlungen zu den Beziehungen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion, ein Tonbandprotokoll vom Besuch Adolf Hitlers beim finnischen Oberbefehlshaber Carl Gustav Mannerheim am 4. Juni 1942 (Wegner, 1993), dem ein Exkurs gewidmet ist, und die Erinnerungen Mannerheims (1952). Herangezogen wird weiter deutsch- und englischsprachige Sekundärliteratur, darunter auch von finnischen Autoren. Kritischere Stimmen aus russischer Perspektive, die ein offensiveres Vorgehen Finnlands gegenüber der Sowjetunion annehmen (Baryshnikov, 2005), werden mit erörtert. Finnischsprachige Standardliteratur (Korhonen, 1961, Jokipii, 1987) konnte mangels Sprachkenntnissen nicht direkt benutzt werden. Hierzu wird auf entsprechende Zusammenfassungen zurückgegriffen (u.a. Saarinen, 1975, Hentilä, 2005, 2007).
Zu den auftretenden geographischen Bezeichnungen, insbesondere Ortsnamen, sei angemerkt, dass in der Literatur hier jeweils die finnischen, schwedischen und russischen Bezeichnungen, auftreten, diese teilweise deutsch oder englisch transkribiert. Dies gilt beispielsweise für den schwedischsprachigen südlichen Teil Finnlands[1]. In der Regel wird im nachstehenden Text die Bezeichnung gewählt, die der territorialen Zugehörigkeit zum betrachteten Zeitpunkt entspricht.
Interessenlage der beteiligten Mächte bezüglich Finnland
Finnlands Interessen nach Erstem Weltkrieg, Bürgerkrieg und Ostkriegszügen
Im Zuge der Oktoberrevolution, der Machtübernahme der Bolschewiki und des beginnenden russischen Bürgerkrieges erklärte Finnland, das seit 1809 als Großfürstentum zum Zarenreich gehörte[2], am 6. Dezember 1917 seine Unabhängigkeit. Diese wurde im Januar 1918 auch von Lenin anerkannt, der in der finnischen Selbständigkeit keine Bedrohung der sowjetischen Herrschaft sah. Es folgte die Anerkennung durch die skandinavischen Nachbarstaaten, Deutschland und Frankreich. (Lehmann, 1989, S. 4)
Kurz darauf kam es in Finnland zwischen Januar und Mai 1918 zum Bürgerkrieg zwischen sozialistischen („Rote Garden“) und konservativen („Weiße Garden“) Kräften. Dabei wurden die „Roten Garden“ von noch in Finnland stationierten revolutionären Soldaten der russischen Armee unterstützt. Insofern ergab sich eine Verflechtung mit dem beginnenden russischen Bürgerkrieg. Letztlich gelang es den bürgerlichen Kräften unter Führung von Carl Gustav Mannerheim, mit deutscher Hilfe den Krieg für sich zu entscheiden[3]. Wegen der Verflechtung mit dem russischen Bürgerkrieg deuteten die Sieger diesen Krieg nicht in erster Linie als finnischen Bürgerkrieg, sondern als einen Freiheitskrieg gegen Russland („Unabhängigkeitskrieg“). Deshalb blieben die Beziehungen zwischen Finnland und der Sowjetunion in den folgenden Jahren weiter spannungsreich. (vgl. Bohn, 2005, S. 206ff.). Zwischen 1918 und 1920 versuchten halboffizielle finnische Verbände in mehreren sogenannten Ostkriegszügen erfolglos, die sowjetischen Teile Kareliens[4] an Finnland anzuschließen.
Mit dem Frieden von Dorpat (Tartu) wurden schließlich 1920 die Feindseligkeiten beendet. Der Vertrag legte im Wesentlichen die Grenzen des zaristischen Großfürstentums Finnland als Grenze des nunmehr unabhängigen Finnland fest. Mit Petsamo (russisch: Petschenga) erhielt Finnland zudem einen eisfreien Hafen am Eismeer, gab aber Ansprüche auf die Kreise Repola und Porajärvi in Ostkarelien auf, die es 1918 bzw. 1919 seinem Gebiet angeschlossen hatte. Die zwischen Finnland, Schweden und Russland umstrittenen Ålandinseln am Eingang des Finnischen Meerbusens wurden vom Völkerbund Finnland zugesprochen, jedoch demilitarisiert (Lehmann, 1989, S. 14f., Bohn, 2005, S. 213) (siehe Karte 1).
Karte 1. Finnland und Russland nach dem Frieden von Dorpat (1920) (aus: Wikipedia, Finnische Ostkriegszüge)
Die territorialen Regelungen des Friedens von Dorpat waren die Ausgangslage für die weitere Entwicklung der finnischen, sowjetischen und deutschen Interessen.
Die finnische Interessenlage bestand insbesondere aus dem Wunsch nach Sicherheit gegenüber der Sowjetunion. Das betraf sowohl die territoriale Integrität als auch den Fortbestand der demokratischen und marktwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung. „Der große östliche Nachbar galt gleichermaßen als Gefahr für das kapitalistische System wie für die nationale Selbständigkeit“ (Menger, 1988, S. 17).
Vor diesem Hintergrund wurden von finnischer Seite vor dem Krieg unterschiedliche Strategien verfolgt:
Aufbau guter Beziehungen zu DeutschlandPolitik der „Skandinavischen Neutralität“Befriedung des Verhältnisses zur SowjetunionNachdem in den 1920er und 1930er-Jahren eine betont deutschfreundliche Stimmung vorherrschte (s.u.), kam es 1936/37 in Finnland zu einem Regierungswechsel. Ziel der finnischen Außenpolitik unter dem neuen Präsidenten Kallio, Ministerpräsident Cajander und Außenminister Holsti war eine Zusammenarbeit mit dem Völkerbund, namentlich Großbritannien und Frankreich, und mit den skandinavischen Staaten und eine Entspannung des Verhältnisses zur Sowjetunion. (Menger, 1988, S. 37; Lehmann, 1989, S. 11).
Eine Orientierung der Gesamt- und Außenpolitik auf die skandinavischen Staaten, vor allem Schweden, sollte einen Ausweg aus dem sicherheitspolitischen Dilemma zwischen Deutschland und der Sowjetunion bieten. Konkretere Absprachen über eine solche „skandinavische Neutralität“ scheiterten aber an der reservierten Haltung Schwedens (Schweitzer, 1993) und der mangelnden Bereitschaft zu einem „länderübergreifenden militärischen Vorgehen in unterschiedlichen geographischen Räumen“ (Lehmann, 1989, S. 9).
Vor diesem Hintergrund hatte sich Finnland weitgehend allein im machtpolitischen Spannungsfeld zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion zu orientieren. Hierauf wird in den beiden folgenden Abschnitten eingegangen.
Finnisch-Deutsche Zusammenarbeit vor dem Krieg
Insgesamt war in den 1920er und 1930er Jahren in Finnland eine antisowjetische und prodeutsche Stimmung tonangebend (Lehmann, 1989, S. 6ff.) Dies führte zu einer intensiven finnisch-deutschen Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet. Deutschland wurde ab 1921 zum wichtigsten Importland für Finnland (Menger, 1989, S. 17). Dies setzte sich auch nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland fort, auch wenn es in Finnland kaum Befürworter der Nationalsozialisten gab.
Menger (1988) gliedert die Beziehungen zwischen Finnland und dem nationalsozialistischen Deutschland in zwei Phasen: die Phase der traditionellen Freundschaftlichkeit (1933-1936) und die Phase deutscher Aktivitäten gegen einen finnischen Kurswechsel (1937 – 1939).
In der ersten Phase, die vom deutschfreundlichen Präsidenten Svinhufvud, Ministerpräsident Kallio und Außenminister Hackzell auf finnischer Seite bestimmt wurde, wurde „Deutschland als stärkster Garant finnischer Unabhängigkeit“ (Menger, 1988, S. 29) gesehen, die Sowjetunion hingegen als deren größter Gegner. Deutschland konnte umfangreiche wehrwirtschaftliche Interessen mit finnischen Rohstofflieferungen (Kupfer, Eisen und Nickel aus der Petsamoregion, siehe Menger, 1988, S. 25 und S. 69) befriedigen.
Finnland wurde von Anfang an in die deutschen Kriegsplanungen als „antisowjetischer Brückenkopf“ (Menger, 1988, S. 35) bzw. als „Flankenpartner, Aufmarsch- und Nachschubbasis“ (Menger, 1988, S. 79) einbezogen. Es kam zu einer noch intensiveren Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet (Lehmann, 1989, S: 6ff.). Die einzige „Gefahr“ wurde in dieser Seite deutscherseits in einer Annäherung Finnlands an Großbritannien gesehen (Menger, 1988, S. 35).
Hinsichtlich der deutschen Interessen an Finnland ist also mit Salewski (1979) festzustellen, dass
Finnland für Deutschland Hauptlieferant kriegswichtiger Rohstoffe war,Deutschland strategische Interessen im Ostseeraum und im Nordpolarmeer verfolgte,Deutschland die Gefahr englisch-französischer Interventionen in Nordeuropa abwenden wollte.Diese Interessen waren durchaus teilweise gemeinsame, da Finnland von Deutschland die Garantie des politischen Status Quo erwartete und in Deutschland einen wichtigen Abnehmer seiner Rohstoffe, aber auch Lieferanten von Lebensmitteln und Waffen sah. Während Deutschland Finnland in das eigene Lager für den Angriffskrieg gegen die Sowjetunion ziehen wollte, erhoffte sich Finnland durch die deutsche Unterstützung eine mäßigende Wirkung auf die Sowjetunion.