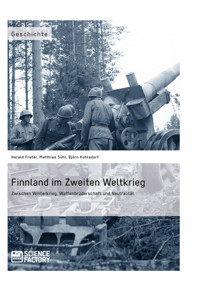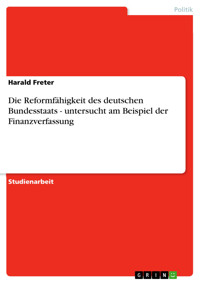Zum Stand der Diskussion über die Entstehung des Alleinstimmrechts der sieben Kurfürsten bei der deutschen Königswahl und die Ausbildung des Kurfürstenkollegs E-Book
Harald Freter
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,3, FernUniversität Hagen, Veranstaltung: Die Entstehung des Kurfürstenkollegs: Von den Königswählern 1198 zum Kurfürstenkolleg 1298, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der Goldenen Bulle von 1356 wurde das Verfahren der Wahl des deutschen Königs erstmals eindeutig in urkundlicher Form festgelegt. Die Königswahl hatte durch die sieben Kurfürsten zu erfolgen, dies waren die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier als geistliche, der Pfalzgraf bei Rhein, die Herzöge von Sachsen und von Brandenburg sowie der König von Böhmen als weltliche Wähler. Die Goldene Bulle schuf kein neues Recht, sondern schrieb den Stand der Entwicklung fest, wonach sich im Laufe des 13. Jahrhunderts der Kreis der Königswähler auf die in der Goldenen Bulle genannten sieben Kurfürsten reduziert hatte. Auf welcher Grundlage dies geschah und warum gerade diese sieben als allein Wahlberechtigte übrig blieben, gilt als das „Fundamentalrätsel der deutschen Verfassungsgeschichte“ Hierzu stellen sich zwei Fragen: zum einen, nach welchem Auswahlkriterium und mit welchen Mechanismen der Kreis der Königswähler allmählich auf genau die sieben Genannten reduziert wurde, zum anderen, zu welchem Zeitpunkt die Kurfürsten eine abgeschlossene Einheit, ein Kollegium, gebildet haben. Für diesen Zeitpunkt werden Datierungen zwischen 1198 und 1298 vorgeschlagen, besondere Bedeutung für diesen Prozess scheinen die Königswahlen von 1198, 1257 und 1298 zu haben. Eine Reihe von Theorien sind zur Erklärung der Auswahl insbesondere der weltlichen Kurfürsten entwickelt worden , darunter die sogenannte Erzämtertheorie wonach das Wahlrecht der Kurfürsten auf bestimmte Hofämter zurückzuführen sei, die Reduktionstheorie, wonach mangels Interesse der Fürsten sich die Wahlbeteiligung immer mehr verringerte oder die Wolfsche Erbrechtstheorie, der zufolge die Wahlberechtigten die Repräsentanten ottonischer Tochterstämme waren. Für jede dieser Theorien kann eine Reihe von Argumenten angeführt werden, gegen jede sind aber auch erhebliche Einwände erhoben worden. Speziell an der Erbrechtstheorie scheiden sich denn auch die Geister. Zunächst werden die wesentlichen Theorien mit ihren Hauptthesen referiert, anschließend soll der Diskussionsprozess der neueren Forschung nachvollzogen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Zum Stand der Diskussion über die Entstehung des
Alleinstimmrechts der sieben Kurfürsten bei der
deutschen Königswahl und die Ausbildung des
Kurfürstenkollegs
zum Kurs 4132: Die Entstehung des Kurfürstenkollegs: Von den Königswählern 1198 zum
Page 4
1 Einleitung
Mit der Goldenen Bulle von 1356 wurde das Verfahren der Wahl des deutschen Königs erstmals eindeutig in urkundlicher Form festgelegt. Die Königswahl hatte durch die sieben Kurfürsten zu erfolgen, dies waren die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier als geistliche, der Pfalzgraf bei Rhein, die Herzöge von Sachsen und von Brandenburg sowie der König von Böhmen als weltliche Wähler. Die Goldene Bulle schuf kein neues Recht, sondern schrieb den Stand der Entwicklung fest, wonach sich im Laufe des 13. Jahrhunderts der Kreis der Königswähler auf die in der Goldenen Bulle genannten sieben Kurfürsten reduziert hatte. Auf welcher Grundlage dies geschah und warum gerade diese sieben als allein Wahlberechtigte übrig blieben, gilt als das „Fundamentalrätsel der deutschen Verfassungsgeschichte“ (Stehkämper, 1973, zit. nach Wolf, 1996, S. 3) oder sogar als „unlösbares verfassungsrechtliches Problem“ (Lintzel, 1952). Hierzu stellen sich zwei Fragen (Wolf, 1996, 1998), zum einen, nach welchem Auswahlkriterium und mit welchen Mechanismen der Kreis der Königswähler allmählich auf genau die sieben Genannten reduziert wurde, zum anderen, zu welchem Zeitpunkt die Kurfürsten eine abgeschlossene Einheit, ein Kollegium, gebildet haben. Für diesen Zeitpunkt werden Datierungen zwischen 1198 und 1298 vorgeschlagen, besondere Bedeutung für diesen Prozess scheinen die Königswahlen von 1198, 1257 und 1298 zu haben.
Eine Reihe von Theorien sind zur Erklärung der Auswahl insbesondere der weltlichen Kurfürsten entwickelt worden1, darunter die sogenannte Erzämtertheorie wonach das Wahlrecht der Kurfürsten auf bestimmte Hofämter zurückzuführen sei, die Reduktionstheorie (Lintzel, 1952), wonach mangels Interesse der Fürsten sich die Wahlbeteiligung immer mehr verringerte oder die Wolfsche Erbrechtstheorie (zusammenfassend Wolf, 1996, 1998), der zufolge die Wahlberechtigten die Repräsentanten ottonischer Tochterstämme waren. Für jede dieser Theorien kann eine Reihe von Argumenten angeführt werden, gegen jede sind aber auch erhebliche Einwände erhoben worden. Speziell an der Erbrechtstheorie scheiden sich denn auch die Geister.
1Die geistlichen Kurfürsten werden in der Literatur kaum oder gar nicht behandelt. Eine Erbrechtstheorie ist auf sie naturgemäß nicht anwendbar. Am ehesten dürfte noch eine Entsprechung der Erzämtertheorie auf sie anwendbar sein, was auch Wolf (1996, 1998) tut, indem er darauf hinweist, dass der Erzbischof von Mainz zur Wahl in seine Diözese einlud und die Wahl leitete, der Erzbischof von Köln den neuen König salbte und der
Page 5
Bei der Untersuchung dieser Fragestellung stellen sich eine Reihe methodischer Probleme. Insbesondere ist die Quellenlage ungünstig (Kaufmann, 1978, Krieger, 1992), weil vom Umfang her dürftig und in ihrer Aussage nicht eindeutig, da vor allem eine mangelnde begriffliche Schärfe der Quellenaussagen zu beklagen ist. Dies betrifft vor allem die Terminologie der lateinischen Quellensprache.
Eine Auswertung der Literatur zeigt, dass einzelne Aufsätze oder Monografien jeweils eine dieser Theorien favorisieren und Gegenargumente gegen andere sammeln. So bemühen sich die meisten Aufsätze im Sammelband von Wolf (2002), anhand der Entwicklung einzelner Fürstenhäuser Belege für die Erbrechtstheorie anzuführen, während sich Erkens (2002) massiv gegen die Auffassungen von Wolf wendet und eine eigene Theorie eines politischen Prozesses entwickelt.
Ziel dieser Hausarbeit, die ursprünglich von der Beschäftigung mit Wolf (1996) motiviert wurde, soll es sein, ganz nüchtern die jeweiligen Theorien darzustellen und systematisch die jeweils aufgeführten Argumente und Einwände gegenüberzustellen, insbesondere die jeweils ins Feld geführten Quellenbelege mit ihrer Quellenkritik. Eine zentrale Bedeutung hat dabei die Datierung des Kurfürstenparagraphen im Sachsenspiegel.
Zu Beginn dieser Arbeit sollen zunächst die wesentlichen Theorien mit ihren Hauptthesen referiert werden. Dabei findet auch die Zusammenfassung der älteren Forschung von Mitteis (1944), an die sich alle neueren Forschungen anschließen, Beachtung. In einem weiteren Abschnitt sollen wichtige Quellen und ihre inhaltlichen Aussagen vorgestellt werden. Dabei handelt es sich neben dem Sachsenspiegel und seinen Nachfolgern als Rechtssammlungen vor allem um Wahlanzeigen, päpstliche Urkunden und erzählende Quellen. Anschließend soll der Diskussionsprozess der neueren Forschung, vor allem nach 1996, dem Erscheinungsjahr des einschlägigen Studienbriefes der Fernuniversität, nachvollzogen werden. Hierzu wird die Dissertation von Hohlweck (2001) herangezogen, die aber noch nicht die o.g. Werke von Wolf (2002) und Erkens (2002) berücksichtigen konnte. Dabei ist die Frage von Interesse, inwieweit die Diskussion nach 1996 neue Aspekte zu den beiden eingangs genannten Fragestellungen aufzeigen konnte.
Erzbischof von Trier ihn inthronisierte. Es wird also ein Zusammenhang mit Funktionen bei der Krönung
Page 6