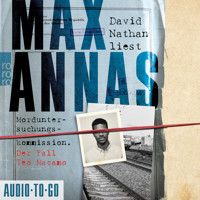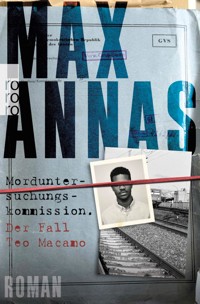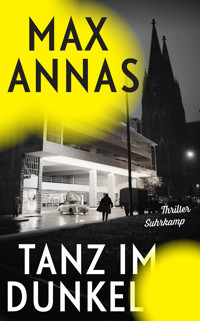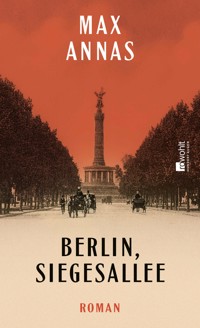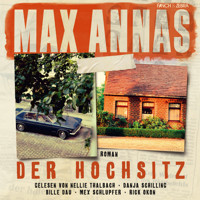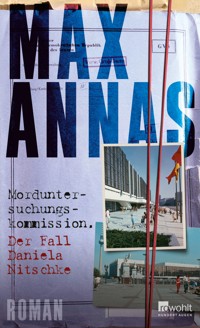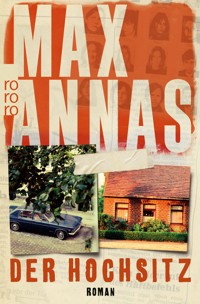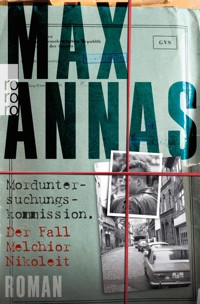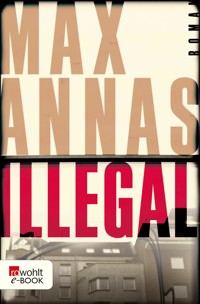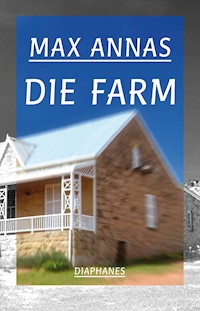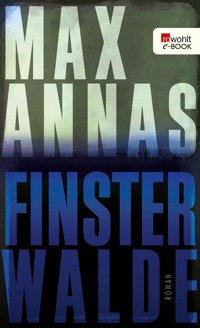
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine beklemmende Zukunftsvision für unser Land – von einem Meister des politischen Kriminalromans So könnte es kommen, vielleicht schon sehr bald: Die EU gibt es nicht mehr. Überall in Europa haben Nationalisten und Fremdenfeinde das Sagen. Leute ohne deutschen Pass werden aus ihren Wohnungen abgeholt, Staatsbürgerschaften aufgekündigt. Die meisten Deutschen mit fremden Wurzeln befinden sich in Übergangslagern, sie hoffen auf eine internationale Lösung, ein Abkommen mit einem Land, das sie aufnehmen wird. Doch auch die korruptesten Regimes weigern sich. Zu schlecht integrierbar, heißt es. Was sie meinen ist: zu viel aufrührerisches Potenzial. In Finsterwalde, einer geräumten Provinzstadt, hat man Tausende Schwarze kaserniert. Unter ihnen Marie mit ihren beiden Kindern. Die Versorgung ist spärlich, die Grenzzäune sind streng bewacht, Strukturen müssen erst noch geschaffen werden. Die Devise heißt Überleben. Da geht das Gerücht, in Berlin seien drei schwarze Kinder zurückgeblieben, vergessen von allen. Marie beschließt, einen Weg aus dem Lager zu finden, um die drei vor dem sicheren Tod zu retten. Parallel dazu erzählt der Roman von einem griechischen Paar, angeworben wie viele andere, um die Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu füllen. Die Ärztin Eleni bekommt eine verwaiste Praxis in Berlin zugewiesen. Theo findet Spuren der früheren Besitzerin – Marie – und macht sich gegen alle Verbote auf die Suche nach ihr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Max Annas
Finsterwalde
Roman
Über dieses Buch
Eine beklemmende Zukunftsvision für unser Land – von einem Meister des politischen Kriminalromans
So könnte es kommen, vielleicht schon sehr bald: Die EU gibt es nicht mehr. Überall in Europa haben Nationalisten und Fremdenfeinde das Sagen. Leute ohne deutschen Pass werden aus ihren Wohnungen abgeholt, Staatsbürgerschaften aufgekündigt. Die meisten Deutschen mit fremden Wurzeln befinden sich in Übergangslagern, sie hoffen auf eine internationale Lösung, ein Abkommen mit einem Land, das sie aufnehmen wird. Doch auch die korruptesten Regimes weigern sich. Zu schlecht integrierbar, heißt es. Was sie meinen ist: zu viel aufrührerisches Potenzial.
In Finsterwalde, einer geräumten Provinzstadt, hat man Tausende Schwarze kaserniert. Unter ihnen Marie mit ihren beiden Kindern. Die Versorgung ist spärlich, die Grenzzäune sind streng bewacht, Strukturen müssen erst noch geschaffen werden. Die Devise heißt Überleben. Da geht das Gerücht, in Berlin seien drei schwarze Kinder zurückgeblieben, vergessen von allen. Marie beschließt, einen Weg aus dem Lager zu finden, um die drei vor dem sicheren Tod zu retten.
Parallel dazu erzählt der Roman von einem griechischen Paar, angeworben wie viele andere, um die Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu füllen. Die Ärztin Eleni bekommt eine verwaiste Praxis in Berlin zugewiesen. Theo findet Spuren der früheren Besitzerin – Marie – und macht sich gegen alle Verbote auf die Suche nach ihr.
Vita
Der Autor hat an einem Forschungsprojekt zu südafrikanischem Jazz an der University of Fort Hare in East London, Südafrika, gearbeitet und ist vor gut zwei Jahren nach Berlin zurückgekehrt. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht zu Themen aus den Bereichen Popkultur, Politik und Sport. Außerdem arbeitete er bei verschiedenen Festivals als Filmkurator. In seinem früheren Leben war er Journalist.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Umschlagabbildung: Ekely/Getty Images
ISBN 978-3-644-00160-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Il serait écrit sur le grand rouleau: «Jacques se cassera le cou tel jour», et Jacques ne se casserait pas le cou? Concevez-vous que cela se puisse, quel que soit l’auteur du grand rouleau?
Jacques le fataliste et son maître/ Denis Diderot
«We may need the guns, we may not.»
The Walking Dead, episode 14 05
Relativ bald.
Oder vielleicht zwei, drei Jahre später.
1
Zuerst kamen die Drohnen. Lautlos. Marie ahnte sie mehr, als dass sie sie sah. Aber als sie zwei der Punkte am dunklen Abendhimmel entdeckt hatte, wurde sie noch andere gewahr. Schwarze Augen. Fünf waren es mindestens, dachte sie, die die Gegend abdeckten. Von ihrem Standort auf dem Balkon des Hauses hatte sie einen guten Blick über diese Stadt. Aber der der Drohnen war noch besser.
Es war genauso wie am Abend zuvor, dem ersten, seit sie hier waren. Der Lärm des Helikopters tauchte am akustischen Horizont auf. Die Scheinwerfer wurden erst später sichtbar, schließlich erfasste das Beben in der Luft ihre ganze neue Welt. Der Hubschrauber blieb hoch über dem Marktplatz stehen, als er seine genaue Position gefunden hatte. So wie am Tag vorher. Dann öffnete sich die Luke, und die Paletten wurden eine nach der anderen herausgestoßen. Auch so, wie sie es schon gesehen hatten.
Alle hielten inne und starrten auf das Schauspiel. Wirklich alle. Die, die keinen freien Blick hatten auf den Helikopter, rannten und suchten sich eine Stelle, von der aus sie die riesigen Paletten an den Fallschirmen zu Boden schweben sehen konnten. Marie sah, wie die Leute ihre Hälse reckten. Eine Palette nach der anderen landete so auf dem Platz, manche aufeinander. Die vierte Palette, mehrfach umwickelt mit reißfester Folie, zerbrach, als sie auf der Kante einer anderen aufkam. Trotzdem fielen die Kisten nicht heraus. Die Palette purzelte als ganze Einheit auf das Pflaster des Marktplatzes.
Auch der Balkon hatte sich schnell gefüllt, als der Helikopter zu hören gewesen war. Die Bewohner des Hauses, das sie gestern bezogen hatten, wollten alle wissen, was draußen geschah. Wie alle anderen. Wer keinen Platz auf dem Balkon fand, drückte sich an die Fensterscheiben. Marie rauchte ihre letzte Zigarette. Sie hatte freie Sicht auf den Helikopter und den Marktplatz.
«Antoinette!», rief Marie laut. «Wo bist du?» Wahrscheinlich konnte ihre Tochter sie gar nicht hören.
«Alles klar, Mama!», kam aber die Antwort aus dem Inneren des Hauses.
«Kodjo?», rief Marie.
«Bin direkt hinter dir», hörte sie die Stimme ihres Ältesten und spürte gleich darauf seine Hand auf ihrer Schulter. «Sechs», zählte er mit, als die sechste Palette aus der Luke gestoßen wurde. «Sieben», sagte er dann. Drei Paletten waren zur gleichen Zeit in der Luft. Zwei von ihnen schlugen direkt nebeneinander auf, die dritte landete auf ihnen und fiel dann zur Seite.
«Gestern waren es zwanzig», sagte Kodjo. Er war ganz nah an Maries Ohr. Auf dem Balkon waren andere Stimmen zu hören. «Sie wollen uns aushungern …» – «War alles so von Anfang an geplant …» – «Hier kommen wir nur tot raus …»
Kodjo zählte weiter. «Fünfzehn, sechzehn.» Sobald die letzte Palette den Helikopter verlassen hatte, schloss sich die Luke. Der Helikopter setzte sich wieder in Bewegung und gewann an Höhe. Kurz darauf war er verschwunden. Die Drohnen folgten ihm wie ein Rudel gutdressierter Hunde.
Da rannten die ersten Leute schon auf den Platz, um sich ihre Ration zu sichern. Noch bevor sie die Paletten erreicht hatten, begannen sie, einander zur Seite zu stoßen. Einer von ihnen fiel zu Boden. Andere trampelten über ihn hinweg. Mehr fielen hin. Die Ersten begannen, die Folien mit Messern zu teilen.
«Das muss sich wirklich ändern», sagte ein großer Typ, der neben Marie stand. Er ragte aus der Gruppe auf dem Balkon mit seinem rasierten Kopf und dem Backenbart heraus, trug Hornbrille und ein weißes Hemd, das in den letzten Tagen fleckig geworden war. Er drehte sich um und ging ins Haus.
«Komm», sagte Marie zu Kodjo und legte einen Arm um seine Schultern, die in den letzten Monaten ganz schön breit geworden waren. Aber ihr Sohn entzog sich der Umarmung und starrte weiter auf den Marktplatz. Hunderte Leute prügelten und schlugen sich, während sie versuchten, an die Kisten auf den Paletten zu gelangen. «Komm, Kodjo!», sagte Marie. «Ich will etwas essen. Komm jetzt!»
2
Das Flugzeug drehte die Runde über dem Berliner Flughafen zum dritten Mal. «Mamá», sagte Aliki. «Prepi na pao stin tualeta.» Sie zerrte an ihrem Sicherheitsgurt, als sich der Flieger wieder auf die Seite legte.
Eleni streichelte den Kopf ihrer jüngeren Tochter. «Sprich deutsch», sagte sie leise, aber deutlich. «Wir landen ja gleich, dann gehen wir ganz sofort zum Klo.» Sie zog ihre Jeansjacke glatt und setzte sich wieder aufrecht hin. Die Hand blieb auf dem Kopf des Kindes.
Theo grinste und stupste Eleni über den Gang hinweg an. «Das benutzt man nicht so mit dem ganz. Ganz und sofort gehen nicht zusammen. Sofort ist immer schon direkt. Das kannst du nicht steigern im Deutschen.»
Eleni zuckte mit den Schultern und blickte Theo in die Augen. «Aber das war sonst richtig, oder?»
«Super, ja. Du hast gesagt, ich soll dich korrigieren.»
Der Flieger verlor kontinuierlich an Höhe.
«Ja, ja … Das meine ich auch so. Du musst jeden Fehler verbessern. Aber das habe ich so nicht gelernt.»
«Feinheiten», sagte Theo, während das Flugzeug auf der Landebahn aufsetzte. «Das kommt noch.» Er zeigte auf Irini, die am Fenster saß und sich die Ohren zuhielt.
«Willkommen auf dem Willy-Brandt-Flughafen Berlin-Brandenburg», sagte die Flugbegleiterin durch die Lautsprecher. «Bitte bleiben Sie noch angeschnallt, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben.»
Ein paar Minuten später standen Theo und Eleni im Gang und zerrten ihre Taschen aus den Gepäckfächern. Eleni, Jeansanzug, rotes T-Shirt und langes schwarzes Haar, ungeschminkt und nicht einmal Lippenstift, neue Laufschuhe an den Füßen, sie fuhr sich mit zwei Fingern an der Nase entlang. Theo, verwaschene Jeans und ein Jackett aus den 80ern des letzten Jahrhunderts, die blaue Krawatte über dem weißen Hemd war neu, genau wie die Lederschuhe, von denen er einen hinten am Jeansbein abwischte, während er die grauen Stoppeln auf dem Kopf sortierte.
Der Bus war schon eine ganze Weile voll besetzt, als sich die Türen schlossen. Theo und Eleni hatten je eines der Mädchen an der Hand. Vier Stücke Gepäck zwischen ihnen. Theo presste die rissige Ledertasche fest an sich, die über seiner Schulter hing.
Eleni beugte sich über das Gepäck. «Meinst du, alles wird gutgehen?»
Theo nickte. «Klar wird alles gutgehen.»
«Warum? War das falsch?»
«Das war richtig. Sogar richtig richtig.» Er lächelte Eleni an. «Und wir haben alle Papiere dabei, die wir brauchen. Mehr können wir nicht tun. Die haben uns vor dem Abflug überprüft. Das waren doch deutsche Zollbeamte in Athen.»
«Die haben aber ausgesehen, als würden sie arbeiten für die Lufthansa.»
«Die haben ausgesehen, als arbeiteten sie für die Lufthansa, klar. Aber die Gerüchte gehen ja schon seit langem um. Und wir haben wirklich alle Papiere. Und den Rest haben sie auf ihren Computern. Sonst hätten sie uns gar nicht erst an Bord gelassen.»
Der Bus hielt. Die Leute stiegen aus und drückten sich in das Labyrinth an Treppen und U-Turns. Theo, Eleni und die Kinder verließen den Bus als Letzte. Sie schlossen sich der menschlichen Schlange an und erreichten eine kleine Halle, die ganz in kahlem Weiß gehalten war. Vier Türöffnungen waren rot umrandet, je ein Pfeil wies die Leute hindurch. Gerade waren die Letzten, denen sie gefolgt waren, durch die Öffnungen verschwunden. Unter dem ersten Pfeil stand «Deutsche», daneben «Europäische Wirtschaft/European Economy», der dritte Pfeil zeigte auf das Logo «Andere/Others». Die Öffnung ganz rechts wirkte frischer, die Farbe dunkler. Der Pfeil zeigte auf einen Aufkleber, der sich an einer Ecke schon von der Wand gelöst hatte. «Verträge/Contracts» stand darauf.
Eleni zeigte auf die Tür ganz rechts und ging vor. Dann blieb sie kurz vor dem Durchgang stehen und blickte an Theo herab.
«Was ist, Mamá?», fragte Irini.
«Mechri na imaste sto leoforio, ute icho na kanete.» Sie zeigte auf die Kinder. «Kein Wort. Ist das klar?»
Beide Mädchen nickten, ohne einen Ton zu sagen. Theo ging vor und begann, die Papiere aus seiner Ledertasche hervorzuholen. Eleni schickte ihm die Mädchen hinterher und folgte ihnen dann. Sie stiegen eine Treppe hinab und dann noch eine. Die Luft wurde dicker, und Theo begann zu schwitzen.
Ein schmaler werdender Gang brachte sie zu einer kleinen Halle ohne Fenster. An einer Kopfseite stand ein leicht erhöhter Tresen. Zwei uniformierte Frauen und ein Mann saßen dahinter und betrachteten die Papiere einer Familie, die wahrscheinlich im selben Flieger wie sie gekommen war. Junger Typ, bärtig, modern, die Frau hinter ihm blickte zur Seite, nicht bescheiden und brav, sondern um Kontakt mit den Uniformen zu vermeiden. Theo meinte, ein Zittern in ihrem Leib zu sehen. Sie war aggressiv. Er kannte diesen Typ. Unter normalen Umständen hätte sie vielleicht die Verhandlungen geführt. Aber hier spielten sie ein Spiel. Traditionelle Familie. Man muss sie ja nicht gleich schon zu Beginn provozieren. Zwei Jungs über zehn und ein kleines Mädchen warteten hinter der Frau. Sie alle sagten keinen Ton. Sie hatten dieselbe Lektion gelernt wie Irini und Aliki.
Die fünfköpfige Familie vor ihnen wurde durch eine weitere Tür gewinkt. Dahinter sah Theo einen kahlen Raum und eine weitere Uniform. Er wusste, was dort geschehen würde. Mit einer Handbewegung schickte er Eleni, Irini und Aliki nach vorn zum Tresen und folgte ihnen. Eine der Frauen hielt die Hand ausgestreckt und sah ihn dabei an. Während sie die Mappe in Empfang nahm, schaute sie auf Eleni und die Mädchen und dann wieder auf Theo. Sie öffnete die Mappe mit zwei Händen und blickte hinein.
«Sie sind deutlich älter als Ihre Frau!» Die Uniformierte war um die dreißig und hatte schon tiefe Falten zwischen Mund und Nase. Sie rückte ihre Uniformmütze zurecht und nickte dem Mann neben sich zu.
«Sie wissen ja …», sagte Theo. «Wo die Liebe hinfällt.» Dabei lächelte er und zeigte seine Zähne.
«Der Vater der Kinder sind Sie nicht.»
«Ums Leben gekommen. Der Vater. Eine schreckliche Geschichte. Wir haben wilde Zeiten hinter uns in Griechenland. Aber das wissen Sie ja.»
«Ihr Beruf?»
«Ich bin Journalist», sagte Theo. «Radiojournalist», schob er nach.
Die Frau blätterte durch den Ordner. Die andere Frau, die neben ihr saß, starrte ihn ohne Ausdruck und Intelligenz an. Der Typ war mit seinen Gedanken offenbar ganz woanders. Die drei hatten nichts zu entscheiden. Das war längst gelaufen. Aber sie hatten die Lizenz zum Demütigen.
«Und gearbeitet haben Sie schon lange nicht mehr.»
«Die politischen Verhältnisse», sagte Theo. «Und es wurde ja überall gespart. Und es muss sich auch jemand um die Kinder kümmern.»
«Das machen Sie. Na ja … Im Radio kriegen Sie hier ja sowieso keinen Job.»
Theo nickte. Und schob dann noch ein tonloses «Ja» nach. Er ließ offen, ob sich seine Reaktion auf die Kinder oder auf die Arbeit beim Radio bezog.
«Sie sind in Köln geboren?»
«Athen. Aber als kleines Kind bin ich nach Köln gekommen.» Das stand alles in dem Ordner. Es gab keinen Grund, diese Fragen zu stellen. Das war seine zweite Einwanderung nach Deutschland. Alles ordentlich dokumentiert.
Sie blätterte weiter. «Konfessionslos», sagte sie ohne Betonung und nickte.
«Und Sie sind Medizinerin.» Die Uniformierte veränderte den Fokus nicht. Sie war mit den Gedanken längst bei einem späten Abendessen.
«Medizinerin», sagte Eleni. Typisch. Wenn sie Leute nicht mochte, wiederholte sie, was sie gesagt hatten.
«Und Sie haben jetzt hier diese Praxis …»
«Ich habe jetzt hier diese Praxis.»
«Das sind Irini und Aliki.»
«Das sind Irini und Aliki.»
Die Uniformierte nickte. Die andere Frau war abwesend. Der Mann guckte auf Elenis Brüste.
Die Uniformierte klappte den Ordner zu und wog ihn kurz in beiden Händen. Dann reichte sie ihn herab. Theo nahm ihn entgegen und steckte ihn zurück in die Ledertasche. Er blickte zum Tresen hinauf.
«Alles in Ordnung», sagte die Frau in der Uniform. «Sie können da durchgehen.»
3
Die Tische, die in der Raummitte zusammengeschoben waren, reichten nicht aus, um allen Platz zu bieten. Etwa zwanzig Leute saßen auf Stühlen oder Hockern und starrten diejenigen an, die noch drum herum standen. Marie blickte sich um. Menschen allen Alters waren in dem großen Wohnzimmer des alten Eckhauses versammelt. Mehr Erwachsene als Kinder, mehr Frauen als Männer, die Stimmung war ruhiger als am Vorabend. Die weiße Frau saß mit ihrem Säugling in einer Ecke und gab ihm die Brust. Der Säugling war nicht weiß. Seine gelbbraune Kopfhaut hob sich deutlich ab vom reflektierenden Hellweiß der Brust, die noch nie einen Sonnenstrahl abgekriegt hatte. Die Frau konzentrierte sich auf ihr Kind und blickte nur ab und zu kurz auf. Marie konnte die Panik in ihren Augen sehen.
«Wir müssen die Tische auseinanderstellen», sagte ein kleiner Mann, der sich mit beiden Händen an der Tischplatte festhielt. Er war vielleicht sechzig, weitgehend kahl. In seinem dunkelblauen, vielgetragenen Anzug sah er aus wie ein Bibliothekar, der seinen Job verloren hatte. «Dann haben alle Platz», sagte er.
«Nein.» Marie stand ebenfalls noch. Antoinette hielt ihre Hand, Kodjo war direkt neben ihrer Tochter. «Lasst uns eine große Runde bilden. So sehen wir uns alle und lernen uns kennen. Ich kann auch im Stehen essen. Was gibt’s überhaupt?»
Ein grauhaariger älterer Mann räusperte sich. «Also …», sagte er. «Kleine Ansprache. Da sind noch ein paar Vorräte im Keller. Dosen mit Gemüse, Fisch, Kartoffeln sind da und Äpfel, beides aus dem letzten Jahr. Auch Öl ist da. Mehl auch. Und Zwiebeln. In der Tiefkühltruhe ist Fleisch. Das hält mehr als ein paar Tage, wenn wir uns ein bisschen zurückhalten. Und gestern sind ja auch Sachen von den Paletten dazugekommen. Und gleich gibt’s hoffentlich auch was. Heute habe ich Kartoffelsalat gemacht. Einen riesigen Topf voll, mit Fisch aus der Dose. Vegetarier müssen den eben weglassen. Dann gibt es frisches Brot und Hummus aus weißen Bohnen, davon gibt’s im Keller eine ganze Palette. Hilft mir jemand beim Reintragen?»
Die ersten Momente des Essens verliefen schweigend. Marie hatte stehend einen guten Blick auf die ganze Gruppe. Die weiße Frau mit dem Säugling saß immer noch in der Ecke. Auf ihrem Schoß ein Teller, das Kind im Arm. Sie führte ihre Gabel zögerlich zum Mund und widmete sich dann wieder dem Kleinen. Dann war da die andere sehr junge Mutter mit einem sehr jungen Mädchen am Tisch. Die Kleinfamilie mit dem zehnjährigen Jungen, Pascal hieß er, das hatte sie gestern schon mitgekriegt. Der große Kahlköpfige mit dem Backenbart. Der Mann im Anzug. Ein sehr junger Mann in Jeans und weiter Jacke, Bart am Kinn, der so wütend aussah, wie nur junge Männer wütend aussehen konnten – nicht, dass er keinen Grund hatte. Marie stocherte in ihrem Salat und blickte zur Seite. Ihre Kinder waren ähnlich leidenschaftslos. «Esst», sagte sie zu ihnen. «Ihr müsst essen.» Dabei fragte sie sich, ob sie sich die Namen der Anwesenden merken würde. Wie lange würden sie hierbleiben müssen?
Die Mutter von Pascal begann, leise zu reden, mehr zu sich als zu den anderen. Sie war kaum zu verstehen. Die in ihrer Nähe saßen, schauten sie nicht einmal an. Marie wusste nicht, ob sie brabbelte oder nur zu leise sprach. Der Mann im Anzug blickte den Backenbart an, der sich an eine Wand gelehnt hatte. «Wie konnte das nur geschehen?», fragte er. «Warum haben wir das zugelassen?»
«Ich will eher wissen, wie wir hier wieder rauskommen», war die Antwort des Großen. Er legte die Gabel auf seinen noch halbvollen Teller und versuchte mit der freien Hand einen neuen Fleck vom weißen Hemd zu kratzen.
«Das ist das Ende», sagte die junge Frau mit dem Mädchen. Jetzt lauter. Sie zog die bunte Mütze tiefer, die einen großen Teil ihrer Frisur bedeckte.
Besteck klackerte laut auf einen Teller. «Ich will keine Albinos hier haben!» Das war der wütende junge Mann. «Sie sind an allem schuld.» Er blickte zu der weißen Frau.
«Ja.» Die junge Mutter nickte mehr in sich hinein als dem jungen Mann zu. «Ja, ja …»
Pascals Mutter schüttelte den Kopf. Sie hörte nicht auf, ihre Lippen zu bewegen. Was immer sie von sich gab, ging im ansteigenden Reden unter. Der junge Mann starrte auf den Tisch und hörte sich an, was er ausgelöst hatte. Er bebte.
Der Anzug hob die Hand und hatte sofort die Aufmerksamkeit aller. «Als Gruppe sind sie sicher schuld an vielem, vielleicht sogar an allem. Auf jeden Fall sind sie schuld an der Situation, in der wir sind.» Er redete leise und zwang die Gruppe, richtig hinzuhören. Er machte so etwas nicht zum ersten Mal. Beim Reden strich er über seinen Haarkranz, ganz so, als könne er das Haar zurückbringen auf die kahle Platte. «Aber wir wollen doch nicht die Fehler begehen, mit denen sie sich schuldig gemacht haben. An uns», er machte eine Pause und sah in die Runde, «und auch an anderen …» Dann stand er auf und ging zu der weißen Frau, die immer noch schweigend in der Ecke saß. Er reichte ihr die Hand. «Kommen Sie. Ich bin Rudy.» Dann nahm er den Teller von ihrem Schoß, geleitete sie zum Tisch und bot ihr seinen Platz an. Als sie sich mit dem Kind hingesetzt hatte, nahm er seinen eigenen Teller in die Hand und stellte sich zu Marie und den Kindern.
Der junge Kerl sah die Weiße voller Hass an. Sie saß drei Plätze neben ihm.
Der Backenbart brach die neue Stille. «Ich hab mich heute umgehört. Im ganzen Gebiet funktioniert kein einziges Telefon, kein Tablet, nichts, man kann gar nicht online gehen. Wir sind ausgeschaltet worden. Ich weiß nicht, ob schon irgendwer das ganze Gebiet innerhalb des Zauns abgegangen ist, aber ich gehe davon aus, dass sie uns von der Außenwelt einfach abgeschnitten haben. Gott sei Dank gibt es überall Wasser und Strom.»
«Scheiß Albinos.» Der Wütende sprang auf und hieb auf den Tisch. Sein Stuhl kippte nach hinten, und gleichzeitig fiel sein Wasserglas um. Er rannte aus dem Raum. Das Wasser zog seine Spur auf dem Holztisch und lief an der anderen Seite auf den Boden.
Die weiße Frau begann, den Rotz in der Nase hochzuziehen. Marie dachte an die weißen Mütter, die ihre Kinder umgebracht hatten, um der Deportation zu entgehen.
Rudy legte ihr eine Hand auf die Schulter. «Er hat recht. Wir müssen das Gelände erkunden, in dem wir gefangen sind. Und wir müssen so etwas wie Kommunikation herstellen. Das ist ja schon schwer genug in unserem Haus. Gott, hat irgendwer eine Vorstellung, wie viele von uns hier überhaupt eingesperrt sind?»
«Tausend?», sagte eine Stimme neben Marie, und sie war überrascht, dass sich Antoinette in der Runde zu Wort meldete.
Rudy schüttelte den Kopf. Er blickte Antoinette an und sagte: «Ich glaube, wir sind viel mehr.» Er schwieg kurz und sagte dann: «Ich glaube, wir sind eher zehnmal so viel.»
4
Ein junger Mann wartete direkt hinter der nächsten Tür auf sie. Er zeigte mit einer Hand auf eine Sitzgruppe aus zwei Sofas und zwei Sesseln. Da sollten sie warten. Eleni half Aliki, die müde wirkte, auf eines der Sofas und setzte sich neben sie. Irini drängte sich auch neben ihre Mutter, also setzte sich Theo auf einen der beiden Sessel.
Der Uniformierte war noch ein Junge. Er blickte über sie hinweg auf die Flügeltür, hinter die sie gleich gerufen würden. «Signal» stand darauf.
«Bist du verrückt?», hatten sie ihn gefragt. «Deutschland?» Die Köpfe hatten sie geschüttelt.
Und Yorgos: «Ausgerechnet Deutschland?» Er hatte auf den Tisch gestarrt. Keinen Ton mehr gesagt.
Yorgos. Sein bester Freund. Seit über dreißig Jahren.
«Wenn ihr ausgerechnet in Griechenland bleiben wollt …» Theo hatte versucht, sachlich zu bleiben. Das Land hatte doch ein paarmal kurz vor einem Bürgerkrieg gestanden. Und sie hatten sich alle die Hände schmutzig gemacht. Die Militärs hatten nicht nur mit einem Putsch gedroht, als die Bank in Thessaloniki gestürmt worden war. Sie hatten auch begonnen, Leute auszuschalten. Es war schlimmer als ein Putsch gewesen. Jetzt war es mehr oder weniger vorbei. Und mit dem Ende der EU und den neuen politischen Bündnissen war etwas Ruhe gekommen. Vorläufig. Aber was geschehen war, war geschehen.
Theo blickte instinktiv auf seine Hände. Niemand hatte ihn je erwischt. «Wenn ihr ausgerechnet in Griechenland bleiben wollt …» Das hatte die Diskussion beendet. Aber obwohl alle wussten, dass die Frist für die Anträge auf Arbeitsverträge in Deutschland bald auslief, hatten sich nur Theo und Eleni beworben.
Eigentlich hatte sich Eleni beworben. Sie war die, die arbeitete.
Der Junge in Uniform starrte immer noch auf die Tür. Er hatte blondes Haar und blaue Augen, sah aus wie ein deutsches Klischee. Selbst das Kinn war markant, wenn auch noch verdeckt vom Babyspeck. Er stand ganz still da, rührte sich nicht. Aber plötzlich ging ein Zucken durch ihn. Der Blick veränderte sich, ohne dass er die Augen bewegte. Er sagte kurz: «Verstanden!» Dann machte er einen Schritt auf sie zu. «Kommen Sie bitte mit.»
Er öffnete die Flügeltür und wies sie hindurch. Eleni trug die schlafende Aliki auf dem Arm, Irini trottete hinterher. Der Raum, der sich öffnete, sah aus wie ein großes Behandlungszimmer. Zwei uniformierte Frauen standen am Rand und sahen ins Nichts. Ein Mann mit grau meliertem Bart kam auf sie zu. Er führte eine Gruppe von fünf Leuten an, die in ihren weißen Kitteln aussahen wie Ärzte. Theo wusste es besser.
«Willkommen», sagte der Graumelierte. Er trug Sneakers und eine Anzughose unter dem Kittel und zeigte auf die Liegen, die an einem Ende des Raumes standen. «Am besten, Sie legen sich einfach hin. Dann geht das alles ganz schnell.»
Eleni legte Aliki auf die erste Liege. «Machen Sie den rechten Unterschenkel frei», sagte eine Frau im Kittel, als Aliki schon lag, ohne aufgewacht zu sein. «Sie können sich dann auch alle hinlegen. Hier passiert ja nichts Gefährliches.» Sie nickte Eleni noch einmal eindringlich zu, als die zögerte. Theo half Irini auf die nächste Liege und zog ihr den rechten Schuh aus. Er krempelte die Jeans bis knapp unter das Knie hoch und lächelte das Mädchen an. Irini guckte verwirrt, sagte aber keinen Ton. Dann ließ Theo eine Liege aus und legte sich auf die vierte, um Eleni die zu überlassen, die am nächsten zu den Kindern stand.
Einer der Kittel, ein junger Mann mit schütterem, farblosem Haar, setzte sich hinter einen festinstallierten Rechner und tippte auf einer Tastatur herum. Dann sagte er: «Alles klar!»
Zwei Männer und eine Frau kamen mit kleinen Päckchen in den Händen auf sie zu. Der Graumelierte kam zu Theo. Er hatte den Ring schon in der Hand, als er die Liege erreichte. «Sie haben ja alles darüber gelesen und gehört. Und haben ja durch Ihre Einreise auch schon dokumentiert, dass Sie damit einverstanden sind. Nur noch mal in der Kurzfassung: Sie tragen den Ring alle ein Jahr lang zur Bewährung. Wir können alle Ihre Bewegungen sehen, auch live, wenn uns danach ist. Sollte jemand von Ihnen versuchen, den Ring zu zerstören oder zu manipulieren, wird Ihre Familie umgehend wieder ausgewiesen. Das gilt auch für die Kinder. Aber es ist nicht einfach, die Dinger kaputt zu kriegen. Und man kann damit ja sogar schwimmen gehen.» Das Ding rastete oberhalb von Theos Knöchel ein. Der Graumelierte schaute hinüber zu dem Mann am Rechner. Der tippte wieder herum, bis nacheinander vier hohe Töne aus den Fußringen ertönten. Theos Ring piepte als letzter.
«Alles klar», sagte der Graumelierte. «Willkommen in Deutschland.»
5
«Es ist kalt für Mai.» Marie drehte sich einmal um die eigene Achse. Eine Stadt ohne Autos. Das Bild irritierte sie auch am dritten Tag noch. Sie umarmte Antoinette, die in T-Shirt und roter Jacke fror. Sie strich ihrer Tochter über den Kopf und entwirrte zwei der neben dem Ohr hängenden kleinen Zöpfe. Ein erster Sonnenstrahl fiel auf das Haus.
Rudy und der Backenbart standen nebeneinander und schwiegen sich an. Der Junge, der gestern so wütend gewesen war, kam aus der Haustür. Hinter ihm erschien Kodjo. «Ich komme doch mit», sagte er. Er hatte sein Telefon in der Hand. «Das funktioniert immer noch nicht.»
Backenbart blickte in Richtung Haustür, die wieder zugefallen war. «Wenn wir alle sind … Wir hätten uns gestern schon vorstellen sollen. Ich bin George.» Er zog den Reißverschluss seines Parkas zu. Marie meinte jetzt, einen amerikanischen Akzent in seiner Stimme zu hören.
«Ich bin Rudy», sagte der Anzug und sah die anderen an.
Marie zögerte kurz. «Marie», sagte sie. Dann zeigte sie auf ihre Kinder. «Antoinette, Kodjo. Wir sind aus Kreuzberg.»
«Das sagst du nicht mehr lange so. Gerade sind wir von nirgendwo.» Der junge Wütende trug ein enges T-Shirt über seinem muskulösen Oberkörper. Über dem blauen Grund waren die Konturen von Angela Davis’ Kopf zu sehen, das berühmte Foto aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Seine Hände hatte er fast bis zu den Ellbogen in den Hosentaschen.
«Und?» Rudy hatte die Hände auf den Hüften. «Einen Namen wirst du doch haben.»
«Derek», sagte der Junge.
«Jetzt interessiert es mich aber doch», sagte Marie. «Woher kommt ihr eigentlich?»
«Schöneberg», sagte Rudy.
«Schwerin.» George fingerte an seinem Telefon herum und schüttelte den Kopf. «Ich hab da für die SPD gearbeitet. Für die Fraktion.»
Derek verdrehte die Augen.
«Als was?», fragte Marie.
«Politische Kommunikation. Bin nicht mal Parteimitglied», sagte George.
«Sollen wir gehen?» Marie wandte sich um. «Wo haben wir gestern aufgehört?»
Die Haustür ging auf. Pascals Mutter erschien im Anorak. Sie hatte Lippenstift und ein wenig Rouge aufgelegt. Auf dem Kopf trug sie eine weite Mütze. In einer Hand hielt sie eine Zigarette.
«Du hast noch eine?», fragte Marie.
«Hier, zieh einfach.» Sie reichte Marie die Kippe. «Ich bin Justine. Was machen wir?»
«Wir haben gestern angefangen, den Zaun abzugehen», sagte Rudy. «Rund um die Stadt oder wo das halt endet …»
«Mit Strom obendrauf», sagte Kodjo. Er schloss seine schwarze Kapuzenjacke bis zum Hals und zog die Jeans höher.
Marie sah eine kleine Kakerlake am Bordstein entlangkrabbeln. Derek sah sie auch. Er machte einen Ausfallschritt und zertrat sie.
Rudy nickte. «Und wir wollen sehen, wie lang er ist und wo er verläuft und ob sie vielleicht vergessen haben, ihn zu vollenden. Und … na ja … weil wir da wenig Hoffnung haben, wollen wir wenigstens herauskriegen, wie groß unser …», er dachte eine Sekunde nach, «wie groß unser Lager ist.»
«Und wir wissen immer noch nicht, wo genau wir hier eigentlich sind.» George ging ein paar Schritte ohne die anderen. «Dahinten irgendwo ist ein kleiner Flughafen hinter dem Zaun. Habt ihr den gestern auch gesehen?»
«Viel weiter sind wir nicht gekommen. Lasst uns einfach da weitermachen.» Marie schloss zu George auf. «Kommt», sagte sie mehr zu ihren Kindern als zum Rest der Gruppe.
«Und dahinten», Derek zeigte in die andere Richtung, alle blieben wieder stehen. «Da ist ein Bahnhof. Aber alle Schilder sind abmontiert. Der Bahnhof ist drinnen, also innerhalb vom Zaun, und die Gleise sind draußen. Und hinter den Gleisen geht die Stadt weiter. Das hab ich mir gestern angesehen.» Während er redete, zog er die Hände aus den Hosentaschen und gestikulierte ungelenk. Als er fertig war, versteckte er sie wieder. Marie lächelte ihn an. Derek erwiderte das Lächeln nicht, sondern schaute auf den Boden.
«Dann lasst uns zum Flughafen gehen.» Rudy war schon ein paar Meter voraus. Aus den ersten Häusern kamen Leute, angelockt von der Helligkeit oder was auch immer. Sie waren überrascht von der Gruppe, die schon unterwegs war.
Eine junge Frau in weißem T-Shirt und roten Shorts stand mit einer Tasse Kaffee oder Tee vor einem Mehrfamilienhaus. «Wohin geht’s?», fragte sie. George zeigte in die Richtung, in die sie gingen. Die Frau stellte die Tasse ab und schloss sich ihnen an. Zwei Jungs um die fünfzehn, ein bisschen jünger als Kodjo, die auf den Stufen eines anderen Mehrfamilienhauses saßen, standen auf und schlurften ihnen wortlos hinterher.
«Dahinten ist der Flughafen.» George zeigte geradeaus. Der Zaun war zwei Meter hoch, vielleicht etwas mehr. Antoinette legte an Tempo zu und ging an der Spitze der Gruppe. «Fass den Zaun nicht an», rief ihr Marie hinterher. Vielleicht lief Strom durch die Drähte. Kodjo legte einen Sprint ein und erreichte Antoinette. Er legte seiner Schwester einen Arm um die Schultern. Kodjo war siebzehn, Antoinette dreizehn, das war manchmal ein großer Unterschied. Die beiden erreichten den Zaun gemeinsam und blieben stehen. Marie sah, wie Antoinette ihre Arme um Kodjo schlang. Auch aus der Entfernung konnte sie ihr Schluchzen hören. Sie ließ George, der neben ihr ging, hinter sich und lief auf ihre Kinder zu. Dann nahm sie beide zugleich in ihre Arme.
«Warum tun die das, Mama?» Antoinette löste sich zuerst von Kodjo und duckte sich dann unter Marie weg.
«Weil sie es können, Schatz.» Marie wusste, dass das nicht die Antwort war, die ihre Tochter hören wollte. Aber sie wollte versuchen, ehrlich zu sein. «Es gibt Leute, die haben lange darauf gewartet.»
Antoinette machte ein Gesicht, das wütender war als das von Derek am Abend zuvor. Marie gefiel das. Eine gute Haltung, Wut, prinzipiell. Sie ging zum Zaun und blickte auf die andere Seite. Der winzige Flughafen lag verlassen da, aber vor dem kleinen Gebäude am Rande standen grau Uniformierte mit Maschinenpistolen. Sie hatten schwere Helme auf den Köpfen. Ihre Gesichter waren hinter dunklen Blenden versteckt.
Marie drehte den Kopf. Ein weiteres Grüppchen, ähnlich ausgestattet, stand hundert Meter weiter zur Rechten, ein anderes in die andere Richtung. Da war also der Zaun. Und da waren die Soldaten.
«Guckt euch das mal genauer an», sagte Rudy. Er zeigte auf die Krone des Zauns. Blinkende Lichter alle paar Meter. «Die haben den wirklich unter Strom gesetzt.»
«Die Schweine, sie wollen uns alle umlegen.» Derek wartete auf Zustimmung. Er erhielt keine.
Die Frau in den roten Shorts schüttelte den Kopf. «Hätten sie ja schon längst tun können, wenn sie das wollten.»
«Derek hat trotzdem recht.» George zeigte auf die Uniformierten am Flughafengebäude. «Die werden uns töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Und selbst wenn es ihnen einfach nur egal ist, ob wir leben oder tot sind, dann ist das schon sehr nah am Vorsatz.»
«Hast du das verstanden, Mama?» Antoinette griff Maries Arm.
«Was George gesagt hat?»
«Hmhm …»
«Ich glaube schon.» Marie nahm ihre Tochter wieder in den Arm. «Er hat gemeint, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Dass wir sehr auf uns aufpassen müssen.» Noch bevor sie zu Ende geredet hatte, hörte sie Rudys Stimme: «Wir gehen einfach weiter am Zaun entlang.»
Durch ein Waldstück war eine Schneise geschlagen. Zu beiden Seiten des Zauns lagen vielleicht zehn Meter gerodete Freifläche. Als sie den Wald betraten, wurde es sofort kühler.
«Wenn wir gutes Werkzeug finden, können wir hier raus.» Die Frau in den Shorts zeigte auf den Wald hinter dem Zaun. «Und uns dann dort verstecken. Der Strom … der ist nur da oben.»
Einer von den beiden Jungs, die sich der Gruppe zuletzt angeschlossen hatten, zeigte ebenfalls in den Wald. Er schüttelte den Kopf. Marie folgte dem Finger in den Wald hinter dem Zaun und sah, was der Junge seinem Kumpel zeigte. Hinter den ersten Baumreihen war ein matter Widerschein auf den Sichtblenden einiger Soldaten zu sehen. Dort waren sie also auch.
«Kommt», sagte George. «Lasst uns weitergehen.»
«Wissen wir mittlerweile eigentlich, wie das Kaff heißt?» Derek stand immer noch am Zaun und sah in den Wald auf der anderen Seite.
«Alle Straßenschilder sind abmontiert», sagte Justine.
«Nicht nur die Straßenschilder», sagte Marie. «Es gibt keinen einzigen Hinweis. Alles ist weg. Es gibt nichts mehr hier. Aber irgendwer muss das doch erkennen. Irgendwer wird doch schon einmal hier gewesen sein.»
Der kleine Wald endete und machte bebauten und nicht bebauten Feldern Platz. Sie erstreckten sich bis zum Horizont, einige davon innerhalb des Zauns.
«Wie ist das gemeint?», fragte Rudy und zeigte in Richtung Stadt. «Sollen wir hier sesshaft werden? Und uns hier niederlassen?»
«Ackerbau und Viehzucht.» George nickte. «Ich sage euch eins: Sie wissen selbst nicht, wie lange sie uns hierbehalten wollen.»
«Ich seh hier nirgendwo Vieh.» Justine blickte hinter den Zaun. «Wollen die uns verarschen? Sollen wir hier zusehen, wie Gemüse wächst?» Alle hörten ihre Frage, aber niemand antwortete.
Die Gruppe ging schweigend am Zaun entlang, bis sie an eine rechtwinklige Ecke kam. «Warum ist der Teil Acker hier innerhalb des Zauns?» Marie zeigte auf einen Flecken, auf dem junger Mais wuchs, und der Rest draußen. Auch sie erhielt keine Antwort. Kodjo machte ein paar Schritte auf sie zu und nahm sie an der Hand.
Langsam kamen sie wieder in bebautes Gebiet. Leute standen auf der Straße und debattierten. George, der mittlerweile voranging, blieb stehen und blickte sich um. Kleine Einfamilienhäuser und enge Straßen. Marie fiel wieder auf, wie sehr es sie irritierte, dass keine Autos unterwegs waren. Sie hatten sie in einer richtigen kleinen Stadt untergebracht, aber so vieles weggeschafft, was im Alltag wichtig war. Die ganze Beschilderung war weg. Und klar, die ganzen Leute, die bis vor kurzem noch hier gewohnt hatten.
«Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich lachen», sagte Rudy. «Wir sind mitten in Deutschland. In einer schwarzen Stadt.»
«Wo mögen die ganzen Weißen denn sein?» Die Frau mit den Shorts hatte aufgeschlossen.
«Was mich viel mehr interessiert, ist, wo die anderen sind», sagte Derek.
«Die anderen sind jetzt hier.» Rudy wirkte beinah heiter.
«Den Weißen geht es sicher nicht schlechter als vorher», erwiderte Derek. «Guckt euch das hier doch mal an. Das ist doch der Osten. Wer will denn hier überhaupt leben?»
«Osten ist es auf jeden Fall.» George zeigte auf die Häuser. «So viel alte Bausubstanz. So was gibt es im Westen nicht mehr. Und darunter sind viele renovierte Häuser. Rund um den Markt ist sowieso alles gut in Schuss. Unser Haus ist ziemlich gut erhalten.»
Die Gruppe stand zusammen. Marie und Antoinette und Kodjo. Rudy und George. Die beiden Jungs. Derek und die Frau in den Shorts. Justine zog den Anorak aus und legte ihn über den Arm. Es wurde langsam warm.
Ein Mann um die vierzig kam mit eiligen Schritten auf die Gruppe zugelaufen. Er trug Hemd, Shorts und Sandalen, die locker an den Füßen schlappten. «Die Ärztin», sagte er und sah Marie direkt ins Gesicht.
Marie nickte ihm zu.
«Mein Sohn», sagte er. «Sie müssen kommen.»
«Was hat er denn?»
«Fieber.»
«Wie alt?»
«Sieben.»
«Hustet er?»
Der Mann schüttelte den Kopf.
«Lebensmittelvergiftung?»
«Dann wäre er der Einzige in der Familie.»
«Wo sind Sie denn?»
Der Mann zeigte Marie den Weg. «Dahinten rechts und das zweite Haus. Plattenbau.»
«Ich komme gleich mal vorbei.»
«Fragen Sie nach Barthelemy», sagte er. «Aber Sie kommen wirklich, ja?» Als sie nickte, ging er davon.
Andere Leute kamen hinzu. Eine Gruppe wirkte attraktiv unter diesen Umständen. Irgendwer in einer Gruppe wusste immer ein bisschen mehr, als man selbst schon erfahren hatte. Bald waren sie umringt von Jungen und Alten, Männern und Frauen. Sie kamen redend und wurden umso leiser, je näher sie der Gruppe kamen.
Als die Gruppe auf mehrere Dutzend angewachsen war, fragte Marie laut: «Weiß jemand, wo wir hier sind?»
«Finsterwalde.» Eine Männerstimme.
«Wie heißt das?», fragte Rudy.
«Finsterwalde.» Die Männerstimme wiederholte den Namen.
«Und wo liegt das noch mal?», wollte Marie wissen.
«Im Osten.» Eine Frauenstimme.
«Aber wo da?», fragte Marie.
«Weit im Osten.» Die Frauenstimme wieder. «Fast in Polen.»
«Und woher weißt du das?» Marie sah immer mehr Leute zusammenkommen. «Dass das Finsterwalde ist.»
«Mein Bruder war hier.» Marie konnte die Frau jetzt sehen. Sie hatte glattes Haar, das ihr bis auf die Schultern reichte. Blaue Bluse, schwarze Jeans, sie hielt ein Telefon in der Hand.
«Mein Mann und ich …» Sie zeigte auf den, der den Namen des Städtchens zuerst erwähnt hatte. «Wir waren hier, um meinen Bruder im Flüchtlingsheim zu besuchen.»
«Wo ist dein Bruder heute?» Marie.
«Wir wissen es nicht.»
«Deportiert?»
«Ein paar Tage bevor wir verhaftet worden sind.»
«Wohin?»
«Kamerun … glauben wir.» Die Frau blickte zu ihrem Gatten. «Aber wir wissen ja immer noch nicht, wer die Leute alle aufgenommen hat.»
Alle begannen, gleichzeitig zu reden. Gerüchte hatte es gegeben, dass die neue Regierung Guineas gegen Zahlung einer hohen Summe viele Leute aufnehmen wollte. Aber auch andere Länder waren genannt worden, als es um das Geld ging, das verschiedene europäische Länder bereit waren zu verteilen.
«Burkina Faso», sagte einer.
«Nie im Leben», hörte Marie die Entgegnung einer Frau.
«Niger …» – «Centrafrique …» – «Tschad …»
Rudy hob die Hände. «Könnt ihr mal ruhig sein?»
Das Gebrabbel ebbte langsam ab. Einer redete noch ein paar Sekunden über ein Gerücht, das er über die Flugzeuge gehört hatte. Sie seien in Richtung Sudan unterwegs.
«Wenn ihr mal ein paar Sekunden zuhört …» Rudy wirkte wie ein Politiker. «Hört mir zu», sagte er. Und die Leute hörten zu.
«Wir sind alle nicht freiwillig hier.» Es gab zustimmendes Gemurmel. Derek wandte sich ab. Ein lautes «Fuck!» kam aus seinem Mund.
«Wir sind jetzt zwei Tage hier. Nicht einmal zwei Tage …», fuhr Rudy fort. «Und wir wissen nicht, was sie mit uns vorhaben. Aber egal, was es ist, wir sind hier in einer …» Er suchte nach einem Wort. «Wir sind in einer beschissenen Situation. Und wir müssen uns organisieren.»
Laute Zustimmung. Immer mehr Leute kamen hinzu. Viele rannten, um die Versammlung zu sehen und Teil von ihr zu sein. Rudy redete darüber, dass nur gemeinsames Handeln eine Basis für Überleben böte. Und er schlug vor, Gruppen zu bilden, die für eine Versammlung am Nachmittag werben sollten. Sie sollten durch die Straßen der Stadt gehen und alle einladen, eine Person pro Straße. Die Leute hörten Rudy zu. Marie war fasziniert.
Am Ende sagte er: «Ich kenne die Stadt nicht. Und wir wissen alle nicht, wie viele von uns hier sind. Vielleicht sind wir zu viele, wenn wir uns treffen, oder viel zu wenige. Aber lasst es uns probieren.» Am Ende gab es lautstarken Zuspruch, einige applaudierten sogar.
6
Die Bustür schloss sich hinter Theo. Ganz vorn saß die Familie, die vor ihnen an der Kontrolle gestanden hatte, die drei Kinder auf zwei Sitze gequetscht. Eleni wies Irini und Aliki in einen Doppelsitz ein paar Reihen hinter ihnen und setzte sich selbst auf die andere Seite des Gangs. Der Rest des Busses war leer, bis auf ein Ehepaar in der allerletzten Reihe.
Theo konnte sehen, dass die Frau, die dort saß, wo der Gang endete, ein kleines Kind auf dem Schoß schaukelte. Die große Welle der Vertragsabschlüsse war vorüber. Vielleicht war der Bus deshalb so leer. Oder es war die Zeit um Mitternacht, wo nicht mehr ganz so viele Flüge in Berlin ankamen. Oder Zufall. Oder auch keiner. Er setzte sich hinter Eleni und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
Der Fahrer nahm einen Weg, den er nicht kannte. Hier ging es nicht in die Stadt hinein. Landstraßen, sie überquerten einen Fluss oder Kanal, fuhren durch ein Dorf und noch eins. Dann hielten sie. Die Leute aus der letzten Reihe stiegen hinten aus.
Langsam schaffte der Bus dann den Weg in die Stadt. Niemand sagte ein Wort. Irini und Aliki schliefen, die Kinder des anderen Paares starrten geradeaus durch die Windschutzscheibe. Ganz sicher hatten auch ihnen die Eltern eingetrichtert, die Klappe zu halten. Erst auf der Sonnenallee fand sich Theo wieder zurecht. Es konnte nicht mehr lange dauern bis zu ihrem neuen Zuhause.
Die Straße war ruhig, anders als er sie kannte aus seiner Berliner Zeit. Dabei war es erst kurz nach Mitternacht. Ein paar Leute gingen ihrer Wege. Taxis waren auf der Straße unterwegs. Theo sah verbarrikadierte Läden, hier sogar gleich mehrere hintereinander. Die Lichtreklame eines arabischen Restaurants war eingeschlagen. Auf den Holzplanken, die über die Ladenfront gezogen worden waren, prangte dieses geschwungene D, das Zeichen der Partei, die vor zwei Jahren die Wahlen gewonnen hatte.
Natürlich hatte sich die Stadt verändert in den letzten Jahren. Freunde hatten Theo gesagt, dass gerade die südlichen Viertel ruhig geworden waren. Von hier waren die meisten Menschen deportiert worden. Und gleich mussten sie den Hermannplatz erreichen. Ob man dort noch die Einschusslöcher sah? Die Regierung hatte damals gesagt, dass zwölf Terroristen bei den Auseinandersetzungen getötet worden seien. Unter der Hand aber kursierten weitaus höhere Zahlen. Gegen die Abschiebungen und Deportationen jedenfalls hatten die Demonstrationen nichts ausrichten können. Direkt im Anschluss hatten sie begonnen.
Mehr als zwanzig Jahre war es her, dachte Theo, aber den Hermannplatz erkannte er noch. Auf der freien Fläche war nicht viel los. In der Mitte stand ein Grüppchen mit Bierflaschen in der Hand. Vielleicht waren es dieselben Leute, die er damals schon dort gesehen hatte. Als der Fahrer an der Kottbusser Brücke anhielt, atmete Theo kurz durch. Das war ihr neues Leben. Kein Traum, vielleicht nicht einmal eine bessere Existenz als jene, die sie in Griechenland geführt hatten. Aber selbst der Wechsel von – wie sagten sie hier – von der Cholera zur Pest war immer noch besser als die Angst zu Hause. Eleni hob Aliki vom Sitz, Theo nahm Irini auf den Arm. Als er den Bus verließ, nickte er der anderen Familie zu. Die beiden Erwachsenen nickten zurück. Vielleicht sah man sich ja noch einmal. Dann hätten sie sich bestimmt eine Menge zu erzählen. Der Busfahrer wartete schon an der Gepäckklappe.
Nach und nach trugen sie die Taschen und Koffer zur Haustür. Als Theo an der Fassade hochblickte, braun ganz unten, wo die Geschäfte waren, beige oder weiß darüber, bemerkte er, wie aus der Haustür eine schmale Gestalt angeschlichen kam. «Sie müssen die Familie Tsiolis sein.» Er reichte Theo die Hand und nickte Eleni zu, die die Mädchen, die jetzt wach waren, zur Haustür trieb und drei Gepäckstücke gleichzeitig zu tragen versuchte. «Ich bin Ihr Vermittler.» Der Mann trug einen grauen Anzug und eine Fliege über dem weißen Hemd. Über der Schulter hing eine Tasche an einem Gurt. Sein Haarkranz umrahmte einen kahlen Schädel, der im Licht der Straßenlaterne leuchtete. «Kommen Sie», sagte er und griff nach einem der großen Koffer. «Es ist ja schon so spät.»
Er war als Erster im zweiten Stock und schloss die Wohnung auf. «Sehen Sie», sagte er und zeigte in die Wohnung, «alles ist sauber. Wir haben alles so gelassen, wie es war. Das hatten Sie so beantragt. Also ist alles da, von der Kaffeekanne bis zum Toilettenpapier. Nur das Persönliche haben wir mitgenommen, als wir die Wohnung gereinigt haben. Und da hatten wir ganz schön zu tun. Haha …», der Mann hustete kurz und ging in die Wohnung. «Mit dem Saubermachen, meine ich. Sie können also einfach loslegen, so wie es vereinbart ist. Hier …» Er griff ins Jackett und holte eine Visitenkarte heraus. «Hier sind meine Telefonnummern. Und hier …», er griff in die andere Tasche des Anzugs und zog eine Broschüre hervor, «und hier haben Sie alles, was Sie für den Anfang wissen müssen. Sie arbeiten ja gar nicht.» Er sah Theo in die Augen, drehte sich dann zu Eleni, die die beiden Mädchen gerade in ein Zimmer scheuchte, das vom Wohnungsflur abging. «Und Sie übernehmen diese Praxis, nicht wahr?»
Eleni drehte sich in der Tür um und legte den Finger auf die Lippen.
«Jaja», der Mann hob beschwichtigend die Arme. «Ich dachte nur, Sie wollten das so schnell wie möglich hinter sich bringen. Schon wegen den Kindern.»
Eleni kam wieder aus dem Zimmer und schloss die Tür leise hinter sich. Sie nickte. «Ja, das wollen wir», sagte sie. «Mamá», rief Irini aus dem Schlafzimmer. Eleni schaute noch einmal in den Raum und sagte: «Leg dich ins Bett. Ich komme gleich noch einmal.»
Dann schloss sie die Tür wieder und blickte den Mann an. Auf seiner Karte stand: Lukas Reiter, städtischer Vermittler, Berlin. «Entschuldigen Sie», sagte Eleni.
«Kein Problem.» Aus seiner Umhängetasche holte er einen dünnen Rechner. «Wir müssen die Registrierung jetzt vornehmen.» Er wischte über den Bildschirm, der zum Leben erwachte. Dann tippte er einen Code ein und wartete zwei Sekunden. «Also», sagte er. «Sie sind Eleni Tsiolis?»
Eleni nickte. «Ja, das bin ich», sagte sie gleichzeitig. Dabei betonte sie das Ich so stark, als würde sie sich sonst verlieren.
«Lassen Sie mich schauen. Geburtsdatum ist hier, Mädchenname, verheiratet, verwitwet», Reiter schaute auf, Eleni nickte, «die beiden Kinder sind hier eingetragen», machte er weiter, «als Ärztin in Athen gearbeitet, ja, das ist hier, also … ich glaube, wir haben alles. Wenn Sie also Ihre Hand kurz hier drauflegen würden. Die rechte.» Er hielt den Bildschirm wie einen Schild vor sich. Darauf tauchte eine stilisierte Hand auf. «Einfach drauflegen», sagte er.
Eleni justierte ihre Hand, legte sie kurz auf den Bildschirm und zog sie wieder zurück. Der Rechner gab einen quäkenden Laut von sich.
Reiter schüttelte den Kopf. «Nein, nein, nein. Das war zu kurz. Warten Sie.» Er tippte wieder irgendetwas ein und hielt den Bildschirm erneut in Richtung Eleni. «Legen Sie die Hand noch einmal darauf und dann warten Sie, bis ich Ihnen sage, dass Sie sie wieder runternehmen können.»
Eleni legte die Hand auf den Bildschirm und wartete.
Reiter wirkte, als zählte er schweigend irgendetwas ab. «So, das sollte reichen.»
Eleni nahm die Hand wieder zurück. Der Rechner plingte kurz.
Reiter blickte auf den Bildschirm. «Alles in Ordnung dieses Mal. Und dann …» Er zeigte auf die Schlafzimmertür. «Wir brauchen die Kinder auch. So ist das System.»
Eleni schaute kurz zu Boden, dann wieder auf, nickte dem Vermittler zu und öffnete leise die Tür. «Vielleicht können wir sie ja schlafen lassen.»
Reiter folgte Eleni ins Schlafzimmer. Theo stellte sich in den Türrahmen.
«Da ist Irini. Das ist die Ältere, ja?», sagte der Vermittler. Er tippte wieder auf dem Bildschirm herum.
«Ja.» Elenis Stimme war gedämpft. «Kommen Sie.» Sie nahm die Hand ihrer älteren Tochter, die mittlerweile schlief, und legte sie auf den Bildschirm. Es dauerte ein paar Sekunden bis zum Pling. Dann wiederholten die beiden die Prozedur mit Alikis Hand. Als Eleni die Tür des Schlafzimmers wieder von außen schloss, tippte Reiter schon wieder.
«Und Sie sind also Theódoros Tsiolis. Lassen Sie mich schauen. Hier … Geburtsdatum, ja, ach ja, Sie haben in Köln gelebt, und in Berlin, und, ach ja, das ist Ihre erste Ehe. Wow, mit … dreiundsechzig Jahren.» Er schaute Theo an, der keine Miene verzog. «Nun, das ist schließlich Ihre Privatsache. Ihre Hand also gleich … Warten Sie.» Er tippte wieder, hielt den Bildschirm in Theos Richtung und sagte: «Bitte!»
Theo drückte so fest auf den Bildschirm, dass Reiter ein paar Zentimeter nach hinten zurückweichen musste. Dabei sahen sich die beiden Männer kurz in die Augen.
«Gut», sagte Reiter dann, als es plingte. «Das wird sicher reichen.» Er steckte den Rechner weg, ohne das Ergebnis zu überprüfen. Dann kramte er wieder in der Jacke. «Sehen Sie, hier sind die Schlüssel zu Ihrer neuen Wohnung.» Er reichte Eleni einen Schlüsselbund. «Tun Sie einfach so, als seien Sie hier zu Hause.» Er wartete, ob Eleni zu lachen begann. Als sie es nicht tat, redete er weiter. «Hier», er reichte ihr einen weiteren Ring, «sind die Schlüssel für die Praxis. Schauen Sie sich einfach dort um. Sie werden alles finden, was Sie brauchen. Und», er schaute auf seine Uhr, «heute ist ja schon Mittwoch. Am kommenden Montag ist die Sprechstundenhilfe wieder da. Und dann kommt auch jemand vom Berufsverband. Keine Ahnung, was der Ihnen sagen wird. Aber das werden Sie ja sehen. Das ist nicht mein Gebiet.» Er wartete ein paar Sekunden, sah zuerst Eleni, dann Theo in die Augen. «Haben Sie noch Fragen? Finden Sie auch online, viele von den Antworten, ja?»
Als er keine Frage hörte, sagte er: «Ich weiß, es ist alles etwas viel auf einmal. Aber Sie haben sich ja auf diesen Moment vorbereitet. Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie mich einfach an. Dafür bin ich da. Und Sie können ja auch alle Informationen runterladen.» Er drehte sich um und öffnete die Wohnungstür. Dann war er verschwunden.
Eleni legte ihre Arme um Theo. «Mallon den itan kali idea.»
«Sprich deutsch!» Theo fing an zu lachen.
«Du nimmst mich nicht ernst.» Eleni machte sich wieder frei. «Sie überwachen vielleicht die Wohnung.»
«Was? Kameras?»
«Mikrophone …»
Theo hob die Schultern. «Was? Und dann sitzt jemand mit Kopfhörern irgendwo und hört uns ab? Lass uns einfach die Wohnung anschauen.»
«Ich will erst nach den Kindern sehen.» Theo folgte Eleni ins Schlafzimmer. Die beiden Mädchen schliefen fest und gaben keinen Ton von sich. Er sah eine Schrankwand aus hellem Holz, Schiebetüren, kleinere Möbel, einen großen Spiegel, in dem sein Blick auf das Flurlicht traf. Vor Eleni verließ er das Schlafzimmer wieder.
Obwohl sie mit Lukas Reiter eine halbe Stunde im Flur gestanden hatten, war ihm der L-förmige Raum völlig neu. Weiß gestrichen mit einem Schuss Beige, Läufer auf dem Boden, Schwarzweißfotografien mit Berliner Motiven an den Wänden, Kleiderhaken und Schuhschrank. Leer. Natürlich leer.
Theo zählte gerade die Türen, die vom Flur abgingen, als Eleni die Schlafzimmertür schloss. «Ich bin so froh, dass sie schlafen.» Dann blickte sie sich um. «Ist das unheimlich hier. So hatte ich es mir nicht vorgestellt.»
Sie ging auf die Nebentür zu und öffnete sie. Die Küche. Funktionale Möbel, eine große Arbeitsplatte mit Gasherd, Spülmaschine und Waschmaschine, die Spüle in der Mitte. Der Holztisch war alt und hatte schon viele Gesellschaften gesehen. Acht Stühle standen drum herum. Wer auch immer hier gewohnt hatte … Die Leute waren auf Gäste vorbereitet gewesen. Eleni öffnete die Türen des Schranks. Teller und Gläser, nichts Spektakuläres. Sachen, die gebraucht worden waren.
Gegenüber das Wohnzimmer. Theo ging hinein. Auch hier ein großer Tisch. Regale, Boards, Bücher. An der Wand zwischen einem Fenster zur Straße raus und der Balkontür steckten drei kleine Nägel. Darunter helle Vierecke. Was mochte dort gehangen haben? Hatten sie das mitgenommen? War es Teil des – wie hatte Reiter das genannt – des Persönlichen gewesen? Die Sachen, die sie weggeschafft hatten. Nichts sollte an die Vorbewohner erinnern. Aber die Bücher hatten sie hiergelassen. Die hatten sie nicht als persönlich angesehen. Wie viele Sachen hatten die, die hier gelebt hatten, mitnehmen können?
Theo fuhr mit dem Finger über die Ränder der hellen Flecken. «Die habe ich auch schon gesehen. Was hat da gehangen?» Eleni stand im Türrahmen.
«Wir werden es kaum erfahren.» Er folgte Eleni in den nächsten Raum. «Genau das wollen sie doch vermeiden.»
«Aber vielleicht werde ich ihre Patienten übernehmen. Dann erfahre ich etwas über sie.»
«Wieso sagst du sie?»
«Das ist die Wohnung einer Frau.» Eleni grinste siegesgewiss.
«Und du meinst, sie war auch die, die die Praxis hatte?»
«Ich denke, ja. Komm …»
Im nächsten Zimmer stand ein großes Bett an der Wand. Einfachholz. Schrank und Schreibtisch waren aus dem gleichen Billigmaterial gefertigt. Reißzwecken an den Wänden, die Poster aber waren heruntergerissen. Die Ecke eines einzigen Posters war noch zu sehen, ein Fetzen, der sich gewehrt hatte gegen die Zerstörung. Theo meinte, eine schwarze Fingerkuppe auf dem Fetzen zu sehen.
Großes Badezimmer, Gästetoilette, ein neutrales Gästezimmer mit einfachen Möbeln, dann noch eines, das bewohnt gewesen war. Plastikherzchen auf dem Bettrahmen, der Fensterrahmen mit pinken Streifen verziert. «Ein Mädchen, ein Junge», sagte Eleni. «Beide schon groß.»
«Beide schon groß, ja. Haben wir alles gesehen?»
«Der Balkon.»
Sie gingen schweigend ins Wohnzimmer. Theo öffnete die Balkontür und ging als Erster hinaus. Dann standen sie an das Geländer gelehnt und schauten nach unten. Theo zeigte auf einen Laden. «Der hat noch auf. Das haben sie nicht kaputt gemacht. Willst du ein Bier?»
Eleni schüttelte den Kopf. «Wenn du willst, hol dir doch eins. Oder zwei … Aber ich brauche das gerade nicht.» Sie zeigte ins Dunkel hinter den Straßenlaternen. «Ist das der Kanal?»
«Ja. Als ich in Berlin gewohnt hab, bin ich da oft spazieren gegangen.»
«Wie lange ist das noch mal her?»
«2010, da bin ich zurück nach Griechenland gegangen.»
«Hm … da war ich 10 Jahre alt. Hast du die Broschüre gesehen?»
Theo schüttelte den Kopf.
«Ist in der Küche. Mit dem Minister drauf», sagte Eleni.
«Welchem Minister?»
«Na, dem Minister.»
«Der Finanzminister?» Theo ging in Richtung Küche.
Die Broschüre war A4-groß. Der Minister lächelte vom Cover, schwere Augenbrauen, knapp rasierter Bart unter der Nase und am Kinn, Augen geradeaus. «Deutschland heute» war der Titel der Broschüre. Unter dem Namen des Politikers waren noch das Geburtsdatum und der Tag seines Todes angegeben.
«Das liegt hier doch nur herum, weil wir aus Griechenland kommen», sagte Eleni. «Oder?»
Theo saß am Tisch, blätterte schon, zuckte mit den Schultern. Auf der zweiten Seite ein Foto, Panorama mit Bergen. Auf der dritten Seite ein Begrüßungsschreiben. «Willkommen in Deutschland» stand oben. Theo überflog das Schreiben. Neue Ordnung, neuer Aufschwung, Teil davon sein. Ordnung und Einordnen. So was. Er blätterte weiter.
«Und?», fragte Eleni. Sie stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch.
Statistiken über den Boom in Deutschland. Bilder von Leuten, die in Büros arbeiten und dabei glücklich aussehen. Auch Bevölkerungspolitik, eine Fotoserie aus Wittenberge, die die Räumung der schrumpfenden Stadt dokumentierte. Und der Hinweis darauf, dass es online noch viel mehr zu lesen gebe.
«Hier …», sagte Theo. « Also … blablabla … und von dem griechischen Attentäter Lefteris Anastasiou mit drei Schüssen in den Hinterkopf ermordet. Das führte zu einem Aufschrei der Bevölkerung … blablabla … Zusammenhang mit dem Niedergang der griechischen Wirtschaft … blablabla … der Pleite der griechischen Bank HPT und den Ereignissen in Thessaloniki, wo 83 Menschen von einem wildgewordenen Mob in einem Verwaltungsgebäude eingeschlossen und verbrannt … blablabla … Fanal für eine europäische Neuordnung …»
«Wir sind also schuld.»
«Das sind wir sowieso. Hier machen sie die Geschichte zum Auslöser für das Ende der EU.»
«Das Attentat?»
«Ja, das und die Sache mit der HPT. Thessaloniki.»
«Dabei hat das doch in Italien angefangen. Steht da irgendwas über Italien?»
Theo überflog den Text. «Kein Wort.»
«Weil die Griechen schuld sein sollen.»
«Ja, aber das ist auch nur ein Text unter anderen. Guck …» Theo blätterte das Heft mit dem Daumen auf. «Bilder, Texte, alles Mögliche. Und das Ding hier kriegen sie alle. Egal, woher sie kommen. Das ist nicht nur für uns gemacht. Hier …», er zeigte mit dem Finger auf einen Text. «Einführung für die Familien. Arbeitskreise für die Spezialisten. Und», er blätterte weiter, «alles auch noch zum Runterladen.»
7
«Sie gehen davon aus, dass wir uns unter diesen Umständen gegenseitig massakrieren. Dass sie sich die Mühe gar nicht selbst machen müssen.» George blieb am Zaun stehen und blickte auf ein Gewerbegebiet auf der anderen Seite. Auf einem kleinen Platz standen zwei Panzer, daneben wurde eine Gruppe Uniformierter aus einem Kleinbus heraus mit Essensrationen versorgt. «Oder?», fragte er.
Marie wartete darauf, dass Kodjo und Antoinette aufschlossen. Sie waren eine der Gruppen, die Leute für das Treffen am Nachmittag ansprechen sollten. Gleich nach der Versammlung hatten sie in einer Siedlung mit kleineren Plattenbauten damit angefangen. Sie hatten eine Burg gesehen, ein Schloss oder so etwas, das außerhalb des Zauns lag. Dann waren sie einfach weitergegangen. Aus Neugier. Und waren schließlich an dem Gewerbegebiet gelandet. Die beiden Jugendlichen waren mittlerweile auch bei ihnen angekommen.
«Was läuft gerade?», fragte Kodjo.
«Wir sehen uns den Zaun an und die Gegend dahinter.» Marie legte Kodjo eine Hand auf die Schulter, aber der entzog sich.
«Ich dachte, wir trommeln die Leute zusammen.»
«Tun wir auch. Aber ich wollte noch mehr von der Stadt sehen. Und das da …»
«Hmhm …», sagte Kodjo. «Die Stadt … Wir hätten ein paar Tage früher weggemusst aus Berlin. Dann wären wir jetzt nicht hier.»
«Du weißt genau, warum das nicht ging.»
«Aber Oma ist schon vor fast zwei Wochen gestorben. Und du hast immer gesagt, dass wir dann sofort woanders hingehen.» Kodjo standen fast die Tränen in den Augen. Eine Gruppe junger Männer aus einem nahe gelegenen Mehrfamilienhaus kam näher. Kodjo wischte sich schnell über die Augen.
«Sind die noch unsere Verantwortung?», fragte Marie und sah George an.
«Glaube nicht. Aber wir können sie mal fragen, ob sie schon von dem Treffen wissen.»
Sie waren zu viert. «Hey, wollt ihr raus?», fragte der Größte von ihnen. Schwarze Lederjacke, breite Schultern. Sie waren alle knapp zwanzig. Das Deutsch des Anführers war nicht dessen erste Sprache. Marie tippte auf kongolesische Eltern.
«Klar», sagte George. «Wir schneiden den Zaun jetzt auf und gehen einfach, wohin wir wollen. Die dahinten …», er zeigte auf die Panzer und die Soldaten, «die können uns mal. Kommt ihr mit?»
«Ist ja gut», sagte der Große. Er grinste und richtete seine Jacke, sah jetzt aus wie ein Bouncer, mit dem man nicht spaßte. Zwei Cornrows liefen parallel von vorn nach hinten über seinen sonst kahlen Kopf. «Aber ihr habt doch irgendetwas vor. Eben waren so Kollegen bei uns, die wollten uns zu einem Treffen überreden. Wir müssen uns organisieren. War das nicht, was sie gesagt haben?» Er drehte sich um. Die anderen drei nickten.
«Organisieren», sagte einer der drei. Er kopierte das Grinsen des Großen. «Meine Eltern hätten nie nach Deutschland kommen sollen. Scheiß Albinos … Sie kriegen schon noch, was sie verdienen.»
«Ja.» Der Große nickte und blickte dabei ins Nirgendwo. Dann kratzte er sich im Schritt, wog kurz seinen Schwanz und sah Marie dabei in die Augen.
Sie senkte den Blick und bemerkte einen feuchten Fleck auf seinem schwarzen Converse-Schuh. Die Flüssigkeit war zum Teil schon eingezogen, aber auf der weißen Spitze störte ein kleiner Spritzer. Er war dunkelrot.
Der Große bemerkte Maries Blick und zeigte seine Zähne. «Ja …», sagte er noch einmal. «Eigentlich können wir hier gar nichts tun.» Er drehte sich um zu seinen Jungs. «Kommt!», sagte er und ging davon. Die anderen folgten ihm.
Der, der als Einziger außer der Lederjacke geredet hatte, drehte sich noch mal um, als die Gruppe schon ein Stück entfernt war. Er reckte seinen Kopf kurz in die Höhe. Was willstu? Und ging dann weiter. Die vier verschwanden in die Richtung, aus der Marie, George und die beiden Jugendlichen eben gekommen waren.
«Was war das denn?», fragte Antoinette, als die vier Jungs außer Hörweite waren.
«Dorftrottel!», sagte Kodjo. Dann spuckte er auf den Boden vor dem Zaun.