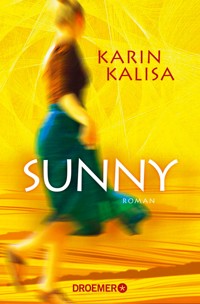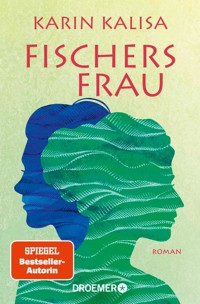
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Teppichgarnen, Erzählfäden und dem sagenhaften Grün der Baltischen See. In »Fischers Frau« lässt Karin Kalisa die Geschichte der Pommerschen Fischerteppiche lebendig werden. Südliche Ostsee, 1928: Ein dreijähriges Fangverbot macht die Fischer arbeitslos – statt hinaus aufs Meer zu fahren, setzen sie sich an Webstühle und knüpfen Teppiche, die die Welt der See zeigen – oder der Welt die See, wie man es nimmt. Ein österreichischer Tapisserist lehrt sie die Knoten, auf die es ankommt: Senneh und Smyrna. Die "Perser von der Ostsee" entwickeln sich europaweit zum Verkaufsschlager. Fast einhundert Jahre später wird der zurückgezogen lebenden Kuratorin Mia Sund ein sehr seltsames Exemplar auf den Tisch gelegt: In seinem Flor irrlichtern Hunderte von Grüntönen, segeln Koggen unter mysteriösen Flaggen, tanzen kleine Wellen in den Augen der Fische und eine ornamentale Borte entpuppt sich als vieldeutige Chiffre. Zum ersten Mal nach zwölf Jahren beantragt Mia eine Dienstreise und macht sich quer durch Europa auf die Suche nach der Knüpferin und ihrer Botschaft, die die alte Erzählung vom Fischer und seiner Frau auf den Kopf stellt. Bestseller-Autorin Karin Kalisa verwebt die Kunst des Teppich-Knüpfens mit den Lebensfäden zweier Frauen zu einem ebenso wahrhaftigen wie phantastischen Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Karin Kalisa
Fischers Frau
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Karte
Motto
Greifswald, Gegenwart
Hof Jamme, Sommer 1999
Greifswald, Gegenwart
Zagreb, Gegenwart
Zagreb, Winter 1929
Zagreb, 1923–1929
Ostsee, Winter 1929
Freest, 1930–1935
Freest, Herbst 1935
Överhogdal, 1948
Överhogdal, 1990
Zagreb, Gegenwart
Triest, wenige Monate später
Trieste und Ávila, einige Wochen später
Es war und es war nicht
Glossar
Verwendete Literatur
Wo wir einen Anfang setzen, da ist längst etwas eingefädelt, da sind schon Weichen gestellt, Bedingungen geknüpft, Voraussetzungen geschaffen.
Siegfried Lenz, Heimatmuseum
Greifswald, Gegenwart
Was einmal war, es – hätte gewesen sein sollen.
Dass in ihrem Leben alle Tage gleich von einem Heute in ein Morgen übergehen, dass jedes Gestern das gleiche Gesicht wie ein Heute oder ein Morgen tragen solle und alle diese Gestern, Heute und Morgen einen Zeitraum bildeten, in dem nichts zu fürchten, nichts zu wünschen und zu wollen sein würde, solange nur die Vergangenheit außen vor bliebe, genau dies war der einzige Wunsch, der in Mia Sunds Leben Platz hatte. Und weil es der einzige war, dachte sie, er könne erfüllt werden; nur dieser eine.
Sie hätte wissen müssen, dass die Vergangenheit nicht mit sich handeln ließ.
Als die Vergangenheit bei ihr einbrach, war Mia Sund nicht in der Lage, sich ihr zu stellen, sie ergriff auch nicht die Flucht, sie blieb wie angewurzelt in der Mitte ihres Büros stehen, während sie fieberhaft eine Antwort darauf suchte, ob es wirklich ihre Vergangenheit war, die da ohne jede Ankündigung wieder bei ihr eingefallen war, oder etwas, was sich bloß den Anschein gab. Falls es wirklich die Vergangenheit gewesen sein sollte, hatte es ihr gefallen, sich die vertraute Gestalt ihres Kollegen Holger Berends zu geben – einen Meter und achtzig groß, Dreitagebart, honiggelbe Halbbrille, struppiges Graublond – und ihn als ihr Sprachrohr zu benutzen: »Nicht, dass es eine Fälschung ist«, hatte sie ihn sagen lassen, während er auf der Schwelle stand, genau wie sie selbst damals auf einer Schwelle gestanden und eins zu eins diesen Satz gesagt hatte, gegen eine sich schließende Tür: »Nicht, dass es eine Fälschung ist.« Im allerletzten Moment hatte sie damals diesen Satz gesagt, gegen ihren Willen, aus einem ihr selbst unerklärlichen Impuls heraus – vielleicht der vagen Idee, der, dem sie das sagte, könne sich auf diesen Fingerzeig hin selbst retten und sie mit dazu; er möge endlich einmal das Richtige tun, ihr dankbar sein, sie schonen, mit ihr einen neuen Anfang finden. »Nicht, dass es eine Fälschung ist«, hatte sie gesagt, mehr geflüstert als gesagt hatte sie das damals, aber er – er war wieder laut geworden; auf seine Art: in wenigen Sekunden vom Flüstern mit fast geschlossenen Lippen zu erhobener Stimme und zu einem schrecklichen Schreien, dicht vor ihrem Gesicht. Als ob er eine Fälschung nicht erkennen könne. Ob sie meine, sie wisse es besser. Sei nicht vielmehr an ihr so einiges falsch? Nahezu alles, wenn er es recht bedenke. Ein letzter kalter Blick, bevor die Tür, hinter der die Zertifikate geschrieben wurden, mit dem Fuß zugestoßen wurde. Damals war sie auf der Schwelle stehen geblieben; unfähig, sich fortzubewegen, gleichermaßen heilfroh und tief verzweifelt, dass diese Tür jetzt zu war. Ein für alle Mal.
Und ja, sie hatte es besser gewusst.
Diesmal war nicht ihr Vater auf der anderen Seite der Tür, sondern Holger Berends – Vineta-Forscher und Museumspädagoge. Von Zimmer 117 zu Zimmer 302 hatte er sich hinaufbemüht, um ihr einen kürzlich ins Haus gekommenen Wandteppich auf den Tisch zu legen. Mit dem wisse er nichts anzufangen. Fischerteppich wahrscheinlich. Eher von früher. Ein Fall für die Kollegin, wie ihm schien. Hatte keine Antwort abgewartet, war schon halb draußen gewesen, als er sich auf der Schwelle noch einmal umdrehte: »Nicht, dass es eine Fälschung ist.«
War mit ihm, war in diesem Moment die Vergangenheit bei ihr eingebrochen? Anders als bei Einbrechern üblich, hatte er nichts mitgenommen, sondern etwas dagelassen: einen Teppich und einen Halbsatz. Völlig offen, ob mit einem von beiden oder keinem von beiden oder mit allen beiden etwas nicht stimmte.
Warum in aller Welt hatte Holger Berends ihr diesen Teppich gebracht? »Eher von früher« war im Zusammenhang mit ihr ein Witz. Eine Faserarchäologin kümmerte sich um mehrere Tausend Jahre alte Spuren von Gewebe. Um Leichentücher – in erdgeschichtlicher Dimension. Zeitgenössisches, Vollständiges fiel nicht in ihr Ressort. Wie alt konnte ein Fischerteppich sein, der »eher von früher« war? Noch nicht einmal hundert Jahre. In der Eingangshalle hing ein halbes Dutzend hinter Glas. Auf den ersten Blick kam ihr im Vergleich mit den Exemplaren, die sie tagtäglich im Vorübergehen sah, ohne sie anzusehen, nichts sonderlich falsch vor. Ähnliches Maß, hundert mal hundertachtzig schätzte sie, schöne ornamentale Kante, gängige Motivik: acht Koggen, von denen die oberen vier nach Osten, die unteren vier nach Westen fuhren. Das Ganze ziemlich Grün in Grün. Aber warum sollte eine schlichte Vorliebe für Grüntöne einen Verdacht erzeugen? Insgesamt handelte es sich wahrscheinlich um nichts anderes als um ein recht typisches, nur eben zur Monochromie neigendes Exemplar dieser lokalen Teppichknüpferei. Angenommen, er wäre knappe einhundert Jahre alt, könnten Spektroskopie und Chromatografie das bestätigen. Aber warum sollte überhaupt ein derartiger Aufwand getrieben werden? Nein, es musste eine Falle sein. Wer spielte mit ihr?
Angenommen, sie ließe sich darauf ein und entnähme eine Fadenprobe: Neben dem Alter würde sie mit Glück etwas über die Farbstoffe erfahren. Auch würde sie sich die Regelmäßigkeit der Knoten auf der Rückseite ansehen, und wäre die Regelmäßigkeit zu groß, müsste sie aufmerksamer nach Zeichen einer maschinellen Herstellung suchen. Wäre die Rückseite fusselig und körnig, und nicht glatt geschliffen und poliert durch nichts als die Zeit selbst, dann wäre Zeit nicht reichlich genug im Spiel gewesen. Sie würde den Flor aufschlagen – und wenn sie sähe, dass die Fäden an der Spitze ausgeblichener waren als am Boden, und zwar nicht infolge eines abrupten Umschlags in der Mitte des Fadens, sondern in Form eines kontinuierlichen Verlaufs, dann hätte man es hier mit einem natürlichen Ausbleichen zu tun, nicht mit einem künstlich hergestellten. Um herauszufinden, dass etwas keine Fälschung war, gab es in der Textilforschung klare Bestimmungsverfahren. Aber wie sollte sie »Nicht, dass es eine Fälschung ist«, wie sollte sie diesen Satz, dieses Echo eines Satzes, auf seine Echtheit prüfen? Konnte es überhaupt so etwas wie ein echtes Echo geben? Ist ein Echo nicht immer schon – eine Kopie? Ist eine Kopie nicht immer schon – eine Fälschung? Wie um Himmels willen konnte sie herausfinden, ob es wahr war, was sie fürchtete, dass mit diesem Echo, das womöglich herumgeirrt war wie eine irrwitzig verzögerte Schallwelle, jahrelang auf der Suche nach einer Reflexionsfläche, bis sie auf einmal in Holger Berends eine gefunden hatte, die Vergangenheit sie hier und jetzt eingeholt hatte, trotz eines anderen Wohnortes, trotz eines anderen Namens, trotz eines anderen Berufes? Oder sicherstellen, dass kein anderer, sondern sie selbst sich narrte, dass der Satz keine hinterhältige Drohung, kein schrecklicher Widerhall, sondern einfach nur als ein launiger Dienstagmorgen-Satz dahergekommen war, von Kurator zu Kuratorin, ein Berufswitz, eine hingeworfene Phrase. Nahezu bedeutungslos. Es müsste ein allgemein empfohlenes Satzprüfverfahren geben, ein semantisches Säurebad, eine Originalitätsmessung des Wortwörtlichen. Wenn nicht überhaupt die Annahme, es gäbe gefälschte Sätze, schon der reinste Irrsinn war. Falsche Sätze; grammatisch falsch und inhaltlich falsch und fehl am Platze; das ja. Aber gefälschte? Gefälschte, in denen von Fälschung die Rede war… Sie spürte Übelkeit in sich aufsteigen und lehnte sich gegen die Aktenwand. »Nicht, dass es eine Fälschung ist.« Waren nicht überhaupt Sätze, die mit »nicht, dass« beginnen, so sehr ein Inbegriff des Zweifels, geradezu eine Formel der Ungewissheit, eine Beschwörung dessen, dass etwas bitte nicht das sein sollte, was es sein könnte, dass sie ohnehin gegen jedes Prüfverfahren imprägniert waren? Weil man in dieser Satzart, im gleichzeitigen Behaupten und Verneinen, immer schon auf der sicheren Seite war. Wie sich das wohl anfühlte, dachte sie, immer auf der sicheren Seite zu sein?
In ihrer Not griff Mia auf eine Taktik zurück, die sie früh gelernt hatte: logischer Kettenbau. Egal, wie logisch die Kette am Ende tatsächlich war, allein das Verfertigen erfüllte seinen Zweck: Mithilfe folgerichtigen Denkens hangelte sich das Kaninchen aus dem Radius der Schlange. Jedes Kettenglied ein Notfalltropfen. So fand sie auch jetzt im Durchspielen von Möglichkeiten echter und gefälschter Sätze zurück an ihren Schreibtisch.
Der Teppich, der vor ihr lag, war nicht das Problem. Der Satz war das Problem. Den musste sie prüfen. Diese vielsagende oder nichtssagende Ansammlung von Wörtern, die sich mit dem Atem dessen, der sie gesprochen hatte, längst hätte verflüchtigen sollen, die aber im Raum hängen geblieben waren wie eine zusammengekauerte Fledermaus, die sich tagsüber nicht aus der Ecke traute, aber nachts – nachts würde sie ihre Schwingen weit ausbreiten und sie aus dem Schlaf reißen und die Haare zu Berge stehen lassen. Sie musste wissen, woran sie war. Wenn sie schon nicht sicher war, musste sie wenigstens dies sicher wissen. Sie sah auf die Uhr.
Es war elf Uhr fünfundvierzig. Holger Berends war nicht der Typ, der Extrawege machte; er bündelte gern. Diesen Teppich wird er ihr auf dem Weg in die Kantine vorbeigebracht haben, war jetzt auf dem Weg dorthin. Stand vielleicht schon an. Wenn sie ihm sofort folgte, würde sie, ohne dass es auffiel, einen Platz an seinem Tisch finden, ein Gespräch anzetteln, das nicht ohne Anzeichen und Hinweise in seinem Mienenspiel bleiben würde, und sie würde es zu lesen wissen. Im Zusammenhang mit anderen Sätzen würde dieser Satz seinen wahren Gehalt offenbaren. Mia nahm das Portemonnaie aus ihrer Tasche, schloss die Tür ab, fuhr mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss, lief über den Hof zur Kantine, stellte sich in die Risotto-Schlange, in der Holger Berends wartete und selbstvergessen einen Fünfeuroschein auf und zu rollte, den er für die Kasse bereithielt. Sie war sechs Plätze hinter ihm, ließ ihn nicht aus den Augen, stellte das Trüffelrisotto aufs Tablett, setzte sich zu ihm, suchte nach passenden Unverfänglichkeiten, fand keine, verwarf alles Drumherum und fragte so geradeheraus, wie man nur geradeheraus fragen konnte: »Sag mal, dieser Fischerteppich – hast du wirklich Zweifel?« Sie hielt seinen Blick fest. Wenn er jetzt »Nein« antworten würde und sie ansähe wie jemand, der fast am Ziel war, gegen Bares beauftragt von jemandem, der auf Rache sann? Wenn er gar nichts sagen würde, sondern nur undurchdringlich schauen und vielsagend schweigen würde? Sie einfach auflaufen ließe auf die Riffe der Vergangenheit? Mia Sund beobachtete gebannt, wie Holger Berends bedächtig kaute, mit dem Finger auf seinen Mund wies, ein verständnisheischendes Lächeln andeutete, sich mit der Serviette umständlich Mund und Bart abwischte, einen Schluck Wasser nahm und schließlich meinte: Na, die seien schon was wert. Allerdings sei Geld ja immer nur ein Beweggrund im Fälschergewerbe. Daneben gäbe es ja diese schiere Lust am Zum-Narren-Halten. Mia nickte. So war es damals auf Hof Jamme gewesen. Exakt diese Motivlage hatte dort das bunt zusammengewürfelte Fälschervolk geeint, bis –
»Hier in Mecklenburg-Vorpommern?«, fragte sie.
Holger Berends, von dem sie wusste, dass er auf die Gediegenheit des ländlichen Nordostens große Stücke hielt, dass er der Letzte gewesen wäre, der sein Museumsdorf und seine Freilichtspiele gegen einen Job in den großen Kunstsammlungen dieser Welt getauscht hätte, sprang über das Stöckchen, das sie ihm hingehalten hatte:
Zwar sei man hier, meinte er, weder beim MoMA noch bei der Tate, aber dies allein schütze noch nicht davor, dass einem eine Fälschung untergejubelt würde. Im Vergleich zu dem jedenfalls, was er an Fischerteppichen so in Erinnerung habe, sei dieser hier ziemlich farbintensiv. Irres Grün, oder? Kennt man doch eigentlich gar nicht, außer in der abstrakten Kunst, stimmt’s? Am Ende sei Mark Rothko unter die Teppichweber gegangen. Im Ernst, seien die nicht eigentlich immer eher beige-braun – so wie die unten in der Halle? Mia nickte, zumindest die im Foyer einte ein ziemlich gedimmtes Farbspiel.
Ach, im Grunde habe er aber keine Ahnung, fuhr Holger Berends fort, er habe nur so das Gefühl gehabt, man sollte den nicht gleich katalogisieren. Er könne sich natürlich täuschen. Teppiche seien weder sein Metier noch sein Ding, egal ob auf dem Boden oder an der Wand. Er persönlich stehe auf Laminat und Raufaser. Mia sah ihn fragend an. Ja, Laminat lasse sich super wischen, Raufaser prima überstreichen.
Ein Gespräch, das binnen fünf Minuten bei der guten Überstreichbarkeit von Raufaser und der leichten Pflege von Laminatböden anlangte, war ein Harmlosigkeitsindikator ersten Ranges. Davon abgesehen natürlich, dass beides Lug und Trug war: Vorspiegelung einer verputzten Wand in dem einen, eines Holzfußbodens in dem anderen Fall, war es dennoch unvorstellbar, dass ein Fan dieser baustoffbiederen Täuschungswelt irgendeine Figur in einem hintersinnigen Rachefeldzug spielen könnte. Holger Berends war kein Sprachrohr der Vergangenheit – beziehungsweise ausschließlich in dem Sinne, in dem er während der Wikinger-Freilichtspiele Harald Blauzahn intonierte: im Männer-mit-Bart-Gespräch mit Hakon dem Guten und Richard dem Furchtlosen, die in ihren bürgerlichen Existenzen eine ebenfalls gut eingespielte Skatrunde ergaben. Mia Sunds Leben würde ohne die Vergangenheit weitergehen. Sie atmete hörbar auf und schob ihr Besteck zusammen. Holger Berends sah sie irritiert an. »Sättigt ganz schön«, sagte sie.
Holger Berends nickte zustimmend, schien aber fest entschlossen, seinen Teller leer zu essen. »Bis später«, meinte er, offenkundig froh darüber, sich seinen Sprachnachrichten zuwenden zu können. Mia war aufgestanden und auf halbem Weg zur Geschirr-Rückgabe, da rief er sie noch einmal zurück. Jetzt, dachte Mia, jetzt doch. Ob sie nicht zum Sommerfest statt Erdbeer-Tiramisu doch lieber Baguette und Käse mitbringen könne; süß und salzig stünden in keinem ausgewogenen Verhältnis mehr. »Kein Problem«, rief Mia, etwas zu schrill, vor lauter Erleichterung darüber, dass aus Holger Berends ganz sicher nicht die Vergangenheit sprach, sondern nur der Vineta-Forscher, Museumspädagoge und Chefplaner von Festen aller Art, der sie nun auch noch von dem Menetekel des Erdbeer-Tiramisus befreit hatte, dem letzten offenen Punkt der Büfettliste, in die mit Kreuzchen und Namen sich einzutragen sie nicht umhin gekommen war. Wie immer hatte sie viel zu lange abgewartet. Weil sie nicht kochte. Weil sie nicht darüber redete, dass sie nicht kochte. Weil sie von Imbissen lebte, von der Hand in den Mund. Statt Ausreden zu erfinden oder italienische Restaurants und Feinkostläden abzuklappern, würde sie nun einfach in irgendeinen Supermarkt gehen und mit Brot und Käse wieder rausmarschieren können. Sie winkte zum Abschied – euphorisch darüber, wie harmlos die Welt war, zumindest die Welt, in der Holger Berends lebte.
Zurück im Büro, fuhr in die bodenlose Erleichterung, die Mia tatsächlich die Treppen hatte hochlaufen lassen, als seien nicht nur ein bedrohlicher Satz und ein kompliziertes Dessert, sondern die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben, ein nachholender Schrecken ein. Wie ein Windstoß durch trockenes Laub weht, es aufwirbelt, fallen lässt, weiterjagt, erfasste sie ein jäher Taumel, der nur auf einen günstigen Moment gelauert zu haben schien, in dem er leichtes Spiel haben würde, um sie vor sich her zu treiben, fahrig und zittrig von Fenster zu Tür, von Tür zum Tisch. Dieses Aufeinmaldasein. Dieses Ausdemnichtskommen. Dieses Ebennochwardochallesanders. Wie gut sie das kannte. Aber Nurzugutkennen half nicht. Plötzlichkeit ließ sich nicht lernen. Auf Plötzlichkeit konnte man sich nicht vorbereiten. Denn auch, wenn man noch so gut weiß, dass mit Plötzlichkeit zu rechnen ist, dass es Plötzlichkeit gibt, lebt die Plötzlichkeit von ihrem Unangekündigtsein. Angekündigt wäre sie: nichts. Wie lange hatte sie eigentlich geglaubt, es sei überall so, dass ein Vater, der eben noch einen Scherz gemacht oder über einen Scherz gelacht hat, plötzlich schmale Augen bekommt und dieses Zucken in den Wangenmuskeln. Dass es allgemein zu Vätern gehörte, dass sie einem ein Wort umdrehen, das arglos im Munde geführt wird, dass sie eine ungeschickt geöffnete Dose anstarren, ein Lächeln beargwöhnen, das nichts als ein Lächeln ist, sich wie besessen an den Anblick eines Bleistiftes heften, der nicht am gewohnten Platz liegt. Und dass es normale Väterart war, dass schmale Augen und Wangenzucken solche Wörter mit sich bringen. Dass ein Vater, der ihr zuweilen vorlas und der sie mitunter auf die Schultern nahm, sich plötzlich in etwas Bedrohliches verwandelte. Weil es eben so war. Weil die Natur es so eingerichtet hatte. Wann hatte sie aufgehört, das zu glauben?
Niemand konnte wissen, wann es wieder so weit war. Nicht einmal er selbst. Wenn sie diese schmal werdenden Lippen sah, dieses Zucken um sie herum, war es immer schon zu spät. Dann war es schon so weit gekommen: Dieser Mund, ein zischelnder, brodelnder Topf, würde Wörter ausspucken, an denen sie sich verbrennt. Sie verbrennt sich, aber ihn feuern sie an. Manchmal greift er mitten im Schlimmessagen ihren Arm. Sein Griff ist übermäßig hart, aber immer noch ein Griff und kein Schlag. Zwei Arme um ihre Schultern sind eine Umarmung, auch wenn sie kaum mehr atmen kann. Sein schwerer Fuß auf dem ihren ist ein Versehen, auch wenn die Zehen rot und blau werden. Dass jemand, der sich so vergisst, nicht vergisst, darauf zu achten, wie und wie sehr, womit und wohin er Schmerz platzieren will. Alle guten Geister verließen ihn – den Kunstsachverständigen Dr. phil. Wenzel Guga, einen in sich gekehrten Mann von erlesenem Geschmack und von feinem Humor –, sein Scharfsinn nie.
Als sie begriffen hatte, dass dies keineswegs aller Väter Art war, hatte ihre Mutter die eigene Not schon ganz und gar in Noten aufgelöst, in ein Decrescendo des Rückzugs in sich selbst. Bis sie gar nicht mehr da war.
Sie hätte es wissen müssen, dass eine dermaßen mit Plötzlichkeit belastete Vergangenheit es sich nicht nehmen lassen würde, auf einmal wieder da zu sein. Sie war ja auf Du und Du mit der Plötzlichkeit, mit ihr zusammen aufgewachsen; konnte gar nicht anders, kannte gar nichts anderes. Vom Fenster aus warf Mia einen Blick auf den Teppich: Das Mittagslicht, durch die große Kastanie im Hof leicht verschattet und quer gestreift durch die Lamellen der Bürojalousien, fiel auf den Flor, spielte dort mit sich selbst Fangen. Tatsächlich war er kräftiger in der Farbe als die Fischerteppiche, die in den Vitrinen der Eingangshalle hingen. Wobei der Singular nicht stimmte. Es waren viele Farben. Viele Farben von Grün. Die waren nicht einfach hier und dort ausgeblichen oder verlaufen, die waren von Anfang an willentlich abgestuft und variiert in den Teppich hineinkomponiert worden. Und dann, jedes Grün für sich, auf nahezu hundertjährige Weise verwirkt. Dessen war sie sich sicher. Säurehaltige Lasuren oder eingelassenes historisches Scherbenmaterial ließen jedes Tongefäß rapide altern. Leinwände ließen sich im Wechselbad von Backofen und Kühltruhe auf alt strapazieren, aber die Verwirkung von Gewirktem nachzuahmen war fast unmöglich. Fadenscheinig werden war ein sehr autonomer Prozess.
Die Ornamente der Borte hatten diesen sachlichen Unterton der Wiener Werkstätten und jenen verspielten Oberton der Art Nouveau. Floral und geradlinig zugleich bildeten sie einen durchaus schönen Rahmen. Mia trat näher an den Schreibtisch heran. Die Koggen, die in tannengrüner Kontur im Zentrum des Teppichs aus dem ins Türkise gehenden Grün auftauchten, waren auf den zweiten Blick überaus filigran gearbeitet. Bis in die Flaggen hinein war offenbar genauestens berechnet worden, wie aus sehr dicht gesetzten Knoten auf allerkleinstem Raum ein Bild entstehen würde. In den Flaggen, gelblich, aber immer noch grün, zerknabberten Eichhörnchen vierkantige Nüsse. Mia ging zum Regal und schlug unter dem Stichwort Länderflaggen nach. Vielleicht würde sie hier ein reales Gegenstück finden. Sie fand keines, noch nicht einmal eine annähernde Farbkombination – ganz davon abgesehen, dass sich schwerlich eine Nation denken ließ, die unter knabbernden Eichhörnchen firmieren wollte. Possierlich und politisch, das ging schwer zusammen. Falls dies kein Original war, war es doch immerhin originell. Aber warum sollte jemand in Jingdezhen oder Dafen oder sonst einem Kopisten-Ort dieser Welt Koggen mit Eichhörnchenflaggen in einen angeblichen Fischerteppich hineinknüpfen? Wer außerhalb eines Einhundert-Kilometer-Radius wusste überhaupt von dieser Ostseekunst? Wenn kaum jemand die Originale kennt, tendiert jede Fälschung Richtung absurd. Nein, ihr Kollege konnte nicht wirklich ein Problem mit diesem Teppich gehabt haben. Sie musste auf der Hut bleiben.
Den Geruch einer langen Lagerung hatte ihre Nase bereits wahrgenommen, als Holger Berends ihr den Teppich auf den Schreibtisch gelegt hatte. Geruch ließ sich leicht fälschen. Jeder x-beliebige feuchte Keller schaffte das in kürzester Zeit. Augen und Nase ließen sich leicht täuschen. Letztlich würden es ihre Finger sein, die Gewissheit gaben. Sie würden jene leichte Unregelmäßigkeit der Knoten ertasten, die Handarbeit von Maschinenarbeit trennt, die schwach ölige Textur naturgefärbter Wollfäden. Ihre Finger waren unbestechliche Detektoren. Sie hatten gelernt zu fühlen, was richtig ist, was stimmig ist, was passt. Sie hatten gelernt, Bruchstellen zu ertasten, Unebenheiten aufzuspüren, zu verbinden, zu glätten, zusammenzuhalten.
Nicht immer war sie eine diplomierte Faserarchäologin gewesen. In erster Linie war sie eine staatlich geprüfte Bandagistin. In drei Lehrjahren hatten ihre Finger beim Bandagieren von Gewebe aller Art mehr begriffen, als sie später in ihren acht Fachsemestern Faserarchäologie gelernt hatte, ja, als sie in hundert Fachsemestern je hätte lernen können. Später, morgen oder erst in einer Woche, je nach Arbeitsplan, würde sie Fasern entnehmen, prüfen, wie sie gefärbt wurden, auf Spuren eines künstlichen Alterungsprozesses achten bei diesem museologischen Jungspund von einem Teppich, der vielleicht nie den Weg in eine große Ausstellung finden würde, allenfalls in den Glaskasten unten in der Eingangshalle, neben die anderen. Jungsteinzeit, nicht Jugendstil stand im Forschungsfokus der hiesigen Sammlung.
Sie nahm eine Rolle Packpapier aus dem Schrank, maß ein Stück ab und bedeckte den Teppich damit. Dann schob sie die Papiere auf ihrem Schreibtisch zusammen und ertappte sich dabei, auf die Tür zu starren, als erwarte sie, dass die sich jeden Augenblick öffnen und Holger Berends noch einmal in Erscheinung treten würde. Abrupt stand sie auf, näherte sich langsam und leise der Tür, horchte auf Geräusche auf dem Flur. Nichts. Nichts, was es rechtfertigen würde, noch weiter irgendein nahendes Unheil herbeizulauschen. Um etwas zu tun, sich aus der Erstarrung zu lösen, goss sie die Pflanze auf dem Fensterbrett, die, der bröckeligen Erde nach, sehr lange nicht, wenn überhaupt jemals, gegossen worden war, ohne dies übel zu nehmen: Genügsamkeit und Gleichmut, dieses zentrale Aufnahmekriterium für Büropflanzen. Während sie die Plastikgießkanne auf die Fensterbank zurückstellte, schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, wie wenig anders die Vergangenheit, wäre es die Vergangenheit gewesen, sie selbst hier vorgefunden hätte, in diesem Büro: gleichmütig und genügsam hineingealtert in jenes lange Moratorium der mittleren Jahre, angewurzelt stehen geblieben zwischen einem Drehstuhl, einem Gummibaum und grauen Aktenregalen aus der Beschaffungsstelle – im Hintergrund ein Kalender vom Büromöbelhersteller, an dem sie wochenlang vergaß, den roten Plastikmarker weiterzuschieben. Musste man mit seiner Vergangenheit brechen, um an einem solchen Ort wieder aufgespürt zu werden? Mit einem Anflug von Scham über ihre Büropflanzenexistenz, jedenfalls mit dem Gefühl, diese Szene unbedingt verlassen zu müssen, griff Mia Sund Mantel und Tasche, meldete sich ab – sie fühle sich nicht, sagte sie – und ging zum Bahnhof; wie jeden Tag, nur zwei Stunden früher. An den dreiundzwanzig Minuten Fahrtzeit zwischen Greifswald und Stralsund änderte das nichts.
Dass sie sich nicht fühlte, war eine glatte Lüge gewesen, denn tatsächlich fühlte sie sich heute zum ersten Mal seit sehr langer Zeit.
Vielleicht, dachte Mia, als sie am Bahnhof in Stralsund angekommen war, ist es so, wenn man sich fühlt: dass man auf einmal nicht den immergleichen Weg ging, sich nicht verhielt wie eine Kugel in ihrer Bahn, sondern seinem Kopf und den Beinen folgte, die Gefühle zwischen sich aushandelten, denen man sich einfach überlassen konnte, und sie somit wie von selbst nicht wie immer vom Bahnhof aus eine Straße geradeaus nahm und dann zweimal links abbog, sondern geradeaus und immer weiter geradeaus direkt ans Wasser ging und sich am Rand des Hafenbeckens niederließ.
Hatte sie es nicht immer gewusst, dass eine Vergangenheit, mit der man gebrochen hatte, vielleicht lange nichts von sich hören ließ, sehr lange nicht, dann aber doch? Weil mit ihr gebrochen zu haben, nicht hieß, dass sie gebrochen war. Weil eine Entscheidung in der Gegenwart nicht mir nichts dir nichts einen Zustand der Vergangenheit erzeugte. Natürlich blieb sie einem auf den Fersen, nicht sesshafter als man selbst, und würde ihren Platz zurückverlangen. Wo sollte sie sonst hin? Sie hatte ja nur diesen. In ihrer Erschöpfung fühlte Mia mit einem Mal fast so etwas wie Erbarmen mit ihrer Vergangenheit. »Dann fang mal an«, sagte sie.
Mit den kleinen Wellen, die sich an der Hafenmauer brachen, schwappten Erinnerungsbilder in ihr hoch und vergingen.
Eine japanische Teeschale, die von einer Hand in die andere wanderte, bis sie in die Hände ihres Vaters gelangte. Sie ließen die Schale rotieren, damit er die leichte Asymmetrie würdigen konnte und dieses unwirkliche, tiefe Rot, das bis in die kleinsten Schattierungen, bis in nadelstichfeinste Löchlein der leicht porösen Außenwand, bis in die halbzylindrische Wellenförmigkeit, bis in die wundersamen Unebenheiten der Lasur hinein planvoll geschaffen worden zu sein schien, alles ohne Drehscheibe, nur von Hand geformt – allerdings nicht von einem Kichizaemon II, VI oder XI in Japan zur Zeit der Samurai und Daimyō, wie er annahm, wie er zu hoffen wagte, sondern vor wenigen Wochen von Katja auf Hof Jamme, ein paar Kilometer außerhalb der Stadtgrenze. Den haarfeinen Sprüngen in der Lasur war mit dem allerspitzesten Aufsatz eines Zahnarztbohrers, der offenbar nicht nur gegen Karies, sondern auch für Craquelé eingesetzt werden konnte, nachgeholfen worden.
Stefan, mit seinen blitzenden Augen und seinem Wird-schon-gut-gehen-Lächeln. Wie er sie von zu Hause abholt und möchte, dass sie von woanders etwas abholt oder etwas woandershin bringt. So harmlos, wie sie aussieht. Lauf schon, ich warte hier auf dich. Er ist zärtlich. Er kennt Kosenamen und weiß sie zu sagen. Natürlich holt sie ab, natürlich bringt sie hin. Aurikelchen, mein Herzallerliebst, du Tausendschöne. Davon kann sie gar nicht genug bekommen.
Drei Polizeiwagen vorm Haus. Die Nachbarn hinter den Gardinen und am offenen Fenster. Ihr Vater in Handschellen. Warum erst jetzt?, hatte sie gedacht. Und warum für etwas, was er gar nicht hatte tun wollen, und nicht für das, was er wirklich und willentlich getan hatte? Sein Mund ist schmal, seine Wangenmuskeln zucken. Sie bleibt stehen, wo sie ist. Er sieht sie an und sie sieht zurück.
Hof Jamme. Leer schwingt die rostige Schaukel im böigen Wind, wie das letzte Zeichen eines viel zu eiligen Aufbruchs. Sie selbst eine heimliche Zeugin, die vom Deich aus Abschied nimmt. Sie sieht Schaulustige im Schritttempo vorbeifahren. Sie lassen das Fensterglas heruntersurren, um den über Nacht verlassenen Hippie-Hof in Augenschein zu nehmen. Subjekte wohnten hier, Elemente. Sie hatten es immer gewusst: Kriminelle. Selbst auf die beträchtliche Entfernung hin meint Mia, die Linien der Selbstgerechtigkeit um Augen und Mund genau zu sehen. Eine Zufriedenheit ohne Lächeln, ohne eine Spur von Glück. Was wussten die von der Schönheit und Wärme jener Abende unter Gauklern und Gestrandeten? Was von einer Fälscherwelt, in der wahrhaftige Menschen mit echten Gefühlen einander besser zu schützen wussten als die meisten Leute einander in einer Welt, in der es ihrer Meinung nach mit rechten Dingen zuging.
Sie selbst im weißen Kittel der Bandagistin. Ihre sich wundernden Finger im hauchdünnen Gewebe der Gaze. Wie kann etwas so zart sein? Wie kann etwas überhaupt heilen? Als Bandagistin ist sie eine Heilpraktikerin; im wörtlichsten Sinne des Wortes. Aber sie kann damit nicht mehr aufhören. Sie ist besessen vom Heilen. Sie ist fixiert auf Gebrochenes und nahe daran, sich absichtlich etwas zu brechen, nur um auch das stillstellen zu können.
Auf dem Amt. Ihr Personalausweis im Reißwolf. Weitestgehende Zerstörung, sagt der Beamte, darum gehe es hier. Maria-Lena Guga verschwindet in einem Schredder der Sicherheitsstufe 3, der Materialpartikel bei einer Schnittbreite von unter zwei Millimeter nicht größer als dreißig Quadratmillimeter auswirft. Nur so sei der Datenschutz zu gewährleisten, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik habe seine Vorgaben. Sie selbst neben ihm, Zeugin ihres eigenen Endes. Der Beamte schiebt sich die Brille immer wieder hoch auf die Nase und spricht über Normen der Zerstückelung. Der personalisierte Chip sei die Crux. »Nicht dass er auf einmal woanders auftaucht und es Sie plötzlich doch wieder gibt.« Vielleicht hat er sie blass werden sehen. »Sie sind ja nun wie neu«, sagt er. »Machen Sie sich keine Sorgen – mehr.« Er sah auf den Schredder, dann auf Maria, die unter seiner amtlichen Ägide zu Mia geworden war, schob die Brille wieder hoch auf die Nase. Was hätte er sonst tun sollen.
Ausschnitte aus der Vergangenheit, gestochen scharf, jederzeit vervollständigbar zu einem Panorama. Die Vergangenheit, zwei Jahrzehnte still und stumm, war da; gesprächig, als wäre nichts gewesen. Aus keinem anderen Grund, als dass Holger Berends an Laminat und Raufaser glaubte, nicht aber an den Teppich, der bei ihm gelandet war.
Woher eigentlich? Warum hatte sie ihn das nicht gefragt? Es würde doch einen Absender geben, der alles erklären könnte. Mit dem man nur telefonieren brauchte – schon wäre die Sache erledigt, der Teppich katalogisiert und archiviert. Gleich morgen früh. Sie hatte sich ins Bockshorn jagen lassen, von einem Kollegen, der wahrscheinlich einfach nur keine Lust auf zusätzliche Arbeit gehabt hatte.
Mia stand auf, ging Richtung Wohnung – und nahm das Gefühl mit, dass die Vergangenheit ihr schattenhaft folgte, als hätte sie, nur weil man einmal miteinander gesprochen hatte, gleich ein Anrecht auf Wohngemeinschaft erworben.
Nie sagte sie sich: nach Hause. Immer sagte sie sich: in die Wohnung. Das klang gut in ihren Ohren. ›Die Wohnung‹ hatte sie damals freundlich aufgenommen. Sie war komplett eingerichtet und offenbar von heute auf morgen verlassen worden. »Wir haben eine Wohnung, aber die muss noch geräumt werden«, hatte die Sekretärin der Wohnungsbaugesellschaft gesagt, »dauert ein paar Tage. Die Entrümpler sind schon bestellt, haben gerade viel zu tun. Alle wollen sie nach Westen. Und nichts soll sie drüben mehr an hier erinnern.«
»Warten Sie mal«, hatte Mia geantwortet, »vielleicht kann ich was davon gebrauchen.« Dann müsse sie aber direkt mal vorbeikommen, hieß es am anderen Ende der Leitung, sonst gehe die Sache ihren – Gang. Mia, damals in einem Greifswalder Studentenwohnheimzimmer, war in den nächsten Zug gestiegen und vom Bahnhof zu der Adresse gelaufen, alle Papiere in der Tasche.
»Dann ma immer rin in die gute Stube«, hatte der Hausmeister gesagt und mit einer ausgreifenden Rundumgeste zur Besichtigung eingeladen, aber Mia, die nur vom Flur aus einen kurzen Blick in die Zimmer geworfen hatte, hatte den Kopf geschüttelt: »Nicht nötig. Lassen Sie alles, wie es ist. Es ist gut so.« – »Na, wenn Sie meinen …« Er hielt inne und sah sie an, als sei ihm plötzlich der Gedanke gekommen, mit ihr könne etwas nicht stimmen: »Sind Sie sicher?« – »Ja, ich bin sicher.« Mit einem Lächeln, doch so ernsthaft und nachdrücklich hatte sie das gesagt, dass der Hausmeister den doppelten Boden des Satzes darin zu spüren meinte. Man hatte ihm angesehen, dass er mit sich rang. Aber was sollte schlecht daran sein, sich sicher zu fühlen. Mit einem »Na denn« gab er ihr die Schlüssel: »Zahlen tun Sie erst ab nächsten Ersten, soll ich Ihnen noch sagen. Wenn wir schon die Räumung sparen. Kostet ja auch, und nicht zu knapp, was?«
Mia wollte daran glauben, dass es für die Vorbewohnerin, die nur ihre Kleidung mitgenommen hatte, diese aber restlos, bis auf einen Morgenmantel, einen guten, einen wirklich guten Grund gegeben haben mochte, ansonsten alles stehen und liegen zu lassen und auf und davon zu sein. Einen besseren als in ihrem Fall. Nicht dass sie hier in einen Ringtausch von gebrochenen Vergangenheiten geraten war. Vielleicht zogen gebrochene Vergangenheiten einander an, wie Menschen einander anziehen, die eine Magersucht überstanden haben oder eine Flucht, die eine Weltreise hinter sich hatten oder eine Insolvenz. Aber ›die Wohnung‹ hatte so gar nichts Unheimliches, im Gegenteil: Sie atmete eine besondere Friedfertigkeit, und in diesem Atem von Friedfertigkeit musste auch sie nicht fortwährend auf der Hut sein. Zuweilen kam Mia der Gedanke, ›die Wohnung‹ habe nur auf sie gewartet. Samt der Kiste Sprudelwasser unter der Spüle, der torffreien Blumenerde auf dem Balkon, den gefalteten Handtüchern im Bad, dem gut sortierten Bücherregal, auf dem neben einer Reihe klassischer und zeitgenössischer Romane einige Bildbände versammelt waren, außerdem Lexika für Englisch, Französisch und Russisch. Am Ende des Regals stand eine geöffnete, aber noch mehr als zur Hälfte gefüllte Flasche Whiskey. Darin sah sie so etwas wie eine Einladung, eine Aufforderung, sich willkommen zu fühlen. Am ersten Abend ihres Einzugs hatte sie unter den Büchern, die sich zu etwa fünfundsiebzig Prozent mit den Büchern in ihrem Elternhaus deckten, wenn auch größtenteils als Ausgaben von DDR-Verlagen, eines herausgezogen, das sie kannte, immer hatte lesen wollen, tatsächlich aber noch nicht gelesen hatte und sich dazu einen Whiskey eingeschenkt. Sie hatte nicht gewusst, wie gut das zusammenpasste: lesen und zwei (nicht ein oder drei) Gläser Whiskey trinken. Seitdem war kein Tag ohne dieses Ritual zu Ende gegangen.
Mit der Zeit war sie darauf gekommen, dass das Geheimnis der Geborgenheit der Wohnung darin lag, dass alles an ihr ›mittel‹ war: gelegen in mittlerer Wohnlage; eingerichtet mithilfe eines mittleren Einkommens; bestückt mit Kulturgütern einer mittleren Bildung. Möbel, Bettzeug, Geschirr: allesamt mittlere Preisklasse. Der Sprudel »medium«. Selbst hinsichtlich des Whiskeys fand sie beim Nachkaufen dieses Prinzip eingehalten: nicht zu billig, nicht zu teuer. Als hätte dieser Jemand, der ihr unwissentlich alles Notwendige für ein neues Leben bereitgestellt hatte, peinlich darauf geachtet, das arithmetische Mittel nicht zu über- oder unterschreiten, um ja keine Turbulenzen auszulösen. Und schließlich war ihr auch klar geworden, dass das, was sie nahezu als Wunderwerk empfand, tatsächlich sehr weit verbreitet war, ja, die Norm selbst: Die Menschen in ihrer Umgebung hatten sich offenbar größtenteils seit Generationen gemittelt. Für sie, deren Leben immer von einem extremen Zustand in den anderen geraten war, nahm dieses vorgesetzte Mittelmaß die Form einer Therapie an. Im Mittel stockte einem nicht immer wieder der Atem. Im Mittel hielt man sich auf wie in bequemer Kleidung: engte nicht ein, schlotterte auch nicht herum. Nur einem Aspekt ihrer neuen mittleren Existenz hatte sie sich entzogen: Sie kochte nicht. Nicht mit der beschichteten Pfanne, nicht mit einem der drei Edelstahltöpfe, nicht mit den hölzernen Kochlöffeln, nicht mit den genau zwölf Gewürzdöschen auf dem kleinen Regal neben dem Herd. In ihrem Leben hatte seelische Selbsterhaltung immer an erster Stelle gestanden, für die leibliche ging sie außer Haus. Sie hatte das Gefühl, wenn sie anfangen würde zu kochen, könnte sie nicht rechtzeitig aufbrechen, falls das noch einmal notwendig werden würde. Dass am Ende ein Auflauf im Ofen oder ein Abwasch in der Spüle sie vom Weggehen abhalten würden; im Falle eines Falles. Aber da ›die Wohnung‹ exakt in der Mitte zwischen einem vietnamesischen und einem italienischen Imbiss lag und auf der gegenüberliegenden Seite zwischen einer nordostdeutschen Fischbratküche und einer Bäckerei mit Frühstücksangebot, schien alles dennoch – im Lot.
Als Mia sich in den Sessel neben dem Regal setzte und sich den ersten der zwei abendlichen Whiskeys eingoss, schlug sie das Buch dort auf, wo sie tags zuvor ein Lesezeichen eingelegt hatte. Sie las die Buchstaben und las sie nicht. Sie schloss die Augen und sah dieses Grün. Diese Symphonie von Grün hätte man sagen können, wenn der Teppich nicht insgesamt so wenig den pompösen Eindruck einer orchestrierten Fülle gemacht hätte. Eher eine Vielschichtigkeit als eine Vielstimmigkeit war das doch, aber eine, die in Bewegung blieb und von der bei aller Harmonie des grünen Grundtons und seiner Abschattungen doch diese seltsame Beunruhigung ausging. Hinter geschlossenen Lidern versuchte Mia sich daran zu erinnern, wie Helligkeit auf dem Flor zu tanzen schien: so unwirklich, dass sie nahezu einen Sehfehler vorzugaukeln schien, einen, den man haben wollte, mit dem nicht nur der Teppich, sondern der Raum um ihn herum schillernder, lichter wurde. Als ob sich das Grün nirgendwo niederlassen mochte, sondern transparente Mäntel von Gelb und Blau und Türkis und Silber überstreifte und sich vor einem unsichtbaren Spiegel hin und her drehte, so färbte sich hier eine Idee von Grün unentwegt fort, als wolle sie endlos den Pantone-Fächer durchprobieren und selbst den noch variieren – wie Leif, der auf Hof Jamme alle zwölf Wochen sein Zimmer in einer anderen Farbe strich, die er sich von den kopfschüttelnden Mitarbeitern eines nahe gelegenen Baumarktes mischen ließ. Und auf die Frage, warum er dies tue, warum er sich dies antue, antwortete er, er arbeite an seiner Differenzierungsfähigkeit. Es käme ihnen allen zugute.
Aber wie hatte dieser Teppichknüpfer, diese Teppichknüpferin vor einem Jahrhundert eine solche Wirkung erzielt – mit Naturfarben? Mia überlegte, welche Pflanzen Grün erzeugten: Brennnessel, Efeu, Berberitze. Daran erinnerte sie sich. Aber um diese Abstufungen hier hinzubekommen, hätte es ein ganzes Färbearsenal, einen botanischen Garten gebraucht, eine Experimentierwerkstatt. Und wenn doch chemische Färbung im Spiel war? Anilin? Sie müsste auf jeden Fall eine Fadenprobe nehmen. Mia spürte eine innere Aufregung, ein hastiges Hin-und-her-Fahren der Gedanken, eine Anspannung, einen Nervenkitzel. Genau das hatte sie nicht mehr gewollt. Genau das Gegenteil hatte sie sich versprochen von einer Anstellung als Faserarchäologin in einer Universitätssammlung: Generalberuhigung. Generalberuhigung war der Plan gewesen, damals, als sie das rechte Maß nicht mehr halten konnte, buchstäblich, weil ihre Finger zitterten. Maßhalten, diese Idee seelisch beruhigter Menschen. Sie war nicht seelisch beruhigt, sie war das Gegenteil von seelisch beruhigt, auch wenn sie alles, alles dafür tat, dass rings um sie herum alles, alles heilte und sich nahezu nahtlos wieder zusammenfügte – sie selbst war in einem Dauerzustand hellster Aufregung gewesen. Saß bis spät nachts an der Arbeit, wickelte und band und gipste, als hinge die Heilung der Welt von ihr ab. Tausende Meter von Gaze, Zentner von Gips, die sie verarbeitete, konnten ihr die Angst nicht nehmen, dass ihre Welt weiter und weiter zusammenbrechen oder auseinanderfliegen würde, mehr noch, als sie sowieso schon auseinandergebrochen und auseinandergeflogen war. Jetzt würde noch sie selbst auseinanderbrechen und auseinanderfliegen, womöglich während sie gipste und verband.
Der Werkstattinhaber hatte sich gefreut über den neuen Lehrling, der in Rekordzeit Gesellin wurde, deren Fleiß ungewöhnlich war; wahrhaft ungewöhnlich. Erst hatte er sie nicht haben wollen, er stand nicht auf Überqualifikation. Abi-Schnitt von 1,7 – wo auch ein akzeptabler Hauptschulabschluss gereicht hätte. Nun hatte er schon Andeutungen gemacht, ob nicht sie es vielleicht sein könnte, die eines nicht so fernen Tages den ganzen Laden übernehmen würde. Er sah nicht, was Frau Eggers, Bandagistin sei 1984, sehr wohl sah, dass nämlich bei diesem jungen Menschen hier das Fixieren zur fixen Idee geworden war, alles andere als gesund. Eines Abends, als Frau Eggers schon Kittel gegen Mantel getauscht hatte, war sie, ihre Handtasche fest im Griff, an Mias Werktisch gekommen, um sich zu verabschieden. Dann aber, nachdem sie Mia lange angesehen hatte, sagte sie nicht: »Bis morgen früh«, sondern etwas, was sie längst hätte sagen wollen oder müssen, nämlich: »Du heilst dich ja kaputt, Mädchen, mach doch lieber was anderes, was ganz anderes.« Mia, die gerade dabei war, ein Stützkorsett zu fertigen, hatte einen Kloß im Hals und keine Idee, was sie antworten, geschweige denn, was sie anstelle der Bandagiererei tun könnte. Frau Eggers hatte den Mantel noch einmal aufgeknöpft, die Tasche abgestellt und sich seufzend auf einem Stuhl niedergelassen.
»Ich sag dir was: Ab nächstem Jahr sind wir nicht mehr Bandagisten, sondern ›Orthopädietechniker‹. Das ist doch kein Name … Ist das noch unser Beruf? Das klingt doch nicht. Also, ich höre auf … Geh zu meiner Tochter nach Stuttgart. Fang noch mal ganz neu an. Frische Säfte werd ich verkaufen, in ihrem Laden. Sach mal noch nix. Wird ihn schwer treffen, den Chef …«