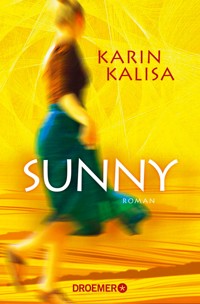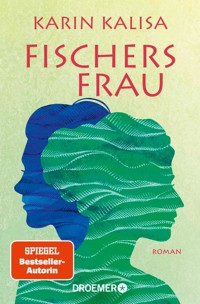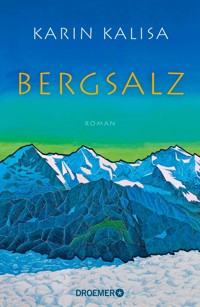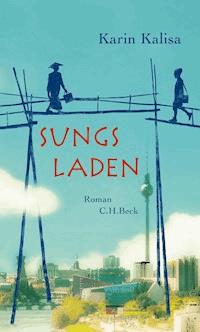8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nora Tewes hat die perfekte Radiostimme - und einen Plan. Im Rundfunk will sie einen Täter stellen, dem ihre Mutter als Kind ausgeliefert war. Er wurde nie belangt, inzwischen ist das Verbrechen verjährt. Aber nicht vergeben. Am Mikrofon beginnt sie ein gefährliches Spiel. Doch mithilfe von Simon, einem Rechtsreferendar, eröffnet sich ein anderer, ein besserer Weg. Nicht unbedingt legal, aber hochwirksam. In ihrem politisch brisanten Roman erzählt Karin Kalisa, behutsam und doch voller Energie, von der Suche nach Gerechtigkeit, von Freundschaft, Mut und dem unbeirrbaren Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit.
Wenn sie zu hören ist, werden die Radios lauter gedreht und stocken die Gespräche: Nora Tewes hat die perfekte Radiostimme - und einen Plan: Auf 100.7, einem Sender, den sie mit zwei Freunden gegründet hat, will sie einen lange davongekommenen Täter in die Enge treiben.
Überstürzt ist Nora in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um ihrer Mutter, die im Sterben liegt, nahe zu sein. Unter der Last des viel zu frühen Abschiednehmens bricht eine nur oberflächlich verheilte Wunde auf, und ein Verbrechen, dessen Opfer ihre Mutter als Kind geworden ist, wird offenbar. Nora erstattet Anzeige und erhält eine niederschmetternde Antwort: Verjährt.
Am Mikrofon beginnt sie ein gefährliches Spiel, um die Hörerschaft gegen den Täter zu mobilisieren. Als es schon fast zu spät ist, findet sie gemeinsam mit Simon, einem Rechtsreferendar, einen anderen Weg. Da ss dabei die Grenzen der Legalität strapaziert werden, ist eine Sache. Eine andere die Frage, was Nora und Simon einander sein können außer "companions against crime".
Temporeich, unverwechselbar im Ton, mit eigenwilligen Charakteren, die man nicht mehr vergisst, erzählt Karin Kalisa in ihrem neuen, schmerzlich-schönen und politisch brisanten Roman davon, wie beherztes Handeln die Suche nach Gerechtigkeit vorantreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Karin Kalisa
RADIOACTIVITY
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Wenn sie zu hören ist, werden die Radios lauter gedreht und stocken die Gespräche: Nora Tewes hat die perfekte Radiostimme – und einen Plan: Auf 100.7, einem Sender, den sie mit zwei Freunden gegründet hat, will sie einen lange davongekommenen Täter in die Enge treiben.
Überstürzt ist Nora in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um ihrer Mutter, die im Sterben liegt, nahe zu sein. Unter der Last des viel zu frühen Abschiednehmens bricht eine nur oberflächlich verheilte Wunde auf, und ein Verbrechen, dessen Opfer ihre Mutter als Kind geworden ist, wird offenbar. Nora erstattet Anzeige und erhält eine niederschmetternde Antwort: Verjährt.
Am Mikrofon beginnt sie ein gefährliches Spiel, um die Hörerschaft gegen den Täter zu mobilisieren. Als es schon fast zu spät ist, findet sie gemeinsam mit Simon, einem Rechtsreferendar, einen anderen Weg. Dass dabei die Grenzen der Legalität strapaziert werden, ist eine Sache. Eine andere ist die Frage, was Nora und Simon einander sein können außer «companions against crime».
Temporeich, unverwechselbar im Ton, mit eigenwilligen Charakteren, die man nicht mehr vergisst, erzählt Karin Kalisa in ihrem neuen, schmerzlich-schönen und politisch brisanten Roman davon, wie beherztes Handeln die Suche nach Gerechtigkeit vorantreibt.
Über die Autorin
Karin Kalisa, ausgebildet in Japanologie und Sprachphilosophie, lebt in Berlin. Ihr Debütroman «Sungs Laden» (2015) stand 27 Wochen lang auf der Bestsellerliste und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
Inhalt
I: ON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
28.
II: STAY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
III: OFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Hinweise
Nachbemerkung
Anregungen und Informationen habe ich aus folgenden Publikationen gewonnen
Wörtliche Übersetzung der lateinischen Passage aus «Stabat Mater» auf S. 343
Hilfreiche Gespräche hinsichtlich verschiedener fachlicher Aspekte des Romans habe ich führen dürfen mit
Für Lektorat und Korrektorat danke ich herzlich
Für W.
Consider the Tender Frequency of Blue in a Rageous Heart
Chorals of the Sea, Anonymus
I
ON
1.
Als sie das erste Mal auf Sendung ging, ließen die Vorarbeiter im Hafenbüro ihre Einsatzpläne sinken. Auf den Schleppern, wo gerade die Buchungslisten besprochen wurden, hielt man inne und sah durch die Luken auf die glitzernden Wellenkämme der auflaufenden Flut. Die Autofahrer, die vor den Schleusen warteten, beugten sich nach rechts, um das Radio lauter zu drehen. An den Frühstückstischen der Stadt stockten die Gespräche, und selbst die Halbwüchsigen, die nichts zur Unterhaltung beigetragen hatten, schauten einen Augenblick lang interessiert auf.
«Guten Morgen, Seeleute», hatte die Moderatorin gesagt, «ihr Leute auf See und an der See, hier schicke ich euch ein Bandoneon vorbei, das euch auf Nordmeerwellen in den Tag trägt. Damit ihr euch daran erinnert, warum ihr hier lebt trotz Werftenkrise und Konjunkturflaute, warum ihr nicht aufgegeben habt und Binnenschiffer geworden seid, warum euch keiner hier wegkriegt und warum Normalnull für euch das Höchste ist. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird und was einem japanischen Dichter zufolge alles in eine Tasse Tee hineinpasst. Wer euch das verspricht? Holly Gomighty. Auf 100,7.»
Nichts, was sie sagte, war so außergewöhnlich, dass es den morgendlichen Betrieb in einer mäßig ausgeschlafenen Hafenstadt hätte stocken lassen müssen. Es war ihre Stimme. Eine perfekte Radiostimme, aus dem mitteldunklen Register. Es lag auch daran, wie diese Stimme sprach: ganz im Tonfall hiesiger Wasser und doch angereichert mit der Melodie fremder Küsten. Und wofür sie die Leitung jetzt freigab: dieses Bandoneon mit seinem kehligen Möwenton, das an die fünf ineinanderrauschende Akkordeons im Schlepptau haben musste, in deren Fahrwasser wiederum eine gute Handvoll Streicher und Bässe einander aufwiegelten. Dann, noch weiter im Hintergrund, irgendetwas Stimmhaftes – ob menschlich oder elektronisch, ob aus dieser Welt oder aus einer anderen, war schwer zu sagen. Und das alles zusammen machte, dass man in die Wellen gezogen wurde, abwärts aufwärts, abwärts aufwärts, im rastlosen Anlauf dicht gebündelter Achtelnoten, die es kaum abwarten konnten, sich in den Sog des nächsten Legato zu stürzen.
Hätte man bei Tee und Teer erst einen Programmdirektor fragen müssen, ob die Biscaya, so wie sie durch die zweiundsiebzig Knöpfe des Bandoneons hindurch in die neubelegte UKW-Frequenz hineinrauschte, nicht der ideale Eröffnungssong für einen neuen Nordseesender sei, wäre es womöglich nicht so weit gekommen. Um Himmels willen, hätte der gesagt, das ist Achtziger, Big Band, schon alles gar nicht mehr wahr. Kinder, das ist: NO GO. James Last! Das ist ein anderes Jahrhundert, ein anderes Jahrtausend, das ist siebzig plus; Tanztee, nicht Radio. Ihr findet etwas anderes. Aber mit dem wasserklaren Instinkt einer am Meer Geborenen hatte Holly Gomighty gewusst, was Instrumente, die ihre Töne durch nichts als frischen Luftzug und ein paar frei schwingende Metallzungen hervorbrachten, generationsübergreifend auslösen konnten. Sie wusste, dass in diesem Moment jeder Kitschverdacht beiseitegeschoben und die Lautstärkeregler der Empfangsgeräte hochgedreht wurden. Und sie wusste genau, wie das Stück klang, wenn es erst einmal laut gedreht war, sehr laut. Sie wusste noch mehr: Sie wusste, wie es sich anfühlte, wenn sich diese nordatlantischen Wellen in den großzügigen Abmessungen eines Theatersaales ausbreiten durften und die Säulen eines Mischpults dabei weit in den roten Bereich stiegen. Dorthin, wo man auf einmal mittendrin war in Himmel, Meer und Sonne; in Wasser, Luft und Licht, und wo es nur von einem nichts gab: Erde. Und am Ende wäre der Programmdirektor eben einer gewesen, der mit beiden Beinen fest auf dieser Erde stand und auch Musik in festen Rubriken konsumierte und in all seiner unerschütterlichen Verachtung für Happy Sound und Easy Listening gar nicht gemerkt hätte, dass in dieser peinlichen Nonstop-Dancing-Soße manchmal noch etwas anderes im Spiel sein konnte. Ja, vielleicht hätte er gar nicht gemerkt, dass einem Bandoneon, diesem mollgestimmten Kleinod der Hafenkneipen, ein Happy Sound gar nicht zur Verfügung stand.
Jedenfalls standen Happy Sound und Easy Listening offenbar auch der jungen Moderatorin nicht zur Verfügung. Denn die saß da und starrte vor sich auf den Tisch, während mit jedem Takt der Biscaya die Guten-Morgen-Munterkeit in ihrem Gesicht sich in Verlorenheit verwandelte und Verlorenheit in Tieftraurigkeit, so bodenlos, dass sie jedem, der ihrer gewahr geworden wäre, eine kalte Hand ans Herz gelegt hätte. Aber so weit kam es nicht. War ja Radio, nicht Fernsehen.
Nachdem Holly Gomighty mit ihrem Griff in die Musiktruhe der frühen 1980er-Jahre der Seestadt viereinhalb Minuten lang ihr Element ins Ohr gespült und den Wetterbericht verlesen hatte – in dem Nordatlantik und Nordseebucht meteorologisch eng zusammenrückten, denn in beiden Fällen waren Orkanböen zu vermelden gewesen –, nachdem sie außerdem verraten hatte, dass eine Tasse Tee in Japan siebzehn Silben fasst: «Bleibt dran, wenn ihr mehr wissen wollt», da hatte sie ihre Hörer. Sowohl die, die trotz der kleinen Lautverschiebung von l zu m, von Golightly zu Gomighty, eine zierliche Frau im Kleinen Schwarzen vor sich sahen, die nach durchtanzter Nacht mit einem Coffee to go in der einen und einem Croissant in der anderen Hand an einem Schaufenster hängen blieb und über den Rand einer massiven Sonnenbrille hinweg unerschwinglichen Schmuck taxierte, als auch die, denen bislang weder Truman Capote noch Audrey Hepburn oder Tiffanys Preziosen untergekommen waren. Eine Frau, die einen morgens dort abholte, wo man sich gerade aufhielt: hinterm Deich – und dorthin mitnahm, wo ein frischerer Wind wehte: auf die Planken eines Dreimastgaffelschoners irgendwo zwischen Bilbao und Biarritz; ja, die einen dazu bewegte, überhaupt einmal aus dem Fenster zu schauen, denn für die Ablage brauchte man ja nicht zu wissen, wie das Wetter ist, wohl aber, wenn man sich auf See befand; eine Frau, die es schaffte, dass sich ein schlecht gelaunter Chef, eine Mathematikarbeit, ein auf dem Arbeitsweg geplatzter Reifen, ein dunkelrotes Minus auf dem Kontoauszug viereinhalb Minuten lang im ewigen Gang der Wellen auflösten und nach diesen viereinhalb Minuten deutlich weniger bedrohlich daraus auftauchten; eine, die einen mitten im morgendlichen Stau, in der unaufgeräumten Küche, in der Warteschlange am Kiosk mit der Nase darauf stieß, warum man die Mobilitätsaufforderung des Arbeitsamtes in den Wind geschlagen und es hier ausgehalten hatte, obwohl dieser Wind sich dann kräftig gegen einen gedreht hatte; eine, deren Stimme diesen Gegenwind, ja, die sogar die nordatlantischen Orkanböen in eine muntere Brise verwandeln konnte – die wollte man wieder hören, jeden Morgen, jeden Tag. Holly Gomighty. Auf 100,7.
2.
Als ebendiese Holly Gomighty nach ihrer ersten Morgensendung die Treppen der Fachhochschule hinunterging, in deren Dachgeschoss das Radiostudio von Tee und Teer eingerichtet worden war, hatte sie zwar einen Coffee to go in der Hand, aber statt eines Kleinen Schwarzen trug sie Jeans, einen ausgewaschenen Kapuzenpullover und darüber einen Uralt-Parka. Die Sommersprossen auf ihrer hellen Haut hätten ordnungsgemäß zu roten Haaren gehört, doch ihre Haare waren wie ihre Stimme: mitteldunkel. Sie stieg in die Straßenbahn und hielt dem Fahrer ihr Monatsticket hin. Unter ihrem Passfoto stand nicht Holly Gomighty, natürlich nicht, sondern Nora Tewes. Aber die Stimme, mit der sie sich bei einer älteren Frau für eine beiseitegeschobene Einkaufstasche bedankte, war diese perfekte Radiostimme. Fiel hier nur niemandem auf, so ganz ohne Mikrofon.
Radiostimme und Mikrofon, das war die ultimative Kopplung, nicht bloße Verstärkung, das war Verwandlung: von einer Stimme im Raum in einen Raum aus Stimme.
Es war ihr Chef im Tonstudio WU gewesen, der zuerst davon angefangen hatte – kurz nachdem sie bei ihm angeheuert und eines Nachmittags in ebenso nüchterner wie eindrücklicher Wiederholung des Wortes «Test» sämtliche Mikrofone überprüft hatte. «Wenn du die Anlage testest», hatte Walther Ullich gesagt, der sich seit fünfundfünfzig Jahren vorwiegend in fensterarmen, schallgeschützten Räumen aufhielt und mit dem Genuss filterloser Zigaretten seine eigene Stimme auf markante Weise ruiniert hatte, während er aus unzähligen anderen das Beste rausholte, «soll der Test nie zu Ende gehen. Versteh mich nicht falsch», hatte er nachgeschoben, «ich bin ein alter Mann.»
«Wenn du mich dafür bezahlst», gab sie zurück, «teste ich für dich den ganzen Tag. Versteh mich nicht falsch. Ich bin jung und brauche das Geld.»
«Kann ich mir nicht leisten», meinte Walther, ohne die Zigarette aus dem Mundwinkel zu nehmen, «aber du könntest Radio machen nur mit Testläufen, die Leute würden trotzdem einschalten. Eigentlich brauchst du nur ein Mikrofon und eine Sendelizenz.»
«Sendelizenz klingt kompliziert», sagte Nora und zog die Schrauben eines Mikrofonständers an, «nach einer Menge Schwierigkeiten.»
Bei Walther wurde sie auf Stundenbasis bezahlt. Dafür, dass sie nie ein Studium der Tontechnik, nie auch nur eine Grundausbildung in Elektroakustik absolviert hatte, war der Lohn nicht so schlecht. Berechtigterweise, denn tatsächlich machte sie ihre Arbeit gut, besser als manch ein diplomierter Toningenieur, was wiederum daran lag, dass sie beträchtliche Teile ihrer Kindheit zwischen Mikrofonen und Mischpulten zugebracht hatte – an der Seite ihrer Mutter, der Tonmeisterin des Stadttheaters. Ein Vater war nicht da, und als sie noch zu klein gewesen war, um allein zu Hause zu bleiben, und sich kein Babysitter fand, verbummelte sie halbe Nachmittage und ganze Abende in dem schummrigen Studio auf der Halbetage zwischen Parkett und Rang. Sie lernte das Ausbalancieren von Bässen vor dem kleinen Einmaleins, den Umgang mit Rückkopplung, Echo und Schall, lange bevor Physik auf ihren Stundenplan trat. Sie verlernte, sich über den Mangel an Licht und Luft zu beschweren. Im Dunkeln hört man besser, hatte ihre Mutter gesagt. «Aber atmen muss ich auch beim Hören», hatte Nora beharrt. «Diese verwöhnten Kinder von heute», hatte die Mutter entgegnet, «jetzt wollen sie auch noch Luft.»
Luftig genug war es auf den Gittern der Beleuchterbrücke hoch über der Bühne. Zwischen Handzügen und Scheinwerfern hockte sie da, hielt hier ein Seil, dort eine Wechselbirne und lernte das mehrsprachige Fluchen. Dessen unangefochtener Meister war der aus der Karibik stammende Obermaschinist. Er fluchte im Idiom seiner Insel, einem höchst eigengesetzlichen Kreol, aber auch auf Spanisch, Portugiesisch und Englisch. Zudem vermochte er, in begnadeter Intuition, die Flüche seiner von anderswoher auf dem Schnürboden des städtischen Theaters gestrandeten Kollegen zu übersetzen – zunächst in eine der ihm vertrauteren Sprachen und von dort aus in sein eher griffiges denn grammatisches Deutsch. Nora legte sich ein dreispaltiges Vokabelheft zu und notierte diese Transaktionen im festen Glauben daran, dass ihr das Einüben feinsinniger Bedeutungsverschiebungen in groben Ansagen im Leben nicht weniger weiterhelfen würde als Vokabellisten herkömmlicher Art, und ließ sich durch kein verlegenes «Nix für kleine Mädchen» davon abbringen, im Zweifelsfall noch einmal ganz genau nachzufragen.
Als Zwölfjährige rutschte sie auf den Stuhl ihrer Mutter, wenn die mal aufs Klo musste. Und als dann wenig später ihre Stimme derjenigen ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich geworden war, hatten sie beide die Techniker zum Narren gehalten und an eine Tonmeisterin glauben lassen, die im Orchestergraben und im Studio zugleich sein konnte. Nach dem Abitur hatte man sie vom Fleck weg für die tontechnische Assistenz engagieren wollen: Eine geklonte Tonmeisterin zum halben Preis war so ziemlich das Beste, was man sich am Stadttheater vorstellen konnte. Aber sie war dann doch lieber zum Ballett nach Stuttgart und von Stuttgart nach New York gegangen, weil sie schon früh ihre Beine nicht hatte stillhalten können, wenn der Korrepetitor im Proberaum des Ballettensembles dem abgenutzten Gründerzeit-Klavier einen beseelten Chopin abrang. Sie lauerte im Flur auf die ersten Töne und schlüpfte dann durch die Tür, in die letzte Reihe, wo sie einfach das machte, was die andern machten: beugen, strecken, drehen, Plié, Relevé, Arabesque. Man ließ sie gewähren und gab ihr aus Spaß kleine Auftritte im Bewegungschor, bis Madame la Chorégraphe sich eines Tages die Augen rieb und sagte: «Die ist gut, die Kleine, ab mit ihr in die Ausbildung.»
3.
In New York hatte sie von Hafenstadt zu Hafenstadt, von Einwandererhafen zu Auswandererhafen gesimst, gemailt, geskypt, dreitausenddreihundert Seemeilen weggewischt mit zwei Fingerkuppen auf einem Touchscreen. In ihrem Briefkasten in der Halsey Street von Bedford-Stuyvesant dagegen war außer den Abrechnungen des altmodischen Hausbesitzers nie etwas von Bedeutung zu finden gewesen, und dann hatte sie eines Tages doch einen Brief bekommen, und in dem stand etwas, das sie dazu brachte, innerhalb von zwei Tagen ihren Spind leer zu räumen, ihren Namen aus allen Probenplänen zu streichen, ihre Siebensachen in einen Koffer mittlerer Größe zusammenzuraffen und Toshio darüber aufzuklären, dass ihrer beider Zeit vorüber sei. Starr vor Unverständnis und mangelndem Mut, Fragen zu stellen, die offenkundig nicht gestellt werden durften, hatte er wortlos darauf bestanden, ihr den Koffer zur U-Bahn-Station zu tragen. Dort war sie plötzlich noch einmal zurückgerannt, kam wieder mit einer zweisprachigen Ausgabe der Haiku von Issa Kobayashi, die er ihr zum ersten Jahrestag ihres Paarseins geschenkt hatte. Sie hatte ihm den Haustürschlüssel in die linke Hand gedrückt, während sie aus seiner rechten den Koffer entgegennahm. Dann hatte sie ein Ticket gelöst, single trip, zum Flughafen. In der Wartezone heftete sich ihr Blick auf die Leuchtziffern einer Digitalanzeige, die in sechsunddreißig Spalten die verschiedenen Uhrzeiten rund um den Globus simultanisierte. Lange nahm sie darin nichts anderes wahr als den Sekundentakt, der die Welt in Gang hielt. Dann fing sie an, auf dieser Wand den Abstand zu ermessen zwischen Departure und Destination, wie sie auf ihrer Bordkarte angegeben waren. Kurz bevor ihr Flug aufgerufen wurde, zog sie ihr Handy hervor, öffnete es mit einem Fingernagel, nahm die Sim-Karte heraus, zerknickte sie und warf sie in einen Mülleimer. Nicht mehr viel Zeit vertrug nur eine Zeitzone, nicht sechs.
Ihre Heimatstadt empfing sie mit vertrautem Geruch und Klang. Als wäre hier alles beim Alten. Auf dem Bahnhofsvorplatz, zwischen zwei Straßenbahngleisen, brach die Nachricht, die alles verändert hatte, aus ihr heraus, erst in Form von mit Kaffee vermischtem Magensaft, dann in einem Sturzbach von Tränen, der sich in ihr aufgestaut hatte seit jenem Moment, in dem sie den Brief geöffnet hatte und ihre ungläubigen Blicke sich in seiner ersten Zeile verfingen: «Süße, du und ich, wir zwei sind jetzt mal ganz tapfer.»
Nachdem sie eine Reihe wohlmeinender Menschen abgewehrt hatte, die guten Willens waren, ihr Trost zuzusprechen, wofür oder wogegen auch immer, und sie auf einer Bank abgewartet hatte, bis die Krämpfe in Magen und Kehle leerliefen, ging sie in das Krankenhaus, in dem sie geboren worden war, suchte die gynäkologische Station, dachte den bitteren Gedanken, dass das Leben hier gerade kopfstand, verkehrt herum war, von einer hinterhältigen Absurdität, einmal ganz zu Ende, vertrieb ihn, verbot ihm, wiederzukommen, klopfte, öffnete die Tür, nahm alle Kraft zusammen und sagte: «Hey, Mom, ich wär auch so mal wieder vorbeigekommen. Musst nicht gleich mit so was Heftigem auffahren.»
Ihre Mutter hatte den Kopf zur Tür gedreht und gelächelt wie eine, die vergessen hatte, wie Lächeln geht, und nun darüber lächeln musste, dass es ihr auf einmal dennoch gelang. Sehnsucht und eine Traurigkeit, die schon auf halbem Weg war zu einer Stille, in die nur sie allein hineinlauschen konnte, zogen durch ihr Gesicht, das nichts mehr verbergen konnte – oder wollte.
Nora richtete sich in der kleinen Wohnung ein, in der sie Kind gewesen und groß geworden war, wusch die Wäsche der Mutter, schnitt Obst und Leckereien zurecht und ließ auch dann nicht davon ab, als ihr klar wurde, dass sie ein ums andere Mal unangerührt im Behälter für Essensreste hinter der Krankenhauskantine landen würden. Längst hatte der Magen ihrer Mutter angefangen, sich leicht zu machen – zugunsten des Kopfes, der es mit einer Flut von Bildern und Gedanken aufzunehmen hatte, die schwer wogen und durchdrungen werden mussten in Hinblick auf das, was noch festgehalten, und das, was losgelassen werden durfte. Und auf das, was sich auf diese Unterscheidung nicht einließ.
4.
Nachdem sie ihre Mutter zu Grabe getragen hatte, ihre Fassungslosigkeit eingekapselt und ruhiggestellt von einem Körper, der seltsam ungerührt vor sich hin funktionierte, ging sie morgens nicht ins Krankenhaus wie alle einundfünfzig Tage zuvor, sie ging ans Wasser. Durch kleine Straßen, über grüneiserne Brücken, zum Alten Hafen, von dort ans Meer. Zwischen den alten Pollern setzte sie sich auf die Basaltsteine, an deren tangschlierigen Kanten sie sich als Kind die Knie aufgeschlagen hatte, ließ ihre Blicke den vorüberziehenden Schiffen folgen, prüfte mechanisch ihre Sehkraft, indem sie die Schiffsnamen mal nur mit dem linken, mal nur mit dem rechten Auge zu entziffern versuchte, Lady Saliha, Ebba 2, Finnsea, prüfte die Windrichtung mit einem nassen Zeigefinger, schaute aufs Wasser und schwieg. Alles wie immer und doch nichts wie immer, weil niemand am Stand ihrer Kurzsichtigkeit interessiert war oder daran, woher der Wind heute wehte, oder daran, einvernehmlich nichts zu sagen, um auf das Spiel der Wellen und das Kreischen der Möwen zu lauschen und sich Schalldiagramme dazu vorzustellen. Sie wartete auf Nachricht, und manchmal meinte sie, eine zu vernehmen, im Flügelschlag eines Vogels, im Heranwehen eines Schilfhalms, im Aufleuchten einer Glasscherbe zwischen dem angespülten Rollholz – auf einer völlig neuen Frequenz.
Ließ sich eine Nachricht nicht einfangen, aß sie sich ihre Mutter herbei. Mit Äpfeln. In ihrer kleinen Mutter-Tochter-Wohngemeinschaft hatte es oft an allem Möglichen gefehlt; nie an Äpfeln. Äpfel waren ranghöchstes Lebensmittel und letzter Rückhalt. Ihre Mutter, die gelernt hatte, in allen Lebenslagen zu improvisieren und sich durch Engpässe, zeitliche oder materielle, kaum jemals aus der Ruhe bringen zu lassen, wurde nervös und neigte zu Kurzschlusshandlungen, wenn der Vorrat an Äpfeln zur Neige ging. Als könne sie nun ihrer Mutter ein Zeichen geben, dass sie gut versorgt war mit dem Nötigsten, saß Nora dort, wo Deich und Meer einander berührten, und aß Äpfel. Als ließe sich eine Nabelschnur ins Jenseits legen, kaute sie Pektin und Folsäure, Vitamine und Jod aus Schale und Kerngehäuse heraus, um die Mutter mit zu versorgen auf der letzten Reise.
Wenn sie lange am Wasser gesessen hatte und ausgekühlt war bis in die weiß gewordenen Fingerspitzen, ging sie in die Stadthalle zum Eislaufen. In der Wohnung hatte sie in einer Kiste unter dem Sofa ihre Schlittschuhe wiedergefunden – aus jener Zeit, in der noch nicht entschieden gewesen war, ob sie sich lieber auf einer rosa Satinspitze oder einer scharf geschliffenen Metallschiene um die eigene Achse drehen wollte, bis Himmel und Erde die Plätze tauschten. Ein Gefühl, nach dem man süchtig werden konnte. Die Spitzenschuhe waren in Übersee geblieben, in einer Welt, in der es Chopin, Janáček, Toshio und ein kleines Café Ecke Quincy Street gegeben hatte – und eine Mutter, die über verschiedenste Kanäle das neue Programm des Stadttheaters kommentierte. Sie nahm die Schlittschuhe mit ihrem brüchig gewordenen weißen Leder und glitt auf das Eis, um den Himmel auf den Boden zu holen oder den Boden in den Himmel zu treiben, wie damals. Aber dann waren auf einmal ihre Beine an Pirouetten nicht mehr interessiert, sondern nur daran, mit den Kufen in das dunkle Schimmern hineinzuritzen, schnell, hart und unnachgiebig, Runde für Runde, dann das aufgeriebene Eis zusammenzuschieben mit Stopps aus voller Fahrt heraus, sich an die Bande fallen zu lassen und zu beobachten, wie die Eisbearbeitungsmaschine diese Narben abschliff und eine spiegelglatte Fläche hinter sich zurückließ. Wie neu. So konzentriert starrte Nora auf das monotone Hin und Her der Maschine, dass die Fahrer sie fragten, ob alles in Ordnung sei. «Ich finde, ihr macht sie zu schnell wieder glatt», sagte sie.
«Ja, das meinen sie alle, bis sie in den Rillen auf die Schnauze fliegen, dann sind wir hier wieder schuld», riefen sie zu ihr herüber.
«Das ist auch nicht richtig», rief sie zurück.
Die beiden Fahrer nickten ihr zu und zogen weiter ihre Bahnen, während Nora am Eingang zur Fläche mit dem Schlittschuh die neue Glätte abtastete und überlegte, wohin die Maschine den Abschliff wischte, letzten Endes.
Von der Eishalle ging sie ins Tonstudio. Am Mischpult blieb sie an Walthers Seite, der wenig fragte, weil er zu rauchen hatte und die wenigen Fragen, die das Leben ihm offengelassen hatte, lieber sich selbst stellte. Nora dankte ihm seine Schweigsamkeit mit Verlässlichkeit, Überstunden und Wochenenddiensten. Davon konnte sie nicht genug haben. Denn anders als Walther Ullich stellte ihre Wohnung Fragen. Irgendwann stand eine Liege im Tonstudio WU. Für wenn sie es nicht nach Hause schaffte.
5.
Im Tonstudio WU war es auch, wo sie ein halbes Jahr nach ihrer Rückkehr aus New York Grischa und Tom wiedergetroffen hatte. Ihre Zwei-Mann-Band nannte sich LogMen, womit die beiden meinten, ihrem Studienfach, der Logistik, Reverenz zu erweisen, nicht ohne dabei auch auf seemännische Navigationskunst anzuspielen – was nicht unmittelbar zündete, genauso wenig wie ihr mäßiger Folkrock-Verschnitt, den Nora in einer Eins-a-Tonqualität abmischte.
«Jungs», hatte sie mit der Offenheit einer Schulfreundin gesagt, die darauf zählte, dass, hatte man gemeinsam einen manisch-depressiven Klassenlehrer, eine schwerhörige Englischlehrerin und einen dichtenden Direktor durchlitten, diese Verbindung belastbar war, «da ist kein Kawumm drin. Nicht am Anfang, nicht in der Mitte, nicht am Ende. Irgendwo müsst ihr es krachen lassen, sonst kommt ihr nie ins Radio.»
Tom, der sich keine Illusionen über die Durchschlagskraft von LogMen gemacht zu haben schien und gerade lustlos seine Gitarre verstaute, zerrte am Reißverschluss und meinte, statt darauf zu warten, dass die im Radio sich ihrer erbarmten, würde er sowieso lieber selbst Radio machen, dann könnte er auch selbst auflegen – sich selbst auflegen: LogMen eben. Grischa sah ihn interessiert von der Seite an. Dies schien ihm ein ebenso schlichter wie schöner Gedanke zu sein. «Wie damals, nur größer», fuhr Tom fort, «wisst ihr noch, das Schülerradio?»
Da es ja noch nicht so ewig lange her war, erinnerten sich Grischa und Nora tatsächlich sehr genau an den Piratensender, für den Tom mit einem älteren Freund eine freie Frequenz gekapert hatte und neun Monate lang vom Schlepper seines Onkels aus ein gefeiertes Programm gemacht hatte: Die Ergebnisse der Mathe-Hausaufgaben aus der gesamten Mittel- und Oberstufe hatte er übersichtlich geordnet und in sachlicher Artikulation – wie weiland die Durchsage der Einsätze für die Hafenarbeiter: «Gänge 3 und 4, Vorarbeiter 2 und 5» – denen weitergereicht, die den wahren Schulfunk zu empfangen wussten. Die Nachmittagstreffpunkte der schulischen Subkulturen wurden ebenso durchgegeben wie die Information, wo es die Großpackung Milky Way gerade im Sonderangebot gab. Bis eines Tages ein kleiner Weltempfänger mitten auf dem langen Tisch im Lehrerzimmer gestanden hatte, ein druckfrischer Wälzer zum Rundfunkrecht in den Händen des Direktors, dreißig Lehrkräfte im Halbkreis um ihn herum, die, je nach Persönlichkeitstyp, amüsiert oder aufgebracht Toms Stimme lauschten, wie sie durch die Untiefen des Stimmbruchs hindurch die Ergebnisse deklamierte: «Prozentrechnung der 7c. Arbeitszettel S. 1, Aufgabe 3: 24%, ich wiederhole: 24%, Aufgabe 2: …»
Grischa schaute versonnen auf das Mischpult, an dem sich Nora mit ihrem Song abgemüht hatte. «Im Radio», sagte Grischa, eher zu sich selbst als zu den anderen, «musst du was zu sagen haben. Gute Mucke allein reicht nicht.» Tom sah Grischa an wie einer, der sich für eine weit geöffnete Tür bedankte. «Hast du doch», entgegnete er, «wer, wenn nicht du? Du sagst, was zu sagen ist, gehst damit auf Sendung, und die Welt ist dein Zeuge.»
Nora verfolgte diesen Wortwechsel und erinnerte sich durch Grischas Bart, durch seine ersten Stirnfalten und den dicken Zopf seiner blonden Haare hindurch an den schmalgesichtigen Grischa mit den halblangen Locken, an seine nachtblauen Augen, die ins Grüne kippten, wenn er sich freute oder aufregte: der ganze Junge ein einziges Meeresleuchten. Von der Schwarzmeerküste hatten seine Eltern ihn, gerade dreijährig, in jenes Land zurückversetzt, aus dem seine Vorväter stammten und das glücklicherweise auch über eine Küste verfügte, wenn auch eine kühlere. Unverdrossen hatte Grischa in der Schule für Windräder geworben, Lehrer in lange Diskussionen über Entwicklungshilfemodelle verstrickt, alle Vorzüge von Basisdemokratie in komplexen Tafelbildern gebannt, die von Schülern abfotografiert wurden, um sie ihren Erziehungsberechtigten unter die Nase zu halten, und von Lehrern, um nachfolgende Schülergenerationen damit zu beeindrucken. Mit dem aus seinem Geburtsland importierten rollenden R erklärte er die Prinzipien des Crowdfunding, lange bevor dieser Begriff in aller Munde war, ging auf dem Schulhof für Seehundstationen auf Juist und Ackergerät in Burkina Faso sammeln und studierte mit einem stetig schrumpfenden Chor unbeirrt Arbeiterlieder ein. Offenbar hatte sich seine Gemütslage seitdem wenig geändert. Immer zur Stelle, wo etwas im Argen lag.
Grischa, die Gitarre auf dem Rücken, hatte die Hand schon an der Türklinke gehabt, als er Toms Gedanken aufnahm: «Klar habe ich was zu sagen, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wer will das hören?» Nora und Tom sahen einander an. Das klang alarmierend resignativ, für Grischas Verhältnisse. Tom zog Grischa am Ärmel zurück auf den Stuhl neben sich. «Du musst die Leute eben dort kriegen, wo sie nicht wegkönnen. Morgens, kurz vor den 7-Uhr-Nachrichten, wenn sie sich ihre Zähne putzen oder im Auto vor der Schleuse stehen. Da sind sie hilflos, hören alles, ob sie wollen oder nicht; es sickert in ihre Hirne, weil sie noch nicht wach genug sind, um sich dagegen zu wehren.» Grischa sah Tom an, noch immer halb zum Gehen aufgelegt und halb zum Bleiben: «Und dann schalten sie doch wieder um», sagte er. «Tun sie nicht», antwortete Tom, «sie haben Angst, den Wetterbericht zu verpassen.»
Nora goss den beiden Tee ein. Außer Leitungswasser bot man im Tonstudio WU zwei Getränke an: Cola und schwarzen Tee, Letzterer von Walther Ullich in Fünfliterkannen mit der gleichen Sorgfalt zubereitet wie die Abmischungen auf Band. Zwei Drittel Assam, ein Drittel Ceylon. Auch ihre eigene Tasse füllte sie nach, führte sie an den Mund und pustete die Hitze weg. Wie in einer Windbö von einer indischen Hochebene her wirbelten ihre Gedanken durcheinander: … und die Welt ist dein Zeuge … die Leute kriegen, wo sie nicht wegkönnen … gerade noch rechtzeitig … dranbleiben … wenn alle dranbleiben müssen … muss ich erst recht dranbleiben … erst recht … erst das Recht und wenn nicht erst das Recht, dann …
«In Ordnung», meinte Grischa, dessen Gesichtszüge sich belebten, ob durch den würzigen Tee oder das Fahrt aufnehmende Gespräch, «du machst den Wetterbericht, ich die Weltverbesserungsnachrichten.»
«Oder auch mal umgekehrt: Du die Wetterverbesserung und ich den Weltbericht.» Tom stieß Grischa in die Rippen.
«Und die Sondermeldungen, die mache ich», sagte Nora und lächelte die beiden an.
«Wenn du dabei bist, kauft man uns auch schlechtes Wetter ab», meinte Tom.
«Aber keine schlechte Welt», sagte Grischa, «das ist das Problem.»
«Wart’s ab», meinte Nora, «lasst uns doch mal einen Namen finden.» Sie hatte den Sessel am Mischpult verlassen und umkreiste die Standmikrofone. Die Sache hier musste vorangetrieben werden, notfalls mit einer Namenssuche, die ihr im Grunde gleichgültig war, wenn sie damit nur dieser Möglichkeit näher käme, die sich abzuzeichnen begann, zaghaft, voller Sogkraft.
Tom, der die Rolle des federführenden Radiomachers nicht so schnell aus der Hand geben wollte, der das sich anbahnende Revival genießen und nichts überstürzen wollte, beeilte sich dann auch festzustellen, dass ohne Sendefrequenz ein Sendername sich als überflüssig erweisen würde.
Ob Dinge beim Namen zu nennen, nicht die erste Radiopflicht sei, hielt Nora ihm entgegen, und dass man da ja mit dem Sendernamen gleich mal anfangen könne. Sie fixierte den Boden vor sich, als könnte sie aus der abgewetzten Schraffur des Linoleums den gesuchten Namen herauslesen. Tom, erpicht darauf, diese, wie ihm schien, doch reichlich überdosierte Konzentration aufzubrechen, brachte einen ersten Namen ins Spiel:
«Logifunk», sagte er und war sich vollkommen darüber im Klaren, dass dies nach einem Privatinteresse der LogMen klang und außerdem stark an die Mathenachhilfe von damals erinnerte. Ein Insiderwitz, den Nora sofort abblockte. «Lockt Nerds an», sagte sie, «Techniker, Ingenieure, Programmierer. Wir brauchen was für alle, für alle von hier: Local spirit.»
«Regionavy», meinte daraufhin Grischa, «vielleicht mit großem N in der Mitte, wie bei LogMen.» Nora verdrehte die Augen, Tom schüttelte den Kopf: Klang nach einer neuen Privatbahn – zwischen Weddewarden und Ganderkesee. Verkehrt samstags nur alle zwei Stunden. Schienenersatzverkehr. Ging gar nicht. Nora starrte in ihre Teetasse und dann auf den kalfaterten Boden des zum Studio umfunktionierten Docks. «Tee und Teer», sagte sie.
«Schwarzer Kanal?» Tom sah sie an und hob die Augenbrauen.
«Stark, schwarz, gut», antwortete Nora, hob ihre Tasse und sah aufmunternd in die Runde. Grischas Augen begannen, grüne Funken zu sprühen: «Isses, oder?»
Anstelle einer Antwort hatte Tom seine Notenblätter aus der Gitarrentasche geholt und begonnen, auf der Rückseite von Walk on the Wild Side eine To-do-Liste zu schreiben, die begann mit: «Helge anrufen», gefolgt von «Frequenz beantragen», und die ihr vorläufiges Ende fand in dem Eintrag: «Zielgruppenanalyse». Grischa las über Toms Schulter mit und legte beim letzten Eintrag die Stirn in Falten.
«Ein Sender zielt nicht, Tom, er sendet. Und Hörer hören.» Grischa ließ sein R rollen, in Abrundung seiner Verachtung für zu viel Bürrrokratie.
«Grischa, darum geht es: Wer sind unsere Hörer? Junge? Frauen oder Männer? Schüler oder Lehrer, Barfrauen, Banker oder Ökofuzzis wie du?», sagte Tom. «Das musst du im Blick haben.»
Grischa setzte mit großer Geste zur Antwort an, aber Nora schnitt sie ihm ab, ohne auch nur den Ansatz einer Entschuldigung.
«Alle», sagte sie. «Alle sollen es hören.»
6.
Die Frage, wie man nicht weniger als alle erreichen würde, zog dann noch einige grundsätzliche Erörterungen nach sich. Auch die wurden im Tonstudio WU ausgetragen. Kommando Tee und Teer. Dreimal die Woche ab zweiundzwanzig Uhr dreißig. Ausgetragen war wiederum wohl zu viel gesagt, denn mit der Autorität der Mikrofonexpertin und Tonstudioschlüsselinhaberin beschnitt Nora, wenn die Standpunkte sich mehr oder minder einvernehmlich abzeichneten, kurzerhand die Zeit für weitere Argumentationsschlaufen und Rückpässe. Manchmal saß Walther Ullich noch an seinem Pult, hielt die Arme hinterm Kopf verschränkt und nuschelte ein «Junge, Junge» über seine Zigarette hinweg in Richtung Radiogründer, wobei er weder den einen noch den anderen Jungen im Blick hatte, sondern die junge Frau, die aus ihrer in sich gekehrten Traurigkeit jetzt eine Betriebsamkeit hervorbrachte, die ihm die Nackenhaare aufstellte – nicht, weil er etwas gegen energetische Verdichtung hatte, sondern, weil er, technisch sensibel, die Hochspannung spürte, die diesen Willen antrieb. Starkstromradio, dachte er bei sich, das kann was werden.
Ohne sich an Einzelheiten seines bereits Jahrzehnte zurückliegenden Physik-Unterrichts erinnern zu können, hatte Walther Ullich damit ein treffendes Bild für die Dynamik gefunden, die die Zusammenkünfte im Tonstudio WU prägte: drei ziemlich aufgespulte Individuen, die sich phasenverschoben und wechselseitig in Spannung versetzten, dabei ihre Energien potenzierten und sich langsam, aber sicher auf die gleiche Frequenz einpendelten.
Tom war es, der an einem der ersten Treffen unversehens hochtourig wurde, und zwar als Grischa die Frage stellte, welches Format der Sender denn eigentlich haben solle. «Keines, will ich meinen», stieß Tom hervor, mit einer Vehemenz, die die beiden anderen erst einmal sprachlos machte. In ihr Schweigen hinein fing er an, mit der weit ausgreifenden Umständlichkeit all jener, die auf einmal gezwungen sind, sich über das auszusprechen, was sie lange schon im Innersten umtreibt, eine Erklärung abzugeben: Format – beim Radio sei dies nur ein anderes Wort für die öde Wiederkehr des Immergleichen. Wehe, wenn der Sparwitz kurz vor der vollen Stunde ausbleibe oder das Pseudoquiz: «Gewinne hundert Euro, wenn du fehlerfrei drei Wahrzeichen deiner Stadt aufsagen kannst, okay, nahezu fehlerfrei, na gut, eines reicht auch», oder: «Wir verlosen eine Reise in die Alpen: Gehören die Alpen a: in die Norddeutsche Tiefebene, b: ins Ruhrgebiet oder c: ins Gebirge». Und genau dieses Trauerspiel immer genau um halb. Pünktlich sein für nichts, das sei Format. Und in den Minuten dazwischen Musik für die, von denen man meint, dass sie eher nur ein Wahrzeichen ihrer Stadt aufsagen können oder die Alpen mit den Abraumhalden in Duisburg verwechseln.
«Sie nennen das AC, habt ihr schon mal gehört, oder?»
Nora schüttelte den Kopf, Grischa nuschelte etwas von AC/DC, was Tom, in seinem eigenen Film unterwegs, ignorierte.
«Adult Contemporary», fuhr Tom fort, und genau dieser erwachsene Zeitgenosse, der werde ja da erst hergestellt, dudelfunkformatiert, gehirngeschrumpft. Und deswegen könne und dürfe Tee und Teer mit Format nichts zu tun haben, gar nichts. Nicht mit ihm. So wahr er hier sitze. Und tatsächlich saß er ziemlich knapp auf der Stuhlkante, bereit zum Aufstehen und Gehen.
Auch eine weniger tendenziöse Darstellung hätte rasch ergeben, dass Nora und Grischa mit dieser Schwundform der Radiokultur, die sie bislang mit dem Wort ‹Format› gar nicht in Verbindung gebracht hatten, gleichfalls nichts am Hut haben wollten und ihnen nichts ferner lag, als jetzt gegen Toms starke Überzeugungen anzuarbeiten. Grischa, der flammende Reden dieser Art eher aus seinem eigenen Mund gewöhnt war und diesen Seitenwechsel erst verarbeiten musste, dem aber darüber auf einmal ganz gegenwärtig geworden war, warum er mit Tom, dem Leichtfüßigen, noch immer befreundet war – seitdem der ihm damals auf dem Schulhof einen Ball zugepasst und ihn, den Randständigen, ins Spiel gezogen hatte, der ihm wenig später auch noch die Klarinette aus der Hand genommen und eine Gitarre hineingelegt hatte, um ihn einen ziemlich lasziven Offbeat zu lehren –, begann vor sich hin zu nicken. Tom, der ihm immer die leichte Seite der Dinge zeigen wollte, The Big Easy, hatte offenbar doch nicht verlernt, wie das ging: Dinge schwernehmen. Format zum Beispiel, dort, wo es nicht hingehörte. In sorgsamer Vermeidung ebendieses Wortes begann Grischa, behutsam, beinahe zärtlich, nachzufragen: Aber wie solle es denn, hm, aufgebaut sein, wenn nicht …, also Form an sich, verstehst du, Form, nur so eben als, ja, Form, Gestalt, du weißt schon, ist doch nichts Schlechtes, oder? Damit die Hörer sich ein bisschen auskennen. Er zum Beispiel, ehrlich gesagt, stehe auf Nachrichten zur vollen Stunde. Über das, eh, sorry, also die Form, nein, die Darstellung, meine ich, der Nachrichten solle man unbedingt auch noch mal sprechen, aber hier und da ein Anker, wäre das nicht doch irgendwie richtig … damit die Leute wissen, woran sie sind, in etwa, wenigstens …
Tom nickte, so froh darüber, so dankbar dafür, dass er jetzt nicht kämpfen musste, dass hier zwei Menschen waren, die sich nicht über seine roten Wangen, seine gepresste Stimme und seine angespannten Nackenmuskeln lustig machten, sondern sofort begriffen, dass Radio etwas war, das in seiner Gegenwart nicht als Begleitfunk, als Hintergrundgeräusch des Lebens aufgefasst werden durfte, sondern als Lebensrettungsfunk, als der dünne Draht, der einen im Hier und Jetzt hält, wenn die Welt um einen herum versinkt. Eine Sache, die er selbst spätestens mit acht Jahren in buchstäblich ganzer Bandbreite verstanden hatte, als er in die heftigen Streitereien seiner Eltern hinein die Radioprogramme durchzappte, immer auf der Suche nach Stimmen, die stärker waren als die ihren. Dann, mit knapp sechzehn, als er erst nicht wusste, was genau Julia von ihm erwartete, als sie ihn zu sich einlud und kurz zuvor herausposaunt hatte, ihre Mutter begleite ihren Vater auf einer Geschäftsreise, und er die Erkenntnisse aus den wiederaufgelegten Nachmittagssendungen von ‹Radio Romantica›, der Aufklärungsabteilung bei den Piraten, wo eine tiefenentspannte Sexologin Antworten gab, die so klar waren, dass er sie selbst durchs Niederländische hindurch hatte verstehen können, in sich hochladen konnte und die ganze freibeuterische Gelassenheit sich vorteilhaft auf den Krampf in seinem Kopf und seinem Körper auswirkte – hatte Julia dann auch gefunden –; immer wieder war es das Radio gewesen, zumeist das illegale und dabei einzig wahre Radio, das ihn aus dem ganzen Schlamassel rausgerissen hatte, noch dazu mit dem besten Soundtrack, den man sich denken konnte. Dass er all dies hier gar nicht ausbreiten musste, sondern einfach in seinem Anliegen ernst genommen und flankiert wurde, machte es ihm leicht, den beiden schleunigst zu versichern, dass er beileibe keine Freakshow wolle. Freak an dem einen Ende, Format an dem anderen, beides nicht seins. Nora und Grischa warteten ab, in dem Gefühl, dass jetzt jedes Wort zu viel sein könnte.
Seine eigentliche Überzeugung sei ja, dass man Radio für einen Freund mache, hob Tom wieder an. Nicht für einen bestimmten Freund, mehr so für die Idee von einem Freund. Einem Freund erzähle man ja auch nicht immer das Gleiche, das hält der beste Freund nicht aus, sondern man lässt ihn, über Funk, wissen: Egal, wie mies es dir gerade geht, es gibt diese andere Welt da draußen, zumindest einen Moderator und einen Sendemast. Die Piratensender damals, das seien im Grunde alles Freundschaftssender gewesen.
«So wie bei uns», strahlte Grischa ihn an. Tom, leicht geschockt darüber, dass sein hohes Ideal so unversehens in die Konkretion ihres trauten, kleinen Kreises zusammenschrumpfte, und doch angerührt von Grischas unerschütterlicher Begeisterungsfähigkeit, überspielte seine Irritation und meinte: «Freundschaftsradio hoch zwei. Von Freunden für Freunde. Nicht auszuhalten.» Nora, ebenfalls seltsam berührt, nickte nachdenklich. Waren diese beiden Kumpel von früher ihre Freunde? Dort, wo sie die letzten Jahre zugebracht hatte, hatte es Verliebtheit gegeben, Kollegialität, Höflichkeit und Respekt und natürlich auch von allem das Gegenteil, aber Freundschaft? Zwischen der Erinnerung an all das, was angenehm oder lästig, was schön oder schrecklich, jedenfalls nicht Freundschaft gewesen war, und der unfassbaren Vereinzelung, in die sie sich jetzt versetzt sah, schlotterte Grischas hochanaloge Freundschaftsanfrage in ihrer Seele wie ein Gespenst umher. Sie vertrieb es mit einer Reihe sachlicher Erwägungen:
«Auf jeden Fall brauchen wir noch ein paar solcher Piratenfreunde für unser Radio», meinte sie. «Wenn ich die Morgensendung mache, Tom mittags und Grischa abends auf Sendung geht, dann maßschneidern wir noch ein paar Sendeplätze drum herum, und schon passt das, oder?»
Auch wenn hier gerade, im Wind des Freundschaftsthemas segelnd, ihr Radio mächtig Fahrt aufnahm, entging es Tom und Grischa nicht, dass die Lady in ihrer Mitte gerade mir nichts, dir nichts die Morningshow an sich gerissen hatte. Aber da sich mittags und abends ganz gut mit ihren individuellen Leistungskurven deckte, oder anders gesagt, da morgens früh um vier aufzustehen und gute Laune zu verbreiten, im Grunde jenseits ihrer Vorstellungsvermögen lag, protestierten sie nicht und überließen sich der harmonisch-produktiven Stimmung. Sie ahnten schon, dass die nicht von Dauer sein würde. Dafür war die Luft hier einfach zu geladen. AC oder DC oder AC/DC oder nichts von alledem – diese Schnellstraße Richtung Radiosender hatte definitiv etwas von einem Highway to Hell.
7.
Und tatsächlich gerieten Tom und Nora schon wenige Tage später heftig aneinander – als es wieder einmal um die Frage ging, für wen genau Tee und Teer eigentlich auf Sendung gehen solle, und Nora sich immer noch auf keinerlei Zuschnitt einlassen wollte.
«Alle, alle, alle», sagte Tom, «wenn du alle willst, dann musst du auch in allen Sprachen senden. Allen Sprachen der Welt – was sag ich, in allen Sprachen des Alls.»
Grischa beeilte sich, die Ironie in guten Willen umzumünzen: Das sei doch gar keine schlechte Idee, echt jetzt, Tom, einfach mal die Ohren offenhalten, in welchen Sprachen die Schauerleute von werweißwoher und überhaupt die Bewohner ihrer Stadt so unterwegs waren. Sollten nicht gerade die, die nicht so leicht darauf hoffen konnten, jemanden zu treffen, der ihre Sprache teilte, funkversorgt werden?
Nora verzog die Mundwinkel, hob die Augenbrauen und schob ihre Notizzettel geräuschvoll zusammen. Tom verspürte auf einmal große Lust, sie ein für alle Mal, genau: alle Mal, von ihrer Alle-und-zwar-schnell-Schiene zu schubsen.
«Eben», sagte er, «eigentlich müssten wir überhaupt in den kleinsten Sprachen der Welt senden, im Sinne des Artenschutzes. Yugurisch, Korsisch, Friesisch.»