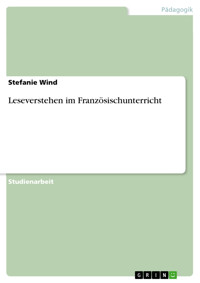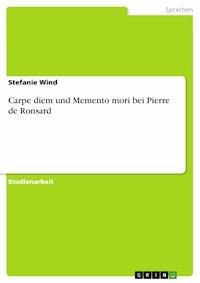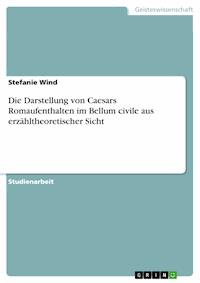18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Didaktik für das Fach Französisch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,5, Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Romanische Philologie), Veranstaltung: Hauptseminar: Romanische Syntax, Sprache: Deutsch, Abstract: Obwohl die romanischen Sprachen alle aus dem Lateinischen hervorgegangen sind und daraus zahlreiche sprachliche Erscheinungen übernommen haben, weisen sie gegenüber der gemeinsamen Ursprungssprache einen deutlichen Unterschied in einem zentralen Teil der Syntax auf: Das lateinische Kasussystem baute sich im Laufe der Sprachentwicklung radikal ab und formte sich um in ein sprachliches System, in dem die Mehrzahl der syntaktischen Relationen durch Präpositionen markiert werden. Die Menge dieser kleinen, für die Herstellung syntaktischer Zusammenhänge aber enorm wichtigen Wörter fand bereits würdiges Interesse in der Sprachwissenschaft. Besonders in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfuhr die Forschung um die französischen Präpositionen neuen Aufwind unter verschiedenen Aspekten. Zumeist handelt es sich in den einschlägigen Arbeiten jedoch um synchronische Betrachtungen. Diachronische Untersuchungen liegen weiter zurück. Wie und warum sich im Französischen und in den romanischen Sprachen überhaupt die Präpositionen in solchem Maß, wie Textuntersuchungen es beweisen, durchgesetzt haben, ist bisher nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Auch in den Monographien, die ausdrücklich den Übergang vom Lateinischen zum Romanischen oder auch konkret zum Französischen untersuchen, wird zwar stets auf den Verlust der lateinischen Kasus hingewiesen, aber die Frage, durch welche Mittel die im Lateinischen durch Kasusendungen ausgedrückten Satzfunktionen in den modernen romanischen Sprachen markiert werden, wurde noch nicht systematisch aufgearbeitet. Die vorliegende Arbeit soll zumindest einen Schritt in diese Richtung machen. Nach einer knappen Darstellung der Problematiken bei der Markierung von Satzgliedern durch Kasusendungen im Lateinischen soll die Häufigkeit von Präpositionen, die bereits in den frühesten lateinischen Sprachstufung eine Alternative oder Ergänzung zum kasuellen System bildeten, in verschiedenen Epochen und Sprachstufen des Lateinischen untersucht werden. Ein starker Fokus wird dabei auf das Vulgärlateinische als Scharnierstelle zwischen klassischem Latein und romanischen Entwicklungen geworfen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit wird die Situation im Altfranzösischen nur in knappen Grundzügen einbezogen. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Hinführung
2. Die Syntax des klassischen Latein – Regeln und Ausnahmen
2.1 Das Grundprinzip der Flexion und seine Schwachstellen
2.2 Der Gebrauch von Präpositionen
2.3 Das Inventar der lateinischen Präpositionen
2.4 Auswertung vorklassischer und klassisch-lateinischer Texte
2.4.1 Vorgehen bei der Auswertung
2.4.2 Zur Textauswahl
2.4.3 Statistische Auswertung der Texte im Vergleich
2.4.4 Besondere Feststellungen zur Auswertung des Präpositionsgebrauchs
3. Die Entwicklung der lateinischen Syntax auf dem Weg zu den
modernen romanischen Sprachen
3.1 Entwicklungstendenzen im gesprochenen Latein und im Protoromanischen
3.2 Verdeutlichungsprozesse und Umstrukturierung des Systems
3.2.1 Abbau der Kasusflexion
3.2.2 Folge: Zunahme im Gebrauch von Präpositionen?
3.2.3 Die vulgärlateinischen Präpositionen
3.3 Auswertung vulgär- und spätlateinischer Texte
3.3.1 Zur Textauswahl
3.3.2 Statische Auswertung hinsichtlich des Präpositionsgebrauchs
3.3.3 Einzelauswertung von den Freigelassenengesprächen in Petrons Satyricon
3.3.4 Einzelauswertung des Reiseberichts der Nonne Egeria
3.3.5 Fazit
4. Die romanischen Präpositionen
4.1 Allgemeine Entwicklungen
4.2 Beispiel: Altfranzösisch
5. Kasusmarkierung im modernen Französisch
5.1 Allgemeine Tendenzen
5.2 Inventar der französischen Präpositionen
5.3 Auswertung französischer Texte
5.4 Gegenüberstellung lateinischer Kasus und französischer Präpositionalphrasen
6. Abschließende Bemerkungen
7. Anhang: Textauswertungen
7.1 Auswertung der lateinischen Texte
7.2 Auswertung der französischen Texte
8. Literaturverzeichnis
8.1 Fachliche Sekundärliteratur
Quellen für das Textkorpus
1. Hinführung
Obwohl die romanischen Sprachen alle aus dem Lateinischen hervorgegangen sind und daraus zahlreiche sprachliche Erscheinungen übernommen haben, weisen sie gegenüber der gemeinsamen Ursprungssprache einen deutlichen Unterschied in einem zentralen Teil der Syntax auf: Das lateinische Kasussystem baute sich im Laufe der Sprachentwicklung radikal ab und formte sich um in ein sprachliches System, in dem die Mehrzahl der syntaktischen Relationen durch Präpositionen markiert werden.
Die Menge dieser kleinen, für die Herstellung syntaktischer Zusammenhänge aber enorm wichtigen Wörter fand bereits würdiges Interesse in der Sprachwissenschaft. Besonders in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfuhr die Forschung um die französischen Präpositionen neuen Aufwind unter verschiedenen Aspekten. Zumeist handelt es sich in den einschlägigen Arbeiten jedoch um synchronische Betrachtungen.[1] Diachronische Untersuchungen liegen weiter zurück.[2] Wie und warum sich im Französischen und in den romanischen Sprachen überhaupt die Präpositionen in solchem Maß, wie Textuntersuchungen es beweisen, durchgesetzt haben, ist bisher nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Auch in den Monographien, die ausdrücklich den Übergang vom Lateinischen zum Romanischen oder auch konkret zum Französischen untersuchen, wird zwar stets auf den Verlust der lateinischen Kasus hingewiesen, aber die Frage, durch welche Mittel die im Lateinischen durch Kasusendungen ausgedrückten Satzfunktionen in den modernen romanischen Sprachen markiert werden, wurde noch nicht systematisch aufgearbeitet.[3]
Die vorliegende Arbeit soll zumindest einen Schritt in diese Richtung machen. Nach einer knappen Darstellung der Problematiken bei der Markierung von Satzgliedern durch Kasusendungen im Lateinischen soll die Häufigkeit von Präpositionen, die bereits in den frühesten lateinischen Sprachstufung eine Alternative oder Ergänzung zum kasuellen System bildeten, in verschiedenen Epochen und Sprachstufen des Lateinischen untersucht werden. Ein starker Fokus wird dabei auf das Vulgärlateinische als Scharnierstelle zwischen klassischem Latein und romanischen Entwicklungen geworfen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit wird die Situation im Altfranzösischen nur in knappen Grundzügen einbezogen. Den Abschluss bildet eine Betrachtung des Präpositionsgebrauchs im Neufranzösischen, und zwar in Original- wie Übersetzungstexten, wobei anschließend eine umfassende Gegenüberstellung der lateinischen Kasus in ihren verschiedenen Funktionen mit den entsprechenden durch eine Präposition markierten Ausdrucksmöglichkeiten des Französischen versucht wird.
2. Die Syntax des klassischen Latein – Regeln und Ausnahmen
2.1 Das Grundprinzip der Flexion und seine Schwachstellen
Im Lateinischen ist das Prinzip der Flexion tief verankert[4]und tatsächlich lässt sich in dieser Sprache eine Vielzahl an synthetischen Wortformen im Nominal- und Verbalbereich feststellen, die ihr trotz der prinzipiellen Grundwortstellung SOV[5]eine große Stellungsfreiheit hinsichtlich der einzelnen Elemente im Satzsyntagma erlauben. Semantisch gleichbedeutend und wegen der Endungen eindeutig verständlich sind die beiden folgenden Propositionen (1) und (2):
(1)Publius filio parvo librum pulchrum dat.
(2)Librum pulchrum dat Publius filio parvo.
Die einzelnen Satzbausteine können sogar noch weiter verschoben und voneinander getrennt positioniert werden:
(1)Librum Publius pulchrum filio dat parvo.