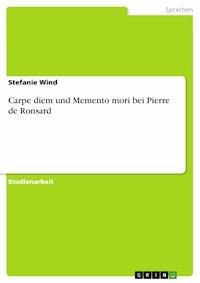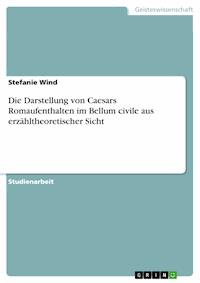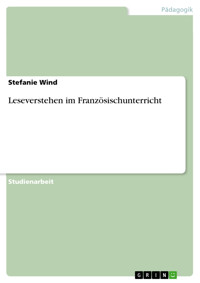
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Didaktik für das Fach Französisch - Sonstiges, Note: "-", Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Romanische Philologie), Veranstaltung: Proseminar: Theorie und Praxis des Französischunterrichts, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit wendet sich in einem theoretischen Teil den wissenschaftlichen Grundlagen des fremdsprachlichen Leseverstehens mit Schwerpunkt des Französischen zu und zitiert dabei namhafte Didaktiker. Daran schließt sich ein sehr ausführlicher praktischer Teil an, der einen Unterrichtsentwurf zum Thema Leseverstehen für die 10. Klasse G8 (F2) präsentiert (Umfang des Unterrichtsentwurfs: 10 Seiten). In der Anlage finden sich ausführliche Materialien zum Unterrichtsentwurf. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Theoretischer Teil: Leseverstehen
1.1 Inhalt und Ziele der Arbeit
1.2 Leseprozess und Lesertypen
1.3 Leseabsicht und Leseverfahren
1.4 Leseverstehen im Unterricht: Übungsgestaltung und Übungsformen
1.5 Fazit für die Unterrichtsgestaltung
2.Praktischer Teil: Unterrichtsentwurf
2.1 Datenteil
2.2 Analyse der Klassensituation
2.3 Die Unterrichtsstunde
2.4 Lernziele der Stunde
2.4.1Verankerung im Lehrplan
2.4.2Lernziel: Methoden der Texterschließung
2.4.3Lernziel: Umgang mit dem einsprachigen Wörterbuch
2.5 Didaktische Analyse
2.5.1Begründung der Auswahl
2.5.2Analyse der Schwierigkeit
2.5.3Förderung von Kompetenzen
2.6 Methodische Überlegungen
2.6.1 Unterrichtsphasen
2.6.2Sozialformen
2.6.3Medien
2.7 Detailplanung
3. Anhang: Materialien zum Unterrichtsentwurf
3.1 Anlage 1: Erwartungshorizont für die Wiederholung
3.2 Anlage 2: Kopiervorlage zum Text „Vous avez dit polyandrie"
3.3 Anlage 3: Erwartungen an die Schüler im ersten Textabschnitt
3.4 Anlage 4: Kopiervorlage für die Verständnisfragen
3.5 Anlage 5: Detailfragen und Erwartungshorizont an die Schüler
3.6 Anlage 6: Übersichtstabelle zur Detailplanung
4. Literaturverzeichnis
4.1 Wissenschaftliche Literatur zum theoretischen Teil
4.2 Literatur zum Unterrichtsentwurf
1. Theoretischer Teil: Leseverstehen
1.1 Inhalt und Ziele der Arbeit
„Die Schüler lernen, Texte vielfältiger Art unter verschiedenen Gesichtspunkten zu erschließen und zu kommentieren, und sie entwickeln eine individuelle Lesekompetenz. Neben der Arbeit mit schriftlichen Texten, bei denen auch die Anwendung unterschiedlicher Lesestrategien trainiert wird, (beschäftigen sie sich mit Hörtexten...).“1 Mit diesen Worten äußert sich die Lehrplanredaktion im Fachprofil für moderne Fremdsprachen zum Thema Leseverstehen und nennt dabei die wichtigsten Ziele, die ein Lerner einer modernen Fremdsprache im Schulunterricht erreichen sollte. Diese sollen im Zusammenhang mit geeigneten Methoden, die zu ihrem Erwerb führen können, im Folgenden unter besonderer Berücksichtigung der Didaktik des Französischen näher untersucht werden. im Anschluss an eine theoretische Einführung in das Thema wird ein konkreter Entwurf einer Unterrichtsstunde zum Thema Leseverstehen vorgestellt.
1.2 Leseprozess und Lesertypen
Beim Lesen finden auf verschiedenen Ebenen ineinander verwobene Abläufe statt, die in ihrem Zusammenspiel zum Verständnis eines Textes führen. Auf der graphophonischen Ebene werden mit Hilfe von Fixationspunkten, zu denen sich die Augen ruckartig bewegen, vertraute Rechtschreibmuster und Morpheme wahrgenommen und der Text damit visuell dekodiert. Gleichzeitig wird auf das mentale Lexikon zugegriffen, in dem die einzelnen Wörter mit ihren Bezeichnungen gespeichert sind, um die Wortbedeutung zu entschlüsseln. Außerdem wird das Gelesene syntaktisch analysiert, wobei hier hinsichtlich des fremdsprachlichen Lesens die Ähnlichkeiten, die zwischen Mutter- und Fremdsprache bestehen, eine große Bedeutung haben und das fremdsprachliche Lesen erleichtern können. Auf der semantischen Ebene beeinflusst vor allem inhaltliches Vorwissen sowie die Kenntnis von Schemata das Verständnis positiv.[1][2]
Jeder fremdsprachliche Leseprozess findet zunächst auf der Basis allgemeiner Leseabläufe und auf der Grundlage des muttersprachlichen Lesens statt. Grundsätzlich muss bei der Dekodierung eines gelesenen Textes von zwei Typen der informationsverarbeitung ausgegangen werden, nämlich von einem beim muttersprachlichen Lesen und im idealfall auch beim fremdsprachlichen Lesen automatisch ablaufenden Teilprozess, der dem Erkennen der sprachlichen Form dient und einem bewussten, der besonders von untrainierten Lesern als mühsam empfunden werden kann und anders als der automatische Prozess keine uneingeschränkte Kapazität besitzt. Nur mit Hilfe dieses bewusstseinsnahen Prozesses jedoch gelingt es, den inhalt des Gelesenen aufzunehmen und zu verstehen.[3] Erfordert aber bereits der Prozess der sprachlichen Dekodierung alle vorhandene Gedächtniskapazität, unterbleibt der Prozess des Verstehens, da für ihn keine Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen.[4] Leseanfänger, bei denen die einzelnen Elemente des Leseprozesses[5] noch nicht automatisch ineinander greifen, müssen sich stark auf die eigentliche Dekodierung konzentrieren und sind häufig darauf angewiesen, sich von ihren Erwartungen steuern zu lassen, die ihrerseits das richtige Verständnis erschweren können. Raten, inhaltliches Inferieren (hierbei kann Vorwissen zum Thema durchaus hilfreich sein)[6] oder auch das Vermeiden schwierigerer Textstellen sind typische Hilfsstrategien schwacher Leser. Nur durch Übung und Erfahrung kann die sprachliche Dekodierung immer weiter automatisiert und das Lesetempo verbessert werden.[7]
Beim Lesen in der Fremdsprache müssen auch geübte muttersprachliche Leser anfangs Strategien schwacher Leser anwenden, solange sie mit Wortschatz und Syntax (besonders an Stellen, wo diese von der muttersprachlichen Struktur abweicht)[8] noch nicht so vertraut sind, dass die Erkennungsprozesse automatisch ablaufen können. Eine unmittelbare Sinnentnahme aus dem Gelesenen wird erst ermöglicht, wenn nicht mehr die gesamte Konzentration auf die Entschlüsselung des sprachlichen Materials gerichtet werden muss.