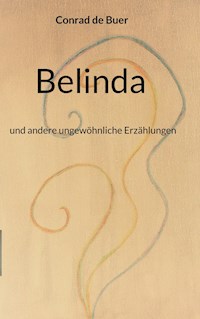1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann man Fliegen eigentlich mögen? Eine wirklich heikle Frage. Jedenfalls dann, wenn man süchtig nach ihnen ist. So wie eben Gideon Walter, der etwas verschrobene Held der vorliegenden Erzählung. Aber man überzeuge sich selbst davon, wie ausgerechnet während eines Kur-Aufenthaltes und einer vielversprechenden Kur-Romanze mit einer attraktiven Frau einem gestandenen Mann seine ungewöhnliche Sucht zum Verhängnis wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Fliegenpizza
Ein Herr mit FliegeSchweinsaugeVon Anwendung zu AnwendungIm GebrechenszooKurorchester auf AbwegenBegegnung bei den FlussauenMissglückte AttackeDie Dame in BlauLust und Leid - GenovevaVerwirrung und VerlangenVersöhnungsessenEin Rückfall ...... und seine FolgenFliege und SonnenschirmÜberreizung der SinneDer Schrei im ThermalbadImpressumEin Herr mit Fliege
Eine Fliege macht noch keinen Gideon.
Wenn er diese flapsige Bemerkung vernahm, huschte ein kurzes, verkrampftes Lächeln über das Gesicht des besagten Herrn. Eigentlich war es kein Lächeln, sondern mehr ein ungewolltes Entgleiten der Gesichtszüge, deretwegen ein Beobachter in dem Moment leicht einen heiteren Gemütszustand könnte unterstellt haben. Heiter war aber womöglich übertrieben; dafür gab sich das Entgleiten zu verkrampft. Korrekt ist auf jeden Fall, dass sich der Gesichtsausdruck der Person veränderte. Und das, so darf der Erzähler behaupten, war das Entscheidende in der ganzen Angelegenheit. Denn gewöhnlich veränderte sich Gideons Gesichtsausdruck nie, was immer um ihn herum auch passieren mochte.
Der grammatikalisch schlicht aufgebaute Satz, den wir unserer kleinen Geschichte vorangestellt haben, muss es also gehörig in sich haben, dass er wie ein Maskenbildner zu wirken verstand. Die Betonung in der Spöttelei liegt übrigens auf eine; im Unterschied zu drei, vier oder unseretwegen auch ein halbes Dutzend Fliegen. Aber das ist nicht so wichtig wie die Teilhabe von Individuen dieser ungeliebten Plagegeister an den merkwürdigen Vorkommnissen in unserer Geschichte überhaupt. Doch wollen wir der Reihe nach berichten. Erst einmal mag die Erwähnung angebracht sein, dass unserem tragischen Helden die Sache mit den Fliegen oder mit einer Fliege, je nachdem, sogar einen Spitznamen eingetragen hat, der da lautet: Herr der Fliegen.
Nur in einem engen Bekanntenkreis verstand man die geflissentliche Anspielung von ihrem tieferen Sinn her, wobei das Wort eng besser nicht den Eindruck erwecken sollte, als hätte unsere Person eine gefühlsmäßige Bindung zu denen, die seinen Namen mit dem Ehrentitel versehen hatten. Denn erstens sendete Gideon im Allgemeinen zu niemandem hin irgendwelche Zeichen einer Empathie. Und zweitens meint Bekanntenkreis auch nur das höchstens halbe Dutzend Mitmenschen, mit denen beruflich zu tun zu haben er gar nicht umhin konnte. Die Enge, von der die Rede war, veranschaulicht also treffender das räumliche Beieinander in dem Büro, in dem der Herr seinem Existenzerwerb nachging als irgendeine gefühlsbetonte Geneigtheit.
Und jetzt errät der mitdenkende Leser gewiss, dass es bestimmt das Büchergewerbe war, in dem Gideon Walter in Lohn und Brot stand. Denn wo anders sollte eine Schar von Beschäftigten einen passenderen, stilvolleren und – wie sich noch zeigen wird - verweiskräftigeren Spitznamen für einen ihrer Mitarbeiter gefunden haben als in dem Gewerbe, in dem Stil und Prägnanz, Bildhaftigkeit und Tiefsinn gewissermaßen zu Hause sind.
Bisweilen sprach ein vorlauter Zeitgenosse auch schon mal von dem König der Fliegen anstatt von dem Herrn der Fliegen. Geschah das im Beisein von Gideon, dann trug sich bezeichnenderweise gar kein Entgleiten der Gesichtszüge in der geschilderten Art zu. Mehr noch, der mürrische Grundzug in seinem Gesicht erschien noch um eine Spur mürrischer, wenn das überhaupt möglich war.
Die mimischen Variationen halfen dem Mann aber wenig, das offenbarte Interesse an seiner Person zu beeinflussen. Sein Kunststück mit Fliege oder mit Fliegen, je nachdem, hatte ihm nun einmal einen unvergänglichen arbeitsplatzinternen Ruhm eingetragen und eine Aufmerksamkeit erregt, die in keinem rechten Verhältnis stand zu der übrigen Aufmerksamkeit, die ihm von seiner mitmenschlichen Außenwelt entgegengebracht wurde.
Sicher, unser Held stellte äußerlich etwas vor. Zum Zeitpunkt unserer kleinen Geschichte ist Gideon Walter gerade über die fünfzig hinaus und sieht mindestens so aus. Seine eigenen Nachlässigkeiten haben mit den Vorgaben der Natur tatkräftig zusammengewirkt und ein Mannsbild geformt, das mit seinen einsachtundachtzig an jeder Bushaltestelle aufgefallen wäre. Dies natürlich auch der Größe wegen: Eine hoch gewachsene, drahtige Gestalt, im Schulterbereich etwas gebeugt, weil es zu den hartnäckigsten Gepflogenheiten des Inhabers des Körpergerüstes gehörte, immerzu und wie sinnend zu Boden zu blicken und die gegenständliche Welt um sich herum mit erdkalter Verachtung zu strafen.
Wenn wir nach all dem vorher Gesagten nun noch hinzufügen, dass der Verlagsangestellte Gideon Walter ein ziemlich zurückgezogenes Leben führte, dann mag der Leser eine vorläufig hinreichende Vorstellung von der Hauptperson in unserer Geschichte bekommen haben, und den Schreiber dieser Zeilen würde es nicht wundern, wenn die vorläufige Vorstellung sich schon zu dem ersten Eindruck verdichtet hätte: Na, so einer ist das also!
Dieser Eine war übrigens etwas ländlich untergebracht. Nicht zu viel ländlich, nur eben so, dass er mit seiner Zurückgezogenheit einigermaßen in das Siedlungsbild passte und nicht zu sehr aneckte. Lange hatte er seinerzeit nach einer passenden privaten Residenz für sich gesucht, damals, als es ihn an seine Arbeitsstelle verschlagen hatte. Zahllose Wohneinheiten hatte er besichtigt, bis er irgendwann erschöpft geglaubt hatte, dort, auf einer Anhöhe am Rande von Eppeldorf, genau für sich das Richtige gefunden zu haben.
Nun war aber Eppeldorf ebenso wenig ein richtiges Dorf, wie Hagestadt eine richtige Stadt war. Dafür lagen die urbanen Bebauungen doch zu nahe beieinander; die Siedlung, die viel zu jung und zu unkoordiniert gewachsen war, um ein wirkliches Dorf zu sein, und Hagestadt mit seinen zweihunderttausend Einwohnern; kreisfrei und mit allen öffentlichen Einrichtungen versehen, die eine richtige Stadt braucht.
Dass Hagestadt keine richtige Stadt sei, war also Unfug und entsprang nur dem eigensinnigen Vorurteil des Herrn Walter, der zur Erleichterung seines Gemütes viel weiter auf Eppeldorf zu wohnte als nach Hagestadt hin, sich aber dennoch unausgesetzt ärgerte, wenn er nur einen Gedanken auf Hagestadt verwendete oder, wie das meistens geschah, verwenden musste.
Der Ärger nützte ihm aber nichts, denn in Hagestadt war nun einmal sein Verlag ansässig, bei dem er schon über zwanzig Jahre tätig war. Und auch sonst, wenn ein Gang zur städtischen Behörde dringlich war oder es eine nicht zugestellte Postsache abzuholen galt; jedes Mal führte sein Weg nach Hagestadt, einer Agglomeration von Wohneinheiten, der Gideon Walter hartnäckig und vehement das Gütesiegel Stadt verweigerte. Gehe er in Hagestadt um, so pflegte er zu sagen, bewege er sich immerzu in einer Spur der Trostlosigkeit. Eine Stadt sei nun einmal nicht bloß eine rechtliche Einheit, sondern auch ein ästhetisches Gebilde. Gebilde allein reiche nicht. Punktum.
Im Grunde genommen und manchem gelegentlichen Seufzer zum Trotz konnte Gideon Walter mit seiner Wohnsitzwahl zufrieden sein. Die einstmals getroffene Richtungsentscheidung zugunsten einer festen Bleibe nahe den grünen Fluren beließ ihn ungeschmälert in seiner Vorstellung, kein Hagestädter zu sein, beließ ihm aber auch die Freiheit, sich mit einem mäßigen Zeitaufwand in Richtung des Gebildes Hagestadt aufmachen zu können, wann immer er das wollte; treffender gesagt: wann immer er das musste.
Ein zweiter Vorteil war ihm durch das im Vergleich zu einem echten Dorf untypisch durchmischte mitmenschliche Umfeld seiner Wahlheimat zugefallen. Man bedenke, die braven Leute hatten ohne Vorwarnung einen Nachbarn zu verdauen, dem sehr schnell die Eigenschaften eines Sonderlings zugemessen wurden; einer, der niemals Besuch bei sich empfing noch selbst sich bemüßigt fühlte, irgendjemandem eine Visite abzustatten. Diese zweifellos ungesellige Verhaltensweise forderte es geradezu heraus, sich mit ihr zu beschäftigen, ja, ihr mit geeigneten Zeichen und passenden Ausdrucksformen des menschlichen Gebarens angemessen misstrauisch zu begegnen.
Nicht so in Eppeldorf mit seinem bemerkenswert aufgeschlossenen Publikum. Hier war manches anders. Dabei hatte die Siedlung schon im ersten Jahr nach Zuzug des neuen Nachbarn ein Gerücht zu verarbeiten, das die oberen Eppeldorfer aufhorchen ließ. Nichts, rein gar nichts hatte man bis dahin, bis vor dem Auftauchen des Gerüchtes also, über den Sonderling gewusst, außer dass er eben existierte und in Hagestadt einer ehrbaren beruflichen Tätigkeit nachging.
Da auf einmal hieß es, der Mann sei vor langer Zeit verlobt gewesen, und mit dieser Botschaft der sonderbare Umstand eine Erklärung zu finden schien, dass der scheue Herr, der während der berufsfreien Zeit bis auf gelegentliche Spaziergänge in der Umgebung und Erledigung seiner Einkäufe beinahe niemals die Wohnung verließ, dennoch gerade an einem herausgehobenen Tag im Laufe von vielleicht einem Monat, einem Tag, der sich aller Vorausschau und jeder Berechenbarkeit entzog, förmlich der nachbarschaftlichen Kontrolle entwischte und dann immer erst tief in der Nacht nach Hause zurückfand.
Diejenigen aus der Nachbarschaft, die ihn schon einmal bei der Rückkehr von einem jener Ausflüge beobachtet hatten, behaupteten, er habe zerstreuter noch als sonst, beinahe selbstvergessen gewirkt, sei aber von seinem ewig finsteren Dreinschauen geradezu befreit gewesen. Insbesondere dieser Gesichts-Punkt, die Verklärung gewissermaßen des physiognomischen Rohbaus eines gestandenen Mannes, hatte manchem, vorwiegend weiblichem Ohrenzeugen des Erzählten sogar das Herz berührt.
Daran, wie wenig Anstoß im Grunde genommen die Neuigkeit von einer angeblichen Verlobung erregte, zeigt sich übrigens, dass es sich in Eppeldorf auch für einen Einzelgänger ohne besondere Nachteile leben ließ. Das einsetzende Gerede um das weit zurückliegende und offenbar doch längst getilgte Verlöbnis beförderte schließlich nicht mehr als eine trübe Langeweile. Niemand überhaupt ereiferte sich. Ja, eigentlich war es eher ein kaum merkliches Getuschel, das die Siedlung von einem Ende zum andern träge durchstreifte und hernach den Rückweg schon nicht mehr fand.
Als ob nur zerstreut in der Sache interessiert, ließen sich selbst die wenigen eingefleischten Kolportanten schon nach wenigen Tagen, welche dem Bekanntwerden der hauptsächlichen Informationen folgten, leicht auf ein anderes Thema herüberziehen oder verfielen ohne fremdes Zutun in den üblichen belanglosen Siedlungstratsch.
Auch sonst hielt die Geschichte mit der Verlobung nicht sehr lange vor. Das läge doch schon jahrelang zurück, hieß es. Wie sollte darin für heutzutage eine Erklärung im Hinblick auf die eigenartige Zurückgezogenheitslücke des Herrn Walter liegen?
Man glaubte schließlich allgemein und fand Genügsamkeit in diesem Glauben, dass der Mann mit dem weiblichen Geschlecht nichts für sich anfangen konnte oder keinen rechten Zugang zu ihm fand. Wirklich nichts Geheimnisvolles vermutete man dahinter, eher eine gewisse Scheu, ein im Herzlichen angesiedeltes Unvermögen im empathischen Verhalten, wie man sie bei einem bestimmten Typ von Männern immer wieder antrifft. Denn dass Gideon Walter am anderen Ufer des erotischen Erlebens auf Erfüllung hoffen mochte, dafür gab es nun wirklich keine Anhaltspunkte, nicht einmal für die Misstrauischsten.
Wie dieser Mann überhaupt aussah! Die Erscheinung wirkte nun einmal nicht auf Frauen. Aber – und das war das Beruhigende – auf Männer wirkte das noch viel weniger. Man brachte es bald auf den Punkt, dass es das nun einmal gab, dass jemand den zärtlichen Seiten des Lebens nicht zugetan war oder ihnen nichts abgewinnen mochte. Bei einem Mann kam das doch tatsächlich häufiger vor als bei einer Frau. Das besagte aber nicht viel. Sicher, sicher, das dahinter stehende Bedürfnis spannte im Falle eines Mannes womöglich weiter und hatte ja wohl so oder so seine eigene Wucht und einen im Allgemeinen schwer zu kontrollierenden Rhythmus. Herr Walter, so dachte man, wenn man über so etwas gelegentlich nachdachte, würde wohl seine eigene Technik und Taktik haben, um mit dem da fertig zu werden.
Nun lagen die Leute nicht ganz falsch mit ihrer Vermutung, dass eine gewisse Scheu dem Herrn Walter den mitmenschlichen Umgang insbesondere mit dem weiblichen Geschlecht verleide. Doch sie hatten keine Vorstellung davon, dass es über die gefühlsmäßigen Barrieren hinaus ganz grundsätzliche Erwägungen für den gereiften Mann gab, sein stilles und zurückgezogenes Fürsichsein jeder Art von Lebensgemeinschaft, insbesondere auch dem Bunde mit einer Frau, vorzuziehen.
Mit zwanzig zwar hatte er davon geträumt, ein Mädchen, dem er und das ihm herzlich zugeneigt wäre, in den Stand der Ehe zu führen. Noch mit dreißig hatte er die Hoffnung darauf nicht ganz begraben. Mit vierzig freilich war der Gedanke daran dann doch abgetan gewesen. Da hatte ihm seine Befassung mit den Geheimnissen des biologischen Wissens klar gemacht, wie sinnlos es aus der Perspektive der Evolution für ein alterndes männliches Primatenexemplar sei, dem erotischen Verlangen und den damit zweifellos zusammenhängenden Fortpflanzungsgelüsten schwächlich nachzugeben.
Weiterhin war in Erwägung zu ziehen, dass eine zusätzliche Person in ein und derselben Wohnung eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensumstände darstellen müsste. Hin und her hatten ihn zeitweise die stürmischen Gedanken gerissen, und am Ende einer reinigenden Lebenskrise hatte er dem Schicksal dafür gedankt, ihm die Chance einer ungeschmälert auf sich selbst gestellten Lebensführung nicht vorenthalten zu haben. Bis auf die eine kleine Schwäche für Mathilde war er aller Last enthoben, die sich aus den Nebenwirkungen des entsetzlichen Wahns zusammenstellt, mit dem sich Fleisch zum Fleische drängt. In dieser ungebundenen, von jeglicher Beziehungsschwerkraft befreiten Lebensart war unser Held locker über die fünfzig hinweggekommen.
Gideon Walter vermisste nichts. Und er vermisste niemand. Jedenfalls musste jeder diesen Eindruck davontragen, der den drahtigen Mann in seinen schnellen Bewegungsabläufen beobachtete und womöglich gar die Gelegenheit eines Gesprächs mit ihm wahrnehmen durfte. Die Bezeichnung Gespräch ist womöglich schon wieder etwas übertrieben ausgefallen, doch dass jemand in eine Situation hineingeraten konnte, in der zwischen ihm und Gideon Walter Worte in Echtzeit ausgetauscht wurden, das war immerhin denkbar.
Schließlich musste der Herr, so zurückgezogen er auch sonst lebte, Alltagsverpflichtungen wahrnehmen, um die Notdurft seiner Existenz zu sichern. Da war beispielsweise der Gang zum Bäcker. Da war der zwingend notwendige wöchentliche Einkauf im Supermarkt und dieses noch und jenes, was die Menschen zwangsläufig in einen Kontakt zu ihren Mitmenschen bringt.
Gideon Walter erledigte all das Soziale mit Bravour. Kein Wort gebrauchte er zu viel und keines zu wenig. Und wenn er sich einmal aus der Not der Umstände heraus mit einem Anliegen an einen Mitbürger wandte, so war für den Angesprochenen der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, dass die Worte genau abgezählt waren und dass der Beginn des Gesprächs keinen anderen Zweck verfolgen konnte, als es möglichst schnell zu beenden.
Einmal hatte die Bäckersfrau, ein gar dralles und redseliges Persönchen, es unternommen, den sie interessierenden Herrn aus der Nachbarschaft nach seinem Wohlbefinden zu befragen. Außerdem hatte sie begonnen, ganz nebenbei allerlei Auslassungen vorzunehmen, wie das bei einer nachbarschaftlichen Konversation wohl so zugehen kann. Da war ihr der erzürnte Herr aber sogleich barsch über den Mund gefahren: Ob sie denn nicht bemerke, dass bei all ihrem Gesabbel die Brötchen in seiner Tüte immer mehr zusammenschrumpfen würden! Hatte das Geld, abgezählt wie immer, auf die Theke geknallt und war grußlos davongeeilt.
Nachtragend aber schien der Herr nicht zu sein, denn auch nach dem Vorfall besorgte er sich in dem nämlichen Laden regelmäßig sein Backwerk und ließ durch keinerlei Verhaltens-Auffälligkeit weder erkennen, dass es einmal eine Verstimmung gegeben hatte, noch ob er durch die nunmehr stumme, wenngleich jedes Mal von einem stillen Seufzer begleitete Bedienung der Bäckersfrau, einen Zugewinn in seinem Gemüt hatte davontragen können.
Um der Wahrheit willen muss Herr Gideon Walter aber vor dem Verdacht in Schutz genommen werden, als habe das grußlose Verlassen des Bäckerladens bei dem geschilderten Vorfall etwas mit dem Vorfall selbst zu tun. Gideon Walter grüßte niemals, weder beim Eintritt in eine noch beim Austritt aus einer Lokalität. Das konnte man übrigens auch beim Metzger, im Supermarkt und überall dort bestätigen, wo der bärbeißige Herr um notwendiger Besorgungen willen vor Ort zu sein nicht umhin konnte.
In seinem beruflichen Umfeld galt es übrigens als ausgemacht, dass Gideon Walter seine ihm obliegenden Verpflichtungen mit bienenhaftem Fleiß und nicht erlahmender Aufmerksamkeit versah. Unermüdlich war er in sein dienstliches Lesen vertieft, das den hauptsächlichen Inhalt seiner arbeitsvertraglich niedergelegten Pflichthandlungen abgab. Er hatte gewissermaßen vor zu sortieren, was von den eingehenden Manuskripten für den Verlag in die engere Auswahl zu nehmen sei.
Sein thematischer Bereich war weit gefasst. Er selbst war nicht wählerisch. Doch am liebsten hatte er solchen Stoff, der in irgendeiner Weise mit Musik zu tun hatte. Diese Bemerkung gestatten wir uns zum einen im Hinblick auf die kommenden Geschehnisse, deren innerer Dynamik zweifellos auch etwas Musisches zu Grunde gelegt ist. Zum anderen gibt die Vorliebe für das Musische, der Gideon Walter anhing, eine kleine weltanschauliche Schwäche preis, die der Mann gewöhnlich in die Worte kleidete, die Ausstattung mit musischem Können und Empfinden, die sie dem Menschen gewährt habe, sei von der Natur als Ausgleich, als Entschuldigung, ja als Wiedergutmachung dafür gedacht, dass sie ihre Geschöpfe so furchtbar leichtfertig mit der Fähigkeit des Redens bewaffnet habe.
Nun, Gideon Walter hatte sich mit seiner Unterschrift unter den Arbeitsvertrag zum Lesen verpflichtet. Zu mehr eigentlich nicht. In diesem Sinne leitete er jedes Manuskript-Päckchen, mit einem Kommentar und abschließender Empfehlung versehen, weiter auf die nächste Hierarchiestufe. Die endgültige Entscheidung, ob aus einem Konvolut ein Buch werde, trafen andere, mächtigere und besser bezahlte Angestellte, die aber wohl auf sein Urteil achteten. Denn wiederholt war ihm von oberer Stelle zugetragen worden, als wie stimmig mit dem letztendlichen Markterfolg sich seine bescheidenen Empfehlungen ausgezeichnet hatten. Das freute auch jene höher gestellten und besser bezahlten Angestellte, die ihrerseits umso weniger Aufwand zu betreiben geneigt waren, je größer die Treffsicherheit im Urteil des geschätzten Kollegen Walter ausfiel, den sie, zugegebenermaßen, noch niemals zu Gesicht bekommen hatten.
Schließlich war es so weit gekommen, dass die Gideon Walter übergeordnete Abteilung überflüssig zu werden drohte, weil die von der unteren Instanz kommenden Vorschläge nahezu als unfehlbar galten. Doch nach wenigen nervösen Besprechungen fand sich schnell Abhilfe mit neuen Aufgaben, deren Nutzen für das betriebliche Ganze zwar nicht mehr so leicht nachgewiesen, dafür aber auch nicht überzeugend widerlegt werden konnte.
Unter diesen besonderen Umständen mutete es einigermaßen merkwürdig an, dass Gideon Walter so gar keinen Anteil nahm an den Möglichkeiten seines eigenen beruflichen Fortkommens. Er bemächtigte sich seiner Arbeit wie in einem wohldosierten Achtstundenrausch, der auf die Minute pünktlich begann und wie auf einen bestimmten Glockenschlag endete. Was sich über seine Lesetätigkeit hinaus in der Firma abspielte, schien sein Interesse nicht zu finden. Gelegenheiten, den eigenen Aktionsradius innerhalb der Firma auszudehnen und dabei Möglichkeiten einer höheren Leistungsvergütung wahrzunehmen, schienen ihm nicht aufzufallen. Ja, eine übergeordnete Andeutung in dieser Richtung war von Gideon Walter mit leichtfertiger, man möchte sagen höhnisch-kalter Verachtung abgestraft worden.
Was nahm es da Wunder, dass später von keiner Seite mehr auf ein solches, im Allgemeinen das Herzstück des Beruflichen betreffendes Thema zurückgegriffen wurde. War er denn, so fragten sich auch seine nächsten Mitarbeiter, dermaßen verbissen und selbstgenügsam auf seine Tätigkeit fixiert, dass er ihr, in einer Art eheähnlicher Gefangenschaft, zugleich verfallen und von ihr ruiniert worden war? So schien es doch, wenn dieser unbeweibte Jemand noch nicht einen einzigen Tag in seinem Berufsleben dem Arbeitsplatz ferngeblieben war und noch nicht eine einzige Initiative gestartet hatte, um einen Fortschritt oder auch nur etwas Abwechslung in seine persönliche Geschäftstätigkeit zu bringen.
Ja schon, Gideon Walter war, so möchte man die bisherigen Beobachtungen auf den gewissen Punkt bringen, eine im Privaten wie im Beruflichen etwas sonderbare Person. Dieser Eindruck war auch in der Firma schnell entstanden, und er hatte sich nach dem unerhörten Kunststück mit der Flieg oder den Fliegen, je nachdem, nachhaltig befestigt.
Gideon selbst sprach nicht gerne davon. Eigentlich sprach er gar nicht davon. Es waren die anderen, die das taten. Obwohl - das Dürftige, was an Erklärung durchgesickert war, stammte von den Vorgesetzten. Die ihrerseits konnten aber nur auf die gewöhnlichen Personalangaben zurückgreifen: Lebenslauf, Zeugnisse, Gutachten und so weiter. Von irgendwelchen Unregelmäßigkeiten oder Begabungen, die mit Fliegen zu tun hatten, stand nirgendwo etwas geschrieben.
Das war wenig. Mehr aber wussten sie tatsächlich nicht. Um wie viel weniger wussten alle anderen. Nicht zu verwundern war es daher, dass in dem allgemein angespannten Klima des Nichtwissens während der beruflichen Probezeit üppig die gewagtesten Spekulationen gediehen. Ausgerechnet alle diejenigen, die doch nichts wussten, warteten mit den unglaublichsten erfundenen Geschichtchen von früher auf, um damit so zu tun, als ob sie etwas wüssten.
Im ersten Jahr nach seinem Berufseinstieg schwollen jedenfalls die Gerüchte um Gideon Walters Vergangenheit an wie eine spekulative Blase an der Börse. Konnte man in dieser Anfangszeit davon ausgehen, dass das hartnäckige Schweigen des Büro-Neuzugangs selbst zur Aufblähung alles Geraune beigetragen hatte, so war später ebenso unzweifelhaft, dass die neugierige Sprechblase durch eben dieselbe schweigsame Hartnäckigkeit des Anstoß erweckenden Kollegen zum Platzen gebracht wurde, als kein Atom Fantasie sich mehr auf ein irgendwann einmal eintretendes Enthüllungsspektakel verausgaben wollte.
Da beruhigten sich die Mitangestellten auf den verschiedenen Hierarchieebenen, vergaßen ihr Gerede, verzichteten auf weitere Vermutungen und hatten irgendwann den Eindruck, dass Gideon Walter, den manche auch dann noch nicht zu Gesicht bekommen hatten, immer bei ihnen gewesen sei und in seiner Eigenschaft als Herr der Fliegen auch unverzichtbar zu ihnen dazu gehöre.
Und in diesem Zustand seiner charakterlichen Naturbelassenheit finden wir unseren Helden vor, als schließlich all die Vorbereitungen und Frühentwicklungen hin zu dem begannen, was letztendlich mit ihm geschah.
Schweinsauge
Gideon Walter schreckte auf.
„Die Fahrkarten bitte!“
Er musste eingeschlafen sein. Worum ging es? Ach ja. Zerstreut griff er in seine Brusttasche, versuchte sich zu erinnern.
„Moment!“
Der Kontrolleur hatte keine Eile. Mehr belustigt als verstimmt betrachtete er den fahrigen Herrn, der mal hierhin, mal dorthin tastete und schließlich sein Gepäck auf den Kopf stellte.
„Da haben wir sie ja.“ Es klang wie ein Triumpf.
Die Fahrkarte steckte in der Manteltasche. Gideon ärgerte sich dennoch. Jetzt fiel ihm wieder ein, dass er, mit dem Mantel bekleidet, das Haus verlassen hatte, dann aber schnell ins Schwitzen gekommen war und die nächstbeste Gelegenheit genutzt hatte, um das lästig gewordene Kleidungsstück in den Koffer zu verfrachten. Er ärgerte sich umso mehr, als er im Gesicht des Beamten ein ironisches Lächeln glaubte feststellen zu können.
„Na, dann noch eine angenehme Reise.“
Gideon war wieder allein. Niemand sonst saß in dem Abteil. Er musste tatsächlich eingeschlafen sein. Wenn er sich recht besann, hatte er sogar von Mathilde geträumt. Nervös blickte er auf die Uhr. Es war noch nicht einmal elf am helllichten Tag. Um diese Zeit lieferte er gewöhnlich ein Manuskript ab oder hatte die übliche Vormittagsunterredung mit dem Abteilungsleiter. An Mathilde hatte er um diese Zeit an einem Wochentag noch nie gedacht. Überhaupt, dass er nicht in seinem Büro, sondern in einem Eisenbahnabteil saß, kam ihm auf einmal gespenstisch vor, und ein intensives Gefühl wollte dagegen aufbegehren. Mit einem Ruck lehnte er sich zurück und verzog schmerzhaft das Gesicht.
Augenblicklich verkroch sich das Alltagsbewusstsein, das sein Recht auf einen ausgefüllten Bürotag für sich reklamieren will. Gideon Walter wurde nachhaltig daran erinnert, warum er eigentlich im Zug saß, wo doch Bürozeit war, und sich auf dem Weg nach Bad Gesundheitsbrunn befand, anstatt die Treppenstufen hinauf zum Zimmer des Abteilungsleiters zu eilen.
Ihre Halswirbel sind ja marode. Und da kommen Sie erst jetzt in die Behandlung? Die Worte des Orthopäden hatten für Gideons Geschmack einen etwas unverschämten Unterton gehabt. Gesprochen wurden sie an einem trüben Tag Ende Mai. Da ging Gideon Walter nicht ins Büro, sondern eben zum Arzt; zum nächstbesten praktischen Arzt. Nach einer allgemeinen Untersuchung verwies dieser ihn weiter an einen Orthopäden, der ihn mit zweckdienlichem Gerät gründlich durchcheckte, Röntgenbilder anfertigen ließ, horchte, klopfte, betastete, immer wieder an die Stelle griff, deren abstrahlendem Schmerz Gideon Walter seine grüne Gesichtsfärbung und die schlaflose Nacht zu verdanken hatte.
Eine hartnäckige Verspannung, die ihre Ursache in den hochgradigen Verschleißerscheinungen des Halswirbelbereichs hat. Nach den Spritzen, die ich Ihnen gleich und in den darauffolgenden Tagen verabreiche, werden Sie in einer Woche wieder arbeitsfähig sein. Doch eine dauerhafte Stabilisierung würde eher einem Wunder gleichkommen. Was ich Ihnen dringend empfehle, ist ein sofortiger Aufenthalt in einem geeigneten Sanatorium.
Der anhaltende Schmerz. Alle Einwände erstarben, wenn auch erst nach bitterem Widerstand. Nach Ablauf einer Woche, ausgefüllt mit ungewohntem Nichtstun und dem Erledigen notwendiger Formalitäten, fand sich Gideon Walter, von den Schmerzen nicht mehr ganz so heftig attackiert, reisefertig am Bahnhof von Hagestadt ein und reiste Erster Klasse dem ersten Kuraufenthalt seines Lebens entgegen.
Alles war so schnell gegangen, dass er nicht einmal Mathilde einen vorläufig letzten Besuch abstatten konnte. Bestimmt war das sogar besser. Die herzzerreißenden Bewegungen - und er mit seinem Rückgrat; das konnte unmöglich gut gehen. Einen Heilungsprozess wollte er auf keinen Fall blockieren. Daran klammerte Gideon sich umso mehr, je stärker die Erinnerungen an die erlittenen Schmerzen in ihm wachgehalten wurden.
Nun beruhigte ihn die Besinnung auf seine Vorsätze. Die Zeit würde vorbeigehen. Die Heilung würde Fortschritte machen. Und er selbst wollte versuchen, der Sache, die in sein Leben geplatzt war, gute Seiten abzugewinnen. Die Gleichaltrigen in seiner Firma hatten alle schon mehr als nur eine Kur hinter sich gebracht. Er hatte also Nachholbedarf.
Der Zug war in einen Bahnhof eingefahren. Es herrschte wenig Betrieb. Da und dort erklangen Rufe. Gepäckstücke schleiften über den Boden. Gideon sah kurz zum Fenster hinaus. Draußen auf dem Bahnsteig erkannte er den Schaffner, vor dem er sich bei der Fahrkartenkontrolle blamiert hatte. Unwillig trat er vom Fenster zurück und setzte sich wieder auf seinen Platz.
Er griff zu einem Buch, bemerkte aber zu seinem Verdruss, dass ihm die innere Ruhe zum Lesen fehlen würde. Das irritierte ihn. Er las doch jeden Tag. Das war sein Beruf. Und jetzt funktionierte es nicht, obwohl eigentlich Arbeitszeit war. Hoffentlich verlor sich keiner der Zusteigenden in sein Abteil. Ungestörtheit war ihm ein höchstes Anliegen. Vielleicht klappte es dann später mit dem Lesen.
Der Gang vor dem Abteil belebte sich. Gideon fluchte leise vor sich hin. Er hatte ein untrügliches Gefühl dafür, wann es mit einem Zustand des Ungestörtseins vorbei sein würde. Diesmal war es ein schlurfendes Ereignis, welches ihm das unangenehme Gefühl bescherte, demnächst belästigt zu werden. Das schlurfende Ereignis kam näher. Unaufhaltsam würde es in sein Leben treten. Daran gab es nun keinen Zweifel mehr.