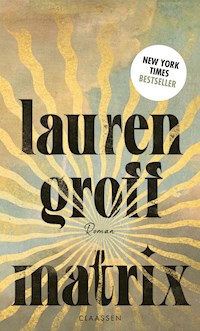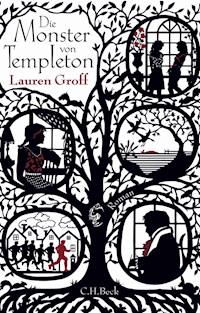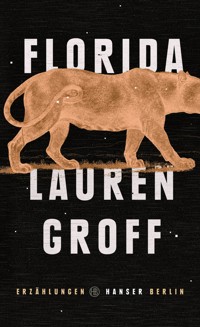
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der New-York-Times Bestseller von Lauren Groff: Geschichten von wilden Tieren, maßlosen Unwettern und dem Menschen, der die größte Bedrohung ist. Erzählungen wie der Ort, nach dem sie benannt sind – Florida: wild und schön, gleißend hell, dunkel und unberechenbar. Eine Mutter läuft Nacht für Nacht gegen Wut und Zweifel an, zwei Mädchen werden allein in der Wildnis zurückgelassen, eine junge Frau gibt jeglichen Besitz auf. Situationen schlagen um, und Menschen verwandeln sich in der flirrenden Hitze Floridas, das hier viel mehr ist als ein Land: eine Atmosphäre, in der alles, was das Leben ausmacht, üppig gedeiht und gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet, die vertraute Oberfläche durchbricht. Mit grausamer Präzision und mitreißender Sprachgewalt erzählt Groff von Zorn, Furcht und Einsamkeit inmitten einer Natur, deren neue Schrecken wir selbst geschaffen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der New-York-Times Bestseller von Lauren Groff: Geschichten von wilden Tieren, maßlosen Unwettern und dem Menschen, der die größte Bedrohung ist. Erzählungen wie der Ort, nach dem sie benannt sind — Florida: wild und schön, gleißend hell, dunkel und unberechenbar. Eine Mutter läuft Nacht für Nacht gegen Wut und Zweifel an, zwei Mädchen werden allein in der Wildnis zurückgelassen, eine junge Frau gibt jeglichen Besitz auf. Situationen schlagen um, und Menschen verwandeln sich in der flirrenden Hitze Floridas, das hier viel mehr ist als ein Land: eine Atmosphäre, in der alles, was das Leben ausmacht, üppig gedeiht und gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet, die vertraute Oberfläche durchbricht. Mit grausamer Präzision und mitreißender Sprachgewalt erzählt Groff von Zorn, Furcht und Einsamkeit inmitten einer Natur, deren neue Schrecken wir selbst geschaffen haben.
Lauren Groff
Florida
Erzählungen
Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs
Hanser Berlin
Inhalt
Geister und Leerstände
In den imaginären Winkeln der runden Welt
Wolf werden
Die Mitternachtszone
Auge in Auge
Um Himmels willen — im siebten Himmel
Salvador
Blumenjäger
Oben und unten
Schlangengeschichten
Yport
Danksagung
Für Heath
Geister und Leerstände
Irgendwie ist aus mir eine Frau geworden, die herumschreit, und weil ich keine Frau sein will, die herumschreit, deren Kinder mit starren und wachsamen Mienen durchs Haus schleichen, habe ich mir angewöhnt, nach dem Abendessen die Laufschuhe anzuziehen, raus auf die dämmrigen Straßen zu gehen und das Ausziehen, Waschen, Vorlesen, Vorsingen und Einmummeln der Jungen meinem Mann zu überlassen, jemandem, der nicht herumschreit.
Während ich meine Runde drehe, wird es allmählich dunkel, und ein zweites Viertel entfaltet sich über dem von tagsüber. Es gibt nicht viele Straßenlaternen, und die, unter denen ich entlanggehe, lassen meinen Schatten Streiche spielen; er trödelt mir hinterher, galoppiert mir vor die Füße und rennt übermütig voran. Die einzigen weiteren Lichtquellen sind die Häuser, an denen ich vorbeigehe, und der Mond, der mir befiehlt: Sieh hoch! Streunende Katzen huschen vorbei, Strelizien strecken die Köpfe aus dem Dunkel, Gerüche durchströmen die Luft: Eichenholzstaub, Schleimpilze und Kampfer.
Im Norden Floridas ist es kühl im Januar, und ich gehe schnell, um warm zu werden, aber auch, weil das Viertel trotz seiner altehrwürdigen Ausstrahlung — riesige viktorianische Häuser, die Zwanziger-Jahre-Bungalows überstrahlen, gerahmt von funktionalen Ranchen aus den Fünfzigern — kein ganz sicheres Pflaster ist. Vor einem Monat hat es eine Vergewaltigung gegeben, eine Joggerin um die fünfzig wurde in die Azaleen gezerrt, und vor einer Woche sind mehrere unangeleinte Pitbulls über eine Mutter und ihr kleines Kind im Buggy hergefallen und haben beide zerfleischt; immerhin leben sie noch. Die Hunde können nichts dafür!, haben sich Tierfreunde in der Nachbarschafts-E-Mail-Liste ereifert, aber diese Hunde waren Soziopathen. Als die Vororte in den Siebzigern gebaut wurden, überließ man die historischen Bauten im Zentrum Studenten, die auf den Kiefernkernholzböden mit Bunsenbrennern Dosenbohnen aufwärmten und die Ballsäle in Apartments zerlegten. Als die Häuser durch Feuchtigkeit und Vernachlässigung irgendwann moderten, zusammenzusacken begannen und rostige Schuppen bekamen, überließ man sie wiederum den Armen und Hausbesetzern. Wir sind vor zehn Jahren hierhergezogen, weil unser Haus billig war und ein Skelett aus gutem Holz hatte, und wenn es schon der Süden mit gekochten Erdnüssen und dem wie Achselhaar von den Bäumen hängenden Louisianamoos sein musste, dann würde ich mich mit meinem Weißsein wenigstens nicht in einer geschlossenen Wohnanlage verbarrikadieren, hatte ich beschlossen. Ist es dort nicht etwas … prekär?, fragten Leute aus der Generation unserer Eltern und verzogen das Gesicht, wenn wir ihnen erzählten, wo wir wohnten, und ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht zu entgegnen: Meinen Sie schwarz oder einfach nur arm? Denn es war beides.
Inzwischen breitet sich im Viertel der Virus Weiße Mittelschicht aus, und überall wird wie wild renoviert. Die Schwarzen sind in den letzten Jahren fast alle weggezogen. Die Obdachlosen blieben noch eine Weile, weil unser Viertel an die Bo Diddley Plaza angrenzt, auf der mehrere Kirchen bis vor Kurzem Essen und Gottes Segen verteilten und über die gleich einer Flutwelle die Leute von Occupy hereinbrachen, die das Recht einforderten, dort zu zelten, bis sie irgendwann keine Lust mehr hatten, ungewaschen und wie gerädert zu sein, und menschliches Treibgut in Form von Obdachlosen in Schlafsäcken zurückließen. Während der ersten Monate in unserem Haus hatten wir ein obdachloses Paar zu Gast, aber wir sahen die beiden nur, wenn sie sich im Morgengrauen davonschlichen: Wenn es abends dunkel wurde, nahmen sie leise das Gitter ab, das zu dem niedrigen Raum unter unserem Haus führte, um dort zu übernachten; unser Schlafzimmerboden war ihre Decke, und wenn wir nachts aufstanden, gingen wir so leise wie möglich, denn es kam uns unhöflich vor, die Füße nur ein paar Handbreit über dem Gesicht eines träumenden Menschen aufzusetzen.
Auf meinen abendlichen Runden offenbart sich das Leben der Nachbarn in erleuchteten Fenstern, die Aquarien ähneln. Manchmal werde ich stille Zeugin von Streitereien, die wie ein langsamer Tanz ohne Musik aussehen. Man kann nur staunen, wie die Menschen leben, über das Chaos, das sie unterhalten, die köstlichen Kochdünste, die auf die Straße wehen, und die Weihnachtsdeko, die allmählich in der Alltagskulisse versickert. Den ganzen Januar über habe ich einem Weihnachtsstrauß auf einem Kaminsims beim Welken zugesehen, bis die Rosen gelbbraun und dürr waren und das Wasser nur noch grüner Schaum, während ein dicker Santa an seinem Deko-Stab immer noch fröhlich aus den Ruinen strahlte. Fenster für Fenster kommt näher, erstarrt mit seinem blauen Fernsehlichtschleier oder dem über eine Pizza gebeugten Paar für einen Augenblick zum Standbild, bis ich vorbei bin, und gleitet dann in die Vergessenheit. Ich muss an Wasser denken, das einen Eiszapfen herunterläuft, kurz innehält und einen glänzenden Tropfen bildet, der schließlich zu schwer wird und abfällt.
Es gibt ein nahezu fensterloses Haus im Viertel, das ich trotzdem sehr mag, weil darin Nonnen leben. Früher waren es sechs, aber wie es bei sehr betagten Damen nun einmal ist, gab es Schwund, und jetzt quietschen nur noch drei gütige Schwestern auf ihren Gesundheitsschuhen durch die palastähnlichen Räume. Ein befreundeter Immobilienmakler hat erzählt, beim Bau des Hauses in den Fünfzigern sei in den bröseligen Kalkstein auf dem Hof ein Luftschutzbunker eingelassen worden, und in schlaflosen Nächten, wenn mein Körper im Bett liegt, aber mein Kopf noch durchs Dunkel wandert, stelle ich mir gern vor, wie die Nonnen in vollem Ornat in ihrem Bunker Kirchenlieder singen und abwechselnd auf einem Heimtrainer strampeln, damit die flackernde Glühbirne nicht ausgeht, während oberirdisch alles verkohlt ist und der Wind sich an rostigen Türangeln reibt.
Weil es abends so kalt ist, sind außer mir nur wenige Menschen unterwegs. Ein Joggerpärchen, etwas langsamer als ich in schnellem Gehtempo. Meist bleibe ich hinter ihnen, höre zu, wie sie über Hochzeitspläne und Streitigkeiten mit Freunden plappern. Einmal lachte ich selbstvergessen über irgendetwas, das sie gesagt hatten, und sie drehten sich mit Eulengesichtern ärgerlich zu mir um, trabten dann schneller und bogen bei der erstbesten Gelegenheit ab, und ich ließ sie im Dunkel verschwinden.
Dann gibt es die elegante, hochgewachsene Frau mit ihrer Deutschen Dogge, deren Fell die Farbe der Flusen im Trocknersieb hat; ich fürchte, der Frau geht es nicht gut, denn sie bewegt sich sehr steif, und manchmal zuckt ihr Gesicht, als würde sie von stromstoßartigen Schmerzen geplagt. Manchmal stelle ich mir vor, ich schieße um eine Ecke und finde sie leblos auf dem Boden; dann würde ich sie über ihren Hund legen, ihm einen Klaps auf den Widerrist geben und zusehen, wie er sie mit seinem höchst würdevollen Gang heimträgt.
Da ist der unglaublich dicke Junge um die fünfzehn, der nie ein Hemd anhat und in seinem Wintergarten auf dem Laufband trainiert. Egal wie oft ich an seinem Fenster vorbeigehe, immer ist er da, und er stampft so laut, dass ich seine Schritte noch ein paar Häuser weiter höre. Weil im Haus alle Lichter brennen, kann er hinter dem schwarzen Fenster nichts sehen, und ich frage mich, ob er sein Spiegelbild so beobachtet, wie ich ihn beobachte, ob er sieht, wie bei jedem Schritt kleine Wellen über seinen Bauch laufen wie über einen Teich, in den jemand einen faustgroßen Stein geworfen hat.
Dann gibt es die scheue, stets vor sich hin murmelnde Dame, eine Dosensammlerin, die ihre klappernden Tüten hinten auf ihr Fahrrad hievt und die alten Betonschwellen vor den größeren Häusern nutzt, um in den Sattel zu kommen; ihr Geruch lässt mich an die wohlhabenden Südladys in dunkler Seide denken, die von diesen Trittsteinen aus früher in ihre Kutschen stiegen und sicher einen ähnlich intimen Gestank verbreiteten. Die Körperpflege mag sich im Laufe der Zeit verändert haben; der menschliche Körper nicht.
Vor einer Bodega mit Fenstergittern steht unter der Laterne oft ein Mann, der fiese Sachen zischt. Ich wappne mich, mache mein Komm-mir-ja-nicht-blöd-Gesicht, und er müsste schon einiges mehr tun als nur zischen, aber ein Teil von mir ist mehr als bereit und will rauslassen, was in mir hochkocht.
Manchmal glaube ich das verstohlene Paar zu sehen, das unter unserem Haus gewohnt hat, die Hand des Mannes auf ihrem Rücken, den ganz bestimmten Winkel seiner Fürsorge, aber wenn ich näher komme, ist es nur ein Papayabaum, der sich über eine Regentonne neigt, oder zwei Jungen, die im Gebüsch rauchen und misstrauisch werden, wenn ich vorbeigehe.
Und dann ist da der Therapeut, der jeden Abend am Schreibtisch im Arbeitszimmer seines viktorianischen Hauses sitzt, das an eine modernde Galeere erinnert. Einer seiner Patienten hat ihn in flagranti mit seiner Frau erwischt; der Patient hatte eine geladene Waffe im Auto. Die Frau starb beim Koitus, der Therapeut überlebte, hat aber immer noch eine Kugel in der Hüfte, die ihn humpeln lässt, wenn er aufsteht, um sich Scotch nachzuschenken. Es heißt, er besuche den gehörnten Mörder einmal pro Woche im Krankenhaus, aber ob aus Freundlichkeit oder um seinen Triumph auszukosten, bleibt unklar, wobei Motive ja nie ganz rein sind. Mein Mann und ich waren gerade erst eingezogen, als der Mord passierte; wir kratzten gerade die alte Farbe von den Eichenleisten in unserem Esszimmer ab, da sprenkelten Schüsse die Luft, aber wir glaubten natürlich, die Kinder ein paar Häuser weiter hätten Böller gezündet.
Auf meiner Runde begegnen mir Fremde, aber auch bekannte Gesichter. Als ich einmal Anfang Februar hochsehe, entdecke ich eine gute Freundin in einem rosa Gymnastikanzug beim Stretching in ihrem Fenster, aber dann macht es klick und mir wird klar, dass sie sich nicht dehnt, sondern die Beine abtrocknet, und dass der Gymnastikanzug ihre Haut ist, gerötet von der heißen Dusche. Obwohl ich sie kurz nach der Geburt ihrer Söhne im Krankenhaus besucht habe, die Neugeborenen, die noch nach ihr rochen, in den Armen gehalten und die frische Kaiserschnittwunde gesehen habe, begreife ich erst jetzt, als ich ihr beim Abtrocknen zusehe, dass sie ein sexuelles Wesen ist, und als ich das nächste Mal mit ihr spreche, werde ich etwas rot und habe andauernd Bilder von ihr in extremen Sexstellungen vor Augen. Aber meistens bekomme ich die Mütter aus meinem Bekanntenkreis nur flüchtig zu Gesicht, wenn sie krumm wie Schäferhaken den Boden nach winzigen Legosteinen, halb zerkauten Weintrauben oder den Menschen, die sie einmal waren, absuchen, zusammengesackt in einer Ecke.
Ich krieg zu viel, ich krieg zu viel, schreie ich meinen Mann an manchen Abenden an, wenn ich nach Hause komme, und er sieht mich ängstlich an, dieser sanfte Hüne, setzt sich mit dem Laptop im Bett auf und sagt leise: Ich glaube, es ist noch nicht ganz weg, Liebling, vielleicht drehst du besser noch eine Runde. Dann zische ich wieder ab, stinksauer, denn je später es ist, desto gefährlicher wird es auf den Straßen; was fällt ihm eigentlich ein, mich diesem Risiko auszusetzen, wo ich doch gerade ohnehin in keiner guten Verfassung bin, aber vielleicht ist auch mein warmes Haus gefährlicher geworden. Tagsüber, wenn meine Söhne in der Schule sind, verschlinge ich wie eine Besessene alles über die Katastrophen der Welt, die Gletscher, die sterben wie lebende Wesen, den Großen Pazifikmüllfleck und das hundertfache, nicht protokollierte Artensterben — Jahrtausende, einfach so ausgelöscht, als wären sie nichts wert. Von unbändiger Trauer erfüllt, lese ich, als könnte Lesen dieser Trauer irgendwie den Rachen stopfen, statt ihre Gier zu befeuern, denn genau das passiert.
Obwohl es mir mittlerweile fast egal ist, wo ich langlaufe, versuche ich, jeden Abend am Ententeich zu sein, wenn sich die seit Wochen vergessene Weihnachtsbeleuchung ausschaltet, die Frösche mit ihrem synkopischen Gesang loslegen und der Teich förmlich explodiert. Eine Weile hat unser Trauerschwanpaar die Frösche mit seinen Trompetenstimmen zurechtgewiesen, als wollte es sagen, Ruhe da!, aber die Vögel, deutlich in der Unterzahl, haben es schnell wieder aufgegeben, sind auf die Insel mitten im Teich geklettert und haben sich schlafen gelegt, die Hälse ineinander verschlungen. Die Schwäne hatten letztes Jahr vier Küken, niedliche, piepsende Federbäusche, in die meine beiden Jungen regelrecht verliebt waren und denen sie jeden Tag Hundefutter hinwarfen, bis einer der Jungschwäne eines Morgens, während die Elterntiere von unserem Futter abgelenkt waren, erstickt tschiepte und ruckartig abtauchte; er tauchte zwar wieder auf, aber am anderen Ende des Teichs, in den Pfoten eines Otters, der ihn sich Bissen für Bissen einverleibte und dabei seelenruhig auf dem Rücken schwamm. Der Otter schnappte sich noch ein weiteres Küken, bevor der Wildlife Service kam, um die restlichen beiden abzuholen, aber später stand in unserem Nachbarschaftsblättchen, dass die winzigen Schwanenherzen vor Angst versagt hatten. Monatelang schwammen die Elternschwäne verloren herum, untröstlich. Aber vielleicht ist das auch eine Projektion: In ihrer Doppelrolle als schwarze Schwäne und Eltern tragen sie von vornherein ein Trauerkleid.
Am Valentinstag sehe ich beim Nonnenkloster von Weitem rot-weiße Lichter blinken und gehe schneller in der Hoffnung, die Nonnen würden eine Liebesparty feiern, mit wilder Disko, aber stattdessen sehe ich einen Krankenwagen wegfahren, und am nächsten Tag bestätigen sich meine Befürchtungen; es ist wieder eine Nonne weniger, jetzt sind es nur noch zwei. Sich zu Ehren Gottes erotischen Genuss zu versagen wirkt in unserer hedonistischen Zeit wie ein Anachronismus, und angesichts ihrer Gebrechlichkeit und des riesigen Hauses, in dem sie herumgeistern, wurde beschlossen, dass die beiden verbleibenden Nonnen umziehen müssen. Am Abend ihres Auszugs will ich zusehen, erwarte einen Umzugswagen, aber die paar Lederkoffer und die ein, zwei Kartons passen auf den Rücksitz ihres Kombis. Als sie abfahren, senkt sich Erleichterung über ihre ermatteten Gesichter.
Die Kälte hält sich bis in den März hinein. Es war für alle ein harter Winter, wenn auch nicht so schlimm wie im Norden, und ich denke an meine Freunde und Familie und den aufgetürmten, schmutzigen Schnee dort oben und versuche mir bewusstzumachen, dass hier alles blüht, die Kamelien, die Pfirsichbäume, die Orangenbäume und der Hartriegel, selbst im Dunkeln. Am nächsten Morgen hängt noch der kräftige Jasminduft in meinem Haar, so wie früher der Geruch von Rauch und Schweiß, wenn ich aus einem Club kam, damals, als ich noch jung war und solche undenkbaren Sachen tun konnte. Es gibt hier in der Gegend einen Baustil namens Cracker, was nicht abwertend gemeint ist; große Veranden und hohe Decken, und Mitte März wird schließlich eins der ältesten Cracker-Häuser in North Central Florida renoviert. Die Fassade bleibt erhalten, der Rest wird entkernt. Abend für Abend sehe ich, was von dem Haus noch übrig ist, das immer weiter ausgeweidet wird, bis es eines Tages schließlich ganz verschwunden ist: Am Morgen ist es über einem der Arbeiter zusammengebrochen, der jedoch überlebte, weil er wie Buster Keaton gerade in einer der Fensteröffnungen stand, als das Gebäude einstürzte. Ich betrachte die Lücke an der Stelle, an der so lange ein bescheidenes und unbemerktes Stück Geschichte stand, ein Haus, das die Stadt durch den Boden brechen und ringsherum wachsen sehen hatte, und ich denke an den Bauarbeiter, der unverletzt aus den Trümmern stieg, und frage mich, was ihm wohl durch den Kopf ging. Ich glaube, ich weiß es. Als ich eines Abends kurz vor Weihnachten von meiner Runde nach Hause kam, war mein Mann gerade im Bad, und als ich seinen Computer aufklappte, sah ich, was ich sah, einen Chat, der nicht für meine Augen bestimmt war, ein Stück Haut, die nicht seine war, und ohne ihn wissen zu lassen, dass ich im Haus gewesen war, machte ich auf dem Absatz kehrt und lief, bis es zu kalt war zum Laufen, bis der Morgen schon fast dämmerte und der Tau auch hätte Raureif sein können.
Während ich jetzt vor dem eingestürzten Haus stehe, gleitet die Frau mit der Deutschen Dogge durchs Dunkel, und mir fällt auf, wie aggressiv bleich sie geworden ist, bleich und so dünn, dass ihre Wangen sich in ihrem Mund berühren müssen, und außerdem ist ihr Toupet verrutscht, so dass über dem Pony ein Streifen Kopfhaut durchscheint. Wenn sie wiederum mich bemerkt, diesen ruhelosen dunklen Dorn, sagt sie nur leise guten Abend, während ihr Hund mit schier menschlichem Mitgefühl im Blick zu mir hochsieht, und zusammen verschwinden sie in der schwarzen Nacht, würdevoll und dezent.
Die meisten Veränderungen geschehen nicht so rasant wie der Einsturz des Hauses, und wie stark der Junge in seinem Wintergarten abgenommen hat, fällt mir erst auf, als ich am Klang seiner Schritte bemerke, dass er auf dem Laufband nicht mehr geht, sondern läuft, und zum ersten Mal seit Langem sehe ich ihn genau an, meinen lieben wabbeligen Freund, dessen Erscheinung ich für gegeben gehalten hatte, und die Veränderung ist so imposant, als hätte sich eine Jungfer in eine Birke oder einen Fluss verwandelt. In den letzten Monaten ist aus diesem übergewichtigen Jugendlichen ein schlanker Mann mit Brustwarzen wie zwei Rosenknospen geworden, der sich schwitzend in der Glasscheibe zulächelt, und ich jauchze auf angesichts der Schnelligkeit der Jugend, dieser großartigen Veränderungen, die so zwingend behaupten, dass doch nicht alles schneller vergeht, als wir es lieben können.
Ich gehe weiter, und während das Traben des Jungen immer leiser wird, nehme ich ein beunruhigendes Dauergeräusch wahr, das ich nicht einordnen kann. Es ist ein schwüler Abend: Seit letzter Woche gehe ich ohne Jacke hinaus, und nur langsam wird mir klar, dass das Geräusch von der ersten eingeschalteten Klimaanlage kommt. Wie Trolle hocken sie unter den Fenstern, und bald werden sie alle laufen; ihr kollektives, tonloses Summen wird Frösche und Nachtvögel übertönen, die Zeit wird einen Sprung machen und die Nacht wird immer unwilliger hereinbrechen, und im kühlen Zaudern der Dämmerung werden die Menschen, die sich nach einem ganzen Tag in der ungesunden Pseudokälte nach echter Luft sehnen, aus ihren Häusern kommen, und dann habe ich die dunklen, gefährlichen Straßen nicht mehr für mich allein. Es liegt ein angenehmer Lagerfeuergeruch in der Luft, so dass ich vermute, die alten Schmuckzypressenwälder rings um die Stadt stehen in Flammen, was ungefähr einmal pro Jahr passiert, und ich denke an all die armen Vögel, die von der sengenden Hitze aus dem Schlaf gerissen werden, in die desorientierende Dunkelheit getrieben. Am nächsten Morgen entdecke ich, dass es noch schlimmer war, ein kontrolliertes Abbrennen der Felder, auf denen Dutzende Obdachlose in einer Zeltstadt gewohnt hatten, und ich gehe hin, um mir ein Bild zu machen, aber es gibt nichts zu sehen außer einsamen hohen Eichen, von der Hüfte abwärts geschwärzt, die aus rauchender Holzkohle aufragen. Als ich zurückkomme und die in derselben Nacht aufgestellten eins achtzig hohen Zäune rund um die Bo Diddley Plaza sehe — wegen Bauarbeiten, so steht es zumindest auf den Schildern —, ist klar, dass dies Teil eines größeren, sorgfältig choreografierten Plans ist. Blinzelnd stehe ich im Tageslicht und will schreien, und ich halte nach einem oder einer Vertriebenen Ausschau. Bitte, schießt es mir durch den Kopf, bitte lass mein Pärchen vorbeikommen, lass mich endlich ihre Gesichter sehen, ihre Hände nehmen. Ich will ihnen Sandwiches machen, ihnen Decken bringen und ihnen sagen, dass es in Ordnung ist, dass sie unter unserem Haus wohnen dürfen. Später bin ich froh, dass ich sie nicht gefunden habe, nämlich als mir klar wird, dass es nicht gerade nett ist, zu einem Menschen zu sagen, Du darfst unter meinem Haus wohnen.
Die warme Woche erweist sich als Übergangsphänomen, ein Fehlstart der Jahreszeit. Es wird noch einmal so klamm und kalt, dass sonst niemand vor die Tür geht, und unterwegs zittere ich, bis ich in einen Drogeriemarkt gehe — kurz raus aus der Kälte —, um Epson-Badesalz zu kaufen, das mir in die Knochen kriechen soll wie jetzt die Kälte. Es ist ein Schock, aus dem kalten Grau in Grau in diese schreienden Farben, die Bullenhitze zu kommen, Hunderte Meilen über die rissigen Bürgersteige zurückzulegen, vorbei an kümmerlichen Zwergpalmen und über den Weg huschenden schwarzen Katzen, vor denen ich blitzschnell flüchte, hinein in diesen Wahnsinn, die Gänge voll buntem Schrott in sinnloser Plastikfolie und mit Plastikaufreißlaschen, die eines Tages im Schlund der letzten Meeresschildkröte dieser Erde landen werden. Ich merke, dass ich hinke, und das Hinken verwandelt sich in eine Art schmerzerfülltes Wippen, denn die Musik fördert längst vergessene Grundschulzeiten zutage, als meine Eltern jünger waren als ich jetzt, unglaublich, und den einen langen Sommer, in dem sie in Dauerschleife Paul Simon gehört haben, der zum federnden Rhythmus afrikanischer Trommeln über einen Ausflug mit einem Sohn, ein menschliches Trampolin und das Fenster im Herzen sang. Es ist zu viel und gleichzeitig zu wenig, und ich gehe ohne das Salz, weil ich für so eine bequeme Absolution noch nicht bereit bin. Ich kann nicht.
So gehe ich Schritt um Schritt, und als ich irgendwann nahe dem entfesselten Froschkonzert hochsehe, erwartet mich dort mitten im Dunkel etwas Überwältigendes: Der neue Eigentümer des ehemaligen Nonnenklosters hat Bodenstrahler installieren lassen, aber sie leuchten nicht die ästhetisch glatte Wand des Kastens an, sondern die sprühend lebendige Eiche davor, so alt und so ausladend, dass sie sich über das halbe Grundstück ausbreitet. Ich wusste schon immer, dass der Baum da ist, meine Kinder haben oft auf den unteren Ästen geschaukelt oder kleine Farne und Epiphyten aus seiner Rinde geklaubt und mir damit den Kopf geschmückt. Aber noch nie zuvor hat sich der Baum ganz als der Koloss, der er ist, zu erkennen gegeben, mit so schweren Ästen, dass sie dem Boden zuwachsen, ihn berühren und dann wieder himmelwärts streben; und so auf die Ellbogen gestützt, erinnert er an eine Frau, die am Küchentisch sitzt, das Kinn auf den Knöcheln, und Tagträumen nachhängt. Erschüttert von seiner Schönheit, bleibe ich stehen, und während ich ihn betrachte, stelle ich mir vor, wie die Schwäne auf ihrer Insel den hellen Funken in der Nacht sehen, der etwas in ihren Schwanenherzen berührt. Irgendjemand hat erzählt, sie hätten wieder angefangen, ein Nest zu bauen, aber ich weiß nicht, wie sie das ertragen nach allem, was sie verloren haben.
Ich hoffe, meinen beiden Söhnen ist jetzt wie auch in der im Dunkel gerade erst Gestalt annehmenden Zukunft bewusst, dass ihre Mutter in all den Stunden, in denen sie so zügig von ihnen wegmarschierte, gar nicht weg war, dass mein Geist schon vor Stunden zurück ins Haus gewandert und in das Zimmer gekrochen ist, in dem ihr früh aufstehender Vater bereits eingeschlafen ist, meistens vor acht, und dass ich ihn berührt habe, diesen sanften Mann, den ich so verzweifelt liebe und auf gewisse Weise so fürchte, dass ich den Puls an seinen Schläfen gefühlt und seine Träume gespürt habe, die zu fern sind für meinesgleichen, und anschließend die knarrende alte Treppe hinaufgestiegen bin, mich oben zweigeteilt und zu den jeweiligen Zimmern der Jungen geschlichen habe und durch die Ritzen unter der Tür geschlüpft bin, um die Luft einzuatmen, die sie ausgeatmet haben. Jede Pause zwischen dem Ende eines Atemzugs und dem Beginn des nächsten ist lang; andererseits gibt es nichts, was sich nicht unentwegt im Wandel befände. Bald, morgen schon, werden die Jungen Männer sein, dann werden die Männer das Haus verlassen und mein Mann und ich werden einander ansehen, gebückt unter dem Gewicht all dessen, was wir nicht brüllen konnten oder wollten, und all der Stunden, die wir, mein Körper, mein Schatten und der Mond, zusammen draußen herumgelaufen sind. Es ist schrecklich wahr, selbst wenn in dieser Wahrheit kein Trost liegt, dass die alten Cartoons recht hatten, dass der Mond, wenn man ihn Abend für Abend nur lange genug ansieht, wie ich es getan habe, tatsächlich lacht. Aber er lacht nicht über uns, uns einsame Menschen; wir sind viel zu klein und unser Leben ist viel zu kurz, um uns überhaupt Beachtung zu schenken.
In den imaginären Winkeln der runden Welt
Jude wurde in einem Cracker-Haus geboren, direkt am Rand eines Sumpfs, der förmlich brodelte, so viele namenlose Reptilienarten lebten darin. Damals war Floridas Mitte nur dünn besiedelt. Klimaanlagen hatten nur die Reichen, der Rest behalf sich mit hohen Decken, Schlaf-Veranden und Dachventilatoren. Judes Vater war Herpetologe und arbeitete an der Universität, und wenn die Schlangen nicht von selbst in das warme Haus gekrochen wären, hätte sein Vater es ohnehin damit vollgestopft. Auf den Fensterbänken standen Klapperschlangen in Formaldehyd. Die Bretterverschläge, in denen seine Mutter einmal Hühner zu halten versucht hatte, waren von zuckenden Reptilienknäueln bevölkert. Jude lernte schon in jungen Jahren, ruhig Blut zu bewahren, wenn er etwas berührte, das Giftzähne hatte. Er hatte gerade erst laufen gelernt, als seine Mutter in die Küche kam und eine Korallenotter um sein Handgelenk herum ihren rot-gelben Schwanz jagen sah. Sein Vater schaute von der anderen Seite des Zimmers aus zu und lachte. Seine Mutter kam aus dem Norden, eine Presbyterianerin. Sie war immer erschöpft; täglich kämpfte sie allein gegen den Moder und den höllischen Schlangengestank im Haus an. Sein Vater hätte nie zugelassen, dass eine Schwarze einen Fuß in sein Haus setzte, und eine weiße Frau konnten sie sich nicht leisten. Judes Mutter fürchtete sich vor allem, was Schuppen hatte, und versuchte, solches Getier mit Kirchenliedern fernzuhalten. Als sie mit Judes Schwester schwanger war und eines Abends im August ein kühles Bad nehmen wollte, übersah sie ohne Brille den knapp einen Meter langen Albino-Alligator, den ihr Mann in der Badewanne einquartiert hatte. Am nächsten Morgen war sie weg. Eine Woche später kam sie zurück. Und nachdem Judes Schwester tot geboren wurde, ein Baby wie ein makelloses Blütenblatt, hörte seine Mutter nie mehr auf, leise vor sich hin zu singen.
Das Tosen des Kriegs wurde immer lauter. Schließlich war es unüberhörbar. Seine Mutter bügelte die neue Khakiuniform seines Vaters, dann ging seine Abwesenheit durchs Haus wie eine kühle Brise. Er war in Frankreich und flog Frachtmaschinen. Jude stellte sich schuppige Tiere vor, die in der Luft mit riesigen Flügeln schlugen, während sein Vater mit grimmigem Blick die Zügel hielt.
Als Jude an ihrem ersten Tag allein im Haus einen Mittagsschlaf hielt, warf seine Mutter die toten Schlangen samt Gläsern in den Sumpf und trennte den lebenden fein säuberlich den Kopf ab. Mit der Gartenschere schnitt sie sich einen Bob. Innerhalb einer Woche zog sie mit ihm neunzig Meilen weiter an die Küste. In der ersten Nacht im neuen Haus, als sie glaubte, er würde schlafen, ging sie im Mondlicht hinunter ans Wasser und grub die Füße in den Sand. Es sah aus, als würde der glänzende Saum des Meeres sie sich bis zu den Knien einverleiben. Jude hielt ängstlich die Luft an. Eine große Welle kam und rollte über ihre Schultern hinweg, und als das Wasser zurücklief, war seine Mutter wieder ganz.
Es war eine ganz neue Welt, voller Delfine, die als glänzende Bögen die Küste entlangglitten. Jude mochte die Pelikane, geisterhafte Keile am Himmel, und das wilde Graben nach Strandschnecken, die immer tiefer im nassen Sand verschwanden. Wenn sie Schnecken sammeln gingen, zählte er im Kopf immer mit, und als sie einmal nach Hause kamen, verkündete er seiner Mutter, sie hätten genau vierhunderteinundsechzig Stück ausgegraben. Ohne zu blinzeln, sah sie ihn durch ihre Brille an und zählte die Tiere laut nach. Dann ging sie zum Waschbecken und wusch sich lange die Hände.
Schließlich drehte sie sich um und sagte, Du magst Zahlen.
Ja, antwortete er. Sie lächelte, wobei ein sanftes Strahlen von ihr ausging, das ihn erschreckte. Er spürte, wie es in ihn eindrang, bis tief in seine Knochen sickerte. Sie küsste ihn auf den Scheitel und brachte ihn ins Bett, und als er mitten in der Nacht aufwachte und sah, dass sie neben ihm lag, schob er die Hand unter ihr Kinn und ließ sie bis zum Morgen dort liegen.
Ihm dämmerte, dass die Welt nach Regeln funktionierte, die sich ihm nicht offenbarten, dass er nur einzelne Fäden eines größeren Gewebes zu fassen bekam. Judes Mutter eröffnete eine Buchhandlung. Weil Frauen in Florida keine Immobilien erwerben durften, kaufte Judes Onkel, ein kugelrunder, kleiner Mann, der keinerlei Ähnlichkeit mit seinem Vater hatte, den Laden von ihrem Geld und überschrieb ihn ihr anschließend. Seine Mutter trug seit Neuestem Kostüme, die ihr Dekolleté zeigten, und bevor sie in die Straßenbahn stieg, nahm sie ihre Brille ab, damit sie der Öffentlichkeit mit sanftem Blick begegnete. Statt Jude Schlaflieder vorzusingen, wie sie es im Schlangenhaus getan hatte, las sie ihm jetzt vor. Shakespeare, Neruda und Rilke, und während sich das Metrum der Verse in seinem Kopf mit dem trägen Rhythmus des Meers vermischte, sank er in den Schlaf.
Jude mochte die Buchhandlung sehr; es war hell dort und roch nach frischem Papier. Einsame Kriegsbräute kamen mit ihren Kinderwagen und gingen mit einem Armvoll Modern-Library-Klassiker, Matrosen auf Urlaub schlenderten hinein, um wenig später mit einer Tüte Bücher vor der Brust beglückt wieder hinauszugehen. Nach Ladenschluss löschte Judes Mutter alle Lichter und öffnete den Schwarzen, die geduldig am Hintereingang warteten, dem würdevollen Mann mit seiner Rollmütze, der Galsworthy verehrte, der dicken Frau, die als Dienstmädchen arbeitete und pro Tag einen Roman las. Dein Vater würde fuchsteufelswild werden. Ach, zur Hölle mit ihm, sagte seine Mutter zu Jude und sah dabei so entschlossen aus, dass in seinem Kopf die letzten Spuren der furchtsamen Frau ausgelöscht wurden, die sie einmal gewesen war.
Als er eines Morgens kurz vor der Dämmerung allein am Strand war, sah er etwa hundert Meter vor der Küste etwas Großes, Metallisches durch die Wasseroberfläche brechen. Das U-Boot sah ihn aus seinem einen Periskop-Auge an und tauchte lautlos wieder ab. Jude erzählte niemandem davon. Er behielt dieses gefährliche Wissen in seinem Inneren, wo es drückte und kniff, aber der größeren Welt nichts anhaben konnte.
Judes Mutter stellte eine schwarze Frau namens Sandy ein, die ihr bei der Hausarbeit half und auf Jude aufpasste, während sie im Laden war. Sandy und seine Mutter wurden Freundinnen, und manchmal wachte er nachts auf und hörte auf der Veranda Gelächter, und wenn er nachsah, saßen seine Mutter und Sandy dort in der nächtlichen Meeresbrise. Sie tranken Schlehen-Gin-Fizz und aßen Zitronenkuchen; Sandy legte Wert darauf, immer frischen im Haus zu haben, auch wenn Zucker Mangelware war. Sie gaben ihm auch ein Stück, dann schlief er auf Sandys breitem Schoß ein, auf der Zunge die saure Süße und im Ohr den Atem des Meers und die Stimmen der Frauen.
Mit sechs entdeckte er ganz allein die Multiplikation, als er in der heißen Sonne vor einem Ameisenhügel kauerte. Wenn pro Minute zwölf Ameisen den Hügel verließen, bedeutete das siebenhundertzwanzig pro Stunde, ein immenses Kommen und Gehen. Sprachlos vor Glück, rannte er in den Buchladen. Als er den Kopf im Schoß seiner Mutter vergrub, verwechselten die Frauen, die an der Ladentheke mit ihr plauderten, sein Schluchzen mit Traurigkeit.
Der Junge vermisst bestimmt seinen Vater, sagte eine der Damen und meinte es nur gut.
Nein, sagte seine Mutter. Sie allein kannte sein berstendes Herz und kratzte ihm sanft die Kopfhaut. Doch in Judes Innerem bewegte sich etwas, und er dachte an seinen Vater, von dem seine Mutter in all den Jahren so selten gesprochen hatte, dass der Mann fast nicht mehr existierte. Jude konnte sich kaum noch an das Schaben von Schuppen auf Schuppen und das düstere Cracker-Haus im Sumpf erinnern, in dem stets die Vorhänge zugezogen waren, damit die heiße, stinkende Sonne nicht hereinkam.
Aber es schien, als hätte die wohlmeinende Dame Judes Vater herbeigerufen, denn er kam zurück. Riesig und mit stoppligen Wangen thronte er mitten im Wintergarten. Judes Mutter saß nervös ihm gegenüber auf dem Divan, die Knie von ihm weggedreht. Der Junge spielte auf dem Boden still mit seiner Holzeisenbahn. Sandy kam und brachte frisch gebackene Kekse, und als sie wieder in die Küche ging, sagte sein Vater etwas, so leise, dass Jude es nicht verstand. Seine Mutter sah seinen Vater lange an, dann stand sie auf und ging in die Küche; kurz darauf wurde die Fliegentür zugeschlagen, und der Junge sah Sandy nie wieder.
Als seine Mutter in der Küche war, sagte Judes Vater: Wir gehen nach Hause.
Jude konnte seinen Vater nicht ansehen. Der Raum, den er einnahm, war zu schwer und zu dunkel. Er schob seine Eisenbahn um ein Stuhlbein herum. Komm her, sagte sein Vater, und der Junge stand langsam auf und ging zum Knie seines Vaters.
Zack, ein Hieb mit der großen Hand, und Judes Gesicht brannte vom Ohr bis zum Mund. Er fiel hin, aber er schrie nicht. Er zog die Nase hoch und spürte, wie sich Blut hinten im Hals sammelte.
Seine Mutter kam gerannt und hob ihn auf. Was ist passiert?, schrie sie, und sein Vater sagte mit seiner kühlen Stimme: Der Junge kriegt den Mund nicht auf. Mit dem stimmt was nicht.
Er macht vieles mit sich allein aus. Er ist schüchtern, sagte seine Mutter und trug Jude weg. Als sie ihm das Blut aus dem Gesicht wusch, spürte er ihr Zittern. Sein Vater kam ins Bad. Rühr ihn ja nie wieder an, zischte sie.
Nicht nötig, sagte er.
Judes Mutter blieb neben ihm liegen, bis er einschlief, aber als er aufwachte, sah er durch die Windschutzscheibe des Autos den Mond und davor die gezackten Profile seiner Eltern, die auf die Straße starrten, die schwarz wie ein Tunnel vor ihnen lag.
Das Haus am Sumpf füllte sich wieder mit Schlangen. Der Onkel, der Judes Mutter mit dem Buchladen geholfen hatte, war nicht mehr willkommen, auch wenn er der einzige Verwandte war, den sein Vater noch hatte. Judes Mutter briet jeden Abend ein Steak und kochte Kartoffeln, aß aber selbst nichts. Sie wurde ein Knochen, eine Klinge. Sie saß in ihrem Hauskleid auf der Veranda im Schaukelstuhl, das Haar nassgeschwitzt und strähnig. Jude stellte sich neben sie und flüsterte ihr die alten Sonette ins Ohr. Sie zog ihn zu sich heran und bettete ihr Gesicht zwischen seiner Schulter und seinem Hals, und wenn sie blinzelte und ihre feuchten Wimpern ihn kitzelten, wusste er, dass er nicht weggehen durfte.
Sein Vater hatte begonnen, nebenbei Schlangen an Zoos und Universitäten zu verkaufen. Er verschwand für zwei, drei Tage am Stück und kam mit verrauchten Kleidern und Säcken voll Klapperschlangen und Kletternattern zurück. Er war zwei Nächte weg gewesen, als Judes Mutter ihren blauen Pappkoffer packte, eine Seite mit Judes Sachen und die andere mit ihren eigenen. Sie sagte nichts, verriet sich aber durch ihr Summen. Zusammen gingen sie durch die dunklen Straßen, dann saßen sie lange am Bahnhof und warteten auf den Zug. Der Bahnsteig war leer; ihr Zug war der letzte vor dem Wochenende. Er lutschte ein Karamellbonbon, das sie ihm gegeben hatte, drückte sein Bein fest gegen ihres und spürte, dass sie am ganzen Körper zitterte.
Während des Wartens hatte sich so viel in ihm aufgestaut, dass es eine Erleichterung war, als der Zug seufzend in den Bahnhof einfuhr. Seine Mutter stand auf und nahm Jude an die Hand. Er lächelte zu ihr hoch, in das sanfte Lächeln hinein, das sie ihm zurückgab.
Dann trat Judes Vater ins Licht, packte ihn und hob ihn hoch. Jude spürte seinen sehnigen Körper unter sich und war so erschrocken, dass ihm der Schrei im Halse steckenblieb. Seine Mutter sah weder ihren Mann noch ihren Sohn an. Sie wirkte wie eine Statue, schmal und bleich.
Als der Schaffner Alle einsteigen! rief, stieß sie einen entsetzlichen, erstickten Ton aus und sprang schnell in den Waggon. Mit einem Pfeifen rollte er langsam an. Jetzt konnte Jude schreien, und er schrie, so laut es ging, auch wenn es ihm nicht gelang, sich loszureißen, weil sein Vater ihn zu fest hielt, doch der Zug trug seine Mutter unaufhaltsam fort ins Dunkel.
Dann waren sie allein in dem Haus im Sumpf, nur Jude und sein Vater.
Die Sprache verkümmerte zwischen ihnen. Jude begann zu fegen und zu schrubben, und er war es auch, der zum Abendessen Sandwiches machte. Wenn sein Vater unterwegs war, öffnete er die Fenster, um etwas von dem Reptilienmief rauszulassen. Sein Vater riss die Lilien und Rosen seiner Mutter heraus und pflanzte Mandarinenbäumchen und Blaubeersträucher; weil Obst Vögel anlockte und Vögel Schlangen, wie er sagte. Der Junge ging drei Meilen zu Fuß zur Schule, wo er niemandem erzählte, dass er sich mit Zahlen schon besser auskannte als die Lehrer. Obwohl er klein war, legte sich niemand mit ihm an. Als ihn ein kräftiger Zehnjähriger am ersten Tag wegen seiner Kleidung verspotten wollte, stürzte sich Jude so jäh auf ihn, wie er es bei den Klapperschlangen gesehen hatte, und danach blutete der größere Junge am Kopf. Er war ein Zwischenwesen, mutterlos, aber nicht ohne Vater, gehemmt und verlottert wie ein Armenkind, aber der Sohn eines Professors, und wenn die Lehrer ihn aufriefen, wusste er stets die korrekte Antwort, auch wenn er von selbst nie ein Wort sagte. Die anderen hielten Abstand zu ihm. Jude spielte allein oder mit einem der Welpen, die sein Vater immer wieder mit nach Hause brachte. Früher oder später rannten die Hunde unweigerlich hinunter zum Sumpf, wo sie sich einer der vier- bis viereinhalb Meter langen Alligatoren schnappte.
Judes Einsamkeit wuchs, wurde zu einem lebendigen Wesen, das seinen Schatten auf ihn warf und sich nur dann verzog, wenn er in Gesellschaft seiner Zahlen war. Mehr als Murmeln oder Zinnsoldaten waren sie sein Spielzeug. Mehr als Zuckerstangen oder Pflaumen ließen sie ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. So chaotisch die Welt auch war, die vorhersehbaren, freundlichen Zahlen brachten Ordnung hinein.
Als er zehn war, sprach ihn auf der Straße ein kleiner, runder Mann an und drückte ihm ein Paket in braunem Packpapier in die Arme. Obwohl er Jude vage bekannt vorkam, konnte er ihn nicht genau einordnen. Der Mann legte einen Finger auf die Lippen und tänzelte davon. Abends in seinem Zimmer packte Jude die Bücher aus. Eins war eine Gedichtsammlung von Robert Frost. Das andere war ein Buch über Geometrie; es brach die Welt so weit herunter, dass sie nur noch aus Geraden und Winkeln bestand. Als er wieder hochsah, glitzerten die ersten Morgensonnensprenkel in der Lorbeereiche. Das Buch hatte ihm etwas über Geometrie vermittelt, aber noch stärker spürte der Junge, dass es ihm etwas gezeigt hatte, das bisher unentdeckt in seinem Inneren gelebt hatte.
Auch ein Brief lag dabei. Er war in der runden Handschrift seiner Mutter an ihn adressiert. Wenn er in der Schule saß und die Stunden dividierte, bis er wieder frei war, wenn er zum Abendessen Thunfisch-Sandwiches machte, wenn er am Esstisch neben seinem Vater saß, der Benny Goodman im Radio dirigierte, wenn er sich die Zähne putzte und den viel zu kleinen Pyjama anzog, dann riefen die vier perfekten Winkel des Briefs nach ihm. Er legte ihn unters Kopfkissen, ungeöffnet. Eine Woche lang war der Brief für ihn wie die Sonne, wenn sie an einem heißen, bedeckten Tag nicht zu sehen, aber trotzdem immer da ist.
Nachdem er schließlich alles aus dem Geometriebuch herausgepresst hatte, was es zu wissen gab, legte er den noch immer verschlossenen Umschlag hinein, klebte die beiden Buchdeckel mit Klebeband zusammen und versteckte es zwischen seiner Matratze und dem Lattenrost. Jeden Abend, nachdem er sein Gebet aufgesagt hatte, sah er nach, ob es noch da war, dann schlief er getröstet ein. Als er eines Abends entdeckte, dass die Klebestreifen aufgerissen worden waren und der Brief nicht mehr im Buch lag, wusste er, dass sein Vater ihn gefunden hatte und nichts mehr zu machen war.
Als er das nächste Mal den kleinen runden Mann auf der Straße sah, sprach er ihn an. Wer sind Sie?, fragte er, und der Mann blinzelte und sagte: Dein Onkel. Als Jude ihn ohne ein Zeichen des Wiedererkennens im Gesicht ansah, breitete der Mann die Arme aus, sagte: Ach, mein Junge!, und wollte ihn an sich drücken, aber Jude hatte sich schon umgedreht.
Die Universität wuchs unerbittlich. Von Klimaanlagen stets mit kühler Luft versorgt, machte sie sich breit und breiter und verleibte sich das Land ein, das zwischen ihr und dem Sumpf lag, bis die Universitätsstraßen das Grundstück seines Vaters eng umschlangen. Am Abendbrottisch gab es nun endlose Schimpftiraden: Wussten die von der Uni denn nicht, dass seine Tiere Platz zum Leben brauchten, dass das weite, sandige Land hier eines der artenreichsten Reptilienvorkommen in Nordamerika beherbergte? Er würde nie verkaufen, niemals. Er würde über Leichen gehen, um sein Grundstück zu behalten.
Während sein Vater sprach, träumte der Verräter in Jude von den Summen, die man seinem Vater angeboten hatte. Geld, so schien es, ließ sich so leicht vermehren. Anders als andere Zahlen befruchtete es sich ganz von selbst; es verdoppelte sich wieder und wieder, bis es in tosenden Wellen über einem zusammenschlug. Wenn genug davon da war, das wusste Jude, brauchte sich nie wieder irgendjemand Sorgen zu machen.
Mit dreizehn entdeckte Jude die Universitätsbibliothek. Als er an einem Sommertag von dem Stapel Bücher aufsah, die er zufrieden durchgearbeitet hatte — Trigonometrie, Statistik, Höhere Analysis, alles, was er finden konnte —, blickte er in das Gesicht seines Vaters. Jude wusste nicht, wie lange er schon dort gestanden hatte. Es war ein schwüler Vormittag, und selbst in der Bibliothek war die Luft stickig, aber sein Vater wirkte kühl mit seiner ledrigen Haut, seinem verschossenen Hemd und dem roten Halstuch.
Komm jetzt, sagte er. Mit ungutem Gefühl folgte ihm Jude. Sie fuhren mit dem Pick-up, und erst nach zwei Stunden Fahrt begriff Jude, dass sie zusammen auf Schlangenjagd gingen. Es war sein erstes Mal. Als er noch kleiner gewesen war, hatte er darum gebettelt, mitzudürfen, aber sein Vater hatte immer nein gesagt, das sei zu gefährlich, und Jude hatte ihm nie entgegengehalten, dass es auch nicht sicherer war, ein Kind eine Woche lang allein in einem Haus voll Schlangengift, Waffen und zweifelhafter Elektroinstallationen zurückzulassen.
Sein Vater baute das Zelt auf, dann aßen sie im Dunkeln Bohnen aus der Dose. Als sie nebeneinander in ihren Schlafsäcken lagen, sagte sein Vater irgendwann: Du bist gut in Mathe.
Ja, antwortete Jude, auch wenn es eine solche Untertreibung war, dass es ihm vorkam wie eine Lüge. Irgendetwas zwischen ihnen veränderte sich, und die Stille, in der sie einschliefen, hatte weichere Ränder als sonst.