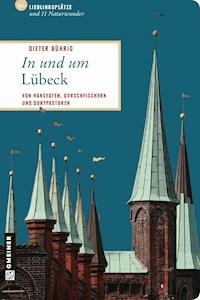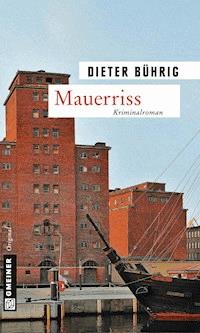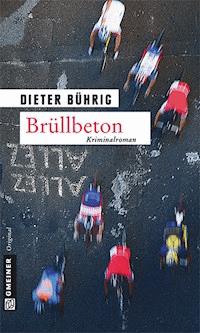Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Inspektor Kroll
- Sprache: Deutsch
Was hat die Leiche eines Schwarzafrikaners in einem Kühlwagen zu tun mit der Insassin einer Pflegeanstalt für psychisch Kranke, die vor 25 Jahren nach einem schweren Unfall das Gedächtnis verlor? Auf den ersten Blick nichts. Doch als der Lübecker Kriminalhauptkommissar Kroll herausfindet, dass es in beiden Fällen um Fluchtversuche geht, wird er in einen Fall verwickelt, der ihn fast das Leben kostet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Bührig
Fluchtvögel
Ein musikalischer Kriminalroman
Impressum
Alle Personen und die Handlung des Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie mit historischen Geschehnissen wären rein zufällig. Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass das Schlösschen Bellevue in der Einsiedelstraße keine psychiatrische Klinik beherbergt. Hier dient die Realität als dichterische Vorlage. Um unerwünschte Assoziationen zu vermeiden, ist der Name einiger Institutionen und Dienstbezeichnungen leicht verändert. Zitate aus historischen Quellen sind der heutigen Rechtschreibung vorsichtig angepasst.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: © sanderstock – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4326-8
Kapitel 1: Oberstimme – Die Falle
»Big Mac kommt. Schnell, jeder auf seinen Platz!«
Asad, ein kurdischer Junge, presste sein Kommando kaum hörbar durch die Zähne, aber alle wussten sofort, was zu tun war. Die meisten der Jungenbande verdrückten sich pfeifend und mit einer zerbeulten Bierdose kickend die Treppe hinunter auf die belebte Durchgangsstraße, wo sie bald nicht mehr zu sehen waren. Dennoch wusste Asad, dass sie notfalls schnell zur Stelle sein konnten. Eine Gruppe hielt links, eine andere rechts der Brücke Wache.
Nur sein Freund Kimi, ein Rumäne, blieb an seiner Seite. Auffällig unauffällig spielten sie an dem neuen Smartphone herum, dass sich Asad von seiner älteren Schwester ausgeliehen hatte. Er wählte rasch und entschieden die 110 und flüsterte: »Hallo, ist dort die Polizei? – Wir sind ein paar Kinder und stehen hier auf der Vorwerker Autobahnbrücke. Bitte kommen Sie sofort. Man will uns überfallen. Wir kennen den Typen, der ist immer so brutal zu uns. – Wenn Sie sich beeilen und die Brücke auf beiden Seiten abriegeln, kann er Ihnen nicht entkommen. – Ich lasse das Handy auf Empfang. Dann können Sie alles mithören.«
Asad gab seinem Freund das verabredete Zeichen. Der rief laut: »Gib doch nicht so an mit deinem Handy! Das von meinem Bruder ist viel moderner. Damit kannst du auch skypen.«
»Vielleicht«, konterte der Ältere unüberhörbar, »aber dafür ist meins teurer. Hab’ drei Riesen gelöhnt! Und hat auch ein GPS-Navi. Hier, wollen mal sehen, wo wir sind.« Die beiden fummelten umständlich an dem Handy herum, bis der Erwartete herangekommen war.
»Na, Kumpels, neues Spielzeug? Lass mal sehn!«
Rico McDonald, 19-jähriger Sprössling eines irischen Seemanns, den er nie kennengelernt hatte, und ungewolltes Kind einer Prostituierten, die ihn kurz nach seiner Geburt kurzerhand in die Lübecker Babyklappe gelegt hatte, wurde gewöhnlich Big Mac genannt. Er rempelte Kimi zur Seite. Dann zog er den um mehr als einen Kopf kleineren Asad am Jackenrevers zu sich heran. »Lass mal sehn! – Das ist doch nichts für kleine Kinder. Gib mir mal, ich kenn’ mich da besser aus!«
»Nein, das gehört mir nicht. Ich hab’ meiner Schwester versprochen, es nicht aus der Hand zu geben.« Aus den Augenwinkeln beobachtete Kimi, wie sich an beiden Seiten der Brücke unauffällig zwei Polizeiwagen näherten und von den Freunden eingewiesen wurden.
»Ach was, deine Schwester, diese Hure.« Rico zog ein Klappmesser aus der Hosentasche, ließ es mit einem trockenen Schwupp aufklappen und fummelte damit vielsagend vor Asads Gesicht herum. »Du weißt doch, dass man Erwachsenen nicht widersprechen soll! Hast wohl keine Manieren, was?«
»Lass uns in Ruh’! Wir wollen keinen Streit mit dir, wir wollen jetzt zum Spielplatz in den Koggenweg. Ich geb dir fünf Euro, wenn du uns durchlässt.« Der irische Halbstarke aber ließ nicht locker. »Ich handle nicht mit Kindern, noch dazu mit euch verdammt dreckigen Kurden! Gib das Ding jetzt endlich her!«
»Nein, es gehört doch meiner …« Asad kam nicht weiter. Ein rascher Schnitt mit dem scharfen Messer hinterließ eine brennend schmerzende Wunde auf seiner linken Wange. Erschrocken ließ der Junge das Handy fallen und strich sich mit dem Daumen über das Gesicht. Blut klebte an seiner Hand. Panisch liefen die beiden Kinder davon. Rico bückte sich lachend und hob das Handy auf. »Na, geht doch! Man muss nur wissen wie! – Blöde Kurden. Denen muss man ab und zu die Zähne zeigen.«
Er bemerkte nicht, dass das Gerät noch auf Empfang gestellt war. Rasch ließ er es in seiner Jackentasche verschwinden und stiefelte zufrieden in Richtung des nahegelegenen Einkaufszentrums. Dort kannte er einen Aushilfswachmann, der ihm das Handy sicherlich gegen gute Kohle abkaufen würde.
Die Woche schien für ihn gerettet zu sein. Viel hatte er bislang nicht verdient. Da wäre ihm ein Riese gerade recht. Aber leider kam es ganz anders. Eben war er am Ende der Brücke angelangt, schossen aus dem Gebüsch ein paar Polizisten hervor.
»Halt, stehen bleiben!« Rico wollte sich umdrehen und davonrennen, aber das Klicken der Dienstwaffe warnte ihn: »Keine Experimente! Hände an das Geländer, einen Schritt zurück und dann die Beine breit.« Brutal riss ihm ein Beamter den rechten Arm auf den Rücken. Rico hätte fast das Gleichgewicht verloren. Aber der professionelle Klammergriff schien ihn festzunageln.
Flinke Hände tasteten ihn ab und brachten schnell das Klappmesser und das geraubte Handy ans Tageslicht. »Na, was haben wir denn da?«, fragte der Polizist. »Klappmesser dieser Größe sind verboten. Und das Smartphone – sieht auch eine Nummer zu groß für dich aus.«
»Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Ich will meinen Anwalt sprechen.« Das hatte er aus den Fernsehkrimis gelernt. »Und überhaupt, das Handy gehört mir. Hab ich gestern gekauft.«
»Ja ja, das kennen wir. Und das mit dem Messer hast du natürlich nicht gewusst. Wir werden dich mit aufs Revier nehmen, da kannst du in Ruhe deinen Anwalt anrufen. Und sag ihm, er soll gleich den Kaufbeleg für das Handy mitbringen. Ansonsten könnten wir vermuten, dass du es dir nicht auf legalem Weg beschafft hast.«
Der Polizeibeamte bemerkte, dass es noch auf Empfang geschaltet war. Er führte es an sein Ohr. »Hallo, hier Schulz vom 3. Revier. – Habt ihr alles mitbekommen und aufgezeichnet? – Gut. – Ja, wir haben ihn festgesetzt und sind gleich zurück. Von den Kindern nehmen wir nur noch rasch die Personalien auf.«
Rico fühlte den Boden unter seinen Füßen nachgeben. ›Verdammt, das war eine blöde Falle‹, dachte er. ›Die Kids haben mich reingelegt.‹
Kaum war das Polizeiauto verschwunden, rief Asad seine Getreuen zusammen. »So, das hat prima geklappt. Den haben wir geknackt. Jetzt gehört die Straße uns!«
Kimi klopfte seinem Freund auf die Schulter und strich ihm liebevoll über die leicht blutende Wunde: »Ja, und du wirst unser Anführer!« Die anderen johlten zustimmend. Was für ein Held in ihren Reihen! Da würden auch die älteren Kinder Respekt zeigen. Mit einer knappen Handbewegung brachte Asad sie zum Schweigen. »Passt auf, ich setze noch einen drauf.« Er machte eine kleine Kunstpause, um die Wichtigkeit seiner Worte zu unterstreichen.
»Die Verletzung mit dem Messer verschweigen wir erst einmal der Polizei gegenüber. Denn das würde Big Mac unweigerlich in den Knast bringen. Ich hab’ aber Besseres mit ihm vor. – Er soll für uns arbeiten! Er hat mehr Erfahrung als wir und ein paar gute Kontakte. Das können wir ausnutzen. Und wenn er nicht spurt, werden wir ihn mit dieser Messergeschichte erpressen.«
*
Die Verhandlung vor dem Jugendgericht ging schnell über die Bühne. Der Richter kannte derartige Fälle zur Genüge. ›Der kommt bestimmt wieder‹, dachte er. ›Danach steht Intensivtäter auf seiner Akte. Und beim dritten Mal tritt er endgültig seine Knastkarriere an.‹
Dann wog er mit juristischem Weitblick ab: Schwere der Tat, jugendtümliches Verhalten – der Angeklagte hatte gerade mal eben das 19. Lebensjahr vollendet –, soziale Herkunft, marode Familienverhältnisse … – Fazit: zwei Monate Sozialdienst wegen Nötigung. Das zuständige Jugendamt vermittelte ihn in die Nervenklinik der Frau Dr. Schahyn.
Rico kam glimpflich davon, aber nur, weil Asad die Wunde an seiner Wange nicht ins Spiel brachte. Raub in Tateinheit mit Körperverletzung hätte den Angeklagten gleich direkt hinter schwedische Gardinen gebracht. So musste er sich der Bande der jungen Kurden unterordnen.
Widerwillig schloss er sich ihnen an. Immerhin hatte das den Vorteil, dass er nicht mehr als Einzelgänger auf Pirsch gehen musste, sondern sich im Schutz einer Bande bewegen konnte. Man traf sich in einer abgelegenen Halle des längst ausgedienten Schlachthofs zwischen Wallhafen und Katharinenstraße. Zwar stank es dort immer noch bestialisch nach Blut und Kot, aber gerade das hielt unliebsame Gäste auf Abstand. Außerdem bot der unübersichtliche Wasserarm einen idealen Fluchtweg. Ein geklautes Motorboot lag in einem Versteck bereit, um im Notfall über die Hafengewässer und Industrieanlagen hoch zur Teerhofinsel zu fliehen, wo es genügend Schlupfwinkel gab.
Der junge Ire hatte das Versteck vermittelt. Nicht ganz uneigennützig, denn in unmittelbarer Nachbarschaft, in den verlassenen Hallen einer Werft, traf sich eine Profibande, für die er schon öfter den einen oder anderen Coup durchgeführt hatte. Rico wusste, dass die ein ganz anderes Kaliber waren, als seine kurdischen Gelegenheitsgangster. Deswegen sorgte er strikt für eine Interessentrennung. Den Profis, deren Oberhaupt ›Wiesel‹ gerufen wurde, kam die Verstärkung durch eine Kurdenbande gerade recht. Dadurch konnten sie gezielt Boten- und Kundschafterdienste von scheinbar harmlosen Kindern ausführen lassen.
Rico entwickelte sich langsam zum Bindeglied zwischen beiden Parteien, was ihm wiederum einen gewissen Respekt bei Asad und seinen Freunden verschaffte. Im Laufe der Zeit erwies sich diese Konstellation als vorteilhaft für beide Seiten, Profis wie Jugendgang.
Kapitel 2: Unterstimme – Fluchtvögel
Der stürmische Levantewind hatte ihr Boot durch die Meeresenge von Gibraltar bis hinein in die Bucht von Barbate getrieben. Im letzten Moment, die Bootsflüchtlinge aus Marokko konnten die südspanische Küstenlinie schon deutlich erkennen, war der primitive Holzkahn infolge einer mannshohen, sich überschlagenden Welle gekentert. Fast alle wurden ins Wasser geschleudert und ertranken.
Nur Achmed und seinem Kumpel Driss gelang es, sich an einer schmalen Holzplanke festzuklammern und sich gegen die über sie hereinbrechenden Wassermassen zu behaupten. In ihrer Heimat waren sie als ausgezeichnete Schwimmer bekannt. Diese Eigenschaft sollte jetzt ihr Leben retten.
Alle anderen, wasserscheue Bauernsöhne aus dem Inland, hatten in dem Höllenkessel der gischtigen Flut keine Chance. Jeder von ihnen hatte 1000 Dollar für die gefahrvolle Überfahrt berappen müssen. Nun war das Vermögen ihrer Familien und damit auch jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes zugrunde gegangen.
Die Strömung drohte, die Planke in den offenen Atlantik abzutreiben. Die beiden brachten verzweifelt ihre letzten Kräfte auf und versuchten, mit der freien Hand und den nackten Beinen dem entgegenzupaddeln. Endlich spürten sie den steinigen Ufersand unter den Füßen. Eine letzte Anstrengung, und das rettende Festland war erreicht.
Ein heftiges Gewitter ging über sie hinweg, aber sie bemerkten es gar nicht. Erschöpft ließen sie sich in den warmen Sand fallen. Der Regen verhüllte die Landschaft, sodass man kaum zwischen Meer, Himmel und Erde unterscheiden konnte. Und das war für die beiden auch gut so, denn bei diesem miesen Wetter hatten die Beamten von der Guardia Civil keine Lust, mit ihren Geländewagen auf Streife zu gehen und nach Bootsflüchtlingen, nach ›clandestinos‹, also nach denen, die im Untergrund leben mussten, Ausschau zu halten.
Nach etwa einer Stunde rappelten sich die beiden Schiffsbrüchigen wieder auf. Achmed kannte sich hier ein wenig aus. Er hatte die Flucht in das vermeintlich gesegnete Land schon einmal versucht, war aber erwischt und wieder abgeschoben worden.
Fast allen clandestinos erging es so. Manche seiner Kumpel hatten es sogar schon dreimal versucht. Immer ergebnislos, und jedes Mal war viel Geld im Spiel. Geld, das in die unersättlichen Taschen einiger Schlepper floss. Skrupellose Menschenschmuggler, die mit dem Leben ihrer Nachbarn spielten, indem sie ihnen Hoffnungen einflößten, obwohl sie genau wussten, dass die primitiven Boote nichts als schwimmende Särge waren.
Driss setzte sich auf einen Stein, der von den auslaufenden Wellen umspült wurde. Er betrachtete das immer wieder von Neuem ankommende und abfließende Wasser. Jedes Mal wurden kleine Steine, Muschelreste oder Seetang mitgerissen.
Er musste an seine Familie, seine Braut, seine Freunde zu Hause denken. Wird diese Flucht sich lohnen? Würde sie all das aufwiegen, was er bisher auf sich genommen hatte? Würde es ihm gelingen, im fernen Nordeuropa einen Job zu finden, damit er die Seinen zu Hause ernähren konnte? Er hatte sich vorgenommen, bei der erstbesten Gelegenheit seine Braut nachkommen zu lassen.
»Was sie jetzt wohl macht?« Driss warf ein Stück Holz in das abfließende Wasser. »Vielleicht erreicht es ja das Heimatufer und kündet von unserem Erfolg. – Hauptsache, du hast den Kontaktzettel nicht verloren!«
»Keine Angst«, erwiderte sein Freund und tastete nach seinem Brustbeutel. »Ziemlich feucht geworden, aber er ist an Ort und Stelle. Ich hüte ihn wie meinen Augapfel, unseren Pass in die freie Welt. Ohne ihn würden wir über Algeciras nicht hinauskommen.«
Ein Suchscheinwerfer zerriss das Dunkel der Nacht. Oben auf der Straße fuhr langsam ein Geländewagen der Guardia Civil mit gedrosseltem Motor vorbei. Rasch versteckten sich die beiden hinter einem Ginsterbusch. Der grelle, scharf umrissene Lichtkegel streifte wie ein drohender Riesenfinger über den Strauch. Aber die beiden blieben unentdeckt.
Als die Streife außer Sichtweite war, schüttelte Achmed seinen Kameraden hoch und rief: »Weiter geht’s! Wir müssen uns südlich halten, aber wir dürfen weder am Strand entlang noch uns oben an der Schnellstraße blicken lassen.«
Als wäre er mit einem siebenten Sinn ausgestattet, steuerte Achmed zielstrebig quer durch die Marismas de Barbate, vorbei an Zahara de los Atunes, wo sich heute niemand des schlechten Wetters wegen außer Haus wagte.
Als sie weiter südlich den Kamm der Sierra de la Plata erreichten, konnten sie, als die Wolkendecke für einen Moment aufriss, in der Ferne die Stadt Tarifa erkennen, die ›Hauptstadt des Windes‹, wie sie im Volksmund genannt wird.
Das erste Etappenziel ihrer abenteuerlichen Odyssee.
Dort gab es ein Netzwerk der Stadteinwohner, das den illegalen Einwanderern half, wo immer es ging. Tarifa ist nur 15 Kilometer von Marokko entfernt. An klaren Tagen hat man einen herrlichen Blick nach Tanger. Mehr als ein Jahrtausend waren Spaniens Süden und das nördliche Marokko politisch und kulturell vereint. »Ist doch klar, wer uns näher steht«, pflegte Nieves, die Leiterin der Hilfsorganisation, zu sagen. »Die Marokkaner sind unsere Brüder, nicht die Bürokraten in Madrid, die nur auf unsere Steuerabgaben scharf sind. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, den armen Menschen zu helfen. Das ist eine Frage der Menschlichkeit.«
›Los pájaros fugitivos‹, ›Die Fluchtvögel‹, nannten sich die clandestinos untereinander. Menschen, die wie die Zugvögel nach Norden zogen, um dort ihr Glück zu suchen. Nur mit dem Unterschied, dass sie im Winter nicht wieder in den Süden zurückkehrten, weil sie dort kein Nest mehr hatten.
Nieves und ihre Freunde halfen ihnen dabei, wobei sie aber nicht umhin kamen, sich mit den professionellen Menschenschmugglern zu verständigen. Denn die hatten schließlich die entscheidenden Kanäle, um die Bootsflüchtlinge weiter nach Skandinavien zu schleusen. Dort winkte das Gelobte Land. So hofften die clandestinos wenigstens.
»Ihr solltet morgen Mittag um Punkt zwölf Uhr zum Castillo de Guzmán gehen«, erklärte Nieves, nachdem sie die beiden mit dem Nötigsten versorgt hatte. »Dort wird auf einer Bank vor dem Eingangstor ein Mann sitzen. Ihr erkennt ihn an seinem Strohhut mit der hellblauen Schleife. Er erwartet euch. Er wird ›El Buitre‹ genannt, der Geier. Vergesst aber euren Kontrollzettel nicht. Die Treiber reagieren ziemlich sauer, wenn ihr euch nicht korrekt ausweisen könnt. Ihr müsst wissen, dass die Bullen in letzter Zeit des Öfteren versucht haben, ihre Leute als Spitzel einzuschleusen, um die ganze Organisation auffliegen zu lassen. Wenn ihr euch dann mit ihm verabredet habt, kommt ihr nochmals bei mir vorbei, bevor es auf die weite Reise geht. Ihr bekommt dann Decken und die notwendigen Lebensmittel. Und nehmt genug Geld mit! El Buitre ist wählerisch, er nimmt nur die Besten. Er macht die beste Arbeit, aber fordert auch das Meiste. – Und noch eins: Wenn euch die Guardia Civil erwischt, wäre es besser, ihr verleugnet mich. Ansonsten würde es euren Brüdern, die da noch kommen wollen, sehr leidtun …!«
Die beiden Marokkaner fanden sich rechtzeitig am Castillo de Guzmán ein. In einem kleinen Park vor der Burg hatte die Stadtverwaltung ein Schachspiel aus unterschiedlich getönten Steinplatten errichten lassen, auf dem sich Rentner nachmittags gern die Zeit damit vertrieben, überdimensionale Schachfiguren hin und her zu schieben. Wer gerade nicht dran war, saß auf einer der das Feld flankierenden Bänke und kommentierte laustark und besserwisserisch das Spiel seiner Kumpels.
Heute, am noch frühen Vormittag, war nichts los hier. Nur ein Mann, dessen Strohhut mit einer hellblauen Schleife verziert war, saß einsam auf einer Bank. Achmed holte seinen Kontrollzettel aus der Hosentasche. Es handelte sich um die Skizze einer Schachpartie. Etwas unbeholfen stellten die beiden Marokkaner die Partie nach. Für Außenstehende sahen sie aus wie zwei Freunde, die sich mit einem harmlosen Brettspiel vergnügten.
Wenig später stand der Mann mit dem Strohhut auf und näherte sich den Spielern. Interessiert begutachtete er die Partie. »Sieht für Weiß nicht gut aus«, merkte er in harmlosem Ton an. »Kein Problem«, erwiderte Achmed und bewegte eine der schweren Schachfiguren von einem Feld zu einem andern.
»Okay, ihr seid dabei«, konterte der Fremde, nachdem er sich den Zug genau angeschaut hatte. »Kommen wir zum Wesentlichen. Ich nehme an, ihr kennt meine Bedingungen.«
Der Handel war schnell abgemacht. Die beiden Marokkaner mussten El Buitre gleich den ganzen Geldbetrag aushändigen, statt wie üblich erst die Hälfte als Anzahlung. »Man weiß ja nie, was dazwischenkommt«, erklärte der Menschenschmuggler eiskalt. »Nachher bleibe ich auf meinen Unkosten sitzen. Also, meldet euch übermorgen in der Früh um vier Uhr bei Carlos auf dem Verladekai B im Hafen von Algeciras. Der wird euch einweisen. Wenn alles okay ist, geht es hoch nach Norddeutschland bis zur Ostsee. Dort übernimmt euch die Organisation Falke. Deren Mittelsmann weiß Bescheid. Von ihm werdet ihr erfahren, wie es weitergeht. Vorausgesetzt, ihr kennt den nächsten Schachzug.«
Er ließ sich den Zettel mit der Schachskizze geben und sagte: »Falls etwas dazwischenkommen sollte, notiere ich euch hier eine Anlaufstation in Lübeck. Die werden euch dann weiterbringen.«
Auf dem Zettel standen nur zwei Worte: Hansabar Lübeck.
Wenige Tage später hockten Achmed und Driss in einem überdimensionalen Kühlwagen, der tiefgefrorenes Gemüse aus Andalusien über Travemünde von Deutschland nach Finnland bringen sollte. Man hatte an der Stirnseite des Frachtraums eine Bretterwand eingezogen und den kerkerartigen Hohlraum notdürftig gegen die Kälte aus dem Frischeraum isoliert. Aber es war immerhin ein sicheres Versteck. Ein Zöllner hätte sich erst durch Tonnen eiskalten Gemüses kämpfen müssen, um den geheimen Raum zu entdecken. Derartiges war bislang noch nie vorgekommen. El Buitre war stolz darauf, dass noch nie einer seiner Kunden aufgeflogen war.
Was aber bislang ebenfalls noch nie vorgekommen war, wussten die beiden Marokkaner nicht. Es sollte die erste Fracht sein, die in einem Rutsch von Algeciras nach Helsinki durchlief. Bislang wurde die riesige Strecke in zwei oder drei Etappen auf verschiedene LKWs aufgeteilt. Noch nie mussten clandestinos so lange in einem Kühlwagen hausen.
Der Fahrer ahnte von all dem nichts.
Kapitel 3: Oberstimme – Das Schlösschen
Frau Dr. Schahyn warf enttäuscht den schweren Hefter mit den Arbeitsblättern auf ihren Schreibtisch. Beinahe wären dabei die klobigen Figuren auf dem antiken Schachbrett, das als einziger Gegenstand ihren Arbeitsplatz zierte, umgefallen. Die Partie, an der sie nun schon seit Wochen saß und bei der sie bisher keinen Ausweg gefunden hatte.
Die Ärztin forschte seit geraumer Zeit über das Wechselspiel von Erinnerung und Vergessen. Die Behandlung von Amnesie war ihr Spezialgebiet. Sie wollte einerseits herausfinden, welche Faktoren zum Gedächtnisverlust führen, und auf der anderen Seite erforschte sie, inwiefern das Vergessen als Flucht vor der Erinnerung eine Lebenshilfe sein könnte. Mit diesen Fragestellungen hatte sie sich in den letzten Jahren einen gewissen Ruf in der Fachwelt erobert, was sie mit Stolz erfüllte.
Heute jedoch war ihre Stimmung auf dem Tiefpunkt. Wieder einmal hatte ihre Patientin auch nicht das geringste Zeichen an Mitarbeit gezeigt. Stumpfsinnig hockte diese auf dem unbequemen Aluminiumstuhl mit dem abwaschbaren blauen Plastikpolster. Ihre Hand war nicht in der Lage, den Bleistift zu führen. In Folge einer groben Bewegung brach die Spitze ab und hinterließ auf dem Papier eine Furche, die wie eine Wunde aussah. Dann warf die Namenlose den Stift achtlos auf den Boden, legte ihre Hände gefaltet in den Schoß und sackte müde in sich zusammen.
›So komme ich nicht weiter‹, dachte die Psychologin. ›Ein hartnäckigerer Fall wie diese Frau ist mir in meiner ganzen Berufspraxis noch nicht vorgekommen. Schlimmste Ausprägung kongrader Amnesie und dazu auch noch Verlust der elementarsten Kommunikationsfähigkeiten. – Wenn sie wenigstens bereit wäre, mitzuarbeiten, hätte ich eine Chance. So aber ist alle Mühe vergebens. – Und das geht jetzt schon 25 Jahre so.
Aber wie sagt ein altes Sprichwort? ›Alles Holz brennt in der Stille, außer den Dornen‹. – Ich bin sicher, dass in ihrer ruhigen Glut eine Energie steckt, die ihr inneres Feuer wieder anzufachen vermag. Eines Tages wird sie brennen, so impulsiv und lichterloh wie das Holz der Dornen. Und dann wird sie ihre Erinnerung zurückgewinnen, dann wird meine ärztliche Kunst gesiegt haben.
Was habe ich nicht alles versucht! Das Hogrefe-Testsystem, die PQRST-Technik, den Berliner-Amnesie-Test. Und dann die technisch-apparativen Verfahren: die Elektroenzephalographie, die Dopplersonographie, die Elektromyographie und wer weiß was sonst noch. – Immerhin habe ich sie dazu erziehen können, ihre Notdurft selber zu verrichten und sich an einen geordneten Tagesablauf zu gewöhnen. Ich denke, das nächste Mal werde ich es mit dem Rorschachtest probieren. Obwohl ich da sehr skeptisch bin.‹
Die Doktorin erhob sich von ihrem schwarzen Ledersessel, öffnete mit einem Seufzer ihren blütenweißen Arztkittel und stellte sich vor den langen, schmalen Spiegel, der neben dem Fenster hing. Die fahle Wintersonne beleuchtete kalt ihr Gesicht.
Das Glas reflektierte einen intelligenten, aber kühl distanzierten Menschen. Von hoher Gestalt und mit einer trotz ihres gehobenen Alters nahezu knabenhaften Figur war sie eine ausgesprochen androgyne Erscheinung. Dazu trugen die kantigen, etwas männlich wirkenden Gesichtszüge und auch die eleganten Hosenanzüge bei, die sie zu tragen pflegte. Die kurzen lilaschwarzen Haare bedeckten leicht gelockt die hohe Stirn der etwa 60-Jährigen. An dem linken Ohrläppchen steckte ein dezenter Perlenohrring. Unter den buschigen Augenbrauen ruhten sinnliche, aber auch ein wenig eitel dreinschauende Augen. Die Augenwinkel unmerklich nach unten gezogen, machte die Frau einen recht selbstkritischen, fast schon harten Eindruck, was durch die ironisch-spöttisch aufgeworfenen Lippen unterstrichen wurde. Den Gesichtszügen und dem dunklen Teint nach zu schließen, musste sie arabischer Abstammung sein. Von daher würde sich auch ihr fremdländisch klingender Name erklären. Auf Fremde machte sie den Eindruck eines Menschen, der wusste, was er wollte und der es gewohnt zu sein schien, das durchzusetzen, was er wusste und was er wollte.
Ihr Blick wanderte zum Fenster, vor dem eine Staffelei und ein zierlicher Beistelltisch voller Malutensilien standen. Draußen hatte ein kalter Winter den Garten der Anstalt fest im Griff. Die Äste der hohen Trauerweiden ächzten unter dem schweren Gewicht des zu Eis erstarrten Schnees und formten bizarre Marionettenfiguren. Ein paar Amseln stritten sich um die kargen Krümel, die der Küchenchef in eine schneefreie Ecke gestreut hatte.
›Ein ideales Motiv für ein Aquarell‹, ging es der Frau Doktor durch den Kopf. ›Eine wunderschöne formale Einheit, dieses Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit. Eigentlich ein herrlicher Platz für die Kunst.‹
Unwillkürlich kam ihr der Name ihrer Wirkungsstätte in den Sinn: ›Das Schlösschen‹. Das weitläufige Herrenhaus, das etwas außerhalb der Altstadt Lübecks gelegen war, bildete inmitten einer hässlichen Industriekulisse den Anschein gediegener Historie. Viele Menschen, die hier vorbeifuhren, hielten den Gebäudekomplex für ein Museum oder für das Domizil eines begüterten Hanseatengeschlechts. Nur die Wenigen, die sich die Mühe machten, das kleine Messingschild neben dem spätbarocken Eingangsportal zu studieren, nahmen erschrocken zur Kenntnis, dass es sich um eine Klinik für psychisch Kranke handelte, eine geschlossene Anstalt, die man besser mied, wie sie meinten.
Aus einem Nebentrakt des Spitals drangen gedämpfte Schreie. Wieder dieser Wahnsinnige, der glaubte, Napoleon zu sein und die Welt vor der Invasion menschenfressender Ameisen retten zu müssen. Dr. Schahyn beschloss, die schallschluckenden Maßnahmen in den Einzelzellen verstärken zu lassen.
Dann wandte sie sich erneut ihrer Patientin zu, betrachtete sie eine Weile kopfschüttelnd und klingelte schließlich nach dem Oberpfleger. Falkenberg erschien sofort, als hätte er an der Tür gelauscht. Mit seinem blütenweißen Kittel, den fahlgrünlichen Einweghandschuhen und der sterilen Haarhaube sah er aus wie ein Arbeiter in einer Fabrik zur Herstellung von hochsensiblen Computerchips.
Wie immer hatte er sein mürrisches, undurchsichtiges Gesicht aufgesetzt. Man spürte, dass er seine Chefin nicht besonders mochte.
»Sie können die Patientin wieder auf ihr Zimmer führen. Aber legen Sie ihr bitte die leichte Zwangsjacke an. Nicht, dass es wieder zu Zwischenfällen kommt. Die Namenlose machte mir heute wieder einmal keinen guten Eindruck. Wir müssen mit aggressiven Wutausbrüchen rechnen. Am besten, Sie verabreichen ihr eine Spritze.«
Sie warf die Akte verärgert mit einem lauten Knall in ein abseitiges Regal. Bevor Falkenberg aus der Tür war, rief sie ihm hinterher: »Und danach lassen Sie den Praktikanten hereinkommen, den Knastbruder, Sie wissen schon.« Die barsche Art war eigentlich nicht ihr Stil, aber sie war mit sich nicht zufrieden. Sie wusste, dass es ihr heute schwerfallen würde, sich durch ihre Malerei abzulenken.
Frau Dr. Schahyn ließ ihren Blick über die Aquarelle streifen, die, geschmackvoll gerahmt, die Wände ihres Arbeitszimmers zierten. Freundliche Bilder in hellen Wasserfarben, leuchtende Blumenmotive, Landschaftsszenen in zarten Pastelltönen, buntgeflügelte Schmetterlinge. So hatte sie sich hier in der sterilen Anstaltsatmosphäre eine kleine eigene Welt aufgebaut, eine heile Welt ohne psychisch Kranke.
Wenige Minuten später zwängte sich Rico McDonald, in der Welt der Lübecker Jugendbanden ›Big Mac‹ genannt, durch die mit dicken Lederpolstern gedämmte Tür. Seine Gitarre, die in einem billigen Plastiksack steckte, hatte er geschultert, sodass sie ihn am freien Eintreten hinderte. Der Resonanzkörper stieß gegen die Türzarge, was einen hohlen, disharmonischen Klang auslöste.
»Die Gitarre hätten Sie ruhig zu Hause lassen können. Hier brauchen wir so etwas nicht«, begrüßte die Chefpsychologin der geschlossenen Anstalt ihren neuen Untergebenen, ohne sich vom Spiegel abzuwenden. Das brauchte sie auch nicht, weil sie den jungen Mann als Spiegelbild sah. »Ich nehme an, im Jugendamt sind Sie informiert worden, was auf Sie zukommt. Und ich bin mir sicher, Sie werden sich an die Regeln unseres Hauses schnell gewöhnen. Sie werden außerdem wissen, dass wir angehalten sind, dem Jugendgericht regelmäßig über Ihr Verhalten Bericht zu erstatten.«
Die Frau drehte sich abrupt um und verschränkte ihre Arme: »Bislang sind wir mit unseren … – wie soll ich sagen – mit unseren Praktikanten gut zurechtgekommen. Weil sie sich an die Regeln gehalten haben.« Im Grunde genommen wusste sie ganz genau, dass der Druck des Jugendgerichts viel größer war, als ihr Hinweis auf die Hausregeln. Wer kurz davor stand, als ›Intensivtäter‹ abgestempelt zu werden, hatte nur eine Chance: sich anzupassen und zu versuchen, so schnell wie möglich wieder rauszukommen.
»Lassen Sie sich von Oberpfleger Falkenberg Ihren neuen Arbeitsplatz zeigen. Er wird Sie entsprechend einweisen. Und noch eins: Musiker mögen wir hier nicht besonders, vor allem keine Gitarristen.«
Frau Dr. Schahyn signalisierte dem jungen Mann mit einer lässigen, aber eindeutigen Handbewegung, dass er zu verschwinden habe. Wieder allein, betätigte die Direktorin einen Knopf auf ihrer Telefonanlage und gab Falkenberg die Anweisung: »Bringen Sie den Praktikanten auf das Zimmer der Namenlosen und weisen Sie ihn in seine Aufgaben ein. Und im Übrigen: Bitte sorgen Sie dafür, dass ich in den nächsten zwei Stunden nicht gestört werde.«
Dann öffnete sie eine Schublade ihres Schreibtisches und zog einen blütenweißen Bogen raufasrigen Papiers hervor. Sie klemmte ihn sorgfältig auf die Staffelei und griff zu den bereitliegenden Malutensilien.
Lange Zeit stand sie dort und ließ ihren Blick von dem Holzgestell zum Fenster hin und her wandern. Sie befeuchtete den feinen Haarpinsel mit einem schmutzigrotbraunen Farbton und setzte zu einem entschlossenen Pinselstrich an. Aber mitten in der Bewegung hielt sie ein. Die weiße Fläche irritierte sie. Sie fühlte ein unbestimmbares Unbehagen in sich aufkeimen. Sie kannte das. Es passierte ihr immer, wenn sie ein neues Werk anfangen wollte. Und dieses Angstgefühl war in den letzten Jahren von Mal zu Mal gewachsen. Sie musste sich regelrecht überwinden, den ersten Pinselstrich zu tun.
Horror vacui. Als Psychologin wusste sie das Phänomen genau zu deuten. Aber sie war außerstande, sich selber zu therapieren.
Heute war es besonders schlimm. Frau Dr. Schahyn fühlte, wie aus ihren Augenbrauen ein stechender Schmerz emporstieg und ihre linke Gehirnhälfte lähmte. Wütend warf sie den Pinsel gegen das Aquarellpapier. Er hinterließ einen hässlichen Fleck, der wie eine blutende Wunde aussah.
Die Frau riss sich mit einer ungeduldigen Bewegung fluchend ihren weißen Kittel vom Leib und stürzte in die dunkelste Ecke des Raumes, in der sich eine geheime Tapetentür befand. Im Bruchteil einer Sekunde war sie dahinter verschwunden.
Das Klingeln der Telefonanlage – Falkenberg wollte den Dienstplan für den nächsten Tag absprechen – hallte in einem leeren Raum wider.
Kapitel 4: Unterstimme – Kroll
Ein grauer, feuchter Winternebel hatte die grell strahlende Wintersonne verdrängt. Vom Travemünder Skandinavienkai waren nur noch die Umrisse zu erkennen. Aber das machte nichts, so attraktiv war dieser Teil Lübecks, der hier eher an ein überdimensionales Fabrikgelände erinnerte, als an das mondäne Kurbad, das viele Fremde mit dem Namen Travemünde verbinden, auch bei Sonnenschein nicht.
Niemand hatte so recht Lust, zu arbeiten. Die Seeleute der großen Fähren lagen verschlafen in ihren Kojen, statt wie sonst sich ihren Landaufenthalt in den einschlägigen Lokalen am nicht weit entfernten Fischereihafen zu versüßen.
Die Brummifahrer hockten schlechtgelaunt in ihren Fahrerhäuschen und warteten stundenlang darauf, endlich abgefertigt zu werden. Sie sehnten sich nach ihrer langen Fahrt quer durch die Länder Westeuropas, endlich an Bord zu kommen und sich ihr mitgebrachtes Dosenbier reinzuziehen.
Was für die einen Verschnaufpause war, war für die anderen harter Arbeitsalltag. Und umgekehrt.
Die Techniker vom Zoll hatten den ganzen Tag geschuftet. Endlich war der neue mobile Cargo-Scanner installiert, der zur Kontrolle von LKWs und Containern eingesetzt werden sollte, um Schmuggelware, Waffen, Sprengstoffe und Drogen aufzufinden. Außerdem ging ein neuartiger Herzschlagdetektor in die Testphase, mit dessen Hilfe die Transporter auf versteckte Personen kontrolliert werden konnten. Die Zollbehörde hatte sich diese kostspieligen Geräte angeschafft, weil sich die Hinweise auf Menschenschmuggel über den Hafen von Travemünde verdichteten.
Ob die neue Technik wirklich den Durchbruch bei der Schmugglerbekämpfung bringt? Der diensthabende Abteilungsleiter war skeptisch. Er verließ sich lieber auf seine eigenen Augen, seine Nase, seinen siebenten Sinn. Jetzt sollte er sich den Röntgenstrahlen und den Wellensensoren beugen.
Der erste Lastwagen, der im Schneckentempo durch die beiden Kontrollen fuhr, musste wieder umkehren. Auf dem Monitor waren nur trübe Streifen zu sehen. Als ob jemand die Webcam, die draußen im Nebel den Parkplatz überwachte, auf den Bildschirm geschaltet hatte.
Wieder brauchten die Techniker Stunden, bis endlich der Fehler gefunden war. Jetzt konnte der LKW zu seinem zweiten Anlauf starten. Und siehe da, zur Überraschung des Abteilungsleiters, konnten die Zöllner jedes, aber auch das kleinste Detail erkennen. Die Tiefenschärfe ließ sich variieren, sodass sie auch durch die dicken Blechplatten sehen konnten, ohne sich von ihrem Computerarbeitsplatz zu erheben. Früher mussten sie aufwändig mit Taschenlampen durch die teilweise eiskalten, teilweise stinkenden Frachträume klettern und nach Geheimverstecken suchen.
Nun ging es zügig voran. LKW auf LKW passierte die Sperre. Bei einem entdeckten die Zöllner auffällig viele Flaschen, die in der Frachterklärung überhaupt nicht erwähnt wurden. Das Übliche: Alkoholschmuggel. Das kannten die Zöllner. Das hätte der Abteilungsleiter aber auch ohne den neuen Scanner aufgedeckt. Schließlich kannte er seine Pappenheimer.